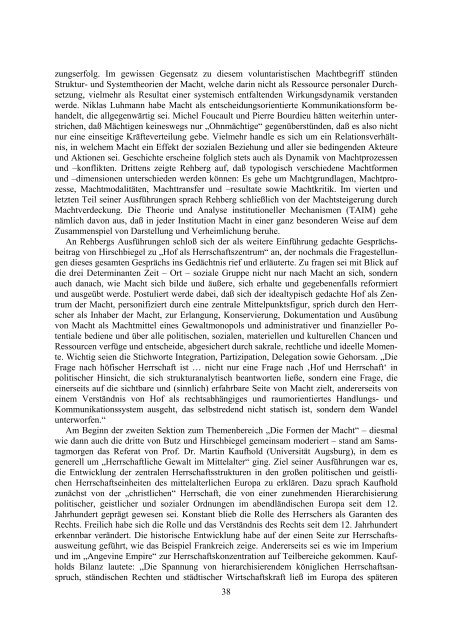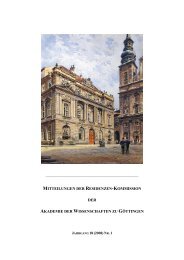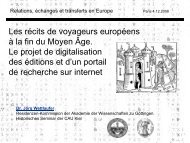MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zungserfolg. Im gewissen Gegensatz zu diesem voluntaristischen Machtbegriff stünden<br />
Struktur- und Systemtheorien der Macht, welche darin nicht als Ressource personaler Durchsetzung,<br />
vielmehr als Resultat einer systemisch entfaltenden Wirkungsdynamik verstanden<br />
werde. Niklas Luhmann habe Macht als entscheidungsorientierte Kommunikationsform behandelt,<br />
die allgegenwärtig sei. Michel Foucault und Pierre Bourdieu hätten weiterhin unterstrichen,<br />
daß Mächtigen keineswegs nur „Ohnmächtige“ gegenüberstünden, daß es also nicht<br />
nur eine einseitige Kräfteverteilung gebe. Vielmehr handle es sich um ein Relationsverhältnis,<br />
in welchem Macht ein Effekt der sozialen Beziehung und aller sie bedingenden Akteure<br />
und Aktionen sei. Geschichte erscheine folglich stets auch als Dynamik von Machtprozessen<br />
und –konflikten. Drittens zeigte Rehberg auf, daß typologisch verschiedene Machtformen<br />
und –dimensionen unterschieden werden können: Es gehe um Machtgrundlagen, Machtprozesse,<br />
Machtmodalitäten, Machttransfer und –resultate sowie Machtkritik. Im vierten und<br />
letzten Teil seiner Ausführungen sprach Rehberg schließlich von der Machtsteigerung durch<br />
Machtverdeckung. Die Theorie und Analyse institutioneller Mechanismen (TAIM) gehe<br />
nämlich davon aus, daß in jeder Institution Macht in einer ganz besonderen Weise auf dem<br />
Zusammenspiel von Darstellung und Verheimlichung beruhe.<br />
An Rehbergs Ausführungen schloß sich der als weitere Einführung gedachte Gesprächsbeitrag<br />
von Hirschbiegel zu „Hof als Herrschaftszentrum“ an, der nochmals die Fragestellungen<br />
dieses gesamten Gesprächs ins Gedächtnis rief und erläuterte. Zu fragen sei mit Blick auf<br />
die drei Determinanten Zeit – Ort – soziale Gruppe nicht nur nach Macht an sich, sondern<br />
auch danach, wie Macht sich bilde und äußere, sich erhalte und gegebenenfalls reformiert<br />
und ausgeübt werde. Postuliert werde dabei, daß sich der idealtypisch gedachte Hof als Zentrum<br />
der Macht, personifiziert durch eine zentrale Mittelpunktsfigur, sprich durch den Herrscher<br />
als Inhaber der Macht, zur Erlangung, Konservierung, Dokumentation und Ausübung<br />
von Macht als Machtmittel eines Gewaltmonopols und administrativer und finanzieller Potentiale<br />
bediene und über alle politischen, sozialen, materiellen und kulturellen Chancen und<br />
Ressourcen verfüge und entscheide, abgesichert durch sakrale, rechtliche und ideelle Momente.<br />
Wichtig seien die Stichworte Integration, Partizipation, Delegation sowie Gehorsam. „Die<br />
Frage nach höfischer Herrschaft ist … nicht nur eine Frage nach ‚Hof und Herrschaft‘ in<br />
politischer Hinsicht, die sich strukturanalytisch beantworten ließe, sondern eine Frage, die<br />
einerseits auf die sichtbare und (sinnlich) erfahrbare Seite von Macht zielt, andererseits von<br />
einem Verständnis von Hof als rechtsabhängiges und raumorientiertes Handlungs- und<br />
Kommunikationssystem ausgeht, das selbstredend nicht statisch ist, sondern dem Wandel<br />
unterworfen.“<br />
Am Beginn der zweiten Sektion zum Themenbereich „Die Formen der Macht“ – diesmal<br />
wie dann auch die dritte von Butz und Hirschbiegel gemeinsam moderiert – stand am Samstagmorgen<br />
das Referat von Prof. Dr. Martin Kaufhold (Universität Augsburg), in dem es<br />
generell um „Herrschaftliche Gewalt im Mittelalter“ ging. Ziel seiner Ausführungen war es,<br />
die Entwicklung der zentralen Herrschaftsstrukturen in den großen politischen und geistlichen<br />
Herrschaftseinheiten des mittelalterlichen Europa zu erklären. Dazu sprach Kaufhold<br />
zunächst von der „christlichen“ Herrschaft, die von einer zunehmenden Hierarchisierung<br />
politischer, geistlicher und sozialer Ordnungen im abendländischen Europa seit dem 12.<br />
Jahrhundert geprägt gewesen sei. Konstant blieb die Rolle des Herrschers als Garanten des<br />
Rechts. Freilich habe sich die Rolle und das Verständnis des Rechts seit dem 12. Jahrhundert<br />
erkennbar verändert. Die historische Entwicklung habe auf der einen Seite zur Herrschaftsausweitung<br />
geführt, wie das Beispiel Frankreich zeige. Andererseits sei es wie im Imperium<br />
und im „Angevine Empire“ zur Herrschaftskonzentration auf Teilbereiche gekommen. Kaufholds<br />
Bilanz lautete: „Die Spannung von hierarchisierendem königlichen Herrschaftsanspruch,<br />
ständischen Rechten und städtischer Wirtschaftskraft ließ im Europa des späteren<br />
38