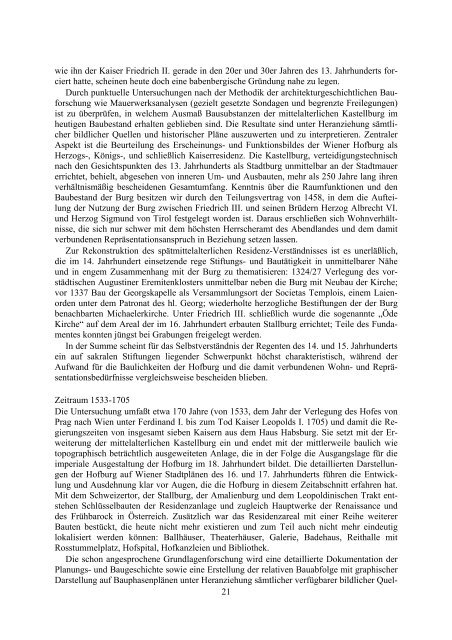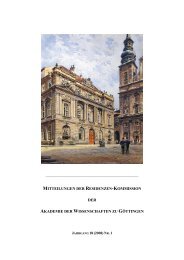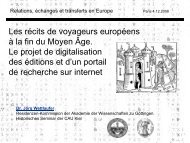MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wie ihn der Kaiser Friedrich II. gerade in den 20er und 30er Jahren des 13. Jahrhunderts forciert<br />
hatte, scheinen heute doch eine babenbergische Gründung nahe zu legen.<br />
Durch punktuelle Untersuchungen nach der Methodik der architekturgeschichtlichen Bauforschung<br />
wie Mauerwerksanalysen (gezielt gesetzte Sondagen und begrenzte Freilegungen)<br />
ist zu überprüfen, in welchem Ausmaß Bausubstanzen der mittelalterlichen Kastellburg im<br />
heutigen Baubestand erhalten geblieben sind. Die Resultate sind unter Heranziehung sämtlicher<br />
bildlicher Quellen und historischer Pläne auszuwerten und zu interpretieren. Zentraler<br />
Aspekt ist die Beurteilung des Erscheinungs- und Funktionsbildes der Wiener Hofburg als<br />
Herzogs-, Königs-, und schließlich Kaiserresidenz. Die Kastellburg, verteidigungstechnisch<br />
nach den Gesichtspunkten des 13. Jahrhunderts als Stadtburg unmittelbar an der Stadtmauer<br />
errichtet, behielt, abgesehen von inneren Um- und Ausbauten, mehr als 250 Jahre lang ihren<br />
verhältnismäßig bescheidenen Gesamtumfang. Kenntnis über die Raumfunktionen und den<br />
Baubestand der Burg besitzen wir durch den Teilungsvertrag von 1458, in dem die Aufteilung<br />
der Nutzung der Burg zwischen Friedrich III. und seinen Brüdern Herzog Albrecht VI.<br />
und Herzog Sigmund von Tirol festgelegt worden ist. Daraus erschließen sich Wohnverhältnisse,<br />
die sich nur schwer mit dem höchsten Herrscheramt des Abendlandes und dem damit<br />
verbundenen Repräsentationsanspruch in Beziehung setzen lassen.<br />
Zur Rekonstruktion des spätmittelalterlichen Residenz-Verständnisses ist es unerläßlich,<br />
die im 14. Jahrhundert einsetzende rege Stiftungs- und Bautätigkeit in unmittelbarer Nähe<br />
und in engem Zusammenhang mit der Burg zu thematisieren: 1324/27 Verlegung des vorstädtischen<br />
Augustiner Eremitenklosters unmittelbar neben die Burg mit Neubau der Kirche;<br />
vor 1337 Bau der Georgskapelle als Versammlungsort der Societas Templois, einem Laienorden<br />
unter dem Patronat des hl. Georg; wiederholte herzogliche Bestiftungen der der Burg<br />
benachbarten Michaelerkirche. Unter Friedrich III. schließlich wurde die sogenannte „Öde<br />
Kirche“ auf dem Areal der im 16. Jahrhundert erbauten Stallburg errichtet; Teile des Fundamentes<br />
konnten jüngst bei Grabungen freigelegt werden.<br />
In der Summe scheint für das Selbstverständnis der Regenten des 14. und 15. Jahrhunderts<br />
ein auf sakralen Stiftungen liegender Schwerpunkt höchst charakteristisch, während der<br />
Aufwand für die Baulichkeiten der Hofburg und die damit verbundenen Wohn- und Repräsentationsbedürfnisse<br />
vergleichsweise bescheiden blieben.<br />
Zeitraum 1533-1705<br />
Die Untersuchung umfaßt etwa 170 Jahre (von 1533, dem Jahr der Verlegung des Hofes von<br />
Prag nach Wien unter Ferdinand I. bis zum Tod Kaiser Leopolds I. 1705) und damit die Regierungszeiten<br />
von insgesamt sieben Kaisern aus dem Haus Habsburg. Sie setzt mit der Erweiterung<br />
der mittelalterlichen Kastellburg ein und endet mit der mittlerweile baulich wie<br />
topographisch beträchtlich ausgeweiteten Anlage, die in der Folge die Ausgangslage für die<br />
imperiale Ausgestaltung der Hofburg im 18. Jahrhundert bildet. Die detaillierten Darstellungen<br />
der Hofburg auf Wiener Stadtplänen des 16. und 17. Jahrhunderts führen die Entwicklung<br />
und Ausdehnung klar vor Augen, die die Hofburg in diesem Zeitabschnitt erfahren hat.<br />
Mit dem Schweizertor, der Stallburg, der Amalienburg und dem Leopoldinischen Trakt entstehen<br />
Schlüsselbauten der Residenzanlage und zugleich Hauptwerke der Renaissance und<br />
des Frühbarock in Österreich. Zusätzlich war das Residenzareal mit einer Reihe weiterer<br />
Bauten bestückt, die heute nicht mehr existieren und zum Teil auch nicht mehr eindeutig<br />
lokalisiert werden können: Ballhäuser, Theaterhäuser, Galerie, Badehaus, Reithalle mit<br />
Rosstummelplatz, Hofspital, Hofkanzleien und Bibliothek.<br />
Die schon angesprochene Grundlagenforschung wird eine detaillierte Dokumentation der<br />
Planungs- und Baugeschichte sowie eine Erstellung der relativen Bauabfolge mit graphischer<br />
Darstellung auf Bauphasenplänen unter Heranziehung sämtlicher verfügbarer bildlicher Quel-<br />
21