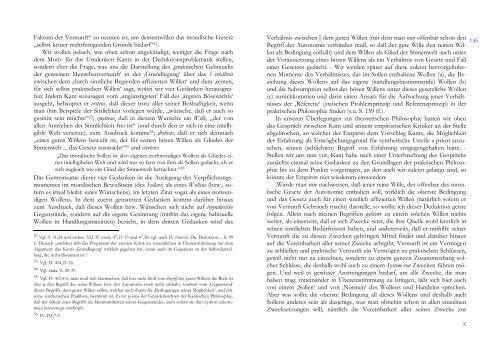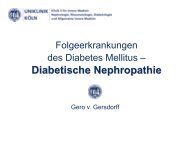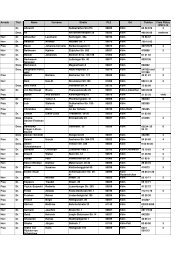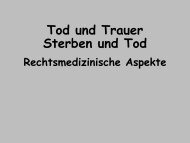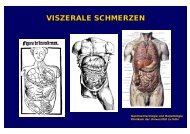Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Faktum der Vernunft“ zu nennen ist, um <strong>des</strong>sentwillen das moralische Gesetz<br />
„selbst keiner rechtfertigenden Gründe bedarf“ 52 .<br />
Wir wollen jedoch, wie oben schon angekündigt, weniger die Frage nach<br />
dem Motiv für das Umdenken Kants in der <strong>Deduktion</strong>sproblematik stellen,<br />
sondern eher die Frage, was uns die Darstellung <strong>des</strong> ‚praktischen Gebrauchs<br />
der gemeinen Menschenvernunft‘ in der ‚Grundlegung‘ über das Verhältnis<br />
zwischen dem ‚durch sinnliche Begierden affizierten Willen‘ und dem ‚reinen,<br />
für sich selbst praktischen Willen‘ sagt, wobei wir vier Gedanken herausgreifen:<br />
Indem Kant sozusagen vom ‚ungünstigsten‘ Fall <strong>des</strong> ‚ärgsten Bösewichts‘<br />
ausgeht, behauptet er erstens, daß dieser trotz aller seiner Boshaftigkeit, wenn<br />
man ihm Beispiele der Sittlichkeit vorlegen würde, „wünsche, daß er auch so<br />
gesinnt sein möchte“ 53 ; zweitens, daß in diesem Wunsche ein Wille, „der von<br />
allen Antrieben der Sinnlichkeit frei ist“ (und durch den er sich in eine intelligible<br />
Welt versetze), zum Ausdruck komme 54 ; drittens, daß er sich demnach<br />
„eines guten Willens bewußt ist, der für seinen bösen Willen als Glie<strong>des</strong> der<br />
Sinnenwelt ... das Gesetz ausmacht“ 55 und viertens:<br />
„Das moralische Sollen ist also eigenes nothwendiges Wollen als Glie<strong>des</strong> einer<br />
intelligibelen Welt und wird nur so fern von ihm als Sollen gedacht, als er<br />
sich zugleich wie ein Glied der Sinnenwelt betrachtet.“ 56<br />
Das Gemeinsame dieser vier Gedanken ist die Auslegung <strong>des</strong> Verpflichtungsmomentes<br />
im moralischen Bewußtsein (<strong>des</strong> Sollens) als eines Wollens (bzw., sofern<br />
es irreal bleibt: eines Wünschens), im letzten Zitat sogar als eines notwendigen<br />
Wollens. In dem zuerst genannten Gedanken kommt darüber hinaus<br />
zum Ausdruck‚ daß dieses Wollen bzw. Wünschen sich nicht auf irgendwelche<br />
Gegenstände, sondern auf die eigene Gesinnung (mithin das eigene habituelle<br />
Wollen in Handlungsmaximen) bezieht, in dem dritten Gedanken wird das<br />
52 Vgl. V 31‚24 und insbes. 32‚1 ff. sowie 47‚11-15 und 47‚28; vgl. auch D. Henrich, Die <strong>Deduktion</strong>..., S. 99<br />
f.: Danach „entfaltet sich das Programm der zweiten Kritik im wesentlichen in Übereinstimmung mit dem<br />
Argument, das Kants ‚Grundlegung‘ wirklich gegeben hat, wenn auch im Gegensatz zu der Selbstdarstellung,<br />
die in ihr dominant ist.“<br />
53 Vgl. IV 454‚21-26.<br />
54 Vgl. ebda. Z. 29-37.<br />
55 Vgl. IV 455‚4-6; man muß sich klarmachen, daß hier nicht bloß vom Begriff <strong>des</strong> guten Willens die Rede ist<br />
(der ja den Begriff <strong>des</strong> reinen Willens bzw. der Autonomie noch nicht enthält), sondern vom ‚Gegenstand‘<br />
dieses Begriffs, dem guten Willen selbst, welcher auch durch die ‚Bedingungen seiner Möglichkeit‘, und d.h.<br />
seine synthetischen Prädikate, bestimmt ist. Es ist ja eine der Grundeinsichten der Kantischen Philosophie,<br />
daß der Inhalt eines Begriffs die Bestimmtheiten seines Gegenstan<strong>des</strong>, auch sofern sie ihm a priori zukommen,<br />
keineswegs erschöpft.<br />
56 IV 455‚7-9.<br />
Verhältnis zwischen | dem guten Willen (mit dem man nun offenbar schon den<br />
Begriff der Autonomie verbinden muß, so daß der gute Wille den reinen Willen<br />
als Bedingung enthält) und dem Willen als Glied der Sinnenwelt auch unter<br />
der Voraussetzung eines bösen Willens als ein Verhältnis von Gesetz und Fall<br />
eines Gesetzes gedacht. - Wir werden später auf diese zuletzt hervorgehobenen<br />
Momente <strong>des</strong> Verhältnisses, das im Sollen enthaltene Wollen (a), die Beziehung<br />
dieses Wollens auf das eigene (handlungsbestimmende) Wollen (b)<br />
und die Subsumption selbst <strong>des</strong> bösen Willens unter dieses gesetzliche Wollen<br />
(c) zurückkommen und darin einen Ansatz für die Aufsuchung jenes Verhältnisses<br />
der ‚Referenz‘ (zwischen Problemprinzip und Referenzprinzip) in der<br />
praktischen Philosophie finden (s.u. S. 159 ff.).<br />
In unseren Überlegungen zur theoretischen Philosophie hatten wir oben<br />
das Gespräch zwischen Kant und seinem empiristischen Kritiker an der Stelle<br />
abgebrochen, an welcher der Empirist dem Vorschlag Kants, die Möglichkeit<br />
der Erfahrung als Ermöglichungsgrund für synthetische Urteile a priori anzusehen,<br />
seinen (schlichten) Begriff von Erfahrung entgegengehalten hatte. -<br />
Stellen wir uns nun vor, Kant habe nach einer Unterbrechung <strong>des</strong> Gesprächs<br />
zunächst einmal seine Gedanken zu den Grundlagen der praktischen Philosophie<br />
bis zu dem Punkte vorgetragen, an den auch wir zuletzt gelangt sind, so<br />
könnte der Empirist nun wiederum einwenden:<br />
‚Würde man mir nachweisen, daß jener reine Wille, der offenbar das moralische<br />
Gesetz der Autonomie enthalten soll, wirklich die oberste Bedingung<br />
und das Gesetz auch für einen sinnlich affizierten Willen (natürlich sofern er<br />
von Vernunft Gebrauch macht) darstelle, so wollte ich dieser <strong>Deduktion</strong> gerne<br />
folgen. Allein nach meinen Begriffen gehört zu einem solchen Willen nichts<br />
weiter, als einerseits, daß er sich Zwecke setzt, die ihre Quelle wohl letztlich in<br />
seinen sinnlichen Bedürfnissen haben, und andererseits, daß er mithilfe seiner<br />
Vernunft die zu diesen Zwecken gehörigen Mittel findet und darüber hinaus<br />
auf die Vereinbarkeit aller seiner Zwecke achtgibt. Vernunft ist ein Vermögen<br />
zu schließen und praktische Vernunft ein Vermögen zu praktischen Schlüssen,<br />
gewiß nicht nur zu einzelnen, sondern zu einem ganzen Zusammenhang solcher<br />
Schlüsse, die <strong>des</strong>halb wohl auch zu einem System von Zwecken führen mögen.<br />
Und weil es gewisser Anstrengungen bedarf, um alle Zwecke, die man<br />
haben mag, miteinander in Übereinstimmung zu bringen, läßt sich hier auch<br />
von einem ‚Sollen‘ und von ,Normen‘ <strong>des</strong> Wollens und Handelns sprechen.<br />
Aber was sollte die oberste Bedingung all dieses Wollens und <strong>des</strong>halb auch<br />
Sollens anderes sein als dasjenige, was man ohnehin schon in allen einzelnen<br />
Zwecksetzungen will, nämlich die Vereinbarkeit aller seiner Zwecke zur<br />
X<br />
145