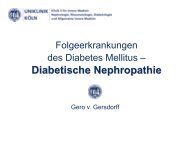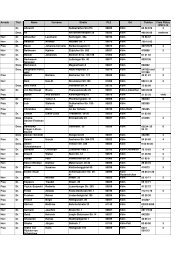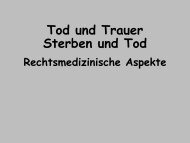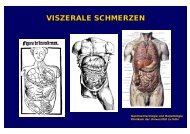Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und um dieser schon so spezifizierten Einheit willen sind die Kategorien der<br />
Freiheit notwendig:<br />
„Da ... die Handlungen einerseits zwar unter einem Gesetze, das kein Naturgesetz,<br />
sondern ein Gesetz der Freiheit ist, folglich zu dem Verhalten intelligibeler<br />
Wesen, andererseits aber doch auch als Begebenheiten in der Sinnenwelt<br />
zu den Erscheinungen gehören, so werden die Bestimmungen einer praktischen<br />
Vernunft nur in Beziehung auf die letztere, folglich zwar den Kategorien<br />
<strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> gemäß, aber nicht in der Absicht eines theoretischen<br />
Gebrauchs <strong>des</strong>selben, um das Mannigfaltige der (sinnlichen) Anschauung unter<br />
ein Bewußtsein a priori zu bringen, sondern nur um das Mannigfaltige der<br />
Begehrungen der Einheit <strong>des</strong> Bewußtseins einer im moralischen Gesetz gebietenden<br />
praktischen Vernunft oder eines reinen Willens a priori zu unterwerfen,<br />
Statt haben können.“ 69<br />
Nun ist zwar durch diesen Satz nicht völlig ausgeschlossen, daß jegliche Einheit<br />
<strong>des</strong> Bewußtseins im Hinblick auf das Mannigfaltige der Begehrungen<br />
nicht nur ohne die Kategorien, sondern auch ohne das moralische Gesetz unmöglich<br />
wäre, aber es folgt doch auch nicht aus diesem Satz; er läßt es durchaus<br />
als denkbar erscheinen, daß die Einheit <strong>des</strong> praktischen Bewußtseins auch<br />
unter einem ganz anderen Prinzip möglich wäre.<br />
Erwarten wir also von einer <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> nicht nur die<br />
bloße Behauptung eines seine Synthesis vermittelnden Dritten, sondern auch<br />
eine transzendentale Explikation dieses Dritten durch die Rückführung auf die<br />
Einheit <strong>des</strong> praktischen Bewußtseins, so suchen wir eine transzendentale <strong>Deduktion</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong>, trotz der Behauptung einer vollzogenen <strong>Deduktion</strong><br />
im 3. Abschnitt der ‚Grundlegung‘, vergeblich; und schon dies läßt die Bestreitung<br />
einer <strong>Deduktion</strong>smöglichkeit in der KdpV verständlich erscheinen.<br />
Dieser negative Befund ist freilich um so bemerkenswerter, als Kant nach<br />
dem Zeugnis seiner Nachlaß-Manuskripte lange Jahre hindurch, vielleicht sogar<br />
noch | nach der Veröffentlichung der ‚Grundlegung‘, immer wieder versucht<br />
hat, das Sittengesetz als Bedingung der Möglichkeit der Einheit <strong>des</strong> Wollens<br />
und Handelns zu deduzieren. D. Henrich hat eine Reihe dieser Versuche<br />
analysiert 70 und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß sie alle mißlungen seien,<br />
ja, daß Kant schließlich erkannt habe, daß sie alle mißlingen mußten; und diese<br />
Erkenntnis habe Kant zu seiner Theorie vom ‚Faktum der reinen Vernunft‘<br />
69 V 65‚15-26<br />
70 Vgl. D. Henrich, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Die<br />
Gegenwart der Griechen im neueren Denken, Festschr. f. H.G. Gadamer, hrsg. v. D. Henrich u.a., Tübingen<br />
1960, S. 77-115.<br />
152<br />
geführt. 71 Gemeinsam ist den Kantischen Versuchen nach Henrichs Interpretation,<br />
daß sie die Unbedingtheit der moralischen Gesetzes nicht erklären, da<br />
sie es allesamt auf Nicht-Moralisches zurückführen: etwa den Abscheu dagegen,<br />
wodurch sich die oberste Kraft (Vernunft) selbst widerstreitet 72 , was auf<br />
nichts anderes hinauslaufe, als auf das Handlungsmotiv, „das Mißvergnügen<br />
anläßlich <strong>des</strong> Widerspruches zu beseitigen ...“. 73 Ein weiteres, letztlich nichtmoralisches<br />
Motiv, das in den ‚Reflexionen‘ eine Rolle spiele, sei die ‚Furcht<br />
um unsere Sicherheit‘ und die Sehnsucht nach einem berechenbaren Leben 74 ,<br />
ein anderes die Freude an einem „Optimum der Selbstrealisierung“, ein Gedanke,<br />
der später, in der „Kritik der Urteilskraft“, das Wohlgefallen am Schönen<br />
erkläre. 75<br />
Eine zweite Gruppe von <strong>Deduktion</strong>sversuchen in Kants Nachlaß läuft<br />
nach Heinrich darauf hinaus, daß letztlich doch das Interesse an der eigenen<br />
Glückseligkeit als bewegende Kraft im moralischen Handeln gesehen werde,<br />
insofern zwar nicht Sittlichkeit und Glückseligkeit miteinander identifiziert<br />
würden, aber die erstere doch als nichts anderes verstanden werde, denn als<br />
‚Würdigkeit, glücklich zu sein‘. 76<br />
Schließlich referiert Henrich noch kritisch jene <strong>Deduktion</strong>sversuche, die<br />
den indirekten Weg über die Idee der Freiheit gehen und die noch im dritten<br />
Abschnitt der ‚Grundlegung‘ ihren Niederschlag gefunden haben. 77 Dabei<br />
wird, wie wir oben gesehen haben, von der Notwendigkeit der Selbstbestimmung<br />
der theoretischen Vernunft auf diejenige auch der praktischen Vernunft<br />
geschlossen. In diesen Versuchen wird nach Henrich die Moralität letztlich auf<br />
die Einheit der Apperzeption als einem Prinzip der theoretischen Vernunft<br />
zurückgeführt, was der Besonderheit der sittlichen Einsicht in keiner Weise<br />
gerecht werde.<br />
| Die Kritik Henrichs an den <strong>Deduktion</strong>sversuchen der Nachlaßtexte ist sicherlich<br />
in vielen Punkten voll gerechtfertigt und zudem ganz im Sinne der<br />
späteren Einsichten Kants. Allerdings bieten die Nachlaßtexte, wie schon<br />
71 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 110.<br />
72 Vgl. D. Henrich, Der Begriff. . . ., S. 101, mit Bezug auf die Refl. 6853.<br />
73 Vgl. D. Henrich, Der Begriff. . . ., S. 102.<br />
74 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 102 f., mit Bezug auf die Refl. 7196 und 6621.<br />
75 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 103 (ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Stelle <strong>des</strong> Nachlasses).<br />
76 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 103-105, mit Bezug auf die Refl. 612, 6621, 7202.<br />
77 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 107-110, mit Bezug auf die Refl. 4220, 4338 und insbes. 5441 sowie<br />
die Vorlesungen über Metaphysik, hrsg. v. Pölitz, 1821, S. 205-207 (vgl. XXVIII 2/2, S. 1120 f.).<br />
XIV<br />
153