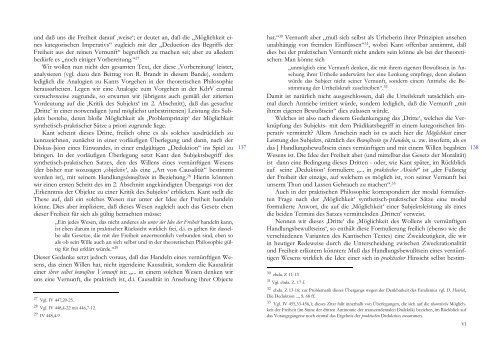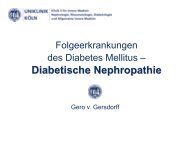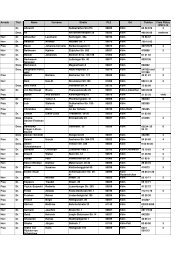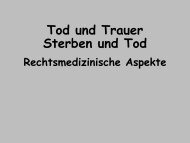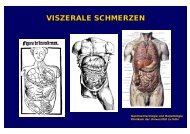Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und daß uns die Freiheit darauf ‚weise‘; er deutet an, daß die „Möglichkeit eines<br />
kategorischen Imperativs“ zugleich mit der „Deduction <strong>des</strong> Begriffs der<br />
Freiheit aus der reinen Vernunft“ begreiflich zu machen sei; aber zu alledem<br />
bedürfe es „noch einiger Vorbereitung.“ 27<br />
Wir wollen nun nicht den gesamten Text, der diese ‚Vorbereitung‘ leistet,<br />
analysieren (vgl. dazu den Beitrag von R. Brandt in diesem Bande), sondern<br />
lediglich die Analogien zu Kants Vorgehen in der theoretischen Philosophie<br />
herausarbeiten. Legen wir eine Analogie zum Vorgehen in der KdrV einmal<br />
versuchsweise zugrunde, so erwarten wir (übrigens auch gemäß der zitierten<br />
Vordeutung auf die ‚Kritik <strong>des</strong> Subjekts‘ im 2. Abschnitt), daß das gesuchte<br />
‚Dritte‘ in einer notwendigen (und möglichst unbestrittenen) Leistung <strong>des</strong> Subjekts<br />
bestehe, deren bloße Möglichkeit als ‚Problemprinzip‘ der Möglichkeit<br />
synthetisch-praktischer Sätze a priori zugrunde liege.<br />
Kant scheint dieses Dritte, freilich ohne es als solches ausdrücklich zu<br />
kennzeichnen, zunächst in einer vorläufigen Überlegung und dann, nach der<br />
Diskus-|sion eines Einwan<strong>des</strong>, in einer endgültigen „<strong>Deduktion</strong>“ ins Spiel zu<br />
bringen. In der vorläufigen Überlegung setzt Kant den Subjektsbegriff <strong>des</strong><br />
synthetisch-praktischen Satzes, den <strong>des</strong> Willens eines vernünftigen Wesens<br />
(der bisher nur sozusagen ‚objektiv‘, als eine „Art von Causalität“ bestimmt<br />
worden ist), mit seinem Handlungsbewußtsein in Beziehung. 28 Hierin könnten<br />
wir einen ersten Schritt <strong>des</strong> im 2. Abschnitt angekündigten Übergangs von der<br />
‚Erkenntnis der Objekte zu einer Kritik <strong>des</strong> Subjekts‘ erblicken. Kant stellt die<br />
These auf, daß ein solches Wesen nur unter der Idee der Freiheit handeln<br />
könne. Dies aber impliziere, daß dieses Wesen zugleich auch das Gesetz eben<br />
dieser Freiheit für sich als gültig betrachten müsse:<br />
„Ein je<strong>des</strong> Wesen, das nicht anderes als unter der Idee der Freiheit handeln kann,<br />
ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei, d.i. es gelten für dasselbe<br />
alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, eben so<br />
als ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig<br />
für frei erklärt würde.“ 29<br />
Dieser Gedanke setzt jedoch voraus, daß das Handeln eines vernünftigen Wesens,<br />
das einen Willen hat, nicht irgendeine Kausalität, sondern die Kausalität<br />
einer ihrer selbst bewußten Vernunft ist: „... in einem solchen Wesen denken wir<br />
uns eine Vernunft, die praktisch ist, d.i. Causalität in Ansehung ihrer Objecte<br />
27 Vgl. IV 447‚20-25.<br />
28 Vgl. IV 448‚4-22 mit 446‚7-12.<br />
29 IV 448‚4-9<br />
hat.“ 30 Vernunft aber „muß sich selbst als Urheberin ihrer Prinzipien ansehen<br />
unabhängig von fremden Einflüssen“ 31 , wobei Kant offenbar annimmt, daß<br />
dies bei der praktischen Vernunft nicht anders sein könne als bei der theoretischen:<br />
Man könne sich<br />
„unmöglich eine Vernunft denken, die mit ihrem eigenen Bewußtsein in Ansehung<br />
ihrer Urtheile anderwärts her eine Lenkung empfinge, denn alsdann<br />
würde das Subject nicht seiner Vernunft, sondern einem Antriebe die Bestimmung<br />
der Urtheilskraft zuschreiben“. 32<br />
Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß die Urteilskraft tatsächlich einmal<br />
durch Antriebe irritiert würde, sondern lediglich, daß die Vernunft „mit<br />
ihrem eigenen Bewußtsein“ dies zulassen würde.<br />
Welches ist also nach diesem Gedankengang das ‚Dritte‘, welches die Verknüpfung<br />
<strong>des</strong> Subjekts- mit dem Prädikatsbegriff in einem kategorischen Imperativ<br />
vermittelt? Allem Anschein nach ist es auch hier die Möglichkeit einer<br />
Leistung <strong>des</strong> Subjekts, nämlich <strong>des</strong> Bewußtsein zu Handeln, u. zw. insofern, als es<br />
137 das | Handlungsbewußtsein eines vernünftigen und mit einem Willen begabten 138<br />
Wesens ist. Die Idee der Freiheit aber (und mittelbar das Gesetz der Moralität)<br />
ist dann eine Bedingung dieses Dritten - oder, wie Kant später, im Rückblick<br />
auf seine ‚<strong>Deduktion</strong>‘ formuliert: „... in praktischer Absicht“ ist „der Fußsteig<br />
der Freiheit der einzige, auf welchem es möglich ist, von seiner Vernunft bei<br />
unserm Thun und Lassen Gebrauch zu machen“. 33<br />
Auch in der praktischen Philosophie korrespondiert der modal formulierten<br />
Frage nach der ‚Möglichkeit‘ synthetisch-praktischer Sätze eine modal<br />
formulierte Anwort, die auf die ‚Möglichkeit‘ einer Subjektsleistung als eines<br />
die beiden Termini <strong>des</strong> Satzes vermittelnden ‚Dritten‘ verweist.<br />
Nennen wir dieses ‚Dritte‘ die ‚Möglichkeit <strong>des</strong> Wollens als vernünftigen<br />
Handlungsbewußtseins‘, so enthält diese Formulierung freilich (ebenso wie die<br />
verschiedenen Varianten <strong>des</strong> Kantischen Textes) eine Zweideutigkeit, die wir<br />
in heutiger Redeweise durch die Unterscheidung zwischen Zweckrationalität<br />
und Freiheit erläutern könnten: Muß das Handlungsbewußtsein eines vernünftigen<br />
Wesens wirklich die Idee einer sich in praktischer Hinsicht selbst bestim-<br />
30 ebda. Z 11-13<br />
31 Vgl. ebda. Z. 17 f.<br />
32 ebda. Z 13-16; zur Problematik dieses Übergangs wegen der Denkbarkeit <strong>des</strong> Fatalismus vgl. D. Henrich,<br />
Die <strong>Deduktion</strong> ..., S. 68 ff.<br />
33 Vgl. IV 455‚33-456‚1; dieses Zitat faßt innerhalb von Überlegungen, die sich auf die theoretische Möglichkeit<br />
der Freiheit (im Sinne der dritten Antinomie der transzendentalen Dialektik) beziehen, im Rückblick auf<br />
das Vorangegangene noch einmal das Ergebnis der praktischen <strong>Deduktion</strong> zusammen.<br />
VI