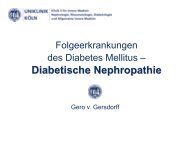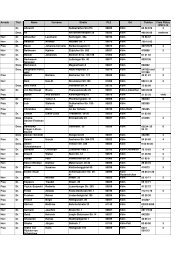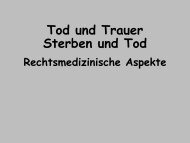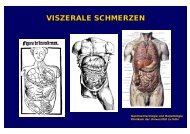Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schen Satz a priori vorstellt, dadurch daß über meinen durch sinnliche Begierden<br />
afficirten Willen noch die Idee eben<strong>des</strong>selben, aber zur Verstan<strong>des</strong>welt<br />
gehörigen reinen, für sich selbst praktischen Willens hinzukommt, welcher<br />
die oberste Bedingung <strong>des</strong> ersteren nach der Vernunft enthält ...“. 41<br />
Dieser Satz (an den sich der vorher zitierte Vergleich zur theoretischen Philosophie<br />
mit „ungefähr so, wie ...“ anschließt) beginnt beinahe mit derselben<br />
Formel wie die an den ‚obersten Grundsatz‘ angeschlossene <strong>Deduktion</strong> der<br />
synthetischen Urteile a priori („Auf solche Weise sind synthetische Urteile<br />
a priori möglich ...“ - s. Anm. 15). Er gibt eine <strong>Deduktion</strong> der Möglichkeit kategorischer<br />
Imperative, grammatisch gesprochen, in zwei „dadurch daß“-<br />
Konstruktionen, wobei die erste dieser Konstruktionen die Möglichkeit <strong>des</strong><br />
synthetischen Satzes a priori zunächst einmal nur auf das ‚Zugleich‘ zweier<br />
Standpunkte zurückführt, während die zweite dieser Konstruktionen die Notwendigkeit<br />
der Verknüpfung beider Standpunkte durch ein Bedingungsverhältnis<br />
erklärt. Die erste Konstruktion erhält eine Komplikation durch einen Gedanken<br />
im Irrealis, der für den Zweck der <strong>Deduktion</strong> entbehrlich ist: Wäre ich<br />
nur Glied einer intelligiblen Welt, so würden „alle meine Handlungen der Autonomie<br />
<strong>des</strong> Willens jederzeit gemäß sein“; auf ein solches Wesen bezogen aber<br />
wäre das Sittengesetz ein analytischer Satz. 42<br />
Lösen wir den ‚irrealen‘ Einschub aus dem ersten Teil der Möglichkeitserklärung<br />
heraus, so lautet der Hauptgedanke:<br />
‚Die Idee der Freiheit macht mich zu einem Gliede einer intelligiblen Welt,<br />
wodurch, da ich mich zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue, alle meine<br />
Handlungen der Autonomie <strong>des</strong> Willens jederzeit gemäß sein sollen.‘<br />
| Die Synthetizität <strong>des</strong> kategorischen Sollens beruht also darauf, daß mein<br />
Handeln von sich aus keineswegs der Autonomie <strong>des</strong> Willens gemäß ist, weil<br />
es ein Handeln in der Sinnenwelt ist. Nun ist damit zwar die Analytizität <strong>des</strong><br />
kategorischen Sollens und indirekt auch die befürchtete Zirkelhaftigkeit ausgeschlossen<br />
43 , aber das bloße Nebeneinander der Standpunkte ergäbe doch, für<br />
sich genommen, nichts als einen schlechten Dualismus, wenn nicht ihre Verknüpfung<br />
als notwendig aufgewiesen würde.<br />
Dies nun soll offenbar die zweite ‚dadurch daß‘-Konstruktion leisten, die<br />
zunächst einmal deutlich macht, daß es in beiden Standpunkten nicht etwa um<br />
41 IV 454‚6-15.<br />
42 Vgl. z.B. IV 447‚6 f. und 452‚35-453‚2.<br />
43 Die befürchtete Zirkelhaftigkeit beruhte ja gerade darauf, daß die Tatsache, daß der Adressat <strong>des</strong> Imperativs<br />
ein Sinnenwesen ist und daher von sich aus keineswegs der Autonomie gemäß handelt, unberücksichtigt<br />
blieb.<br />
141<br />
zwei verschiedene Stücke in mir (etwa meine Freiheit einerseits und meine<br />
Handlungen andererseits) handelt, sondern um ‚ebendasselbe‘, nämlich meinen<br />
Willen, aber einerseits um ihn als einen „durch sinnliche Begierden afficirten<br />
Willen“ und andererseits um „die Idee eben<strong>des</strong>selben, aber zur Verstan<strong>des</strong>welt<br />
gehörigen reinen, für sich selbst praktischen Willens“. Die Identität<br />
<strong>des</strong> Willens unter beiden Standpunkten verhindert nun zwar das Auseinanderfallen<br />
der beiden Betrachtungsweisen, läßt aber noch nicht ein positives und<br />
notwendiges Aufeinander-bezogen-Sein gerade der unterschiedlichen Momente<br />
beider Glieder erkennen. Darauf weist erst der abschließende Relativsatz<br />
unseres Zitats, wonach der ‚reine, für sich selbst praktische Wille die oberste<br />
Bedingung meines durch sinnliche Begierden affizierten Willens nach der Vernunft<br />
enthält‘.<br />
Über den doppelten Standpunkt und die Identität <strong>des</strong> in beiden Standpunkten<br />
vorgestellten Willens hinaus haben wir es nach diesem Relativsatz einerseits<br />
mit der Behauptung eines Bedingungsverhältnisses und andererseits<br />
mit dem Zusatz „nach der Vernunft“ zu tun. In diesem Zusatz wird offenbar<br />
dem „durch sinnliche Begierden afficirten Willen“ die Aufgabe gestellt, mehr<br />
zu sein als ein bloßes „Glied der Sinnenwelt“: vielmehr (insgesamt) jener Wille,<br />
welcher in einem ‚Wollen als vernünftigem Handlungsbewußtsein‘ enthalten<br />
ist - so daß es uns „möglich ist, von seiner Vernunft bei unserem Thun und<br />
Lassen Gebrauch zu machen“. 44 Die Bedingung aber für die Erfüllung dieser<br />
Aufgabe ist der ‚reine, für sich selbst praktische Wille‘.<br />
In ähnlicher Weise ist das sinnlich affizierte Erkenntnisvermögen, ‚nach der<br />
Vernunft‘, d.h. wenn es seiner eigentlichen Aufgabe gerecht werden soll<br />
(wahrhaft Erkenntnis zu leisten), auf die nichtsinnlichen (reinen) Prinzipien<br />
<strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> angewiesen. Dies besagt der schon zitierte letzte Teil <strong>des</strong> <strong>Deduktion</strong>sabsatzes,<br />
den wir noch einmal zitieren, wobei wir zwei verdeutlichende<br />
Ausdrücke in Klammern hinzufügen:<br />
|„... ungefähr so, wie zu den Anschauungen der Sinnenwelt Begriffe <strong>des</strong><br />
Verstan<strong>des</strong>, die für sich selbst nichts als gesetzliche Form (nämlich der angeschauten<br />
Gegenstände) überhaupt bedeuten, hinzu kommen und dadurch<br />
synthetische Sätze a priori, auf welchen alle Erkenntniß einer Natur [d.i. Erfahrung)<br />
beruht, möglich machen“. 45<br />
142<br />
44 Vgl. nochmals IV 455‚34-456‚1.<br />
45 Vgl. IV 454‚15-19; es wäre ein Mißverständnis, zu meinen, daß nach dieser Formulierung nicht die Möglichkeit<br />
der Erfahrung („Erkenntniß einer Natur“), sondern „die Begriffe <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong>“ für sich genommen<br />
schon synthetische Sätze a priori möglich machten: Die Verstan<strong>des</strong>begriffe ermöglichen, genau besehen,<br />
vielmehr auch nach diesem Text die Erfahrung, welche (ihrem Vollbegriff nach) eben darin besteht, daß<br />
VIII