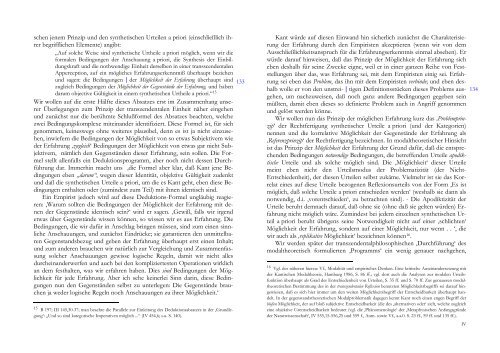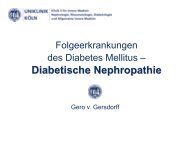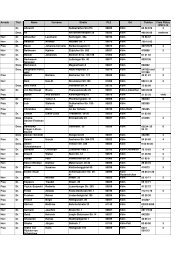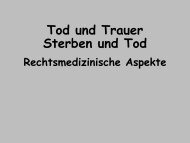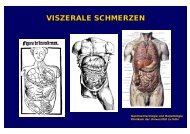Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schen jenem Prinzip und den synthetischen Urteilen a priori (einschließlich ihrer<br />
begrifflichen Elemente) angibt:<br />
„Auf solche Weise sind synthetische Urtheile a priori möglich, wenn wir die<br />
formalen Bedingungen der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft<br />
und die nothwendige Einheit derselben in einer transscendentalen<br />
Apperception, auf ein mögliches Erfahrungserkenntniß überhaupt beziehen<br />
und sagen: die Bedingungen | der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind<br />
zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung, und haben<br />
darum objective Gültigkeit in einem synthetischen Urtheile a priori.“ 15<br />
Wir wollen auf die erste Hälfte dieses Absatzes erst im Zusammenhang unserer<br />
Überlegungen zum Prinzip der transzendentalen Einheit näher eingehen<br />
und zunächst nur die berühmte Schlußformel <strong>des</strong> Absatzes beachten, welche<br />
zwei Bedingungskomplexe miteinander identifiziert. Diese Formel ist, für sich<br />
genommen, keineswegs ohne weiteres plausibel, denn es ist ja nicht einzusehen,<br />
inwiefern die Bedingungen der Möglichkeit von so etwas Subjektivem wie<br />
der Erfahrung ,zugleich‘ Bedingungen der Möglichkeit von etwas gar nicht Subjektivem,<br />
nämlich den Gegenständen dieser Erfahrung, sein sollen. Die Formel<br />
stellt allenfalls ein <strong>Deduktion</strong>sprogramm, aber noch nicht <strong>des</strong>sen Durchführung<br />
dar. Immerhin macht uns ‚die Formel aber klar, daß Kant jene Bedingungen<br />
eben „darum“, wegen dieser Identität, objektive Gültigkeit zudenkt<br />
und daß die synthetischen Urteile a priori, um die es Kant geht, eben diese Bedingungen<br />
enthalten oder (zumin<strong>des</strong>t zum Teil) mit ihnen identisch sind.<br />
Ein Empirist jedoch wird auf diese <strong>Deduktion</strong>s-Formel ungläubig reagieren:<br />
‚Warum sollten die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung mit denen<br />
der Gegenstände identisch sein?‘ wird er sagen. ‚Gewiß, falls wir irgend<br />
etwas über Gegenstände wissen können, so wissen wir es aus Erfahrung. Die<br />
Bedingungen, die wir dafür in Anschlag bringen müssen, sind zum einen sinnliche<br />
Anschauungen, und zunächst Eindrücke; sie garantieren den unmittelbaren<br />
Gegenstandsbezug und geben der Erfahrung überhaupt erst einen Inhalt;<br />
und zum anderen brauchen wir natürlich zur Vergleichung und Zusammenfassung<br />
solcher Anschauungen gewisse logische Regeln, damit wir nicht alles<br />
durcheinanderwerfen und auch bei den kompliziertesten Operationen wirklich<br />
an dem festhalten, was wir erfahren haben. Dies sind Bedingungen der Möglichkeit<br />
für jede Erfahrung. Aber ich sehe keinerlei Sinn darin, diese Bedingungen<br />
nun den Gegenständen selbst zu unterlegen: Die Gegenstände brauchen<br />
ja weder logische Regeln noch Anschauungen zu ihrer Möglichkeit.‘<br />
15 B 197; III 145‚30-37; man beachte die Parallele zur Einleitung <strong>des</strong> <strong>Deduktion</strong>sabsatzes in der ‚Grundlegung‘:<br />
„Und so sind kategorische Imperativen möglich ...“ (IV 454‚6; s.u. S. 140).<br />
133<br />
Kant würde auf diesen Einwand hin sicherlich zunächst die Charakterisierung<br />
der Erfahrung durch den Empiristen akzeptieren (wenn wir von dem<br />
Ausschließlichkeitsanspruch für die Erfahrungserkenntnis einmal absehen). Er<br />
würde darauf hinweisen, daß das Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung sich<br />
eben <strong>des</strong>halb für seine Zwecke eigne, weil er in einer ganzen Reihe von Feststellungen<br />
über das, was Erfahrung sei, mit dem Empiristen einig sei. Erfahrung<br />
sei eben das Problem, das ihn mit dem Empiristen verbinde; und eben <strong>des</strong>halb<br />
wolle er von den unstrei- | tigen Definitionsstücken dieses Problems ausgehen,<br />
um nachzuweisen, daß noch ganz andere Bedingungen gegeben sein<br />
müßten, damit eben dieses so definierte Problem auch in Angriff genommen<br />
und gelöst werden könne.<br />
Wir wollen nun das Prinzip der möglichen Erfahrung kurz das ‚Problemprinzip‘<br />
der Rechtfertigung synthetischer Urteile a priori (und der Kategorien)<br />
nennen und die korrelative Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung als<br />
‚Referenzprinzip‘ der Rechtfertigung bezeichnen. In modaltheoretischer Hinsicht<br />
ist das Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung der Grund dafür, daß die entsprechenden<br />
Bedingungen notwendige Bedingungen, die betreffenden Urteile apodiktische<br />
Urteile und als solche möglich sind. Die ‚Möglichkeit‘ dieser Urteile<br />
meint eben nicht den Urteilsmodus der Problematizität (der Nicht-<br />
Entschiedenheit), der diesen Urteilen selbst zukäme. Vielmehr ist sie das Korrelat<br />
eines auf diese Urteile bezogenen Reflexionsurteils von der Form ‚Es ist<br />
möglich, daß solche Urteile a priori entschieden werden‘ (weshalb sie dann als<br />
notwendig, d.i. ‚vorentschieden‘, zu betrachten sind). - Die Apodiktizität der<br />
Urteile beruht demnach darauf, daß ohne sie (ohne daß sie gelten würden) Erfahrung<br />
nicht möglich wäre. Zumin<strong>des</strong>t bei jedem einzelnen synthetischen Urteil<br />
a priori beruht übrigens seine Notwendigkeit nicht auf einer ‚schlichten‘<br />
Möglichkeit der Erfahrung, sondern auf einer Möglichkeit, nur wenn . . ‘, die<br />
wir auch als ‚replikative Möglichkeit‘ bezeichnen können 16 .<br />
Wir werden später der transzendentalphilosophischen ‚Durchführung‘ <strong>des</strong><br />
modaltheoretisch formulierten ‚Programms‘ ein wenig genauer nachgehen,<br />
16 Vgl. <strong>des</strong> näheren hierzu: Vf., Modalität und empirisches Denken. Eine kritische Auseinandersetzung mit<br />
der Kantischen Modaltheorie, Hamburg 1986, S. 86 ff.; vgl. dort auch die Analysen zur modalen Urteilsfunktion<br />
überhaupt als Grad der Entschiedenheit von Urteilen, S. 35 ff. und S. 70 ff. Zur genaueren modaltheoretischen<br />
Bestimmung <strong>des</strong> in der transzendentalen Reflexion benutzten Möglichkeitsbegriffs sei darauf hingewiesen,<br />
daß es sich hier immer um den weiten Möglichkeitsbegriff der Entscheidbarkeit überhaupt handelt.<br />
In der gegenstandstheoretischen Modalproblematik dagegen kennt Kant noch einen engen Begriff der<br />
bloßen Möglichkeit, der auf bloß subjektive Entscheidbarkeit (die <strong>des</strong> ‚alternativen oder‘ zielt, welche zugleich<br />
eine objektive Unentscheidbarkeit bedeutet (vgl. die ‚Phänomenologie‘ der ‚Metaphysischen Anfangsgründe<br />
der Naturwissenschaft‘, IV 555‚15-556‚25 und 559 f., Anm. sowie Vf., a.a.0. S. 23 ff., 59 ff. und 135 ff.).<br />
IV<br />
134