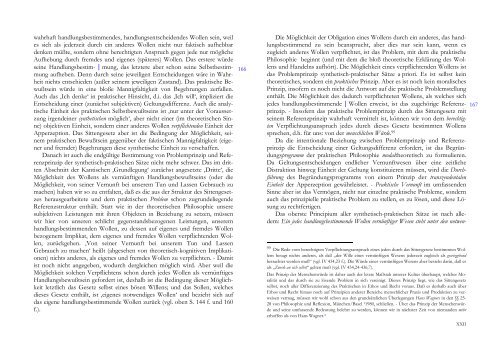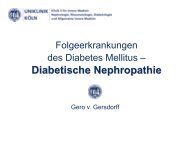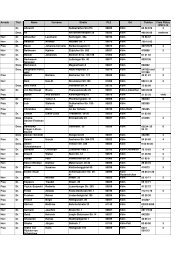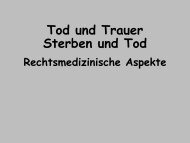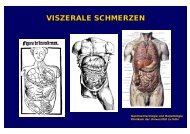Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wahrhaft handlungsbestimmen<strong>des</strong>, handlungsentscheiden<strong>des</strong> Wollen sein, weil<br />
es sich als jederzeit durch ein anderes Wollen nicht nur faktisch aufhebbar<br />
denken müßte, sondern ohne berechtigten Anspruch gegen jede nur mögliche<br />
Aufhebung durch frem<strong>des</strong> und eigenes (späteres) Wollen. Das erstere würde<br />
seine Handlungsbestim- | mung, das letztere aber schon seine Selbstbestimmung<br />
aufheben. Denn durch seine jeweiligen Entscheidungen wäre in Wahrheit<br />
nichts entschieden (außer seinem jeweiligen Zustand). Das praktische Bewußtsein<br />
würde in eine bloße Mannigfaltigkeit von Begehrungen zerfallen.<br />
Auch das ‚Ich denke‘ in praktischer Hinsicht, d.i. das ‚Ich will‘, impliziert die<br />
Entscheidung einer (zunächst subjektiven) Geltungsdifferenz. Auch die analytische<br />
Einheit <strong>des</strong> praktischen Selbstbewußtseins ist ‚nur unter der Voraussetzung<br />
irgendeiner synthetischen möglich‘, aber nicht einer (im theoretischen Sinne)<br />
objektiven Einheit, sondern einer anderes Wollen verpflichtenden Einheit der<br />
Apperzeption. Das Sittengesetz aber ist die Bedingung der Möglichkeit, seinem<br />
praktischen Bewußtsein gegenüber der faktischen Mannigfaltigkeit (eigener<br />
und fremder) Begehrungen diese synthetische Einheit zu verschaffen.<br />
Danach ist auch die endgültige Bestimmung von Problemprinzip und Referenzprinzip<br />
der synthetisch-praktischen Sätze nicht mehr schwer. Das im dritten<br />
Abschnitt der Kantischen ‚Grundlegung‘ zunächst angesetzte ‚Dritte‘, die<br />
Möglichkeit <strong>des</strong> Wollens als vernünftigen Handlungsbewußtseins (oder die<br />
Möglichkeit, von seiner Vernunft bei unserem Tun und Lassen Gebrauch zu<br />
machen) haben wir so zu entfalten, daß es die aus der Struktur <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong><br />
herausgearbeitete und dem praktischen Problem schon zugrundeliegende<br />
Referenzstruktur enthält. Statt wie in der theoretischen Philosophie unsere<br />
subjektiven Leistungen mit ihren Objekten in Beziehung zu setzen, müssen<br />
wir hier von unseren schlicht gegenstandsbezogenen Leistungen, unserem<br />
handlungsbestimmenden Wollen, zu <strong>des</strong>sen auf eigenes und frem<strong>des</strong> Wollen<br />
bezogenem Implikat, dem eigenes und frem<strong>des</strong> Wollen verpflichtenden Wollen,<br />
zurückgehen. ‚Von seiner Vernunft bei unserem Tun und Lassen<br />
Gebrauch zu machen‘ heißt (abgesehen von theoretisch-kognitiven Implikationen)<br />
nichts anderes, als eigenes und frem<strong>des</strong> Wollen zu verpflichten. - Damit<br />
ist noch nicht angegeben, wodurch dergleichen möglich wird. Aber weil die<br />
Möglichkeit solchen Verpflichtens schon durch je<strong>des</strong> Wollen als vernünftiges<br />
Handlungsbewußtsein gefordert ist, <strong>des</strong>halb ist die Bedingung dieser Möglichkeit<br />
letztlich das Gesetz selbst eines bösen Willens; und das Sollen, welches<br />
dieses Gesetz enthält, ist ‚eigenes notwendiges Wollen‘ und bezieht sich auf<br />
das eigene handlungsbestimmende Wollen zurück (vgl. oben S. 144 f. und 160<br />
f.).<br />
166<br />
Die Möglichkeit der Obligation eines Wollens durch ein anderes, das handlungsbestimmend<br />
zu sein beansprucht, aber dies nur sein kann, wenn es<br />
zugleich anderes Wollen verpflichtet, ist das Problem, mit dem die praktische<br />
Philosophie beginnt (und mit dem die bloß theoretische Erklärung <strong>des</strong> Wollens<br />
und Handelns aufhört). Die Möglichkeit eines verpflichtenden Wollens ist<br />
das Problemprinzip synthetisch-praktischer Sätze a priori. Es ist selbst kein<br />
theoretisches, sondern ein praktisches Prinzip. Aber es ist noch kein moralisches<br />
Prinzip, insofern es noch nicht die Antwort auf die praktische Problemstellung<br />
enthält. Die Möglichkeit <strong>des</strong> dadurch verpflichteten Wollens, als welches sich<br />
je<strong>des</strong> handlungsbestimmende | Wollen erweist, ist das zugehörige Referenzprinzip.<br />
- Insofern das praktische Problemprinzip durch das Sittengesetz mit<br />
seinem Referenzprinzip wahrhaft vermittelt ist, können wir von dem berechtigten<br />
Verpflichtungsanspruch je<strong>des</strong> durch dieses Gesetz bestimmten Wollens<br />
sprechen, d.h. für uns: von der menschlichen Würde. 99<br />
Da die intentionale Beziehung zwischen Problemprinzip und Referenzprinzip<br />
die Entscheidung einer Geltungsdifferenz erfordert, ist das Begründungsprogramm<br />
der praktischen Philosophie modaltheoretisch zu formulieren.<br />
Da Geltungsentscheidungen endlicher Vernunftwesen über eine zeitliche<br />
Distraktion hinweg Einheit der Geltung konstituieren müssen, wird die Durchführung<br />
<strong>des</strong> Begründungsprogramms von einem Prinzip der transzendentalen<br />
Einheit der Apperzeption gewährleistet. - Praktische Vernunft im umfassenden<br />
Sinne aber ist das Vermögen, nicht nur einzelne praktische Probleme, sondern<br />
auch das prinzipielle praktische Problem zu stellen, es zu lösen, und diese Lösung<br />
zu rechtfertigen.<br />
Das oberste Principium aller synthetisch-praktischen Sätze ist nach alledem:<br />
Ein je<strong>des</strong> handlungsbestimmende Wollen vernünftiger Wesen steht unter den notwen-<br />
99 Die Rede vom berechtigten Verpflichtungsanspruch eines jeden durch das Sittengesetz bestimmten Wollens<br />
besagt nichts anderes, als daß „der Wille eines vernünftigen Wesens jederzeit zugleich als gesetzgebend<br />
betrachtet werden muß“ (vgl. IV 434‚23 f.). Die Würde eines vernünftigen Wesens aber besteht darin, daß es<br />
als „Zweck an sich selbst“ gelten muß (vgl. IV 434‚24-436‚7).<br />
Das Prinzip der Menschenwürde ist daher auch der letzte Maßstab unserer Kultur überhaupt, welcher Moralität<br />
und das durch sie zu lösende Problem in sich vereinigt. Dieses Prinzip liegt, wie das Sittengesetz<br />
selbst, noch aller Differenzierung <strong>des</strong> Praktischen in Ethos und Recht voraus. Daß es <strong>des</strong>halb auch über<br />
Ethos und Recht hinaus noch auf Prinzipien anderer Bereiche menschlicher Praxis und Produktion zu verweisen<br />
vermag, müssen wir wohl schon aus den grundsätzlichen Überlegungen Hans Wagners in den §§ 25-<br />
28 von Philosophie und Reflexion, München/Basel 31980, schließen. - Über das Prinzip der Menschenwürde<br />
und seine umfassende Bedeutung belehrt zu werden, können wir in nächster Zeit von niemanden mehr<br />
erhoffen als von Hans Wagner.*<br />
XXII<br />
167