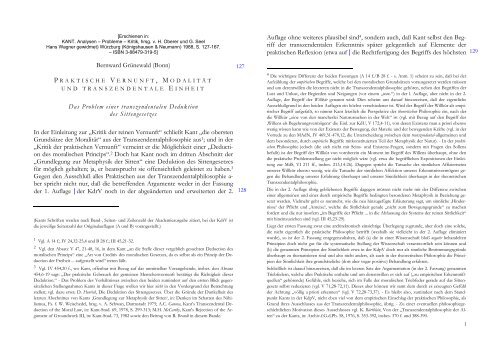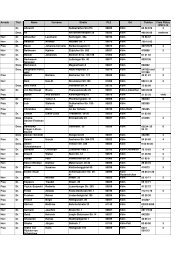Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
[Erschienen in:<br />
KANT. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. H. Oberer und G. Seel<br />
Hans Wagner gewidmet) Würzburg (Königshausen & Neumann) 1988, S. 127-167.<br />
– ISBN 3-88479-319-5]<br />
Bernward Grünewald (Bonn)<br />
P RAKTISCHE V ERNUNFT, M ODALITÄT<br />
UND TRANSZENDENTALE E INHEIT<br />
Das Problem einer transzendentalen <strong>Deduktion</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong><br />
In der Einleitung zur „Kritik der reinen Vernunft“ schließt Kant „die obersten<br />
Grundsätze der Moralität“ aus der Transzendentalphilosophie aus 1 ; und in der<br />
„Kritik der praktischen Vernunft“ verneint er die Möglichkeit einer „Deduction<br />
<strong>des</strong> moralischen Princips“. 2 Doch hat Kant noch im dritten Abschnitt der<br />
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ eine <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong><br />
für möglich gehalten; ja, er beansprucht sie offensichtlich geleistet zu haben. 3<br />
Gegen den Ausschluß alles Praktischen aus der Transzendentalphilosophie aber<br />
spricht nicht nur, daß die betreffenden Argumente weder in der Fassung<br />
der 1. Auflage | der KdrV noch in der abgeänderten und erweiterten der 2.<br />
(Kants Schriften werden nach Band-, Seiten- und Zeilenzahl der Akademieausgabe zitiert, bei der KdrV ist<br />
die jeweilige Seitenzahl der Originalauflagen (A und B) vorangestellt.)<br />
1 Vgl. A 14 f.; IV 24‚32-25‚4 und B 28 f.; III 45‚21-32.<br />
2 Vgl. den Absatz V 47, 21-48, 16, in dem Kant „an die Stelle dieser vergeblich gesuchten Deduction <strong>des</strong><br />
moralischen Princips“ eine „Art von Creditiv <strong>des</strong> moralischen Gesetzes, da es selbst als ein Princip der Deduction<br />
der Freiheit ... aufgestellt wird“ treten läßt.<br />
3 Vgl. IV 454‚20 f., wo Kant, offenbar mit Bezug auf das unmittelbar Vorangehende, insbes. den Absatz<br />
454‚6-19 sagt: „Der praktische Gebrauch der gemeinen Menschenvernunft bestätigt die Richtigkeit dieser<br />
<strong>Deduktion</strong>.“ - Das Problem <strong>des</strong> Verhältnisses zwischen den beiden zumin<strong>des</strong>t auf den ersten Blick gegensätzlichen<br />
Stellungnahmen Kants in dieser Frage wollen wir hier nicht in den Vordergrund der Betrachtung<br />
stellen; vgl. dazu etwa: D. Henrich, Die <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong>. Über die Gründe der Dunkelheit <strong>des</strong><br />
letzten Abschnittes von Kants ‚Grundlegung zur Metaphysik der Sitten‘, in: Denken im Schatten <strong>des</strong> Nihilismus,<br />
Fs. f. W. Weischedel, hrsg. v. A. Schwan, Darmstadt 1975; A.C. Genova, Kant’s Transcendental Deduction<br />
of the Moral Law, in: Kant-Stud. 69, 1978, S. 299-313; M.H. McCarthy, Kant's Rejection of the Argument<br />
of Groundwork III, in: Kant-Stud. 73, 1982 sowie den Beitrag von R. Brandt in diesem Bande.<br />
127<br />
128<br />
Auflage ohne weiteres plausibel sind 4 , sondern auch, daß Kant selbst den Begriff<br />
der transzendentalen Erkenntnis später gelegentlich auf Elemente der<br />
praktischen Reflexion (etwa auf | die Rechtfertigung <strong>des</strong> Begriffs <strong>des</strong> höchsten<br />
4 Die wichtigste Differenz der beiden Fassungen (A 14 f./B 28 f. - s. Anm. 1) scheint zu sein, daß bei der<br />
Aufzählung der empirischen Begriffe, welche bei den moralischen Grundsätzen vorausgesetzt werden müssen<br />
und um derentwillen die letzteren nicht in die Transzendentalphilosophie gehören, neben den Begriffen der<br />
Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen (vor einem „usw.“) in der l. Auflage, aber nicht in der 2.<br />
Auflage, der Begriff der Willkür genannt wird: Dies scheint uns darauf hinzuweisen, daß der eigentliche<br />
Ausschlußgrund in den beiden Auflagen ein höchst verschiedener ist. Wird der Begriff der Willkür als empirischer<br />
Begriff aufgefaßt, so nimmt Kant letztlich die Perspektive der theoretischen Philosophie ein, nach der<br />
die Willkür „eine von den mancherlei Naturursachen in der Welt“ ist (vgl. mit Bezug auf den Begriff <strong>des</strong><br />
‚Willens als Begehrungsvermögens‘ die Einl. zur KdU, V 172‚4-11), von deren Existenz man a priori ebenso<br />
wenig wissen kann wie von der Existenz der Bewegung, der Materie und der bewegenden Kräfte (vgl. in der<br />
Vorrede zu den MAdN, IV 469‚31-470‚12, die Unterscheidung zwischen dem transzendental-allgemeinen und<br />
dem besonderen‚ durch empirische Begriffe mitkonstituierten Teil der Metaphysik der Natur). - In der praktischen<br />
Philosophie jedoch (die sich nicht mit Seins- und Existenz-Fragen, sondern mit Fragen <strong>des</strong> Sollens<br />
befaßt) ist der Begriff der Willkür von vornherein ein Moment im Begriff <strong>des</strong> Willens überhaupt, ohne den<br />
die praktische Problemstellung gar nicht möglich wäre (vgl. etwa die begrifflichen Expositionen der Einleitung<br />
zur MdS, VI 211 ff., insbes. 213‚14-26). Dagegen spricht die Tatsache <strong>des</strong> sinnlichen Affiziertseins<br />
unserer Willkür ebenso wenig, wie die Tatsache der sinnlichen Affektion unseres Erkenntnisvermögens gegen<br />
die Behandlung unserer Erfahrung überhaupt und unserer Sinnlichkeit überhaupt in der theoretischen<br />
Transzendentalphilosophie.<br />
Die in der 2. Auflage übrig gebliebenen Begriffe dagegen müssen nicht mehr mit der Differenz zwischen<br />
einer allgemeinen und einer durch empirische Begriffe bedingten besonderen Metaphysik in Beziehung gesetzt<br />
werden. Vielmehr geht es nunmehr, wie die neu hinzugefügte Erläuterung sagt, um sinnliche ‚Hindernisse‘<br />
der Pflicht und ‚Anreize‘, welche die Sittlichkeit gerade „nicht zum Bewegungsgrunde“ zu machen<br />
fordert und die nur insofern „im Begriffe der Pflicht ... in die Abfassung <strong>des</strong> Systems der reinen Sittlichkeit“<br />
mit hineinzuziehen sind (vgl. III 45‚23-29).<br />
Liegt der ersten Fassung zwar eine architektonisch einsichtige Überlegung zugrunde, aber doch eine solche,<br />
die nicht eigentlich die praktische Philosophie betrifft (weshalb sie vielleicht in der 2. Auflage eliminiert<br />
wurde), so ist der 2. Fassung entgegenzuhalten, daß (a) die in einer Wissenschaft bloß negativ behandelten<br />
Prinzipien doch nicht gut für die systematische Stellung der Wissenschaft verantwortlich sein können und<br />
(b) die genannten Prinzipien der Sinnlichkeit etwa in der KdpV doch nur als sinnliche Bestimmungsgründe<br />
überhaupt zu thematisieren sind und also nicht anders, als auch in der theoretischen Philosophie die Prinzipien<br />
der Sinnlichkeit ihre grundsätzliche (dort aber sogar positive) Behandlung erfahren.<br />
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die im letzten Satz der Argumentation (in der 2. Fassung) genannten<br />
Triebfedern, welche alles Praktische enthalte und um derentwillen es sich auf („zu empirischen Erkenntnißquellen“<br />
gehörende) Gefühle, sich beziehe, sich im Falle der moralischen Triebfeder gerade auf das Sittengesetz<br />
selbst reduzieren (vgl. V 71‚28-72‚11). Dieses aber können wir samt dem durch es erzeugten Gefühl<br />
der Achtung „völlig a priori erkennen“ (vgl. V 72‚28-73‚37). - Es bleibt also, zumin<strong>des</strong>t nach dem Standpunkt<br />
Kants in der KdpV, nicht eben viel von dem empirischen Einschlag der praktischen Philosophie, als<br />
Grund ihres Ausschlusses aus der Transzendentalphilosophie, übrig. - Zu einer eventuellen philosophiegeschichtlichen<br />
Motivation dieses Ausschlusses vgl. K. Bärthlein, Von der „Transzendentalphilosophie der Alten“<br />
zu der Kants, in: Archiv.f.G.d.Ph. 58, 1976, S. 353-392, insbes. 370 f. und 388-390.<br />
I<br />
129
Gutes und auf das rechtsphilosophische Prinzip der Publizität) anwendet. 5 -<br />
Welches ist dann aber das Problem, das der Gedanke einer <strong>Deduktion</strong>, oder<br />
gar transzendentalen <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> für Kants praktische Philosophie<br />
mit sich führt? Und ist dieses Problem auf der Grundlage der Kantischen<br />
Überlegungen und mit den Kantischen Mitteln wirklich so unlösbar, wie<br />
dies zumin<strong>des</strong>t die Ausführungen der „Kritik der praktischen Vernunft“ vermuten<br />
lassen?<br />
Diese beiden Fragen lassen sich kaum durch eine bloße Analyse der Kantischen<br />
Haupttexte im 3. Abschnitt der ‚Grundlegung‘ und in der KdpV beantworten<br />
- nicht nur, weil Kant selbst nirgendwo deutlich erklärt, ob er die Position<br />
der KdpV wirklich als ein Revision der ‚Grundlegung‘ verstanden wissen<br />
will, sondern auch, weil diese Fragen letztlich systematische Fragen sind. Wir<br />
wollen uns <strong>des</strong>halb hier weniger eine vollständige Analyse der Texte und gar<br />
einen Vergleich der beiden Positionen zum Ziel setzen (so notwendig auch<br />
dies sein mag), sondern einmal versuchen, die systematischen Bedingungen für<br />
die Lösung <strong>des</strong> Problems so weit wie möglich in der Kantischen Philosophie<br />
freizulegen. Einer Antwort auf die beiden Fragen wollen wir uns in fünf<br />
Schritten nähern: Wir werden 1. den Begriff und das mit gewissem Recht<br />
„modaltheoretisch“ zu nennende Programm der Transzendentalphilosophie,<br />
insbes. nach der 2. Auflage der KdrV, skizzieren, soweit Kant bei<strong>des</strong> in der<br />
theoretischen Philosophie entwickelt. Wir werden 2. diese modaltheoretischen<br />
Strukturen in der Problemstellung der praktischen Philosophie Kants wiederzufinden<br />
versuchen. 3. werden wir die transzendentalphilosophische Durchführung<br />
<strong>des</strong> modaltheoretischen Programms in der KdrV, insbes. in der transzendentalen<br />
<strong>Deduktion</strong> der Kategorien, kurz charakterisieren. Dabei wollen wir vor allem<br />
die Strukturen herausarbeiten, die sich für Kant aus dem ‚transzendentalen‘<br />
Prinzip der Einheit ergeben, welches in gewisser Weise an die ‚Transzendentalphilosophie<br />
der Alten‘ 6 anknüpft, und 4. den Andeutungen <strong>des</strong> entsprechenden<br />
‚transzendentalen‘ Prinzips und der in ihm begründeten Strukturen in<br />
Kants praktischer Philosophie nachgehen und die damit verbundenen prinzipientheoretischen<br />
Schwierigkeiten verdeutlichen, um dann 5. den Versuch zu<br />
machen, durch eine systematische ‚Ausschöpfung‘ der Kantischen Ansätze die<br />
Möglichkeit einer transzendentalen <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> nachzuweisen.<br />
5 Vgl. V 113‚5-12 und VIII 381-386, insbes. 381‚2 f. und 22-25 sowie 386‚10-13.<br />
6 Vgl. § 12 der 2. Auflage der KdrV, B 113 ff.; III 97,20-99‚6.<br />
1. Begriff und modaltheoretisches Programm<br />
der (theoretischen) Transzendentalphilosophie<br />
„Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist ... in der Frage enthalten: Wie<br />
sind synthetische Urtheile a priori möglich?“ 7 . Aus dieser Frage ergibt sich „die Idee<br />
einer besondern Wissenschaft, die Kritik der reinen Vernunft heißen kann“ 8 und<br />
welche „die Propädeutik zum System der reinen Vernunft“ oder zur „Transscendental-Philosophie“<br />
9 darstellt. Bedenken wir, daß in der Frage nach der Möglichkeit<br />
gewisser Urteile auch die Frage nach der Möglichkeit der darin enthaltenen<br />
Begriffe vorausgesetzt ist, so ist der Begriff <strong>des</strong> Transzendentalen (zumin<strong>des</strong>t<br />
nach dem Text der 2. Auflage) letztlich durch die Ausgangsfrage der „Kritik<br />
der reinen Vernunft“, die ‚eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft‘ bestimmt,<br />
wie dies auch in der Definition der transzendentalen Erkenntnis zum<br />
Ausdruck kommt:<br />
„Ich nenne alle Erkenntniß transscendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen,<br />
sondern mit unserer Erkenntnißart von Gegenständen, so fern diese<br />
a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt.“ 10<br />
Worauf zielt nun genau der modale Begriff der Möglichkeit, der in der Ausgangsfrage<br />
und in der Definition der transzendentalen Erkenntnis benutzt<br />
wird? Hier müssen wir uns zunächst klarmachen, daß dasjenige, nach <strong>des</strong>sen<br />
Möglichkeit gefragt wird, von vornherein eine Geltungseinheit ist. Es geht um<br />
die Möglichkeit gültiger Urteile und die Möglichkeit gültiger, d.h. wahrhaft auf<br />
Gegenstände bezogener Begriffe, und nicht etwa nur um die Möglichkeit faktischer<br />
Behauptungen. So ist denn auch die Wirklichkeit synthetischer Urteile<br />
a priori, die Kant gemäß dem Text der „Prolegomena“ und der 2. Auflage der<br />
7 B 19; III 39‚27-29.<br />
8 Vgl. B 24; III 42‚29 f.<br />
9 Vgl. B 25; III 43‚11 f. und 19 f.<br />
10 B 25; III 43‚16-19; Die entsprechende Formulierung der 1. Auflage bezieht sich zumin<strong>des</strong>t weniger deutlich<br />
auf das Problem der synthetischen Urteile a priori, indem sie statt von der ‚Erkenntnisart‘ und ihrer<br />
Möglichkeit a priori nur von „Begriffen a priori von Gegenständen überhaupt“ spricht (vgl. A 11 f; IV 23‚8-<br />
11). Diese Formulierung ist offenbar in dem folgenden Satz auch noch der 2. Auflage vorausgesetzt, wenn<br />
es heißt: „Ein System solcher Begriffe würde Transscendental-Philosophie heißen.“ (B 25; III 43‚19 f.). - Zu der<br />
Frage, inwieweit Kant mit der Neuformulierung der Definition der transzendentalen Erkenntnis eine tiefgreifende<br />
Veränderung in der Konzeption der Transzendentalphilosophie vorgenommen hat, vgl. T. Pinder,<br />
Kants Begriff der transzendentalen Erkenntnis. Zur Interpretation der Definition <strong>des</strong> Begriffs „transzendental“<br />
in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft (A 11 f./B 25), in: Kant-Stud. 77, 1986, S. 1-40. -<br />
Wir werden uns im folgenden hauptsächlich an der 2. Auflage der KdrV orientieren<br />
II<br />
130
„Kritik der reinen Vernunft“ in der reinen Mathematik und der reinen Naturwissenschaft<br />
gegeben | sieht 11 , Wirklichkeit von gültigen synthetischen Urteilen<br />
a priori, d.i. Entschiedenheit ihrer Geltungsdifferenz.<br />
Das Problem ist nun aber nicht die Wirklichkeit, sondern die Möglichkeit<br />
solcher Urteile. - Was heißt das? Die Entschiedenheit der Geltungsdifferenz<br />
von Urteilen hängt, zumin<strong>des</strong>t, wenn wir nicht von ‚Urteilen an sich‘, sondern<br />
von ihrer Realisierung in menschlichen Subjekten reden wollen, von vielerlei<br />
im weitesten Sinne historischen Gegebenheiten ab. Auch wenn alle diese Gegebenheiten<br />
der Fall wären, könnten wir (einerseits) immer noch fragen, wodurch<br />
denn solche Urteile unter diesen Gegebenheiten als gültige Urteile überhaupt<br />
möglich seien. Würden wir dagegen diesen Grund der Möglichkeit<br />
kennen, so wäre dadurch (andererseits) noch nichts über die Wirklichkeit (im<br />
Sinne der Entschiedenheit je<strong>des</strong> einzelnen) solcher Urteile gesagt. Wir hätten<br />
allenfalls ein Geltungsprinzip an der Hand, mit <strong>des</strong>sen Hilfe wir jeweils in einem<br />
Prüfverfahren über die Geltung eines jeden entscheiden könnten.<br />
Das Problem nun der Möglichkeit (gültiger) synthetischer Urteile a priori<br />
besteht bekannter Maßen darin, daß in ihnen von einem Subjektsbegriff ein<br />
Prädikatsbegriff ausgesagt wird, der nicht in diesem Subjektsbegriff enthalten<br />
ist, ohne daß doch ein Entscheidungsgrund für diese Synthesis in irgendeiner<br />
Erfahrung gegeben wäre. Daher können wir auch sagen, daß die Möglichkeitsfrage<br />
auf ein `Drittes‘ neben dem Subjekts- und dem Prädikatsbegriff zielt,<br />
welches zwischen Subjekts- und Prädikatsbegriff vermittelt. 12 Mit dem Problem<br />
der synthetischen Urteile a priori ist dasjenige der reinen Begriffe a priori<br />
verbunden. Auch sie stehen unter dem Verdacht, ungültig zu sein, und zwar in<br />
dem Sinne, daß sie sich gar nicht auf Gegenstände beziehen, da sie per Defini-<br />
11 Vgl. IV 279‚15-28 und B 20; III 40‚17-25; es ist ein wenig irreführend, die <strong>Deduktion</strong>, welche die ‚Prolegomena‘<br />
von der Möglichkeit der reinen Mathematik und der reinen Naturwissenschaft geben, (nicht wegen<br />
geringer Ausführlichkeit, sondern schon ihrer Zielsetzung nach) eine ‚schwache <strong>Deduktion</strong>‘ zu nennen (vgl.<br />
D. Henrich, Die <strong>Deduktion</strong> ..., S. 30-32). Wird nachgewiesen, wie gewisse Urteile möglich sind, so spielt es für<br />
die Bewertung der <strong>Deduktion</strong>s-Leistung keine Rolle, ob vorher (gemäß der analytischen Methode) angenommen<br />
wurde, daß sie möglich seien (weil sie schon für wirklich gehalten werden). Gelänge nämlich der<br />
Nachweis nicht, so müßte die Annahme natürlich revidiert werden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die<br />
‚Logik‘ einer transzendentalen <strong>Deduktion</strong> nicht von derjenigen eines trivialen Beweises: Die Argumente<br />
sind, wenn sie geliefert werden, für jemanden, der die These vorher bezweifelt hat, dieselben und ebenso<br />
verbindlich, wie für den, der sie immer schon vertreten hat. Wenn wir nicht auf den Grad der Ausführlichkeit<br />
achten, so liegt der Unterschied der beiden <strong>Deduktion</strong>sformen allein in der Methode sowie in der literarischen<br />
und didaktischen Absicht.<br />
12 Vgl. B 194; III 144‚1-5, wo auch vom „Medium aller synthetischen Urtheile“ gesprochen wird; vgl. auch<br />
B 13; III 35‚27-36‚1: „das Unbekannte = x“.<br />
131<br />
tionem nicht aus der Erfahrung, unserer alltäglichen Quelle für Gegenstandsbezüge,<br />
genommen sind. 13<br />
| Die Antwort Kants auf die Frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile<br />
a priori wie auch auf die nach der Möglichkeit von Begriffen a priori ist nun<br />
wiederum in einer modaltheoretischen Formulierung zu finden: „Die Möglichkeit<br />
der Erfahrung ist also das, was allen unseren Erkenntnissen a priori<br />
objective Realität giebt.“ 14 Auch diese Antwort enthält also den Begriff der<br />
Möglichkeit einer Geltungseinheit, nun aber nicht einer Geltungseinheit<br />
a priori, sondern a posteriori, die Möglichkeit von aufgrund sinnlicher Anschauungen<br />
entscheidbaren Urteilen. Aber (und das ist nun wichtig) die Möglichkeit<br />
dieser empirischen Erkenntnis überhaupt ist selbst nichts Empirisches,<br />
sondern ein Prinzip a priori: Schon vor aller faktischen Erfahrung muß ich wissen<br />
können, ob und wie grundsätzlich über die Gültigkeit der empirischen Urteile<br />
entschieden werden kann.<br />
Um uns klar zu machen, worauf die Leistungsfähigkeit dieses Prinzips beruht,<br />
wollen wir es kurz einem anderen Prinzip gegenüberstellen, das uns ebenfalls<br />
als Begründungsprinzip in den Sinn kommen könnte. Wie könnten<br />
sagen: Die Kategorien sind reine Verstan<strong>des</strong>begriffe und die synthetischen Urteile<br />
a priori reine Verstan<strong>des</strong>grundsätze; sie definieren, eventuell zusammen<br />
mit den formal-logischen Prinzipien, dasjenige, was der (menschliche)<br />
Verstand selbst ist. Was aber sollte theoretische Gültigkeit besitzen, wenn<br />
nicht die Prinzipien <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> selbst? - Wir sehen sogleich, daß mit diesen<br />
Sätzen (eines ‚dogmatischen Rationalisten‘) so richtig sie sein mögen,<br />
nichts bewiesen ist. Gerade wenn der Begriff <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> durch jene Prinzipien<br />
zu definieren ist, würden wir uns im Zirkel bewegen. Wir würden unseren<br />
Verstand als einen (Gegenstände) wahrhaft erkennenden Verstand annehmen,<br />
um die Kategorien und die synthetischen Urteile a priori als gültig zu<br />
denken; und wir würden nachher jene Prinzipien als gerechtfertigt betrachten,<br />
weil wir unseren Verstand als wahrhaft erkennen<strong>des</strong> Vermögen gedacht hätten.<br />
Inwiefern nun das Prinzip der möglichen Erfahrung mehr leisten kann als<br />
ein so verwendeter Begriff <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong>, erklärt ein wenig genauer jener Absatz,<br />
welcher unmittelbar auf die Formulierung <strong>des</strong> ‚obersten Grundsatzes aller<br />
synthetischen Urteile‘ folgt und eine Art von (transzendentaler) <strong>Deduktion</strong> der<br />
synthetischen Urteile a priori enthält, und zwar, indem er das Verhältnis zwi-<br />
13 Vgl. B 120; III 101‚19-104‚2.<br />
14 B 195; III 144‚32 f; vgl. auch mit Bezug auf die Kategorien B 167; III 128‚16-23 und B 126; III 105‚1-12.<br />
III<br />
132
schen jenem Prinzip und den synthetischen Urteilen a priori (einschließlich ihrer<br />
begrifflichen Elemente) angibt:<br />
„Auf solche Weise sind synthetische Urtheile a priori möglich, wenn wir die<br />
formalen Bedingungen der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft<br />
und die nothwendige Einheit derselben in einer transscendentalen<br />
Apperception, auf ein mögliches Erfahrungserkenntniß überhaupt beziehen<br />
und sagen: die Bedingungen | der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind<br />
zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung, und haben<br />
darum objective Gültigkeit in einem synthetischen Urtheile a priori.“ 15<br />
Wir wollen auf die erste Hälfte dieses Absatzes erst im Zusammenhang unserer<br />
Überlegungen zum Prinzip der transzendentalen Einheit näher eingehen<br />
und zunächst nur die berühmte Schlußformel <strong>des</strong> Absatzes beachten, welche<br />
zwei Bedingungskomplexe miteinander identifiziert. Diese Formel ist, für sich<br />
genommen, keineswegs ohne weiteres plausibel, denn es ist ja nicht einzusehen,<br />
inwiefern die Bedingungen der Möglichkeit von so etwas Subjektivem wie<br />
der Erfahrung ,zugleich‘ Bedingungen der Möglichkeit von etwas gar nicht Subjektivem,<br />
nämlich den Gegenständen dieser Erfahrung, sein sollen. Die Formel<br />
stellt allenfalls ein <strong>Deduktion</strong>sprogramm, aber noch nicht <strong>des</strong>sen Durchführung<br />
dar. Immerhin macht uns ‚die Formel aber klar, daß Kant jene Bedingungen<br />
eben „darum“, wegen dieser Identität, objektive Gültigkeit zudenkt<br />
und daß die synthetischen Urteile a priori, um die es Kant geht, eben diese Bedingungen<br />
enthalten oder (zumin<strong>des</strong>t zum Teil) mit ihnen identisch sind.<br />
Ein Empirist jedoch wird auf diese <strong>Deduktion</strong>s-Formel ungläubig reagieren:<br />
‚Warum sollten die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung mit denen<br />
der Gegenstände identisch sein?‘ wird er sagen. ‚Gewiß, falls wir irgend<br />
etwas über Gegenstände wissen können, so wissen wir es aus Erfahrung. Die<br />
Bedingungen, die wir dafür in Anschlag bringen müssen, sind zum einen sinnliche<br />
Anschauungen, und zunächst Eindrücke; sie garantieren den unmittelbaren<br />
Gegenstandsbezug und geben der Erfahrung überhaupt erst einen Inhalt;<br />
und zum anderen brauchen wir natürlich zur Vergleichung und Zusammenfassung<br />
solcher Anschauungen gewisse logische Regeln, damit wir nicht alles<br />
durcheinanderwerfen und auch bei den kompliziertesten Operationen wirklich<br />
an dem festhalten, was wir erfahren haben. Dies sind Bedingungen der Möglichkeit<br />
für jede Erfahrung. Aber ich sehe keinerlei Sinn darin, diese Bedingungen<br />
nun den Gegenständen selbst zu unterlegen: Die Gegenstände brauchen<br />
ja weder logische Regeln noch Anschauungen zu ihrer Möglichkeit.‘<br />
15 B 197; III 145‚30-37; man beachte die Parallele zur Einleitung <strong>des</strong> <strong>Deduktion</strong>sabsatzes in der ‚Grundlegung‘:<br />
„Und so sind kategorische Imperativen möglich ...“ (IV 454‚6; s.u. S. 140).<br />
133<br />
Kant würde auf diesen Einwand hin sicherlich zunächst die Charakterisierung<br />
der Erfahrung durch den Empiristen akzeptieren (wenn wir von dem<br />
Ausschließlichkeitsanspruch für die Erfahrungserkenntnis einmal absehen). Er<br />
würde darauf hinweisen, daß das Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung sich<br />
eben <strong>des</strong>halb für seine Zwecke eigne, weil er in einer ganzen Reihe von Feststellungen<br />
über das, was Erfahrung sei, mit dem Empiristen einig sei. Erfahrung<br />
sei eben das Problem, das ihn mit dem Empiristen verbinde; und eben <strong>des</strong>halb<br />
wolle er von den unstrei- | tigen Definitionsstücken dieses Problems ausgehen,<br />
um nachzuweisen, daß noch ganz andere Bedingungen gegeben sein<br />
müßten, damit eben dieses so definierte Problem auch in Angriff genommen<br />
und gelöst werden könne.<br />
Wir wollen nun das Prinzip der möglichen Erfahrung kurz das ‚Problemprinzip‘<br />
der Rechtfertigung synthetischer Urteile a priori (und der Kategorien)<br />
nennen und die korrelative Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung als<br />
‚Referenzprinzip‘ der Rechtfertigung bezeichnen. In modaltheoretischer Hinsicht<br />
ist das Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung der Grund dafür, daß die entsprechenden<br />
Bedingungen notwendige Bedingungen, die betreffenden Urteile apodiktische<br />
Urteile und als solche möglich sind. Die ‚Möglichkeit‘ dieser Urteile<br />
meint eben nicht den Urteilsmodus der Problematizität (der Nicht-<br />
Entschiedenheit), der diesen Urteilen selbst zukäme. Vielmehr ist sie das Korrelat<br />
eines auf diese Urteile bezogenen Reflexionsurteils von der Form ‚Es ist<br />
möglich, daß solche Urteile a priori entschieden werden‘ (weshalb sie dann als<br />
notwendig, d.i. ‚vorentschieden‘, zu betrachten sind). - Die Apodiktizität der<br />
Urteile beruht demnach darauf, daß ohne sie (ohne daß sie gelten würden) Erfahrung<br />
nicht möglich wäre. Zumin<strong>des</strong>t bei jedem einzelnen synthetischen Urteil<br />
a priori beruht übrigens seine Notwendigkeit nicht auf einer ‚schlichten‘<br />
Möglichkeit der Erfahrung, sondern auf einer Möglichkeit, nur wenn . . ‘, die<br />
wir auch als ‚replikative Möglichkeit‘ bezeichnen können 16 .<br />
Wir werden später der transzendentalphilosophischen ‚Durchführung‘ <strong>des</strong><br />
modaltheoretisch formulierten ‚Programms‘ ein wenig genauer nachgehen,<br />
16 Vgl. <strong>des</strong> näheren hierzu: Vf., Modalität und empirisches Denken. Eine kritische Auseinandersetzung mit<br />
der Kantischen Modaltheorie, Hamburg 1986, S. 86 ff.; vgl. dort auch die Analysen zur modalen Urteilsfunktion<br />
überhaupt als Grad der Entschiedenheit von Urteilen, S. 35 ff. und S. 70 ff. Zur genaueren modaltheoretischen<br />
Bestimmung <strong>des</strong> in der transzendentalen Reflexion benutzten Möglichkeitsbegriffs sei darauf hingewiesen,<br />
daß es sich hier immer um den weiten Möglichkeitsbegriff der Entscheidbarkeit überhaupt handelt.<br />
In der gegenstandstheoretischen Modalproblematik dagegen kennt Kant noch einen engen Begriff der<br />
bloßen Möglichkeit, der auf bloß subjektive Entscheidbarkeit (die <strong>des</strong> ‚alternativen oder‘ zielt, welche zugleich<br />
eine objektive Unentscheidbarkeit bedeutet (vgl. die ‚Phänomenologie‘ der ‚Metaphysischen Anfangsgründe<br />
der Naturwissenschaft‘, IV 555‚15-556‚25 und 559 f., Anm. sowie Vf., a.a.0. S. 23 ff., 59 ff. und 135 ff.).<br />
IV<br />
134
wodurch Kant die Identität der Bedingungen <strong>des</strong> Problemprinzips auf der einen<br />
und <strong>des</strong> Referenzprinzips auf der anderen Seite nachgewiesen und damit<br />
den Erklärungsgrund für die Möglichkeit der synthetischen Urteile a priori bereitgestellt<br />
hat. Vorher wollen wir zusehen, inwieweit wir die bisher skizzierten<br />
Strukturen der fundamentalen ‚theoretischen‘ Überlegungen Kants auch in der<br />
Grundlegung seiner praktischen Philosophie wiederfinden können.<br />
2. Exposition der modaltheoretischen Strukturen<br />
in Kants Grundlegung der praktischen Philosophie<br />
Allem Anschein nach finden wir in Kants praktischer Philosophie eine der<br />
Ausgangsfrage der theoretischen Philosophie genau entsprechende Frage: „Wie<br />
ist ein kategorischer Imperativ möglich?“ 17 Ein kategorischer Imperativ ist ein „synthetisch-praktischer<br />
Satz a priori“ 18 . Der (nicht explizit genannte) Subjektsbegriff<br />
dieses synthetischen Satzes ist der Begriff <strong>des</strong> „Willens eines vernünftigen<br />
Wesens“ 19 ; der Prädikatsbegriff besteht in dem Gehalt <strong>des</strong> Imperativs, in der<br />
ersten Formulierung der ‚Grundlegung‘: „... handle nur nach derjenigen Maxime,<br />
durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“<br />
20 Das Prädikat ist also ein gewisses Sollen, das Kant freilich auch als das<br />
,Wollen einer Handlung‘ bezeichnet, nämlich „unter der Idee einer Vernunft,<br />
die über alle subjective Bewegursachen völlige Gewalt hätte“. 21 Zu Beginn <strong>des</strong><br />
dritten Abschnittes der ‚Grundlegung‘ findet sich auch eine scheinbar theoretische,<br />
in Wirklichkeit aber axiologische Umformulierung <strong>des</strong> synthetischpraktischen<br />
Satzes: „... ein schlechterdings guter Wille ist derjenige, <strong>des</strong>sen<br />
Maxime jederzeit sich selbst, als allgemeines Gesetz betrachtet, in sich enthal-<br />
17 17. Vgl. den dritten Zwischentitel im 3. Abschnitt der GMS, IV 453‚16.<br />
18 Vgl. z.B. IV 420‚14 und die zugehörige Fußnote, ebda. Z. 29-35; man beachte, daß der Terminus ‚Satz‘<br />
bei Kant nicht die Bedeutung einer sprachlichen Einheit hat, sondern die einer gedanklichen (noematischen)<br />
Einheit (vgl. dazu IX 109‚11-22 und VIII 193 f., Anm.). Seine Bedeutung ist einerseits enger als die <strong>des</strong><br />
Terminus ‚Urteil‘: Nur (min<strong>des</strong>tens) assertorische, also entschiedene Urteile sind Sätze; andererseits erstreckt<br />
sie sich nicht bloß auf theoretische, sondern auch auf praktisch-entschiedene Gedanken (vgl. IX 110‚1-6).<br />
Gerade in letzterer Hinsicht scheint uns der Terminus in seiner nicht-sprachlichen Bedeutung unentbehrlich<br />
zu sein.<br />
19 Vgl. IV 420, 34 f. und IV 440‚20-24.<br />
20 IV 421‚7 f.<br />
21 Vgl. IV 420‚31 f.<br />
135<br />
ten kann.“ 22 Der Prädikatsbegriff ist hier „Autonomie, d.i. die Eigenschaft <strong>des</strong><br />
Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein“ 23 , während der Subjektsbegriff zwar<br />
schon das Wertprädikat der ‚schlechthinnigen Güte‘ enthält, aber nach Kants<br />
Intention in einem Sinne, der (anders übrigens als der positive Begriff der Freiheit)<br />
noch nicht das Sittengesetz selbst impliziert, weil der Satz sonst kein synthetischer<br />
Satz wäre. 24 Der ‚schlechterdings gute Wille‘ ist also seinem bloßen<br />
Begriff nach (jedenfalls in dem soeben zitierten Satz) ebenso wenig wie der<br />
‚Wille eines vernünftigen Wesens‘ schon in einem eigentlich moralischen Sinne<br />
aufzufassen.<br />
| Zwar spricht Kant in diesem Zusammenhang nicht von einer ‚transzendentalen<br />
Erkenntnis‘, aber die Problemstellung und der in der ‚Grundlegung‘<br />
ins Auge gefaßte Lösungsweg scheinen doch ganz dem zu entsprechen, was<br />
Kant in der KdrV als transzendentale Erkenntnis charakterisiert. Auch hier<br />
geht es um die ‚Erkenntnisart‘, wodurch ein synthetischer Satz a priori möglich<br />
ist, auch hier müssen wir über die Beschäftigung mit dem Gegenstand <strong>des</strong> Satzes<br />
zu einer Kritik <strong>des</strong> Subjekts hinausgehen: Im 2. Abschnitt der ‚Grundlegung‘<br />
heißt es im Vorblick auf das Geschäft <strong>des</strong> 3. Abschnittes:<br />
„... man müßte über die Erkenntniß der Objecte zu einer Kritik <strong>des</strong> Subjects,<br />
d.i. der reinen praktischen Vernunft, hinausgehen, denn völlig a priori muß<br />
dieser synthetische Satz, der apodiktisch gebietet, erkannt werden können ...<br />
„ 25<br />
Wie die theoretisch-synthetischen Sätze a priori, so bedürfen auch die praktischsynthetischen<br />
Sätze a priori zu ihrer Möglichkeit, zur Entscheidbarkeit ihrer<br />
Geltungsdifferenz, eines ‚Dritten', welches den Grund der Entscheidung<br />
und der Verknüpfung zwischen Subjekts- und Prädikatsbegriff abgibt. 26 Dieses<br />
Dritte nun liegt im Text der ‚Grundlegung‘ nicht ebenso offen zu Tage wie<br />
dies bei der Möglichkeit der Erfahrung im Text der „Kritik der reinen Vernunft“<br />
der Fall ist, obwohl Kant die Frage nach diesem Dritten explizit stellt<br />
und implizit sogar beantwortet zu haben beansprucht. Unmittelbar sagt uns<br />
Kant zunächst nur, daß der „positive Begriff der Freiheit“ dieses Dritte ‚schaffe‘<br />
22 IV 447‚10-12.<br />
23 Vgl. IV 447‚1 f.<br />
24 Vgl. IV 447‚12-14 und nochmals 420‚32-35; man vergegenwärtige sich im Gegensatz dazu das Verhältnis<br />
zwischen den Begriffen der Freiheit und <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> (vgl. auch Anm. 55).<br />
25 Vgl. IV 440‚24-27; nimmt man hinzu, was Kant an der anfangs genannten Stelle V 113‚5-8 über die <strong>Deduktion</strong><br />
<strong>des</strong> Begriffs <strong>des</strong> höchsten Gutes sagt, so kann kein Zweifel bestehen, daß wir auch hier von einer<br />
transzendentalen Erkenntnis sprechen dürfen<br />
26 Vgl. IV 447‚14-17.<br />
V<br />
136
und daß uns die Freiheit darauf ‚weise‘; er deutet an, daß die „Möglichkeit eines<br />
kategorischen Imperativs“ zugleich mit der „Deduction <strong>des</strong> Begriffs der<br />
Freiheit aus der reinen Vernunft“ begreiflich zu machen sei; aber zu alledem<br />
bedürfe es „noch einiger Vorbereitung.“ 27<br />
Wir wollen nun nicht den gesamten Text, der diese ‚Vorbereitung‘ leistet,<br />
analysieren (vgl. dazu den Beitrag von R. Brandt in diesem Bande), sondern<br />
lediglich die Analogien zu Kants Vorgehen in der theoretischen Philosophie<br />
herausarbeiten. Legen wir eine Analogie zum Vorgehen in der KdrV einmal<br />
versuchsweise zugrunde, so erwarten wir (übrigens auch gemäß der zitierten<br />
Vordeutung auf die ‚Kritik <strong>des</strong> Subjekts‘ im 2. Abschnitt), daß das gesuchte<br />
‚Dritte‘ in einer notwendigen (und möglichst unbestrittenen) Leistung <strong>des</strong> Subjekts<br />
bestehe, deren bloße Möglichkeit als ‚Problemprinzip‘ der Möglichkeit<br />
synthetisch-praktischer Sätze a priori zugrunde liege.<br />
Kant scheint dieses Dritte, freilich ohne es als solches ausdrücklich zu<br />
kennzeichnen, zunächst in einer vorläufigen Überlegung und dann, nach der<br />
Diskus-|sion eines Einwan<strong>des</strong>, in einer endgültigen „<strong>Deduktion</strong>“ ins Spiel zu<br />
bringen. In der vorläufigen Überlegung setzt Kant den Subjektsbegriff <strong>des</strong><br />
synthetisch-praktischen Satzes, den <strong>des</strong> Willens eines vernünftigen Wesens<br />
(der bisher nur sozusagen ‚objektiv‘, als eine „Art von Causalität“ bestimmt<br />
worden ist), mit seinem Handlungsbewußtsein in Beziehung. 28 Hierin könnten<br />
wir einen ersten Schritt <strong>des</strong> im 2. Abschnitt angekündigten Übergangs von der<br />
‚Erkenntnis der Objekte zu einer Kritik <strong>des</strong> Subjekts‘ erblicken. Kant stellt die<br />
These auf, daß ein solches Wesen nur unter der Idee der Freiheit handeln<br />
könne. Dies aber impliziere, daß dieses Wesen zugleich auch das Gesetz eben<br />
dieser Freiheit für sich als gültig betrachten müsse:<br />
„Ein je<strong>des</strong> Wesen, das nicht anderes als unter der Idee der Freiheit handeln kann,<br />
ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei, d.i. es gelten für dasselbe<br />
alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, eben so<br />
als ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig<br />
für frei erklärt würde.“ 29<br />
Dieser Gedanke setzt jedoch voraus, daß das Handeln eines vernünftigen Wesens,<br />
das einen Willen hat, nicht irgendeine Kausalität, sondern die Kausalität<br />
einer ihrer selbst bewußten Vernunft ist: „... in einem solchen Wesen denken wir<br />
uns eine Vernunft, die praktisch ist, d.i. Causalität in Ansehung ihrer Objecte<br />
27 Vgl. IV 447‚20-25.<br />
28 Vgl. IV 448‚4-22 mit 446‚7-12.<br />
29 IV 448‚4-9<br />
hat.“ 30 Vernunft aber „muß sich selbst als Urheberin ihrer Prinzipien ansehen<br />
unabhängig von fremden Einflüssen“ 31 , wobei Kant offenbar annimmt, daß<br />
dies bei der praktischen Vernunft nicht anders sein könne als bei der theoretischen:<br />
Man könne sich<br />
„unmöglich eine Vernunft denken, die mit ihrem eigenen Bewußtsein in Ansehung<br />
ihrer Urtheile anderwärts her eine Lenkung empfinge, denn alsdann<br />
würde das Subject nicht seiner Vernunft, sondern einem Antriebe die Bestimmung<br />
der Urtheilskraft zuschreiben“. 32<br />
Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß die Urteilskraft tatsächlich einmal<br />
durch Antriebe irritiert würde, sondern lediglich, daß die Vernunft „mit<br />
ihrem eigenen Bewußtsein“ dies zulassen würde.<br />
Welches ist also nach diesem Gedankengang das ‚Dritte‘, welches die Verknüpfung<br />
<strong>des</strong> Subjekts- mit dem Prädikatsbegriff in einem kategorischen Imperativ<br />
vermittelt? Allem Anschein nach ist es auch hier die Möglichkeit einer<br />
Leistung <strong>des</strong> Subjekts, nämlich <strong>des</strong> Bewußtsein zu Handeln, u. zw. insofern, als es<br />
137 das | Handlungsbewußtsein eines vernünftigen und mit einem Willen begabten 138<br />
Wesens ist. Die Idee der Freiheit aber (und mittelbar das Gesetz der Moralität)<br />
ist dann eine Bedingung dieses Dritten - oder, wie Kant später, im Rückblick<br />
auf seine ‚<strong>Deduktion</strong>‘ formuliert: „... in praktischer Absicht“ ist „der Fußsteig<br />
der Freiheit der einzige, auf welchem es möglich ist, von seiner Vernunft bei<br />
unserm Thun und Lassen Gebrauch zu machen“. 33<br />
Auch in der praktischen Philosophie korrespondiert der modal formulierten<br />
Frage nach der ‚Möglichkeit‘ synthetisch-praktischer Sätze eine modal<br />
formulierte Anwort, die auf die ‚Möglichkeit‘ einer Subjektsleistung als eines<br />
die beiden Termini <strong>des</strong> Satzes vermittelnden ‚Dritten‘ verweist.<br />
Nennen wir dieses ‚Dritte‘ die ‚Möglichkeit <strong>des</strong> Wollens als vernünftigen<br />
Handlungsbewußtseins‘, so enthält diese Formulierung freilich (ebenso wie die<br />
verschiedenen Varianten <strong>des</strong> Kantischen Textes) eine Zweideutigkeit, die wir<br />
in heutiger Redeweise durch die Unterscheidung zwischen Zweckrationalität<br />
und Freiheit erläutern könnten: Muß das Handlungsbewußtsein eines vernünftigen<br />
Wesens wirklich die Idee einer sich in praktischer Hinsicht selbst bestim-<br />
30 ebda. Z 11-13<br />
31 Vgl. ebda. Z. 17 f.<br />
32 ebda. Z 13-16; zur Problematik dieses Übergangs wegen der Denkbarkeit <strong>des</strong> Fatalismus vgl. D. Henrich,<br />
Die <strong>Deduktion</strong> ..., S. 68 ff.<br />
33 Vgl. IV 455‚33-456‚1; dieses Zitat faßt innerhalb von Überlegungen, die sich auf die theoretische Möglichkeit<br />
der Freiheit (im Sinne der dritten Antinomie der transzendentalen Dialektik) beziehen, im Rückblick auf<br />
das Vorangegangene noch einmal das Ergebnis der praktischen <strong>Deduktion</strong> zusammen.<br />
VI
menden Vernunft (und damit der Freiheit) enthalten? Diese Frage scheint<br />
durch die Kantische Argumentation noch nicht recht geklärt zu sein, und man<br />
hat darauf hingewiesen, daß die Vernunft eines solchen Wesens ja ebenso gut<br />
nur die Funktion haben könnte, für anderweitig schon gegebene Zwecke, bloß<br />
durch theoretische Überlegung, die Mittel zu erschließen (also die Funktion der<br />
bloßen Zweckrationalität). 34 Wir müssen also fragen, warum erst Freiheit und<br />
Moralität, und nicht schon Zweckrationalität, die zureichenden Bedingungen<br />
der Möglichkeit <strong>des</strong> Wollens als vernünftigen Handlungsbewußtseins darstellen.<br />
Auch wenn wir dieses Bedingungsverhältnis einmal voraussetzen, müssen<br />
wir noch fragen, ob es sich dabei nicht um ein analytisches Verhältnis handelt:<br />
Inwiefern ist der Begriff <strong>des</strong> Wollens als vernünftigen Handlungsbewußtsein<br />
vermitteln<strong>des</strong> und begründen<strong>des</strong> Drittes für die Idee der Freiheit und die Verknüpfung<br />
von Subjekts- und Prädikatsbegriff im Sittengesetz? Er muß mehr<br />
leisten als der Begriff der Freiheit selbst, da Freiheit und Sittengesetz „Wechselbegriffe“<br />
sind. 35 Wenn er nicht mehr leisten könnte, als diese beiden Begriffe,<br />
so liefe das auf einen | ähnlichen Zirkel hinaus, als wollten wir den Grund<br />
für die synthetischen Urteile a priori schon darin erblicken, daß sie die reinen<br />
Verstan<strong>des</strong>gesetze seien. Dies ist offenbar genau der Verdacht, den Kant vor<br />
seinem endgültigen <strong>Deduktion</strong>sversuch ausräumen zu müssen meint:<br />
„Es zeigt sich hier, man muß es frei gestehen, eine Art von Cirkel, aus dem,<br />
wie es scheint, nicht heraus zu kommen ist. Wir nehmen uns in der Ordnung<br />
der wirkenden Ursachen als frei an, um uns in der Ordnung der Zwecke unter<br />
sittlichen Gesetzen zu denken, und wir denken uns nachher als diesen<br />
Gesetzen unterworfen, weil wir uns die Freiheit <strong>des</strong> Willens beigelegt haben<br />
... „ 36<br />
Was somit noch nicht gezeigt werden muß, ist dies, daß das Prinzip der Möglichkeit<br />
<strong>des</strong> Wollens als vernünftigen Handlungsbewußtseins wirklich als ein<br />
Drittes fungieren kann, <strong>des</strong>sen Bedingungen die Idee der Freiheit und die Gültigkeit<br />
<strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> sind, und das doch selbst noch etwas anderes und<br />
möglichst Unbestritteneres ist als diese beiden Begriffe. Um das Problem noch<br />
einmal deutlich mit den Worten Kants zu bezeichnen: Wir müssen den „Ver-<br />
34 Eine besondere Form solcher Zweckrationalität stellt nach der Kantischen Religionsphilosohie die ‚Bösartigkeit‘<br />
der menschlichen Natur dar, die das moralische Gesetz selbst nur dazu benutzt, „um in die Triebfedern<br />
der Neigung unter dem Namen Glückseligkeit Einheit der Maximen“ zu bringen (vgl. VI 36 ff.; s. auch<br />
u. S. 154).<br />
35 Vgl. IV 450‚23-29.<br />
36 Vgl. IV 450‚18-23.<br />
139<br />
dacht“ ausräumen, „daß wir ... vielleicht die Idee der Freiheit nur um <strong>des</strong> sittlichen<br />
Gesetzes willen zum Grunde legen“. 37 Um jenes von der Freiheit wohlunterschiedenen<br />
Dritten willen müssen wir uns dem Sittengesetz unterworfen<br />
denken.<br />
Das in der theoretischen Philosophie angesetzte Dritte, die Möglichkeit der<br />
Erfahrung, könnte seine Begründungsfunktion nicht erfüllen, wenn es (in rationalistischer<br />
Manier) auf den bloßen Verstand reduziert werden könnte oder<br />
wenn es (nach der Vorstellung <strong>des</strong> Empiristen) auf bloße Sinnlichkeit und ihre<br />
allenfalls formallogische Regulation reduzierbar wäre. Seine (eigens nachzuweisende)<br />
Leistungsfähigkeit beruht gerade auf seiner Funktion, die beiden heterogenen<br />
Erkenntnisquellen miteinander in Beziehung zu setzen. Die transzendentale<br />
<strong>Deduktion</strong> der Kategorien und die Analytik der Grundsätze führen<br />
<strong>des</strong>halb den Nachweis, daß Erfahrung nur möglich ist, wenn<br />
„zu den Anschauungen der Sinnenwelt Begriffe <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong>, die für sich<br />
selbst nichts als gesetzliche Form überhaupt bedeuten, hinzu kommen und<br />
dadurch synthetische Sätze a priori, auf welchen alle Erkenntniß einer Natur<br />
beruht, möglich machen“. 38<br />
So rekapituliert Kant seine theoretische Grundüberlegung anläßlich seiner<br />
‚<strong>Deduktion</strong>‘ <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong>, um die Analogie zwischen beiden <strong>Deduktion</strong>sgedanken<br />
deutlich zu machen.<br />
In dem Aufweis einer Verknüpfung von zwei heterogenen ‚Ausgangspunkten‘<br />
| besteht nun genau die Problementfaltung, durch die Kant im dritten Abschnitt<br />
der ‚Grundlegung‘ den Zirkelverdacht ausräumen und die Möglichkeit<br />
eines kategorischen Imperativs zu rechtfertigen versucht. 39 Zitieren wir den<br />
entscheidenden und die ganze Argumentation zusammenfassenden Satz, der<br />
gleich darauf als „Deduction“ bezeichnet wird 40 ‚ zunächst in seiner ganzen<br />
Länge:<br />
„Und so sind kategorische Imperativen möglich, dadurch daß die Idee der<br />
Freiheit mich zu einem Gliede einer intelligibelen Welt macht, wodurch,<br />
wenn ich solches allein wäre, alle meine Handlungen der Autonomie <strong>des</strong> Willens<br />
jederzeit gemäß sein würden, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt<br />
anschaue, gemäß sein sollen, welches kategorische Sollen einen syntheti-<br />
37 Vgl. IV 453‚3-7.<br />
38 Vgl. IV 454‚15-19; wir kommen auf den genauen Sinn dieser Formulierung noch einmal zurück (s.u.<br />
Anm. 45).<br />
39 Vgl. insbes. IV 450‚30-34 („Eine Auskunft bleibt uns aber noch übrig...“) und 453‚3-15 („Nun ist der<br />
Verdacht, den wir oben rege machten, gehoben ...“).<br />
40 Vgl. IV 454‚31.<br />
VII<br />
140
schen Satz a priori vorstellt, dadurch daß über meinen durch sinnliche Begierden<br />
afficirten Willen noch die Idee eben<strong>des</strong>selben, aber zur Verstan<strong>des</strong>welt<br />
gehörigen reinen, für sich selbst praktischen Willens hinzukommt, welcher<br />
die oberste Bedingung <strong>des</strong> ersteren nach der Vernunft enthält ...“. 41<br />
Dieser Satz (an den sich der vorher zitierte Vergleich zur theoretischen Philosophie<br />
mit „ungefähr so, wie ...“ anschließt) beginnt beinahe mit derselben<br />
Formel wie die an den ‚obersten Grundsatz‘ angeschlossene <strong>Deduktion</strong> der<br />
synthetischen Urteile a priori („Auf solche Weise sind synthetische Urteile<br />
a priori möglich ...“ - s. Anm. 15). Er gibt eine <strong>Deduktion</strong> der Möglichkeit kategorischer<br />
Imperative, grammatisch gesprochen, in zwei „dadurch daß“-<br />
Konstruktionen, wobei die erste dieser Konstruktionen die Möglichkeit <strong>des</strong><br />
synthetischen Satzes a priori zunächst einmal nur auf das ‚Zugleich‘ zweier<br />
Standpunkte zurückführt, während die zweite dieser Konstruktionen die Notwendigkeit<br />
der Verknüpfung beider Standpunkte durch ein Bedingungsverhältnis<br />
erklärt. Die erste Konstruktion erhält eine Komplikation durch einen Gedanken<br />
im Irrealis, der für den Zweck der <strong>Deduktion</strong> entbehrlich ist: Wäre ich<br />
nur Glied einer intelligiblen Welt, so würden „alle meine Handlungen der Autonomie<br />
<strong>des</strong> Willens jederzeit gemäß sein“; auf ein solches Wesen bezogen aber<br />
wäre das Sittengesetz ein analytischer Satz. 42<br />
Lösen wir den ‚irrealen‘ Einschub aus dem ersten Teil der Möglichkeitserklärung<br />
heraus, so lautet der Hauptgedanke:<br />
‚Die Idee der Freiheit macht mich zu einem Gliede einer intelligiblen Welt,<br />
wodurch, da ich mich zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue, alle meine<br />
Handlungen der Autonomie <strong>des</strong> Willens jederzeit gemäß sein sollen.‘<br />
| Die Synthetizität <strong>des</strong> kategorischen Sollens beruht also darauf, daß mein<br />
Handeln von sich aus keineswegs der Autonomie <strong>des</strong> Willens gemäß ist, weil<br />
es ein Handeln in der Sinnenwelt ist. Nun ist damit zwar die Analytizität <strong>des</strong><br />
kategorischen Sollens und indirekt auch die befürchtete Zirkelhaftigkeit ausgeschlossen<br />
43 , aber das bloße Nebeneinander der Standpunkte ergäbe doch, für<br />
sich genommen, nichts als einen schlechten Dualismus, wenn nicht ihre Verknüpfung<br />
als notwendig aufgewiesen würde.<br />
Dies nun soll offenbar die zweite ‚dadurch daß‘-Konstruktion leisten, die<br />
zunächst einmal deutlich macht, daß es in beiden Standpunkten nicht etwa um<br />
41 IV 454‚6-15.<br />
42 Vgl. z.B. IV 447‚6 f. und 452‚35-453‚2.<br />
43 Die befürchtete Zirkelhaftigkeit beruhte ja gerade darauf, daß die Tatsache, daß der Adressat <strong>des</strong> Imperativs<br />
ein Sinnenwesen ist und daher von sich aus keineswegs der Autonomie gemäß handelt, unberücksichtigt<br />
blieb.<br />
141<br />
zwei verschiedene Stücke in mir (etwa meine Freiheit einerseits und meine<br />
Handlungen andererseits) handelt, sondern um ‚ebendasselbe‘, nämlich meinen<br />
Willen, aber einerseits um ihn als einen „durch sinnliche Begierden afficirten<br />
Willen“ und andererseits um „die Idee eben<strong>des</strong>selben, aber zur Verstan<strong>des</strong>welt<br />
gehörigen reinen, für sich selbst praktischen Willens“. Die Identität<br />
<strong>des</strong> Willens unter beiden Standpunkten verhindert nun zwar das Auseinanderfallen<br />
der beiden Betrachtungsweisen, läßt aber noch nicht ein positives und<br />
notwendiges Aufeinander-bezogen-Sein gerade der unterschiedlichen Momente<br />
beider Glieder erkennen. Darauf weist erst der abschließende Relativsatz<br />
unseres Zitats, wonach der ‚reine, für sich selbst praktische Wille die oberste<br />
Bedingung meines durch sinnliche Begierden affizierten Willens nach der Vernunft<br />
enthält‘.<br />
Über den doppelten Standpunkt und die Identität <strong>des</strong> in beiden Standpunkten<br />
vorgestellten Willens hinaus haben wir es nach diesem Relativsatz einerseits<br />
mit der Behauptung eines Bedingungsverhältnisses und andererseits<br />
mit dem Zusatz „nach der Vernunft“ zu tun. In diesem Zusatz wird offenbar<br />
dem „durch sinnliche Begierden afficirten Willen“ die Aufgabe gestellt, mehr<br />
zu sein als ein bloßes „Glied der Sinnenwelt“: vielmehr (insgesamt) jener Wille,<br />
welcher in einem ‚Wollen als vernünftigem Handlungsbewußtsein‘ enthalten<br />
ist - so daß es uns „möglich ist, von seiner Vernunft bei unserem Thun und<br />
Lassen Gebrauch zu machen“. 44 Die Bedingung aber für die Erfüllung dieser<br />
Aufgabe ist der ‚reine, für sich selbst praktische Wille‘.<br />
In ähnlicher Weise ist das sinnlich affizierte Erkenntnisvermögen, ‚nach der<br />
Vernunft‘, d.h. wenn es seiner eigentlichen Aufgabe gerecht werden soll<br />
(wahrhaft Erkenntnis zu leisten), auf die nichtsinnlichen (reinen) Prinzipien<br />
<strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> angewiesen. Dies besagt der schon zitierte letzte Teil <strong>des</strong> <strong>Deduktion</strong>sabsatzes,<br />
den wir noch einmal zitieren, wobei wir zwei verdeutlichende<br />
Ausdrücke in Klammern hinzufügen:<br />
|„... ungefähr so, wie zu den Anschauungen der Sinnenwelt Begriffe <strong>des</strong><br />
Verstan<strong>des</strong>, die für sich selbst nichts als gesetzliche Form (nämlich der angeschauten<br />
Gegenstände) überhaupt bedeuten, hinzu kommen und dadurch<br />
synthetische Sätze a priori, auf welchen alle Erkenntniß einer Natur [d.i. Erfahrung)<br />
beruht, möglich machen“. 45<br />
142<br />
44 Vgl. nochmals IV 455‚34-456‚1.<br />
45 Vgl. IV 454‚15-19; es wäre ein Mißverständnis, zu meinen, daß nach dieser Formulierung nicht die Möglichkeit<br />
der Erfahrung („Erkenntniß einer Natur“), sondern „die Begriffe <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong>“ für sich genommen<br />
schon synthetische Sätze a priori möglich machten: Die Verstan<strong>des</strong>begriffe ermöglichen, genau besehen,<br />
vielmehr auch nach diesem Text die Erfahrung, welche (ihrem Vollbegriff nach) eben darin besteht, daß<br />
VIII
Wir wollen nun nicht sogleich fragen, ob diese <strong>Deduktion</strong> uns völlig zufriedenstellt,<br />
sondern nur noch einmal zwei Interpretationsbedingungen hervorheben,<br />
ohne welche schon die ganze <strong>Deduktion</strong>sstruktur (und nicht erst ihr<br />
begrifflicher Inhalt) zusammenbrechen würde: Erstens, weder die Idee der<br />
Freiheit noch der Gedanke einer intelligiblen Welt kann die Funktion jenes<br />
‚Dritten‘ übernehmen, welches die synthetisch-praktischen Sätze möglich<br />
macht. Uns als frei zu denken, bedeutet ja nichts anderes, als uns in die Verstan<strong>des</strong>welt<br />
als deren Glieder zu versetzen; und dies läßt uns zwar „die Autonomie<br />
<strong>des</strong> Willens sammt ihrer Folge, der Moralität“ erkennen 46 , aber nur im<br />
Sinne einer Begriffszergliederung. Das heißt: wollten wir daraus allein unsere<br />
Verpflichtung durch das Sittengesetz ableiten, so kämen wir über den Zirkel<br />
nicht hinaus. Denn der Verpflichtungsgedanke enthält eben mehr als das bloße<br />
Sich-Hineinversetzen in die Verstan<strong>des</strong>welt. 47<br />
Die zweite Interpretationsbedingung, die wir vor allem auch im Hinblick auf<br />
spätere Äußerungen Kants im Auge behalten müssen, ist die, daß wir auf keinen<br />
Fall den ‚durch sinnliche Begierden affizierten Willen ... nach der Vernunft‘,<br />
den wir wohl auch als „eine Vernunft, die praktisch ist“ 48 bezeichnen<br />
können, schon mit der ‚reinen praktischen Vernunft‘ oder dem „für sich selbst<br />
praktischen Willen“ identifizieren dürfen, so wenig wir eine „oberste Bedingung“<br />
mit dem durch sie Bedingten identifizieren dürfen. Nur unter diesen<br />
beiden Interpretationsbedingungen halten wir das einen kategorischen Imperativ<br />
ermöglichende Dritte wirklich als Drittes fest.<br />
| Auch und gerade wenn wir diese Interpretationsbedingungen festhalten,<br />
ist freilich die Frage noch nicht beantwortet, wieso denn eigentlich der reine<br />
Wille eine Bedingung <strong>des</strong> ‚sinnlich affizierten Willens nach der Vernunft‘ sei<br />
(und warum nicht bloße Zweckrationalität ausreiche). 49 - Auch diese ‚Dedukti-<br />
die Verstan<strong>des</strong>begriffe „zu den Anschauungen der Sinnenwelt .. . hinzu kommen“; und erst die Tatsache,<br />
daß durch dieses ‚Hinzukommen‘ Erfahrung ermöglicht wird, ist der Grund der Möglichkeit der synthetischen<br />
Sätze a priori. - Freilich läßt sich nicht leugnen, daß in dieser Formulierung die ‚Möglichkeit der Erfahrung‘<br />
als Problemprinzip nicht sehr deutlich hervortritt und daß dieser Undeutlichkeit wohl auch eine<br />
gewisse Undeutlichkeit in der Formulierung <strong>des</strong> praktischen Analogons entspricht.<br />
46 Vgl. IV 453‚12 f.<br />
47 Vgl. die Fortsetzung unseres letzten Zitats, die mit einem „aber“ nicht etwa bloß den anderen Standpunkt,<br />
sondern das „zugleich“ der beiden Standpunkte anführt, um den Zirkelverdacht zu heben: „... denken<br />
wir uns aber als verpflichtet, so betrachten wir uns als zur Sinnenwelt und doch zugleich zur Verstan<strong>des</strong>welt<br />
gehörig.“ (ebda. Z. 14 f.).<br />
48 Vgl. nochmals IV 448‚11 und den oben, S. 137, besprochenen Textzusammenhang dieser Stelle.<br />
49 Für die Begründung dieses Bedingungsverhältnisses stellt uns Kant allenfalls Hinweise auf zwei analoge,<br />
aber höchst unterschiedliche, Bedingungsverhältnisse aus dem Bereich der theoretischen Philosophie zur<br />
143<br />
on‘ stellt eher ein <strong>Deduktion</strong>sprogramm als <strong>des</strong>sen Durchführung dar. Mit ihr<br />
sind wir daher in der praktischen Philosophie noch nicht weiter, als wir auch<br />
in der theoretischen Problematik nach der bloßen Betrachtung der von uns als<br />
<strong>Deduktion</strong>sformel bezeichneten Identifikation der Bedingungen der Möglichkeit<br />
der Erfahrung mit den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungsgegenstände<br />
waren. Auch jener Formel konnten wir noch nicht entnehmen, wieso<br />
denn eigentlich die behaupteten Bedingungsverhältnisse stattfinden.<br />
Freilich steht uns in der praktischen Philosophie bisher nicht einmal jenes<br />
(im Theoretischen doch wenigstens eine Erklärung andeutende) Verhältnis<br />
von Problemprinzip und Referenzprinzip zur Verfügung. Und so sehr wir<br />
immer wieder auch Spuren der die theoretische <strong>Deduktion</strong> bestimmenden<br />
modaltheoretischen Struktur entdecken können: So unmittelbar zum Thema<br />
wie etwa im Kapitel über den obersten Grundsatz macht Kant die ‚Möglichkeit<br />
<strong>des</strong> Wollens als vernünftigen Handlungsbewußtseins‘ in der praktischen<br />
Philosophie nirgends; ja, es fiel uns sogar nicht ganz leicht, überhaupt einen zu<br />
allen andeutenden Formulierungen passenden Terminus zu finden.<br />
Kants eigene Ausdrücke sprachen etwa von dem ‚durch sinnliche Begierden<br />
affizierten Willen nach der Vernunft‘ oder dem Vermögen, „von seiner<br />
Vernunft bei unserem Thun und Lassen Gebrauch zu machen.“ 50 Ein ebenso<br />
denkbarer Ausdruck wäre die Möglichkeit <strong>des</strong> ‚praktischen Gebrauchs der<br />
menschlichen Vernunft‘, wiederum als Prinzip betrachtet. Die alltägliche Konkretion<br />
dieses Prinzips wäre „der praktische Gebrauch der gemeinen Menschenvernunft“,<br />
von der Kant nun in dem auf die besprochene <strong>Deduktion</strong><br />
folgenden Absatz behauptet: Er „bestätigt die Richtigkeit dieser Deduction“. 51<br />
Man hat festgestellt, daß Kant in diesem Satz einerseits beanspruche, eine <strong>Deduktion</strong><br />
geleistet zu haben, von der er doch später, in der KdpV, allem Anschein<br />
nach behauptet, sie sei nicht möglich; daß aber andererseits der nun folgende<br />
Absatz, welcher diesen ersten | Satz erläutert, auf nichts anderes hinauslaufe<br />
als jenes ‚Bewußtsein <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong>‘, welches nach der KdpV „ein<br />
Verfügung: einerseits darauf, daß der ‚Sinnenwelt‘ der Erscheinungen die ‚Verstan<strong>des</strong>welt‘ der Dinge an sich<br />
zugrunde liege (vgl. IV 450‚37-451‚36), andererseits darauf, daß die Verstan<strong>des</strong>begriffe (Kategorien) Bedingungen<br />
der Möglichkeit der Naturerkenntnis (Erfahrung) seien (vgl. nochmals IV 454‚15-19). Keine der<br />
beiden Analogien scheint uns schon die entscheidende Behauptung zu rechtfertigen, daß (in praktischer Hinsicht)<br />
„Die Verstan<strong>des</strong>welt den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Gesetze derselben enthält“ (vgl. IV<br />
453, 31-33)<br />
50 Vgl. nochmals IV 455‚34-456‚1.<br />
51 Vgl. IV 454‚20 f.<br />
IX<br />
144
Faktum der Vernunft“ zu nennen ist, um <strong>des</strong>sentwillen das moralische Gesetz<br />
„selbst keiner rechtfertigenden Gründe bedarf“ 52 .<br />
Wir wollen jedoch, wie oben schon angekündigt, weniger die Frage nach<br />
dem Motiv für das Umdenken Kants in der <strong>Deduktion</strong>sproblematik stellen,<br />
sondern eher die Frage, was uns die Darstellung <strong>des</strong> ‚praktischen Gebrauchs<br />
der gemeinen Menschenvernunft‘ in der ‚Grundlegung‘ über das Verhältnis<br />
zwischen dem ‚durch sinnliche Begierden affizierten Willen‘ und dem ‚reinen,<br />
für sich selbst praktischen Willen‘ sagt, wobei wir vier Gedanken herausgreifen:<br />
Indem Kant sozusagen vom ‚ungünstigsten‘ Fall <strong>des</strong> ‚ärgsten Bösewichts‘<br />
ausgeht, behauptet er erstens, daß dieser trotz aller seiner Boshaftigkeit, wenn<br />
man ihm Beispiele der Sittlichkeit vorlegen würde, „wünsche, daß er auch so<br />
gesinnt sein möchte“ 53 ; zweitens, daß in diesem Wunsche ein Wille, „der von<br />
allen Antrieben der Sinnlichkeit frei ist“ (und durch den er sich in eine intelligible<br />
Welt versetze), zum Ausdruck komme 54 ; drittens, daß er sich demnach<br />
„eines guten Willens bewußt ist, der für seinen bösen Willen als Glie<strong>des</strong> der<br />
Sinnenwelt ... das Gesetz ausmacht“ 55 und viertens:<br />
„Das moralische Sollen ist also eigenes nothwendiges Wollen als Glie<strong>des</strong> einer<br />
intelligibelen Welt und wird nur so fern von ihm als Sollen gedacht, als er<br />
sich zugleich wie ein Glied der Sinnenwelt betrachtet.“ 56<br />
Das Gemeinsame dieser vier Gedanken ist die Auslegung <strong>des</strong> Verpflichtungsmomentes<br />
im moralischen Bewußtsein (<strong>des</strong> Sollens) als eines Wollens (bzw., sofern<br />
es irreal bleibt: eines Wünschens), im letzten Zitat sogar als eines notwendigen<br />
Wollens. In dem zuerst genannten Gedanken kommt darüber hinaus<br />
zum Ausdruck‚ daß dieses Wollen bzw. Wünschen sich nicht auf irgendwelche<br />
Gegenstände, sondern auf die eigene Gesinnung (mithin das eigene habituelle<br />
Wollen in Handlungsmaximen) bezieht, in dem dritten Gedanken wird das<br />
52 Vgl. V 31‚24 und insbes. 32‚1 ff. sowie 47‚11-15 und 47‚28; vgl. auch D. Henrich, Die <strong>Deduktion</strong>..., S. 99<br />
f.: Danach „entfaltet sich das Programm der zweiten Kritik im wesentlichen in Übereinstimmung mit dem<br />
Argument, das Kants ‚Grundlegung‘ wirklich gegeben hat, wenn auch im Gegensatz zu der Selbstdarstellung,<br />
die in ihr dominant ist.“<br />
53 Vgl. IV 454‚21-26.<br />
54 Vgl. ebda. Z. 29-37.<br />
55 Vgl. IV 455‚4-6; man muß sich klarmachen, daß hier nicht bloß vom Begriff <strong>des</strong> guten Willens die Rede ist<br />
(der ja den Begriff <strong>des</strong> reinen Willens bzw. der Autonomie noch nicht enthält), sondern vom ‚Gegenstand‘<br />
dieses Begriffs, dem guten Willen selbst, welcher auch durch die ‚Bedingungen seiner Möglichkeit‘, und d.h.<br />
seine synthetischen Prädikate, bestimmt ist. Es ist ja eine der Grundeinsichten der Kantischen Philosophie,<br />
daß der Inhalt eines Begriffs die Bestimmtheiten seines Gegenstan<strong>des</strong>, auch sofern sie ihm a priori zukommen,<br />
keineswegs erschöpft.<br />
56 IV 455‚7-9.<br />
Verhältnis zwischen | dem guten Willen (mit dem man nun offenbar schon den<br />
Begriff der Autonomie verbinden muß, so daß der gute Wille den reinen Willen<br />
als Bedingung enthält) und dem Willen als Glied der Sinnenwelt auch unter<br />
der Voraussetzung eines bösen Willens als ein Verhältnis von Gesetz und Fall<br />
eines Gesetzes gedacht. - Wir werden später auf diese zuletzt hervorgehobenen<br />
Momente <strong>des</strong> Verhältnisses, das im Sollen enthaltene Wollen (a), die Beziehung<br />
dieses Wollens auf das eigene (handlungsbestimmende) Wollen (b)<br />
und die Subsumption selbst <strong>des</strong> bösen Willens unter dieses gesetzliche Wollen<br />
(c) zurückkommen und darin einen Ansatz für die Aufsuchung jenes Verhältnisses<br />
der ‚Referenz‘ (zwischen Problemprinzip und Referenzprinzip) in der<br />
praktischen Philosophie finden (s.u. S. 159 ff.).<br />
In unseren Überlegungen zur theoretischen Philosophie hatten wir oben<br />
das Gespräch zwischen Kant und seinem empiristischen Kritiker an der Stelle<br />
abgebrochen, an welcher der Empirist dem Vorschlag Kants, die Möglichkeit<br />
der Erfahrung als Ermöglichungsgrund für synthetische Urteile a priori anzusehen,<br />
seinen (schlichten) Begriff von Erfahrung entgegengehalten hatte. -<br />
Stellen wir uns nun vor, Kant habe nach einer Unterbrechung <strong>des</strong> Gesprächs<br />
zunächst einmal seine Gedanken zu den Grundlagen der praktischen Philosophie<br />
bis zu dem Punkte vorgetragen, an den auch wir zuletzt gelangt sind, so<br />
könnte der Empirist nun wiederum einwenden:<br />
‚Würde man mir nachweisen, daß jener reine Wille, der offenbar das moralische<br />
Gesetz der Autonomie enthalten soll, wirklich die oberste Bedingung<br />
und das Gesetz auch für einen sinnlich affizierten Willen (natürlich sofern er<br />
von Vernunft Gebrauch macht) darstelle, so wollte ich dieser <strong>Deduktion</strong> gerne<br />
folgen. Allein nach meinen Begriffen gehört zu einem solchen Willen nichts<br />
weiter, als einerseits, daß er sich Zwecke setzt, die ihre Quelle wohl letztlich in<br />
seinen sinnlichen Bedürfnissen haben, und andererseits, daß er mithilfe seiner<br />
Vernunft die zu diesen Zwecken gehörigen Mittel findet und darüber hinaus<br />
auf die Vereinbarkeit aller seiner Zwecke achtgibt. Vernunft ist ein Vermögen<br />
zu schließen und praktische Vernunft ein Vermögen zu praktischen Schlüssen,<br />
gewiß nicht nur zu einzelnen, sondern zu einem ganzen Zusammenhang solcher<br />
Schlüsse, die <strong>des</strong>halb wohl auch zu einem System von Zwecken führen mögen.<br />
Und weil es gewisser Anstrengungen bedarf, um alle Zwecke, die man<br />
haben mag, miteinander in Übereinstimmung zu bringen, läßt sich hier auch<br />
von einem ‚Sollen‘ und von ,Normen‘ <strong>des</strong> Wollens und Handelns sprechen.<br />
Aber was sollte die oberste Bedingung all dieses Wollens und <strong>des</strong>halb auch<br />
Sollens anderes sein als dasjenige, was man ohnehin schon in allen einzelnen<br />
Zwecksetzungen will, nämlich die Vereinbarkeit aller seiner Zwecke zur<br />
X<br />
145
Glückseligkeit. Dieser umfassende Gegenstand all unsers Wollens ist das oberste<br />
Gut; und warum sonst sollten wir einen Menschen und seinen Willen<br />
gut nennen, als darum, weil er diesen Gegenstand für sich und für andere - je<br />
mehr um so besser - verwirklichen will. Ich sehe keinen Sinn darin, statt auf<br />
den Gegenstand nun noch auf ein anderes Wollen, gar auf einen | ‚reinen‘ Willen,<br />
der in einer ganz anderen Welt angesiedelt wäre, als Bedingung und Gesetz<br />
eines vernünftigen Wollens zurückzugreifen. Kurz, mir reichen als Bedingungen<br />
vernünftigen Wollens und Handelns gegenständlicher Zweck, sinnliche<br />
Bedürfnisse (als Quelle dieses Zwecks) und Vernunft (als Vermögen zu<br />
logischen Operationen mit diesen Gegebenheiten) völlig aus.‘<br />
3. Transzendentale Einheit in der theoretischen Philosophie<br />
Nehmen wir an, Kant habe zunächst versichert, daß er wiederum mit allen positiven<br />
Feststellungen durchaus einverstanden sei, und an dieser Stelle das Gespräch<br />
wieder auf die theoretische Problematik zurückgelenkt. Die vorher angeführte<br />
,<strong>Deduktion</strong>sformel‘ für die synthetischen Urteile a priori enthielt in<br />
einer wichtigen Hinsicht schon mehr als der soeben referierte praktische <strong>Deduktion</strong>sgedanke<br />
der ‚Grundlegung‘: Er enthielt nicht nur ein ‚Drittes‘, das die<br />
Synthesis jener Urteile vermitteln sollte (das Problemprinzip der möglichen<br />
Erfahrung), sondern auch die Beziehung auf ein anderes, die Möglichkeit der<br />
Gegenstände der Erfahrung (das Referenzprinzip). Der Schritt vom Problemprinzip<br />
zum Referenzprinzip macht, falls die Bedingungen beider Prinzipien<br />
wirklich identisch sind, die Vermittlungsfunktion <strong>des</strong> Problemprinzips allererst<br />
verständlich. Aber eben diese Identität konnte der Empirist noch keineswegs<br />
akzeptieren.<br />
Denken wir uns, Kant habe die Zustimmung <strong>des</strong> Empiristen für den trivialen<br />
Satz erhalten, daß alles, was man sich denken könne, sei es Subjektives oder<br />
Objektives, eines sein müsse, Einheit haben müsse. Er knüpfe nun an die Bemerkung<br />
<strong>des</strong> Empiristen an, daß Erfahrung doch etwas Subjektives sei. Doch<br />
mache er darauf aufmerksam, daß sie keineswegs Sache eines einzigen Augenblicks<br />
und gar eines einzigen sinnlichen Eindrucks sei; und nun mag sich der<br />
Leser vorstellen, wie Kant Schritt für Schritt den Grundgedanken seiner transzendentalen<br />
<strong>Deduktion</strong> der Kategorien entfaltet.<br />
146<br />
Dieser Grundgedanke nimmt, wie gerade angedeutet, seinen Ausgang (vor<br />
allem in der Darstellung der 2. Auflage der KdrV) von einem Prinzip der Einheit,<br />
die Kant auch als qualitative Einheit bezeichnet und die schon den ersten<br />
Platz in der ‚Transzendentalphilosophie der Alten‘ eingenommen hat 57 . Kant<br />
weist nach, daß nicht einmal das ‚Allersubjektivste‘ <strong>des</strong> Erfahrungsbewußtseins,<br />
nämlich die „analytische Einheit der Apperception“ ohne die „Voraussetzung<br />
irgendeiner synthetischen möglich“ sei 58 , und führt zunächst zum ‚obersten<br />
Grundsatz der | Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf den Verstand‘:<br />
„... daß alles Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen der<br />
urspünglich-synthetischen Einheit der Apperception stehe“. 59<br />
Dieser sei ein ‚analytischer Satz‘, erkläre „aber doch eine Synthesis <strong>des</strong> in einer<br />
Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als nothwendig“. 60 - Weitere Schritte<br />
der <strong>Deduktion</strong> bestehen in dem Nachweis, daß die Synthesis nur „in einem<br />
Begriff vom Object“ möglich sei 61 und daß sie als solche im Urteil geschehe,<br />
welches „nichts andres sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objectiven<br />
Einheit der Apperception zu bringen“. 62 Die ‚subjektive‘ Entscheidung, wodurch<br />
ich irgendeine Vorstellung unter dem Titel ‚Ich denke‘ mir zurechne, zu<br />
meiner Vorstellung mache, wird demnach ermöglicht durch den Objektbezug<br />
eines Urteils. Dies führt schließlich zu einer ersten Rechtfertigung der Kategorien,<br />
denn diese sind<br />
„nichts andres, als eben diese Functionen zu urtheilen, so fern das Mannigfaltige<br />
einer gegebenen Anschauung in Ansehung ihrer bestimmt ist ... Also<br />
steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung nothwendig unter<br />
Kategorien.“ 63<br />
Wir müssen hier nicht noch die weiteren Schritte der transzendentalen <strong>Deduktion</strong><br />
der Kategorien (in ihrem zweiten, die universale Erkenntnisfunktion der<br />
Kategorien nachweisenden Teil) im einzelnen referieren; für den späteren Vergleich<br />
mit der praktischen Problematik genügt deren Ergebnis:<br />
57 Vgl. B 131; III 108‚11-15 und den § 12 der 2. Auflage, B 113 ff.; III 97-99; vgl. hierzu auch K. Bärthlein,<br />
Von der „Transzendentalphilosophie“ der Alten..., S. 384 ff.<br />
58 Vgl. B 133; III 109‚23-25.<br />
59 Vgl. B 136; III 111‚7-9.<br />
60 Vgl. B 135; III 110‚19-23.<br />
61 Vgl. B 137 ff., insbes. B 139; III 113‚3-9.<br />
62 Vgl. B 141; III 114‚7 f.<br />
63 B 143; III 115‚15-18.<br />
XI<br />
147
„...so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung und<br />
gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung.“ 64<br />
Schon hier also sind Erfahrung und Erfahrungsgegenstände in jene Relation<br />
gebracht, welche allein die spätere Identifikation der Bedingungen <strong>des</strong> einen<br />
(<strong>des</strong> Problemprinzips) und der Bedingungen <strong>des</strong> anderen (<strong>des</strong> Referenzprinzips)<br />
rechtfertigen kann: Die Bedingungen <strong>des</strong> (subjektiven) Problemprinzips<br />
sind ihrerseits nicht (schlicht) subjektive Bedingungen, sondern gültige begriffliche<br />
Bestimmungen der Objekte und insofern identisch mit den (notwendiger<br />
Weise) zu denkenden Bestimmtheiten der Gegenstände.<br />
| Für unsere Problematik (und die Fragen <strong>des</strong> Empiristen) entscheidend ist<br />
bei alledem der Nachweis, daß jene scheinbar bloß subjektive Möglichkeit der<br />
Erfahrung, um auch nur das Allersubjektivste, die analytische Einheit <strong>des</strong><br />
Selbstbewußtseins (gegenüber der Mannigfaltigkeit der Anschauungen), zu<br />
wahren, einer synthetischen Einheit der Gegenstandsbestimmung in diesem<br />
Selbstbewusstsein bedarf, welche nur durch reine, den Urteilsfunktionen entstammende<br />
Begriffe von Gegenständen möglich ist.<br />
Es könnte uns erstaunen, daß Kant dem Problemprinzip der möglichen<br />
Erfahrung mit dem Prinzip der synthetischen Einheit einen Begriff sozusagen<br />
als ‚Lösungsprinzip‘ beigesellt, der jener ,Transzendentalphilosophie der Alten‘<br />
entnommen ist, von der er sonst nicht gerade mit Hochachtung spricht. 65<br />
Doch geht der Gebrauch, den Kant von diesem Begriff macht, offensichtlich<br />
weit über den ‚kümmerlichen‘ Gebrauch, den die Tradition von ihm machte,<br />
hinaus. Insbesondere Kants Unterscheidung der analytischen und der synthetischen<br />
Einheit <strong>des</strong> Selbstbewußtseins, die Herausarbeitung der synthetischen<br />
Einheit als Bedingung der analytischen Einheit und schließlich die Verknüpfung<br />
<strong>des</strong> Begriffs der synthetischen Einheit mit dem der objektiven Einheit<br />
<strong>des</strong> Selbstbewußtseins, welche den Begriff der Einheit in eine prinzipientheoretische<br />
Relation zu dem der Wahrheit, also dem zweiten Prinzip der ‚Transzendentalphilosophie<br />
der Alten‘ setzt, sind Kants eigene Leistung und die<br />
Voraussetzungen dafür, daß diese Prinzipien eine Funktion in Kants eigener<br />
Transzendentalphilosophie übernehmen können.<br />
64 Vgl. B 161; III 125‚14-16. - Zur Interpretation dieses zweiten Teils der transzendentalen <strong>Deduktion</strong> vgl.<br />
die Auseinandersetzung Hans Wagners mit der Analyse D. Henrichs: H. Wagner, Der Argumentationsgang<br />
in Kants <strong>Deduktion</strong> der Kategorien, in: Kant-Stud. 71, 1980, S. 352-366 sowie die Beiträge beider Autoren<br />
und weiterer Diskussionsteilnehmer zu: Die Beweisstruktur der transzendentalen <strong>Deduktion</strong> der reinen<br />
Verstan<strong>des</strong>begriffe - eine Diskussion mit Dieter Henrich, in: Probleme der „Kritik der reinen Vernunft“,<br />
Kant-Tagung Marburg 1981, hrsg. v. B. Tuschling, S. 34-96 (dort auch weitere Lit.-Hinweise).<br />
65 Vgl. insbes. B 113; III 97‚24-33.<br />
148<br />
In der Erklärung der synthetischen Einheit <strong>des</strong> Selbstbewußtseins als einer<br />
objektiven Einheit <strong>des</strong> Selbstbewusstseins(65) und der darauf beruhenden<br />
Notwendigkeit von Urteilfunktionen und Kategorien in einer jeden Erfahrung<br />
liegt letztlich der Grund dafür, daß Kant die Bedingungen <strong>des</strong> Problemprinzips<br />
mit denen <strong>des</strong> Referenzprinzips identifizieren kann. Denn die objektive<br />
Einheit der Apperzeption ist eben nur dadurch möglich, daß den erfahrenen<br />
Gegenständen selbst in reinen Gegenstandsbegriffen oder Kategorien eine<br />
synthetische Einheit zugedacht wird.<br />
Um seinem Gesprächspartner nun auch die reinen Verstan<strong>des</strong>grundsätze als<br />
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung vorzustellen, könnten wir Kant<br />
mit der Erläuterung <strong>des</strong> ‚obersten Grundsatzes alles synthetischen Urteile‘ beginnen<br />
lassen:<br />
„... ein jeder Gegenstand steht unter den nothwendigen Bedingungen der<br />
synthetischen Einheit <strong>des</strong> Mannigfaltigen der Anschauung in einer möglichen<br />
Erfahrung.“ 66<br />
Welches diese Bedingungen sind, wissen wir schon aus der transzendentalen<br />
Dededuktion der Kategorien; und die an den ‚obersten Grundsatz‘ anschließende,<br />
oben | (S. 133, Anm. 15) schon zitierte, ‚<strong>Deduktion</strong>‘ der synthetischen<br />
Urteile a priori macht in ihrem einleitenden ‚wenn‘-Satz deutlich, daß dieser<br />
Grundsatz zugleich auch eine Art Zusammenfassung der transzendentalen<br />
<strong>Deduktion</strong> der Kategorien enthält: Denn nur durch die letzteren erhält die auf<br />
„die formalen Bedingungen der Anschauung a priori“ zurückbezogene „Synthesis<br />
der Einbildungskraft ... nothwendige Einheit“. Die reinen Verstan<strong>des</strong>grundsätze<br />
als synthetische Urteile a priori aber sind nichts anderes als die Artikulation<br />
der ursprünglichen Anwendung reiner Gegenstandsbegriffe auf empirische<br />
Anschauungen. Und <strong>des</strong>halb können nun, wie die berühmte ‚<strong>Deduktion</strong>sformel‘<br />
behauptet, die Bedingungen jenes subjektiven Problemprinzips<br />
(der Möglichkeit der Erfahrung) und jenes objektiven Referenzprinzips (der<br />
Möglichkeit der Erfahrungsgegenstände) identisch sein, weil sie Urteile (und<br />
Begriffe) sind, in denen dem Gegenstand der Erfahrung etwas zugedacht wird. Sie<br />
sind insofern die ursprüngliche und notwendige Entfaltung <strong>des</strong> zweiten Transzendentalienbegriffs,<br />
<strong>des</strong> Prinzips der Wahrheit.<br />
Für unsere späteren Überlegungen wichtig ist es im übrigen, daß sowohl<br />
Kants Begriff der transzendentalen Einheit als auch der hier vorauszusetzende<br />
Begriff der ‚transzendentalen Wahrheit‘, die nach einer Bemerkung <strong>des</strong> Schematismuskapitels<br />
eben ‚in der allgemeinen Beziehung auf mögliche Erfahrung<br />
66 Vgl. B 197; III 145‚26-29.<br />
XII<br />
149
esteht‘ und „die vor aller empirischen vorhergeht und sie möglich macht“ 67 ,<br />
über Kants eigene ‚harmlose‘, formallogische Interpretation der Transzendentalien<br />
in § 12 der 2. Auflage der KdrV hinausgehen: Sie implizieren jene formallogischen<br />
Begriffe, erschöpfen sich aber nicht in ihnen.<br />
Wir können die gesamte transzendentale <strong>Deduktion</strong> der Kategorien zusammen<br />
mit der Rechtfertigung der synthetischen Urteile a priori als eine Entfaltung<br />
<strong>des</strong> Prinzips <strong>des</strong> Denkens überhaupt zu einer besonderen Funktion <strong>des</strong><br />
Denkens auffassen, insofern nämlich Denken eine Wahrheit produzierende<br />
Leistung darstellt. Denken leistet demgemäß ein Doppeltes: Es stellt erstens die<br />
(analytische und synthetische) Einheit <strong>des</strong> Subjekts her, so daß in jedem Akt<br />
<strong>des</strong> Denkens wirklich ich es bin, welcher dieses oder jenes denkt, und sich alle<br />
Gehalte <strong>des</strong> Denkens zusammenschließen unter dem Gedanken ‚Ich denke‘.<br />
Dies erste aber ist, wenn das Denken speziell den Sinn ‚Ich behaupte, erkenne,<br />
weiß wirklich dies (und habe nicht bloß einmal diesen und einmal jenen Einfall)‘<br />
haben soll, nur möglich, wenn das Denken zweitens für uns die Einheit <strong>des</strong><br />
gedachten Gegenstan<strong>des</strong> herstellt, so daß uns nicht nur subjektive Zustandsfolgen,<br />
sondern wahrhaft Gegenstände in der Erfahrung gegeben sein können.<br />
4. Transzendentale Einheit und praktische Geltung<br />
in Kants moralphilosophischem Denken<br />
Kehren wir nun wieder zum Grundproblem der praktischen Philosophie zurück,<br />
so ist von vornherein klar, daß das zweite der eben genannten Momente<br />
ein spezifisch zur Theorie gehöriges darstellt, während das erste, die analytische<br />
und synthetische Einheit <strong>des</strong> Subjekts, offensichtlich nicht nur für das<br />
theoretische, sondern auch für das praktische Selbstbewußtsein notwendig ist:<br />
Zwar ist die Form <strong>des</strong> Denkens (in einem ausreichend weiten Sinne von Denken)<br />
nun nicht mehr die <strong>des</strong> ‚Ich behaupte, erkenne, weiß ..., daß ... ‘, sondern<br />
die <strong>des</strong> ‚Ich will, daß ... ‘ bzw. ‚Ich will dies oder jenes tun‘ (unter Umständen<br />
auch: ‚Ich wünsche, daß ...). Aber auch in dieser Hinsicht ist es notwendig, daß<br />
ich es bin, der in jedem praktischen Bewußtsein will, und daß die Akte <strong>des</strong><br />
praktischen Bewußtseins in einem Bewußtsein zu vereinigen sind. Wie im Theoretischen<br />
so mag ich auch im Praktischen meine Entscheidungen mitunter<br />
korrigieren. Aber selbst dies ist schon eine Folge <strong>des</strong> Prinzips der syntheti-<br />
67 Vgl. B 185; III 139‚7-10; vgl. auch B 196 f.; III 145‚21-25.<br />
150<br />
schen Einheit meiner Akte, deren Gehalte als zu einem kompatiblen System<br />
zusammengeschlossen gedacht werden müssen, wenn ich wahrhaft ‚Ich will,<br />
daß ...‘ sagen können soll.<br />
Das erstgenannte Moment der synthetischen Einheit würde Kant in der<br />
transzendentalen <strong>Deduktion</strong> der Kategorien noch nicht ans Ziel gelangen lassen,<br />
wenn er nicht nachweisen könnte, daß das zweite Moment eine notwendige<br />
Bedingung <strong>des</strong> ersten sei. Er hätte sonst dem Empiristen noch nicht bewiesen,<br />
daß zur Erfahrung und dem darin enthaltenen Selbstbewußtsein mehr<br />
gehöre als empirische Anschauung und deren Verbindung nach formallogischen<br />
Regeln. Enthält auch die praktische Philosophie das Problem der synthetischen<br />
Einheit und gibt es auch in ihr einen Grund, über eine bloß logische<br />
Einheit der Gehalte (<strong>des</strong> Wollens) hinauszugehen? Die Frage nach einer<br />
Einheit, die mehr ist, als eine bloß formallogische Einheit, scheint uns genau<br />
diejenige zu sein, die nach der im 3. Abschnitt der ‚Grundlegung‘ geleisteten<br />
<strong>Deduktion</strong> noch zu beantworten bleibt.<br />
„... die analytische Einheit der Apperception ist nur unter der Voraussetzung<br />
irgend einer synthetischen möglich.“ 68 - Es wäre sicherlich allzu gewagt, in den<br />
Ausdruck „irgend einer“ dieses Zitats mehr hineinzulegen, als die Bezugnahme<br />
auf ein bisher noch nicht genanntes und nun allererst aufzusuchen<strong>des</strong> Prinzip.<br />
Wenn es jedoch nicht mehr nur um die Interpretation dieses Textes, sondern<br />
um die Entfaltung systematischer Zusammenhänge geht, so können wir doch<br />
fragen, ob die (theoretisch-) objektive Einheit der Apperzeption die einzig<br />
mögliche syn- | thetische Einheit sei und ob die analytische Einheit eines Bewußtseins,<br />
das nicht bloß theoretisches, sondern zugleich praktisches Bewußtsein<br />
ist, schon durch diese objektiv-synthetische Einheit allein gewährleistet<br />
sei.<br />
In Kants Schriften freilich findet sich kaum eine Bezugnahme auf das<br />
Problem der Einheit der Apperzeption in praktischer Hinsicht. Lediglich im<br />
zweiten ‚Hauptstück‘ der ‚Analytik der praktischen Vernunft‘ in der KdpV<br />
spricht Kant bei der Einführung der ‚Kategorien der Freiheit‘ davon, daß „das<br />
Mannigfaltige der Begehrungen der Einheit <strong>des</strong> Bewußtseins ... zu unterwerfen“<br />
sei, aber so, daß daraus keinerlei <strong>Deduktion</strong>sansatz für das Sittengesetz selbst<br />
zu gewinnen ist, sondern allenfalls für die Kategorien der Freiheit unter der<br />
Voraussetzung <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong>. Denn die Einheit <strong>des</strong> Bewußtseins ist an dieser<br />
Stelle von vornherein eine „Einheit <strong>des</strong> Bewußtseins einer im moralischen<br />
Gesetze gebietenden praktischen Vernunft oder eines reinen Willens a priori“;<br />
68 Vgl. nochmals B 133; III 109‚23-25.<br />
XIII<br />
151
und um dieser schon so spezifizierten Einheit willen sind die Kategorien der<br />
Freiheit notwendig:<br />
„Da ... die Handlungen einerseits zwar unter einem Gesetze, das kein Naturgesetz,<br />
sondern ein Gesetz der Freiheit ist, folglich zu dem Verhalten intelligibeler<br />
Wesen, andererseits aber doch auch als Begebenheiten in der Sinnenwelt<br />
zu den Erscheinungen gehören, so werden die Bestimmungen einer praktischen<br />
Vernunft nur in Beziehung auf die letztere, folglich zwar den Kategorien<br />
<strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> gemäß, aber nicht in der Absicht eines theoretischen<br />
Gebrauchs <strong>des</strong>selben, um das Mannigfaltige der (sinnlichen) Anschauung unter<br />
ein Bewußtsein a priori zu bringen, sondern nur um das Mannigfaltige der<br />
Begehrungen der Einheit <strong>des</strong> Bewußtseins einer im moralischen Gesetz gebietenden<br />
praktischen Vernunft oder eines reinen Willens a priori zu unterwerfen,<br />
Statt haben können.“ 69<br />
Nun ist zwar durch diesen Satz nicht völlig ausgeschlossen, daß jegliche Einheit<br />
<strong>des</strong> Bewußtseins im Hinblick auf das Mannigfaltige der Begehrungen<br />
nicht nur ohne die Kategorien, sondern auch ohne das moralische Gesetz unmöglich<br />
wäre, aber es folgt doch auch nicht aus diesem Satz; er läßt es durchaus<br />
als denkbar erscheinen, daß die Einheit <strong>des</strong> praktischen Bewußtseins auch<br />
unter einem ganz anderen Prinzip möglich wäre.<br />
Erwarten wir also von einer <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> nicht nur die<br />
bloße Behauptung eines seine Synthesis vermittelnden Dritten, sondern auch<br />
eine transzendentale Explikation dieses Dritten durch die Rückführung auf die<br />
Einheit <strong>des</strong> praktischen Bewußtseins, so suchen wir eine transzendentale <strong>Deduktion</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong>, trotz der Behauptung einer vollzogenen <strong>Deduktion</strong><br />
im 3. Abschnitt der ‚Grundlegung‘, vergeblich; und schon dies läßt die Bestreitung<br />
einer <strong>Deduktion</strong>smöglichkeit in der KdpV verständlich erscheinen.<br />
Dieser negative Befund ist freilich um so bemerkenswerter, als Kant nach<br />
dem Zeugnis seiner Nachlaß-Manuskripte lange Jahre hindurch, vielleicht sogar<br />
noch | nach der Veröffentlichung der ‚Grundlegung‘, immer wieder versucht<br />
hat, das Sittengesetz als Bedingung der Möglichkeit der Einheit <strong>des</strong> Wollens<br />
und Handelns zu deduzieren. D. Henrich hat eine Reihe dieser Versuche<br />
analysiert 70 und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß sie alle mißlungen seien,<br />
ja, daß Kant schließlich erkannt habe, daß sie alle mißlingen mußten; und diese<br />
Erkenntnis habe Kant zu seiner Theorie vom ‚Faktum der reinen Vernunft‘<br />
69 V 65‚15-26<br />
70 Vgl. D. Henrich, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Die<br />
Gegenwart der Griechen im neueren Denken, Festschr. f. H.G. Gadamer, hrsg. v. D. Henrich u.a., Tübingen<br />
1960, S. 77-115.<br />
152<br />
geführt. 71 Gemeinsam ist den Kantischen Versuchen nach Henrichs Interpretation,<br />
daß sie die Unbedingtheit der moralischen Gesetzes nicht erklären, da<br />
sie es allesamt auf Nicht-Moralisches zurückführen: etwa den Abscheu dagegen,<br />
wodurch sich die oberste Kraft (Vernunft) selbst widerstreitet 72 , was auf<br />
nichts anderes hinauslaufe, als auf das Handlungsmotiv, „das Mißvergnügen<br />
anläßlich <strong>des</strong> Widerspruches zu beseitigen ...“. 73 Ein weiteres, letztlich nichtmoralisches<br />
Motiv, das in den ‚Reflexionen‘ eine Rolle spiele, sei die ‚Furcht<br />
um unsere Sicherheit‘ und die Sehnsucht nach einem berechenbaren Leben 74 ,<br />
ein anderes die Freude an einem „Optimum der Selbstrealisierung“, ein Gedanke,<br />
der später, in der „Kritik der Urteilskraft“, das Wohlgefallen am Schönen<br />
erkläre. 75<br />
Eine zweite Gruppe von <strong>Deduktion</strong>sversuchen in Kants Nachlaß läuft<br />
nach Heinrich darauf hinaus, daß letztlich doch das Interesse an der eigenen<br />
Glückseligkeit als bewegende Kraft im moralischen Handeln gesehen werde,<br />
insofern zwar nicht Sittlichkeit und Glückseligkeit miteinander identifiziert<br />
würden, aber die erstere doch als nichts anderes verstanden werde, denn als<br />
‚Würdigkeit, glücklich zu sein‘. 76<br />
Schließlich referiert Henrich noch kritisch jene <strong>Deduktion</strong>sversuche, die<br />
den indirekten Weg über die Idee der Freiheit gehen und die noch im dritten<br />
Abschnitt der ‚Grundlegung‘ ihren Niederschlag gefunden haben. 77 Dabei<br />
wird, wie wir oben gesehen haben, von der Notwendigkeit der Selbstbestimmung<br />
der theoretischen Vernunft auf diejenige auch der praktischen Vernunft<br />
geschlossen. In diesen Versuchen wird nach Henrich die Moralität letztlich auf<br />
die Einheit der Apperzeption als einem Prinzip der theoretischen Vernunft<br />
zurückgeführt, was der Besonderheit der sittlichen Einsicht in keiner Weise<br />
gerecht werde.<br />
| Die Kritik Henrichs an den <strong>Deduktion</strong>sversuchen der Nachlaßtexte ist sicherlich<br />
in vielen Punkten voll gerechtfertigt und zudem ganz im Sinne der<br />
späteren Einsichten Kants. Allerdings bieten die Nachlaßtexte, wie schon<br />
71 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 110.<br />
72 Vgl. D. Henrich, Der Begriff. . . ., S. 101, mit Bezug auf die Refl. 6853.<br />
73 Vgl. D. Henrich, Der Begriff. . . ., S. 102.<br />
74 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 102 f., mit Bezug auf die Refl. 7196 und 6621.<br />
75 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 103 (ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Stelle <strong>des</strong> Nachlasses).<br />
76 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 103-105, mit Bezug auf die Refl. 612, 6621, 7202.<br />
77 Vgl. D. Henrich, Der Begriff . . . , S. 107-110, mit Bezug auf die Refl. 4220, 4338 und insbes. 5441 sowie<br />
die Vorlesungen über Metaphysik, hrsg. v. Pölitz, 1821, S. 205-207 (vgl. XXVIII 2/2, S. 1120 f.).<br />
XIV<br />
153
Henrichs Referat zeigt, keine einheitliche Theorie; und so findet man bei genauerem<br />
Studium durchaus auch eine Reihe von <strong>Deduktion</strong>sansätzen, die dem<br />
Wortlaut nach jedenfalls von den bei Henrich herausgestellten Rückgriffen auf<br />
Nichtmoralisches frei sind 78 - ohne daß man freilich ausschließen könnte, daß<br />
solche Rückgriffe doch zum größeren Argumentationszusammenhang der jeweiligen<br />
Reflexionsnotiz gehören.<br />
Greifen wir einen dieser Versuche heraus und machen uns die Schwierigkeiten<br />
klar, die ihnen trotz aller ‚Reinheit‘ von empirischen Prinzipien anhaften:<br />
Die Reflexion 7253 hält sich zur Begründung der Sittlichkeit allein an das<br />
Prinzip der ‚unbedingten Einheit unter Handlungen‘, nachdem sie vorher ausdrücklich<br />
das moralische Sollen vom moralischen Gefühl unterschieden hat,<br />
das allenfalls erklären würde, „wie etwas vorzüglich geschieht“, aber nicht,<br />
„daß etwas geschehen soll“:<br />
„Die Einschränkung <strong>des</strong> besonderen Willens durch die Bedingungen der allgemeingültigkeit<br />
ist ein Princip der Vernunft <strong>des</strong> Practischen. Weil sonst unter<br />
Handlungen keine unbedingte Einheit seyn würde.“ 79<br />
Diese Reflexion präzisiert das Prinzip der unbedingten Einheit der Handlungen<br />
auch noch dadurch, daß sie es von den „Regeln eines bedingten<br />
Gebrauchs unserer Kräfte“ (die ebenfalls in der Vernunft liegen) unterscheidet:<br />
„Vernunft hat Regeln eines bedingten Gebrauchs unserer Kräfte und principien<br />
<strong>des</strong> unbedingten Gebrauchs der freyheit überhaupt. Die letztere sind<br />
nothwendig und geben dem Zufalligen die Bestimung a priori.“ 80<br />
Gerade diese Unterscheidung muß uns veranlassen, eine Reihe von Fragen<br />
auch noch an solche, von aller Bezugnahme auf Glückseligkeit und Gefühl<br />
‚reine‘, <strong>Deduktion</strong>sversuche Kants zu stellen:<br />
1. Sind vielleicht auch die Regeln eines bedingten Gebrauchs unserer Kräfte (der<br />
Zweckrationalität) schon Regeln der Einheit unseres Wollens?<br />
2. Weshalb eigentlich ist über diesen bedingten Gebrauch und gegebenenfalls<br />
über diese bedingte Einheit hinaus noch ein ‚unbedingter Gebrauch der Freiheit‘<br />
notwendig?<br />
3. Warum eigentlich soll unser Wollen und Handeln überhaupt Einheit haben,<br />
u. zw. über die theoretische Einheit der Apperzeption hinaus (die gewiß für<br />
78 Vgl. etwa die Refl. 6843, 6847, 6850, 6853, 6854; XIX 177‚12-14; 178‚9-11; ebda. 28-33; 179‚1929; 180‚2-<br />
31.<br />
79 Refl. 7253; XIX 295‚4-1l.<br />
80 ebda. 12-14.<br />
unser | Wollen und Handeln vorauszusetzen ist, damit es auf die Wirklichkeit<br />
bezogen sein kann)? - Diese letztere Frage ließe sich wohl auf die vorangehende<br />
zweite Frage zurückführen, insofern die Einheit <strong>des</strong> ‚bedingten Gebrauchs<br />
unserer Freiheit‘ auf eine Anwendung von theoretischen Prinzipien auf unsere<br />
Zwecksetzungen hinausliefe.<br />
4. Mit diesen Fragen hängt eine weitere zusammen, zu der uns ein kurzer Blick<br />
in Kants Religionsphilosophie 81 veranlassen könnte: warum denn eigentlich<br />
statt <strong>des</strong> Prinzips der Boshaftigkeit (der Unterordnung der Moralität unter das<br />
Glückseligkeitsprinzip) das Prinzip der Moralität selbst (und damit der Unterordnung<br />
der Glückseligkeit unter die Sittlichkeit) unseren Willen bestimmen<br />
solle.<br />
Wenn wir noch einmal an das Problem der theoretischen <strong>Deduktion</strong> der<br />
Kategorien zurückdenken, so spitzen sich all diese Probleme zu in der Frage,<br />
ob denn auch im Praktischen die analytische Einheit <strong>des</strong> Selbstbewußtseins irgendeine<br />
synthetische Einheit voraussetze und worin sie bestehe.<br />
In gewissen Reflexionen, welche die Sittlichkeit auf ein Prinzip der Einheit<br />
<strong>des</strong> Wollens zurückführen, nimmt Kant zugleich doch noch auf das Prinzip<br />
der Glückseligkeit Bezug, freilich ohne daß man eine notwendige Abhängigkeit<br />
<strong>des</strong> Einheitsarguments von irgendeinem Glückseligkeitsargument erkennen<br />
kann. Dies ist etwa in der Reflexion 7204 der Fall, bei der wir nach anfänglicher<br />
Unsicherheit eine schrittweise Läuterung, vor allem in späteren Zusätzen<br />
beobachten können. Kant stellt sich in dieser Reflexion geradezu die Frage,<br />
was nach der Einsicht, daß Moralität, da sie nicht von jedermann ausgeübt<br />
werde, nicht schon für sich selbst die Glückseligkeit hervorbringen könne‚<br />
„noch übrig bleibe, um gleichwohl den Willen eines jeden (gutdenkenden) zu<br />
bestimmen, sich dieser Regel als einer unverletzlichen zu unterwerfen*: ob<br />
die glükseeligkeit nach der Ordnung der ewigen Vorsehung oder die bloße<br />
würdigkeit Glüklich zu seyn (nach aller Urtheil, da er, so viel an ihm ist, zu aller<br />
Glükseeligkeit beyträgt) oder die bloße Idee der Einheit ... der Vernunft<br />
im Gebrauch der freyheit“. 82<br />
Diese Aufzählung von möglichen Bestimmungsgründen ist in dieser Reflexion<br />
wohl nicht als strenge (ausschließende) Disjunktion gedacht, denn Kant fährt<br />
zwar fort:<br />
„Dieser letzte Grund ist nicht gring zu schätzen. Denn die Selbstbestimung<br />
aus principien giebt allein einen Grund der Einheit der praecognition aller<br />
81 Vgl. VI 36f.; s.o.S. 138.<br />
82 Refl. 7204; XIX 283‚17-23.<br />
XV<br />
154
Handlungen her, und ... so ist dieses ein principium der freyen Handlungen<br />
in Beziehung auf ewige Dauer.“ 83<br />
Aber der Gedanke von der ewigen Dauer gibt Kant sogleich wieder einen Anlaß‚<br />
| auf die (wie wir wohl interpretieren müssen) zweite der aufgezählten<br />
Möglichkeiten zurückzukommen:<br />
„Wenn aber Menschen ewig leben solten, so würde das Wohlverhalten auch<br />
glüklich machen. die Selbstzufriedenheit der Vernunft vergilt auch die Verluste<br />
der Sinne.“ 84<br />
Die beiden zuletzt aufgezählten Möglichkeiten werden jedenfalls im folgenden<br />
miteinander verschmolzen, wenn Kant die Analogie zur theoretischen <strong>Deduktion</strong>sproblematik<br />
herstellt und die formale Identität <strong>des</strong> Wollens als transzendentale<br />
Bedingung eines Problemprinzips erscheint, das den Namen ‚Glückseligkeit<br />
aus mir selbst‘ trägt:<br />
„Gleichwie die identität der apperception ein (g principium der) synthesis<br />
a priori vor alle mögliche Erfahrung ist, so ist die identität meines wollens<br />
der Form nach ein principium der glückseeligkeit aus mich selbst, wodurch<br />
alle Selbstzufriedenheit a priori bestimmt wird.<br />
Ich kan nur, wenn ich nach principien a priori handle, immer eben derselbe<br />
in der Art meiner Zweke seyn, innerlich und äußerlich. Empirische Bedingungen<br />
machen verschiedenheiten.“ 85<br />
Ein späterer Zusatz zu diesen beiden Absätzen resümiert: „( g transscendentale<br />
Einheit im Gebrauch der freyheit.)“. 86 - Nun ist die hier hergestellte Verbindung<br />
zwischen der Sittlichkeit und der ‚Glückseligkeit aus mir selbst‘ ganz offenbar<br />
genau dasjenige, was Kant später in der ‚Dialektik der praktischen Vernunft‘<br />
unter dem Titel <strong>des</strong> ‚höchsten Gutes‘ behandelt, jedoch so, daß Glückseligkeit,<br />
das ‚zweite Element‘ in diesem ‚ganzen Objekt der reinen praktischen<br />
Vernunft‘, gerade nicht als Bestimmungsgrund der Sittlichkeit zugelassen wird,<br />
nicht einmal dann, wenn man die Glückseligkeit auf ihr ‚schon in diesem Leben‘<br />
mögliches Analogon (wie Kant nun vorsichtiger sagt), die moralische (intellektuelle)<br />
Selbstzufriedenheit, beschränkt. 87 Vielmehr ergibt die „kritische<br />
Aufhebung der Antinomie der praktischen Vernunft“ (welche übrigens als<br />
‚transzendentale <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> Begriffs <strong>des</strong> höchsten Gutes‘ angekündigt<br />
83 ebda. Z. 23-28.<br />
84 ebda. Z. 29-31.<br />
85 XIX 283‚33-284‚6.<br />
86 ebda. 284‚7.<br />
87 Vgl. V 110 ff.; insbes. 116‚21-118‚1.<br />
155<br />
wird88 )‚<br />
„daß ... das oberste Gut (als die erste Bedingung <strong>des</strong> höchsten Guts) Sittlichkeit,<br />
Glückseligkeit dagegen zwar das zweite Element <strong>des</strong>selben ausmache,<br />
doch so, daß diese nur die moralisch bedingte, aber doch nothwendige Folge<br />
der ersteren sei.“ 89<br />
Wenn wir von hier aus noch einmal zur Reflexion 7204 zurückblicken, so<br />
scheinen uns die kritischen Differenzierungen, die Kant in der Dialektik der<br />
KdpV erarbeitet hat, ohne weiteres mit dem dritten <strong>Deduktion</strong>sgedanken der<br />
Reflexion | (aus der ‚bloßen Idee der Einheit‘) vereinbar zu sein: wenn wir<br />
nämlich statt der der Möglichkeit der ‚Glückseligkeit aus mir selbst‘ bzw. der<br />
‚Selbstzufriedenheit‘ (die nur die notwendige Folge, nicht der Grund der Sittlichkeit<br />
sein können) etwas anderes als Problemprinzip dieser Einheit finden<br />
und darüber hinaus diese Einheit auch als synthetische Einheit verstehen können.<br />
Versuchen wir zunächst, den letzteren Gesichtspunkt zu verfolgen: Ein<br />
gewisser Hinweis auf die in Frage kommende Synthesis scheint uns schon in<br />
der Rede <strong>des</strong> oben zitierten Textes von der ‚Einheit der Präkognition aller Handlungen‘<br />
zu liegen, zu der die (moralische) ‚Selbstbestimmung aus Prinzipien allein<br />
einen Grund‘ gebe. Dies mag uns an die ‚Synthesis der Rekognition im<br />
Begriffe‘ aus der transzendentalen <strong>Deduktion</strong> der 1. Auflage der KdrV erinnern<br />
90 156<br />
, wobei wir den Zukunftsbezug <strong>des</strong> Begriffs der Präkognition als ein<br />
Spezifikum der Praxis ansehen können.<br />
Neben den Gedanken der Präkognition stellt nun ein weiterer Zusatz zu dieser<br />
Reflexion zwei weitere Synthesisgedanken, indem er eine praktischphilosophische<br />
Interpretation aller drei Prinzipien der ‚Transzendentalphilosophie<br />
der Alten‘ formuliert:<br />
„*(g was kan mich dieses principium (g a priori) der allgemeinen Einstimung<br />
der freyheit mit sich selbst interessiren? Die freyheit nach principien empirischer<br />
Zweke hat keine durchgängige Einstimmung mit sich selbst; ich kan<br />
mir daraus nichts zuverläßiges in ansehung meiner selbst vorstellen. Es ist<br />
keine Einheit meines willens. Daher sind restringirende Bedingungen <strong>des</strong><br />
Gebrauchs derselben absolut nothwendig. Moralität aus dem principio der<br />
Einheit. Aus dem princip der warheit. Daß man sein principium, was man öffentlich<br />
bekennen darf, befolgt, was also vor jedermann gilt. Vollkommenheit<br />
88 Vgl. V 113‚5-12.<br />
89 Vgl. V 119‚7-10.<br />
90 Vgl. A 103; IV 79‚15 ff.<br />
XVI
der form nach: die [allgemeine] Zusammenstimung der freyheit mit den wesentlichen<br />
Bedingungen aller Zweke, d.i. Zwekmäßigkeit a priori.)“ 91<br />
Dieser Zusatz enthält keinerlei Bezugnahme auf das Glückseligkeitsprinzip<br />
und bedarf ihrer auch nicht. Gewiß könnte man im Sinne der Kritik von D.<br />
Henrich auch etwa den Gedanken der Zuverlässigkeit mit der Sehnsucht nach<br />
einem gesicherten Leben in Verbindung bringen. Aber das würde an der Kantischen<br />
Argumentation vorbeigehen. Zuverlässigkeit meiner selbst ist nicht die<br />
Zuverlässigkeit der Lebensumstände. Wieviel an Selbstveränderung ich mir<br />
immer zugestehen mag: Ist Wollen überhaupt ohne jede Zuverlässigkeit meiner<br />
selbst (meiner Grundsätze) denkbar? - Wieviel Opposition zu anderen ich<br />
mir immer herausnehmen mag: Ist Wollen überhaupt (sofern ich in physischer<br />
Gemeinschaft mit | anderen lebe) ohne jeden Anspruch seiner Gründe auf<br />
Geltung für jedermann denkbar? Wieviel Widerstreit einer Zwecksetzung mit<br />
anderen Zwecksetzungen (und mit den Zwecksetzungen anderer) ich immer in<br />
Kauf nehmen mag: Ist Wollen überhaupt ohne jede Rücksicht auf ‚Zweckmäßigkeit<br />
a priori‘, d.i. auf Kompatibilität und wechselseitige Beförderung der<br />
Zwecksetzungen untereinander, denkbar?<br />
So sehr wir Kant in all diesen Fragen jedoch zustimmen mögen, unsere<br />
bisherige Erläuterung macht noch nicht recht deutlich, inwiefern sich die Synthesis<br />
in den drei ‚transzendentalen‘ Hinsichten von einer bloß formallogischen<br />
Synthesis unterscheidet. Wäre nicht all dies, was die drei Gesichtspunkte<br />
erfordern, auch unter ganz anderen Prinzipien (etwa unter Voranstellung der<br />
Glückseligkeit vor der Sittlichkeit 92 nach bloß formallogischen Regeln der Übereinstimmung)<br />
möglich? Welcher Art ist eigentlich die für die Praxis notwendige<br />
synthetische Einheit und Synthesis überhaupt?<br />
Die transzendentale <strong>Deduktion</strong> der Kategorien konnte ihr Ziel nur dadurch<br />
erreichen, daß sie schließlich nicht irgendeine synthetische Einheit, sondern<br />
die objektive Einheit <strong>des</strong> Selbstbewußtseins als Bedingung der Möglichkeit der<br />
analytischen Einheit nachwies. Damit schlug sie die Brücke von dem Problemprinzip<br />
der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori zu deren Referenzprinzip.<br />
Dieser Weg und damit auch der Rückgriff auf das Prinzip der Möglichkeit<br />
der Erfahrung ist uns aber gerade in der praktischen Philosophie verwehrt,<br />
weil es sich hier ja überhaupt nicht um die Bestimmung „der Vernunft<br />
... durch die Beschaffenheit <strong>des</strong> Objects“ handelt, sondern umgekehrt um die<br />
91 XIX 284‚9-19; der Zusatz ist (im Druck) durch das Sternchen unmittelbar an die Frage nach dem Bestimmungsgrund<br />
für die Unterwerfung unter das Prinzip der Moralität angeschlossen.<br />
92 Vgl. nochmals VI 36 f.<br />
157<br />
Hervorbringung von Objekten durch das Subjekt. Eben dieses Problem<br />
scheint auch Kant in der KdpV zur Leugnung der Möglichkeit einer <strong>Deduktion</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> geführt zu haben:<br />
„Einen solchen Gang kann ich aber mit der Deduction <strong>des</strong> moralischen Gesetzes<br />
nicht nehmen. Denn es betrifft nicht das Erkenntniß von der Beschaffenheit<br />
der Gegenstände, die der Vernunft irgend wodurch anderwärts gegeben<br />
werden mögen, sondern ein Erkenntniß, so fern es der Grund von der<br />
Existenz der Gegenstände selbst werden kann und die Vernunft durch dieselbe<br />
Causalität in einem vernünftigen Wesen hat, d.i. reine Vernunft, die als<br />
ein unmittelbar den Willen bestimmen<strong>des</strong> Vermögen angesehen werden<br />
kann.“ 93<br />
Wenn Kant in der transzendentalen <strong>Deduktion</strong> der Kategorien die objektive<br />
Einheit der Apperzeption als die für die analytische Einheit notwendige synthetische<br />
Einheit nachweist, so tut er damit nichts anderes, als die speziell theoretische<br />
Geltungsbeziehung <strong>des</strong> Bewußtseins, die Wahrheitsrelation, als Bedingung<br />
<strong>des</strong> Selbstbewußtseins in theoretischer Hinsicht einzuführen. Theoretische<br />
Geltung, das ist | Beziehung <strong>des</strong> Bewußtseins, genauer seiner Urteile auf<br />
Gegenstände. - Was aber ist eigentlich praktische Geltung? Gibt es auch in ihr<br />
eine geltungsrelevante Intentionalität oder ‚Referenz‘? Gewiß ist auch praktisches<br />
Bewußtsein auf Gegenstände bezogen; aber diese Gegenstände, selbst<br />
wenn wir darunter die noch nicht realisierten Zwecke verstehen, sollen ja nach<br />
Kantischer Lehre gerade nicht geltungskonstitutiv sein. Gibt es gleichwohl<br />
auch in der praktischen Philosophie jenes Verhältnis zwischen Problemprinzip<br />
und Referenzprinzip der synthetischen Sätze a priori?<br />
5. Synthetische Einheit der Praxis, Problemprinzip und<br />
Referenzprinzip synthetisch- praktischer Sätze<br />
Wir wollen diese Frage zu beantworten versuchen, indem wir zunächst jene<br />
Relation der Intentionalität oder Referenz in der sozusagen ‚innermoralischen‘<br />
Reflexion, die schon das Sittengesetz voraussetzen kann, aufsuchen und uns<br />
dann fragen, welche elementare, d.i. schon mit dem Problem, und nicht erst<br />
mit der Lösung der praktischen Philosophie verbundene Relation dem zugrundeliegen<br />
mag. Gehen wir dabei von der ersten Formulierung <strong>des</strong> kategori-<br />
93 V 46‚29-36.<br />
XVII<br />
158
schen Imperativs in der ‚Grundlegung‘ aus:<br />
„... handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst,<br />
daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 94<br />
Wie wir oben sahen, ist der Adressat dieses Imperativs (und damit das Subjekt<br />
dieses praktischen Satzes) der Wille eines jeden vernünftigen Wesens. Dieser<br />
wird als ein Wille gedacht, der nach einer gewissen Maxime sein Handeln bestimmt.<br />
Dieses Subjekt (der Adressat) <strong>des</strong> Imperativs und sein (handlungsbestimmen<strong>des</strong>)<br />
Wollen werden in dem Imperativ nicht explizit genannt, das letztere<br />
ist jedoch implizit im Begriff <strong>des</strong> ‚Handelns nach einer Maxime‘ enthalten. Dagegen<br />
ist explizit die Rede von einem möglichen Wollen, das wir als ‚gesetzgeben<strong>des</strong><br />
Wollen‘ bezeichnen können. Wir könnten diesen praktischen Satz in<br />
Analogie zur <strong>Deduktion</strong>sformel der synthetischen Urteile a priori auch so<br />
formulieren:<br />
‚Die Bedingungen der Möglichkeit eines allgemein gesetzgebenden Wollens<br />
sind zugleich die Bedingungen der praktischen Möglichkeit (d.i. Erlaubtheit)<br />
eines jeden handlungsbestimmenden Wollens.‘<br />
Dieses Prinzip wäre dann eine modaltheoretisch konzipierte methodische Regel<br />
zur Auffindung konkreterer kategorischer Imperative, eine Regel, welche<br />
die notwendige Gesetzgebung der Vernunft zu einer möglichen Gesetzgebung in<br />
Be- | ziehung setzte: Nach dieser Regel (in einer möglichen Gesetzgebung)<br />
unmögliche Maximen führen zu Verbotsgesetzen in der Gesetzgebung der<br />
praktischen Vernunft, Maximen, deren Gegenteil unmöglich ist, zu Gebotsgesetzen,<br />
während den bloß möglichen Maximen einer möglichen Gesetzgebung<br />
in der notwendigen Gesetzgebung der praktischen Vernunft kein Gesetz entspricht.<br />
Die Regel ist brauchbar zur Rechtfertigung konkreter Pflichten, aber<br />
natürlich nicht zur <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> kategorischen Imperativs selbst. Denn sie<br />
ist ja eine mit dem letzteren äquivalente Formulierung.<br />
Immerhin erlaubt sie uns aber, jene Relation ein wenig genauer ins Auge zu<br />
fassen, welche im Begriff der praktischen Geltung als ‚Referenz‘ zu denken ist:<br />
Die Verpflichtungs-Relation zwischen einem gesetzgebenden Wollen und einem<br />
schlicht handlungsbestimmenden, dem Gesetz unterworfenen Wollen.<br />
Das gesetzgebende Wollen will, daß das gesetzesunterworfene Wollen durch<br />
gewisse, nämlich durch die in seiner Gesetzgebung aufgestellten, Bedingungen<br />
eingeschränkt werde, wodurch das erstere Wollen das letztere verpflichtet.<br />
Die Verknüpfung zwischen dem einen und dem anderen Wollen ist alles<br />
andere als eine analytische Verknüpfung. Ja, schon der Gehalt <strong>des</strong> gesetzge-<br />
94 IV 421‚7 f.<br />
159<br />
benden Wollens, die Bedingungen seiner Möglichkeit, ist alles andere als eine<br />
‚analytische Einheit <strong>des</strong> Begriffs‘, in die man alles und je<strong>des</strong>, was man überhaupt<br />
(nach formallogischen Regeln) denken kann, aufnehmen könnte. 95 In<br />
diesem Prinzipienbegriff steckt ja schon nicht bloß die begriffliche Einheit irgendeiner<br />
Maxime, sondern auch die Verknüpfung <strong>des</strong> begrifflichen Gehalts<br />
der betreffenden Maxime mit einem möglichen Adressaten der Gesetzgebung:<br />
einer unbegrenzten Mannigfaltigkeit von Subjekten, welche ihr Wollen und<br />
Handeln nach einem solchen begrifflichen Gehalt ausrichten würden. Deshalb<br />
ist auch der Widerstreit im Wollen, welcher in der Maximenprüfung als negatives<br />
Kriterium der Möglichkeit zu benutzen ist, nicht ein bloß logischer Widerspruch<br />
im begrifflichen Gehalt, sondern ein ‚realer‘ Widerstreit, nämlich in der<br />
als verwirklicht gedachten Gegenständlichkeit dieses Wollens, d.i. in der dieses<br />
Wollen ausführenden Subjektsge- | meinschaft. Die Frage nach der ‚Möglichkeit<br />
eines allgemein gesetzgebenden Wollens‘ ist daher nicht einfach eine Frage<br />
an die reine Vernunft als bloß ‚intellektuelles‘ Vermögen, sondern eine Frage<br />
an eine gesetzgebende Einbildungskraft; und dies, obwohl die ‚Prüfungsgegenstände‘<br />
unserer Regel, die handlungsbestimmenden Maximen, schon das Ergebnis<br />
einer begrifflichen Abstraktion sind. (Denn anders als in der alltäglichen<br />
Praxis selbst geht es in der praktischen Geltungsreflexion nicht um die<br />
anschaulich-praktische Bestimmung von Zwecken in concreto, sondern um<br />
generelle praktische Entscheidungen und um die Gültigkeit der Form unserer<br />
Begehrungen und Zwecksetzungen in abstracto, d.i. in Maximen.) - Die normative<br />
Synthesis <strong>des</strong> Imperativs aber macht die mögliche Synthesis <strong>des</strong> gesetzgebenden<br />
Wollens zum Kriterium <strong>des</strong> erlaubten handlungsbestimmenden<br />
Wollens.<br />
Wie kann uns diese Analyse der ‚innermoralischen‘ Reflexion gemäß dem<br />
kategorischen Imperativ nun bei der Frage nach einer Rechtfertigung <strong>des</strong> kategorischen<br />
Imperativs selbst weiterhelfen? Gibt es einen Grund, die Referenz-<br />
95 Dies unterstellt offensichtlich Hegel in seinem ‚Naturrechts‘-Aufsatz von 1802 der gesamten Moralphilosophie<br />
Kants, wenn er die Allgemeinheit, welche die Aufnahme in die Form (der Tauglichkeit zum Gesetz)<br />
der Maxime erteilt, als „schlechthin analytische Einheit“ interpretiert. Ein gröberes Mißverständnis, das vielleicht<br />
durch Kants mehrfache Betonung <strong>des</strong> analytischen Verhältnisses zwischen Freiheit und Sittengesetz<br />
veranlaßt wurde, ist kaum denkbar; und es ist nicht verwunderlich, wenn Hegel daraus folgert: „... jede Bestimmtheit<br />
ist fähig, in die Begriffsform aufgenommen und als eine Qualität gesetzt zu werden, und es gibt<br />
gar nichts, was nicht auf diese Weise zu einem sittlichen Gesetz gemacht werden könnte.“ (vgl. G.W.F. Hegel,<br />
Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten <strong>des</strong> Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie,<br />
und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften, in: Gesammelte Werke, Bd. IV, Jenaer<br />
kritische Schriften, hrsg. v. H. Buchner und O. Pöggeler, Hamburg 1978, S. 417-485, insbes. S. 435 f.; vgl.<br />
auch die z.T. grotesken Exemplifizierungen S. 436-439).<br />
XVIII<br />
160
struktur, die wir im gesetzgebenden Wollen <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> antreffen, schon<br />
in einer elementaren und unbestreitbaren Weise zwar nicht außerhalb <strong>des</strong> moralisch-praktischen<br />
Problems, aber doch schon vor der Kenntnis seiner Lösung<br />
anzusetzen? Daß wir dies tun müssen, darauf weist uns auch Kants Auslegung<br />
der „gemeinen Menschenvernunft“ im 3. Abschnitt der ‚Grundlegung‘<br />
hin 96 , welche die dortige ,<strong>Deduktion</strong>‘ <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> bestätigen soll: Danach<br />
ist ja „das moralische Sollen“ (a) letztlich „eigenes nothwendiges Wollen“,<br />
(b) intentional bezogen auf das eigene handlungsbestimmende Wollen<br />
und (c) das Gesetz selbst eines bösen Willens (s.o. S. 143 f.).<br />
Hier mag es nützlich sein, sich klarzumachen, daß auch die Gegenstandsbeziehung<br />
der theoretischen Problematik in der Erfahrung einerseits und der<br />
Transzendentalphilosophie (bzw. der reinen Naturwissenschaft) andererseits<br />
nicht schlechthin dieselbe ist. Zumin<strong>des</strong>t darin unterscheiden sie sich, daß die<br />
Beziehung der Erfahrung auf die Gegenstände (jedenfalls zunächst) eine individuelle<br />
und zufällige, die der reinen Verstan<strong>des</strong>begriffe und -grundsätze dagegen<br />
eine gesetzlich-allgemeine und notwendige ist. Gleichwohl beziehen sich<br />
beide Erkenntnisleistungen auf Gegenstände, ja auf denselben Inbegriff von<br />
Gegenständen. Nur <strong>des</strong>halb können die Gehalte der einen Leistung Bedingungen<br />
der Möglichkeit der anderen sein. Deshalb ist aber auch die Gegenstandsbeziehung<br />
überhaupt samt ihrem Bezugspunkt, als Implikat der schon in der<br />
Erfahrung gegebenen Referenzstruktur, schon im Erkenntnisproblem enthalten<br />
und von der transzendentalphilosophischen Lösung dieses Problems völlig<br />
unabhängig.<br />
Nachdem wir nun in der theoretischen Reflexion die beiden Arten der Refe-<br />
| renz und ihre gemeinsame Struktur (mit ihrem gemeinsamen Bezugspunkt)<br />
unterschieden haben, wollen wir versuchen, ein analoge Differenzierung<br />
auch in der praktischen Problematik vorzunehmen. Die Referenzstruktur<br />
der praktischen Gesetzgebung ist die der Verpflichtung eines (<strong>des</strong> handlungsbestimmenden)<br />
Wollens durch ein anderes (das gesetzgebende) Wollen. Nun<br />
muß die Verpflichtung eines Wollens durch ein anderes Wollen nicht notwendig<br />
als gesetzliche und als Gesetzgebungs-Relation gedacht werden. Zumin<strong>des</strong>t<br />
denkbar ist auch eine Verpflichtung <strong>des</strong> einen Wollens durch ein (wodurch<br />
auch immer berechtigtes) individuelles Gebot (oder Verbot) eines anderen, sei<br />
es, daß dieser Imperativ auf eine ganz bestimmte individuelle Handlung, sei es,<br />
daß er schon auf eine (generelle) Handlungsweise eines einzelnen Individuums<br />
zielt. Auch im letzteren Falle hätten wir es noch nicht mit einer gesetzlichen,<br />
96 Vgl. nochmals IV 454‚20-455‚9.<br />
161<br />
sondern noch immer mit einer (bezüglich <strong>des</strong> Adressaten) individuellen Verpflichtung<br />
zu tun.<br />
Verpflichtung überhaupt läßt sich demnach einerseits als generelle, andererseits<br />
als individuelle Verpflichtung denken. Gibt es nun einen Grund, eine<br />
individuelle Verpflichtung schon anzusetzen, bevor wir die Lösung <strong>des</strong> praktischen<br />
Problems, das Sittengesetz, kennen, so eröffnet sich damit ein Weg zu<br />
einem vom Sittengesetz noch unabhängig zu denkenden Problemprinzip praktischer<br />
Sätze, das gleichwohl, um auf sein Referenzprinzip in gültiger Weise<br />
bezogen zu sein, <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> als Bedingung seiner Möglicheit bedürftig<br />
sein könnte.<br />
Wir wollen uns diesem Grund in zwei Schritten nähern, in einem ersten<br />
Schritt, indem wir noch von einer elementaren, aber letztlich wohl kaum<br />
a priori zu erkennenden Voraussetzung der menschlichen Existenz ausgehen,<br />
der Existenz mehrerer wollender Subjekte, die miteinander in praktischer<br />
Wechselwirkung stehen; und in einem zweiten Schritt, indem wir auch von<br />
dieser elementaren Voraussetzung noch absehen und uns als mit einem Willen<br />
begabte vernünftige Wesen nur in unserem Selbstverhältnis betrachten:<br />
1.(a) Unter Voraussetzung einer Wechselwirkung zwischen mit einem Willen<br />
begabten vernünftigen Wesen impliziert das Wollen <strong>des</strong> einen zumin<strong>des</strong>t, daß<br />
es nicht durch ein anderes Subjekt in seinem Wollen und <strong>des</strong>sen Realisierung<br />
gehindert werden will. Ja, unter der Voraussetzung, daß das Wollen <strong>des</strong> einen<br />
nur realisierbar sein sollte, wenn ein anderes Subjekt <strong>des</strong>sen Realisierung beförderte,<br />
müßte dieses Wollen notwendiger Weise auch diese Beförderung<br />
durch ein anderes Subjekt wollen. Dabei brauchen wir über das Ausmaß <strong>des</strong><br />
Durchsetzungs- bzw. Förderungsanspruchs (und eine eventuelle Bereitschaft,<br />
das eigene Wollen auch einmal einzuschränken) nichts näheres auszumachen:<br />
Genug, wenn überhaupt Fälle denkbar sind, in denen das Wollen <strong>des</strong> einen<br />
Subjekts nicht umhin kann, die Unterlassung oder Durchführung von Handlungen<br />
<strong>des</strong> anderen Subjekts zu verlangen, wenn es nicht statt eines wahrhaften<br />
Wollens ein bloßer Wunsch, und damit ein in praktischer Hinsicht (in der<br />
Handlungsbestimmung) nichts entscheiden<strong>des</strong> Begehren, sein will.<br />
| (b) Nun mag die Forderung <strong>des</strong> einen Subjekts an die Handlungen <strong>des</strong> anderen<br />
unter gewissen empirischen Umständen auch durch äußeren Zwang oder<br />
<strong>des</strong>sen Androhung realisierbar sein. A priori jedoch ist nicht auszuschließen,<br />
daß Zwang und Zwangsandrohung in anderen Fällen nicht möglich sind. Min<strong>des</strong>tens<br />
in diesen Fällen, auf die ein je<strong>des</strong> Wollen einmal stoßen kann, will das<br />
betreffende Subjekt notwendiger Weise, daß das andere Subjekt nicht nur in<br />
seinen Handlungen, sondern schon in seinem Wollen auf das eigene Wollen in<br />
XIX<br />
162
negativer oder positiver Weise Rücksicht nimmt. M.a.W. das Wollen eines<br />
vernünftigen Wesens enthält, notwendiger Weise den Anspruch, je<strong>des</strong> andere,<br />
mit ihm in Wechselwirkung tretende Wollen zu verpflichten (zu ‚obligieren‘). 97<br />
(c) Wie immer eine solche Obligation, die sicherlich noch nicht durch den bloßen<br />
Anspruch <strong>des</strong> einen Wollens an das andere gegeben ist, überhaupt möglich<br />
werden mag - das Wollen <strong>des</strong> einen kann das Wollen <strong>des</strong> anderen nur verpflichten,<br />
wenn nicht nur das eine Wollen einen Grund zum Obligieren, sondern<br />
auch das andere Wollen einen Grund, obligiert zu werden, hat. Dies aber muß<br />
ein Grund sein, der schon im anderen Wollen selbst und als solchem enthalten<br />
ist. Denn das verpflichtende Wollen kann sich ja nach der Voraussetzung unseres<br />
Problems auf einen äußeren Grund für ein bloßes ‚Gehorchen‘ <strong>des</strong> anderen<br />
gerade nicht stützen. Auch mit einer bloß zufälligen Übereinstimmung,<br />
einer zufälligen logischen Widerspruchslosigkeit der jeweiligen Wollensgehalte,<br />
kann es sich nicht begnügen, weil dann das Gegenteil seines Wollens ebenso<br />
sehr möglich wäre, es selbst also gar nicht praktisch entscheidend, mithin ein bloßes<br />
Wünschen wäre.<br />
Welchen Grund aber sollte es in einem vernünftigen Wollen selbst geben,<br />
sich als einem fremden Wollen verpflichtet zu betrachten? - Wir müßten einen<br />
Grund finden, wodurch das Wollen <strong>des</strong> anderen veranlaßt werden könnte, auf<br />
das Wollen <strong>des</strong> einen einzugehen, ohne daß das Wollen <strong>des</strong> anderen dadurch<br />
aufhörte, wahrhaftes Wollen zu sein, ja wodurch gerade auch das Wollen <strong>des</strong><br />
anderen wahrhaft Wollen sein könnte, so daß es von sich aus den Anspruch<br />
<strong>des</strong> einen Wollens anerkennen könnte. Nun ist aber kein anderer Grund einer<br />
dergestalt schon im anderen Wollen enthaltenen Anerkennung dieses Anspruchs<br />
denkbar, als ein solcher, der dieses Wollen zugleich umgekehrt in den<br />
Stand setzt, das Wollen <strong>des</strong> einen zu verpflichten. Das aber heißt, die Bedingung<br />
der Möglichkeit der Obligation eines fremden Wollens ist die allgemeine<br />
und wechselseitige Obligation oder diejenige durch ein allgemeines Gesetz. Dies<br />
ist offenbar genau der Gedanke einer Kantischen Nachlaßreflexion:<br />
„Es kan niemand den andern obligiren, als durch eine nothwendige ... einstimung<br />
| <strong>des</strong> Willens anderer mit dem seinen nach allgemeinen Regeln der<br />
Freyheit. Also kan er niemals den andern obligiren, als vermittelst <strong>des</strong>selben<br />
eignen Willen.“ 98<br />
97 Vgl. hierzu die weiter unten noch zu zitierende Refl. 6954 (s. Anm. 98).<br />
98 Refl. 6954; XIX 212‚29-213‚2. - Inwieweit in diesem Punkte auch Hegel die Kantische Moralphilosophie,<br />
trotz aller grundsätzlichen Mißverständnisse, weitergeführt hat, können wir im Rahmen dieses Aufsatzes<br />
nicht mehr untersuchen; hier wären vor allem die elementaren Gedanken <strong>des</strong> § 5 der „Grundlinien der Philosophie<br />
<strong>des</strong> Rechts“ heranzuziehen (Sämtl. Werke, Bd. VII, hrsg. v. H. Glockner, Stuttgart 1928, S. 54 ff.);<br />
Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir die Möglichkeit dieser Obligation eines<br />
anderen Wollens als Korrelat jenes Prinzips der ‚Wahrheit‘ (Wahrhaftigkeit)<br />
auffassen, das der oben zitierte Zusatz zur Reflexion 7204 als zweiten ‚transzendentalen‘<br />
Grund der Moralität nannte: Daß wir nämlich unter Absehung<br />
von allen empirischen Zwecken (bloß als Wollende überhaupt) daran interessiert<br />
sein müssen, ‚ein Prinzip zu befolgen, das wir öffentlich bekennen dürfen,<br />
was also für jedermann gilt‘. Denn, so können wir nun sagen, nur ein solches<br />
Prinzip (nicht übrigens erst meine empirische Befolgung <strong>des</strong> Prinzips nach der<br />
Regel ‚do ut <strong>des</strong>‘) macht aus meinem unvermeidlichen Anspruch an das Wollen<br />
der anderen einen grundsätzlich berechtigten und daher verpflichtenden<br />
Anspruch. Denn er liegt nicht nur dem unvermeidlichen Anspruch meines<br />
Wollens zugrunde, sondern auch dem unvermeidlichen Anspruch <strong>des</strong> Wollens<br />
all derjenigen, an die sich mein Anspruch richtet (auf deren Wollen die praktische<br />
‚Referenz‘ meines Anspruchs zielt).<br />
Dieser erste Schritt einer Rechtfertigung <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> entspricht in<br />
gewisser Weise einer Begründung der rechtlichen Gesetzgebung, denn er setzt<br />
wie jene die Existenz und den wechselseitigen Einfluß mehrerer Handlungssubjekte<br />
voraus. Allerdings geht er schon über den Rahmen der bloß juridischen<br />
Problematik hinaus, insofern er nicht nur ein erzwingbares Recht fordert,<br />
sondern eine Gesetzgebung auch für die Fälle, in denen solche Erzwingbarkeit<br />
nicht gegeben ist (seien es Fälle, in denen die rechtliche Zwangsandrohung<br />
aus irgendwelchen Gründen keine Wirkung auf das Wollen der Handelnden<br />
hat, seien es Fälle ethischer Verpflichtung, in denen eine rechtliche<br />
Verpflichtung aus inhaltlichen Gründen nicht in Frage kommt).<br />
2. Durch den ersten Überlegungsschritt könnten wir noch keinerlei Verpflichtung<br />
eines vernünftigen Wesens gegen sich selbst ableiten. Sie ergibt sich nur<br />
dann, wenn wir das Wollen eines jeden vernünftigen Wesens auch unter Absehung<br />
von intersubjektiven Beziehungen als ein Wollen auffassen können,<br />
das gegenüber einem ‚anderen‘ und doch in ihm, dem vernünftigen Wesen<br />
selbst, liegenden Wollen notwendiger Weise sowohl einen Anspruch stellt als<br />
163 auch einen | Anspruch zu erfüllen hat. Nun ist das Wollen zumin<strong>des</strong>t endlicher<br />
164<br />
Vernunftwesen immer ein Wollen unter Zeitbedingungen; und dies impliziert,<br />
daß schon der Entschluß und die Ausführung eines Wollens in der Zeit distrahiert<br />
sind. Da aber die Ausführung eines Entschlusses (zumal, wenn sie diesem<br />
nicht zeitlich ‚unmittelbar‘ folgt) nicht ‚automatisch‘ geschieht, sondern<br />
vgl. auch den Hinweis D. Henrichs in seinem Aufsatz: Das Problem der Grundlegung der Ethik bei Kant und<br />
im spekulativen Idealismus, in: Sein und Ethos. Untersuchungen zur Grundlegung der Ethik, hrsg. v. P.<br />
Engelhardt (Walberger Studien, Bd. 1), Mainz 1963, S. 350-386, insbes. S. 386.<br />
XX
auch zum Zeitpunkt der Ausführung gewollt sein muß, so ist jede meiner Willensentscheidungen<br />
ohne Sinn, wenn ich nicht zugleich will, daß ich die Ausführung<br />
der betreffenden Handlung auch noch zum Zeitpunkt der Ausführung<br />
wolle. Das Wollen zur Zeit der Ausführung kann aber nur wahrhaft Wollen<br />
sein, wenn es selbst nicht nur ausführen<strong>des</strong> Wollen ist, sondern die Willensentscheidung<br />
mittragen<strong>des</strong>, ja, genauer überlegt, sogar konkretisieren<strong>des</strong><br />
und weiterentwicklen<strong>des</strong> Wollen, mithin selbstentscheiden<strong>des</strong> Wollen ist. Mein<br />
jetztiges Wollen kann das spätere, ausführende Wollen nur zur Ausführung<br />
‚verpflichten‘, wenn es <strong>des</strong>sen Qualität als Wollen unangetastet läßt. Andererseits<br />
kann das spätere Wollen nur wahrhaft Wollen sein, wenn die frühere Entscheidung<br />
die Bedingungen erfüllt, unter denen auch das spätere Wollen sowohl<br />
wahrhaftes Wollen sein kann als auch die Entscheidungen <strong>des</strong> früheren<br />
Wollens billigen und ausführen kann.<br />
Freilich ist mein späteres Wollen nicht überhaupt bloß ein das jetzige Wollen<br />
ausführen<strong>des</strong> und allenfalls überprüfen<strong>des</strong> Wollen. Es fällt seine eigenen<br />
und ganz neuen Entscheidungen, in denen es in mancherlei Hinsicht zu meinem<br />
jetzigen Wollen in Beziehung tritt, sei es, weil mein jetziges Wollen (und<br />
Handeln) die Voraussetzungen zu schaffen hat, damit das spätere Wollen nicht<br />
bloßes Wünschen bleiben muß, sei es, weil sich mein jetziges Wollen dem Anspruch<br />
<strong>des</strong> späteren Wollens gegenübersieht, gewisse Voraussetzungen <strong>des</strong><br />
späteren Handelns und Wollens nicht zu zerstören. Gewiß, nicht alle Bedürfnisse<br />
<strong>des</strong> späteren Wollens kann das jetzige Wollen voraussehen, aber diesen<br />
Anspruch <strong>des</strong> späteren Wollens an das jetzige Wollen kennt es, sofern es nur<br />
Wollen ist, und im späteren Wollen sich selbst und das, was es gewesen zu sein<br />
beanspruchen wird, im voraus entwirft: daß es nur das gewollt habe, was es<br />
dann und zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt billigen kann. Auch das<br />
Verhältnis <strong>des</strong> früheren und <strong>des</strong> späteren Wollens ist alles andere als ein Verhältnis<br />
bloßer Widerspruchslosigkeit; ja es läßt sogar den ‚Widerspruch‘ <strong>des</strong><br />
späteren Wollens gegen den Gehalt <strong>des</strong> früheren Wollens, nämlich aufgrund<br />
besserer Einsicht, durchaus zu. Aber gerade solche Korrektur setzt (wie im<br />
Erkennen so auch im Wollen) ein Prinzip voraus, das beide, das jetzige und<br />
das spätere Wollen als Grund ihrer Entscheidungen in sich enthalten, aus dem<br />
sie das eigentliche ‚Selbst‘ ihrer Selbstbestimmung schöpfen und so die Einheit<br />
eines wollenden Ich (wieder-)herstellen können.<br />
Auch der Anspruch <strong>des</strong> jetzigen Wollens an das spätere Wollen ist ein unvermeidlicher<br />
Anspruch, weil anders durch das jetzige Wollen in Wahrheit<br />
nichts entschieden, es also allenfalls ein bloßes Wünschen wäre. Aber dieser<br />
Anspruch ist nur ein berechtigter und also das spätere Wollen verpflichtender,<br />
wenn es ei- | nen Grund hat, der gerade auch im späteren Wollen selbst enthalten<br />
ist, und zwar notwendiger Weise, d.i. in ihm schon als Wollen überhaupt.<br />
Denn alle empirischen Maximen können allenfalls für eine zufällige Kontinuität<br />
meines Wollens, nicht aber für eine Verpflichtung meines späteren Wollens<br />
aufkommen. Im späteren Wollen selbst kann aber nur dann ein solcher notwendiger<br />
Grund seines Verpflichtetseins liegen, wenn dieser zugleich umgekehrt<br />
der Grund auch seines berechtigten Anspruchs ist, anderes Wollen, sei es früheres<br />
(zur Bereitstellung notwendiger Bedingungen der Handlungsbestimmung<br />
<strong>des</strong> späteren), sei es späteres (zur wenn auch kritisch geprüften Ausführung<br />
seiner Entscheidung) zu verpflichten. Das aber heißt, die Bedingung der<br />
Möglichkeit auch der unvermeidlichen, in dem Wollen eines jeden vernünftigen<br />
(und nicht schon durch ‚schöpferische Anschauung‘ wirkenden) Wesens<br />
enthaltenen Selbstverpflichtung ist die allgemeine und (zwischen früherem und<br />
späteren Wollen wechselseitige) Verpflichtung durch ein allgemeines Gesetz.<br />
Wiederum werden wir kaum fehlgehen, wenn wir diese Selbstverpflichtung<br />
als Korrelat der im zitierten Reflexionszusatz gemeinten transzendentalen<br />
Einheit (in einem engeren, auf das Selbstverhältnis eines praktischen Subjekts<br />
beschränkten Sinne) auffassen, welche mit Bezug auf die zeitliche Erstreckung<br />
<strong>des</strong> Wollens auch als ‚Einheit der Präkognition aller Handlungen‘ begriffen<br />
werden kann. - Der Leser wird darüber hinaus die Auslegung und Entfaltung<br />
<strong>des</strong> dritten dort genannten Prinzips (der ‚Vollkommenheit der Form nach‘)<br />
leicht ergänzen können, indem er die ‚Zusammenstimmung der Freiheit mit<br />
den wesentlichen Bedingungen aller Zwecke‘ als die ebenso durch das Sittengesetz<br />
ermöglichte Vereinigung von Fremd- und Selbstverpflichtung in jedem<br />
vernünftigen (Zwecke setzende und nicht bloß wünschend ausdenkenden)<br />
Wollen versteht. Sie wäre wohl mit der transzendentalen Einheit der Praxis in<br />
einem umfassenden Sinne gleichzusetzen. - Da die Bedingung der synthetischen<br />
Einheit <strong>des</strong> Wollens nur dann ein verpflichtender Grund schlechthin<br />
je<strong>des</strong> Wollens und mithin aller Zwecksetzung sein kann, wenn ihr alle konkreten<br />
Zwecksetzungen untergeordnet sind, kann nicht bloße Zweckrationalität<br />
(die vernünftige Auswahl der Mittel unter der Voraussetzung eines konkreten<br />
Zweckes), sondern nur ein von aller konkreten Zwecksetzung abstrahieren<strong>des</strong><br />
formales Gesetz die hinreichende Bedingung der Möglichkeit vernünftigen<br />
Handlungsbewußtseins darstellen.<br />
Diese transzendentale Einheit <strong>des</strong> praktischen Selbstbewußtseins ist keine<br />
analytische Einheit <strong>des</strong> Wollens, sondern eine synthetische, auf die Verpflichtung<br />
eines anderen Wollens gerichtete Einheit; aber sie macht die analytische<br />
Einheit <strong>des</strong> Wollens allererst möglich. Denn ohne sie könnte das Wollen nicht<br />
XXI<br />
165
wahrhaft handlungsbestimmen<strong>des</strong>, handlungsentscheiden<strong>des</strong> Wollen sein, weil<br />
es sich als jederzeit durch ein anderes Wollen nicht nur faktisch aufhebbar<br />
denken müßte, sondern ohne berechtigten Anspruch gegen jede nur mögliche<br />
Aufhebung durch frem<strong>des</strong> und eigenes (späteres) Wollen. Das erstere würde<br />
seine Handlungsbestim- | mung, das letztere aber schon seine Selbstbestimmung<br />
aufheben. Denn durch seine jeweiligen Entscheidungen wäre in Wahrheit<br />
nichts entschieden (außer seinem jeweiligen Zustand). Das praktische Bewußtsein<br />
würde in eine bloße Mannigfaltigkeit von Begehrungen zerfallen.<br />
Auch das ‚Ich denke‘ in praktischer Hinsicht, d.i. das ‚Ich will‘, impliziert die<br />
Entscheidung einer (zunächst subjektiven) Geltungsdifferenz. Auch die analytische<br />
Einheit <strong>des</strong> praktischen Selbstbewußtseins ist ‚nur unter der Voraussetzung<br />
irgendeiner synthetischen möglich‘, aber nicht einer (im theoretischen Sinne)<br />
objektiven Einheit, sondern einer anderes Wollen verpflichtenden Einheit der<br />
Apperzeption. Das Sittengesetz aber ist die Bedingung der Möglichkeit, seinem<br />
praktischen Bewußtsein gegenüber der faktischen Mannigfaltigkeit (eigener<br />
und fremder) Begehrungen diese synthetische Einheit zu verschaffen.<br />
Danach ist auch die endgültige Bestimmung von Problemprinzip und Referenzprinzip<br />
der synthetisch-praktischen Sätze nicht mehr schwer. Das im dritten<br />
Abschnitt der Kantischen ‚Grundlegung‘ zunächst angesetzte ‚Dritte‘, die<br />
Möglichkeit <strong>des</strong> Wollens als vernünftigen Handlungsbewußtseins (oder die<br />
Möglichkeit, von seiner Vernunft bei unserem Tun und Lassen Gebrauch zu<br />
machen) haben wir so zu entfalten, daß es die aus der Struktur <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong><br />
herausgearbeitete und dem praktischen Problem schon zugrundeliegende<br />
Referenzstruktur enthält. Statt wie in der theoretischen Philosophie unsere<br />
subjektiven Leistungen mit ihren Objekten in Beziehung zu setzen, müssen<br />
wir hier von unseren schlicht gegenstandsbezogenen Leistungen, unserem<br />
handlungsbestimmenden Wollen, zu <strong>des</strong>sen auf eigenes und frem<strong>des</strong> Wollen<br />
bezogenem Implikat, dem eigenes und frem<strong>des</strong> Wollen verpflichtenden Wollen,<br />
zurückgehen. ‚Von seiner Vernunft bei unserem Tun und Lassen<br />
Gebrauch zu machen‘ heißt (abgesehen von theoretisch-kognitiven Implikationen)<br />
nichts anderes, als eigenes und frem<strong>des</strong> Wollen zu verpflichten. - Damit<br />
ist noch nicht angegeben, wodurch dergleichen möglich wird. Aber weil die<br />
Möglichkeit solchen Verpflichtens schon durch je<strong>des</strong> Wollen als vernünftiges<br />
Handlungsbewußtsein gefordert ist, <strong>des</strong>halb ist die Bedingung dieser Möglichkeit<br />
letztlich das Gesetz selbst eines bösen Willens; und das Sollen, welches<br />
dieses Gesetz enthält, ist ‚eigenes notwendiges Wollen‘ und bezieht sich auf<br />
das eigene handlungsbestimmende Wollen zurück (vgl. oben S. 144 f. und 160<br />
f.).<br />
166<br />
Die Möglichkeit der Obligation eines Wollens durch ein anderes, das handlungsbestimmend<br />
zu sein beansprucht, aber dies nur sein kann, wenn es<br />
zugleich anderes Wollen verpflichtet, ist das Problem, mit dem die praktische<br />
Philosophie beginnt (und mit dem die bloß theoretische Erklärung <strong>des</strong> Wollens<br />
und Handelns aufhört). Die Möglichkeit eines verpflichtenden Wollens ist<br />
das Problemprinzip synthetisch-praktischer Sätze a priori. Es ist selbst kein<br />
theoretisches, sondern ein praktisches Prinzip. Aber es ist noch kein moralisches<br />
Prinzip, insofern es noch nicht die Antwort auf die praktische Problemstellung<br />
enthält. Die Möglichkeit <strong>des</strong> dadurch verpflichteten Wollens, als welches sich<br />
je<strong>des</strong> handlungsbestimmende | Wollen erweist, ist das zugehörige Referenzprinzip.<br />
- Insofern das praktische Problemprinzip durch das Sittengesetz mit<br />
seinem Referenzprinzip wahrhaft vermittelt ist, können wir von dem berechtigten<br />
Verpflichtungsanspruch je<strong>des</strong> durch dieses Gesetz bestimmten Wollens<br />
sprechen, d.h. für uns: von der menschlichen Würde. 99<br />
Da die intentionale Beziehung zwischen Problemprinzip und Referenzprinzip<br />
die Entscheidung einer Geltungsdifferenz erfordert, ist das Begründungsprogramm<br />
der praktischen Philosophie modaltheoretisch zu formulieren.<br />
Da Geltungsentscheidungen endlicher Vernunftwesen über eine zeitliche<br />
Distraktion hinweg Einheit der Geltung konstituieren müssen, wird die Durchführung<br />
<strong>des</strong> Begründungsprogramms von einem Prinzip der transzendentalen<br />
Einheit der Apperzeption gewährleistet. - Praktische Vernunft im umfassenden<br />
Sinne aber ist das Vermögen, nicht nur einzelne praktische Probleme, sondern<br />
auch das prinzipielle praktische Problem zu stellen, es zu lösen, und diese Lösung<br />
zu rechtfertigen.<br />
Das oberste Principium aller synthetisch-praktischen Sätze ist nach alledem:<br />
Ein je<strong>des</strong> handlungsbestimmende Wollen vernünftiger Wesen steht unter den notwen-<br />
99 Die Rede vom berechtigten Verpflichtungsanspruch eines jeden durch das Sittengesetz bestimmten Wollens<br />
besagt nichts anderes, als daß „der Wille eines vernünftigen Wesens jederzeit zugleich als gesetzgebend<br />
betrachtet werden muß“ (vgl. IV 434‚23 f.). Die Würde eines vernünftigen Wesens aber besteht darin, daß es<br />
als „Zweck an sich selbst“ gelten muß (vgl. IV 434‚24-436‚7).<br />
Das Prinzip der Menschenwürde ist daher auch der letzte Maßstab unserer Kultur überhaupt, welcher Moralität<br />
und das durch sie zu lösende Problem in sich vereinigt. Dieses Prinzip liegt, wie das Sittengesetz<br />
selbst, noch aller Differenzierung <strong>des</strong> Praktischen in Ethos und Recht voraus. Daß es <strong>des</strong>halb auch über<br />
Ethos und Recht hinaus noch auf Prinzipien anderer Bereiche menschlicher Praxis und Produktion zu verweisen<br />
vermag, müssen wir wohl schon aus den grundsätzlichen Überlegungen Hans Wagners in den §§ 25-<br />
28 von Philosophie und Reflexion, München/Basel 31980, schließen. - Über das Prinzip der Menschenwürde<br />
und seine umfassende Bedeutung belehrt zu werden, können wir in nächster Zeit von niemanden mehr<br />
erhoffen als von Hans Wagner.*<br />
XXII<br />
167
digen Bedingungen der synthetischen Einheit <strong>des</strong> Mannigfaltigen der Begehrungen in einem<br />
möglichen verpflichtenden Wollen.<br />
Wie sind synthetisch-praktische Sätze a priori (kategorische Imperative)<br />
möglich? – Wenn wir die allgemeine Form unserer Begehrungen in Maximen, die Synthesis<br />
der gesetzgebenden Einbildungskraft und die notwendige Einheit derselben auf ein mögliches<br />
verpflichten<strong>des</strong> Wollen überhaupt beziehen und sagen: Die Bedingungen der Möglichkeit<br />
<strong>des</strong> verpflichtenden Wollens überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit<br />
<strong>des</strong> handlungsbestimmenden Wollens und haben darum praktische Gültigkeit<br />
in einem synthetischen Satz a priori.<br />
*[Zusatz 1993:]<br />
Die Fußnote Nr. 99 verweist auf ein 1988 noch nicht erschienenes Werk von<br />
Hans Wagner, dem der Band „Kant. Aalysen – Probleme – Kritik“ gewidmet<br />
war. – Vgl. inzwischen:<br />
Hans Wagner, Die Würde <strong>des</strong> Menschen. Wesen und Normfunktion. Würzburg 1992.<br />
XXIII