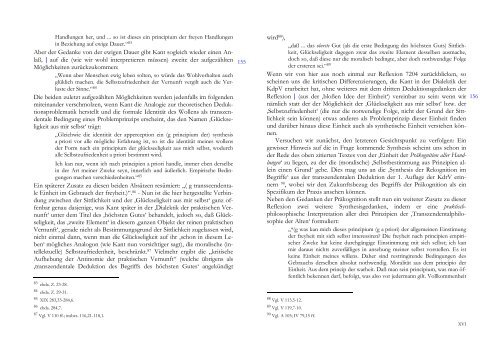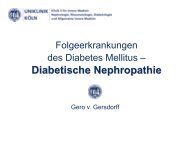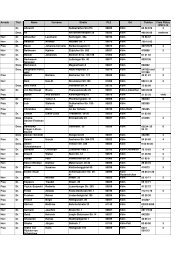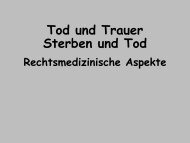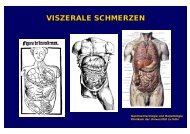Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Handlungen her, und ... so ist dieses ein principium der freyen Handlungen<br />
in Beziehung auf ewige Dauer.“ 83<br />
Aber der Gedanke von der ewigen Dauer gibt Kant sogleich wieder einen Anlaß‚<br />
| auf die (wie wir wohl interpretieren müssen) zweite der aufgezählten<br />
Möglichkeiten zurückzukommen:<br />
„Wenn aber Menschen ewig leben solten, so würde das Wohlverhalten auch<br />
glüklich machen. die Selbstzufriedenheit der Vernunft vergilt auch die Verluste<br />
der Sinne.“ 84<br />
Die beiden zuletzt aufgezählten Möglichkeiten werden jedenfalls im folgenden<br />
miteinander verschmolzen, wenn Kant die Analogie zur theoretischen <strong>Deduktion</strong>sproblematik<br />
herstellt und die formale Identität <strong>des</strong> Wollens als transzendentale<br />
Bedingung eines Problemprinzips erscheint, das den Namen ‚Glückseligkeit<br />
aus mir selbst‘ trägt:<br />
„Gleichwie die identität der apperception ein (g principium der) synthesis<br />
a priori vor alle mögliche Erfahrung ist, so ist die identität meines wollens<br />
der Form nach ein principium der glückseeligkeit aus mich selbst, wodurch<br />
alle Selbstzufriedenheit a priori bestimmt wird.<br />
Ich kan nur, wenn ich nach principien a priori handle, immer eben derselbe<br />
in der Art meiner Zweke seyn, innerlich und äußerlich. Empirische Bedingungen<br />
machen verschiedenheiten.“ 85<br />
Ein späterer Zusatz zu diesen beiden Absätzen resümiert: „( g transscendentale<br />
Einheit im Gebrauch der freyheit.)“. 86 - Nun ist die hier hergestellte Verbindung<br />
zwischen der Sittlichkeit und der ‚Glückseligkeit aus mir selbst‘ ganz offenbar<br />
genau dasjenige, was Kant später in der ‚Dialektik der praktischen Vernunft‘<br />
unter dem Titel <strong>des</strong> ‚höchsten Gutes‘ behandelt, jedoch so, daß Glückseligkeit,<br />
das ‚zweite Element‘ in diesem ‚ganzen Objekt der reinen praktischen<br />
Vernunft‘, gerade nicht als Bestimmungsgrund der Sittlichkeit zugelassen wird,<br />
nicht einmal dann, wenn man die Glückseligkeit auf ihr ‚schon in diesem Leben‘<br />
mögliches Analogon (wie Kant nun vorsichtiger sagt), die moralische (intellektuelle)<br />
Selbstzufriedenheit, beschränkt. 87 Vielmehr ergibt die „kritische<br />
Aufhebung der Antinomie der praktischen Vernunft“ (welche übrigens als<br />
‚transzendentale <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> Begriffs <strong>des</strong> höchsten Gutes‘ angekündigt<br />
83 ebda. Z. 23-28.<br />
84 ebda. Z. 29-31.<br />
85 XIX 283‚33-284‚6.<br />
86 ebda. 284‚7.<br />
87 Vgl. V 110 ff.; insbes. 116‚21-118‚1.<br />
155<br />
wird88 )‚<br />
„daß ... das oberste Gut (als die erste Bedingung <strong>des</strong> höchsten Guts) Sittlichkeit,<br />
Glückseligkeit dagegen zwar das zweite Element <strong>des</strong>selben ausmache,<br />
doch so, daß diese nur die moralisch bedingte, aber doch nothwendige Folge<br />
der ersteren sei.“ 89<br />
Wenn wir von hier aus noch einmal zur Reflexion 7204 zurückblicken, so<br />
scheinen uns die kritischen Differenzierungen, die Kant in der Dialektik der<br />
KdpV erarbeitet hat, ohne weiteres mit dem dritten <strong>Deduktion</strong>sgedanken der<br />
Reflexion | (aus der ‚bloßen Idee der Einheit‘) vereinbar zu sein: wenn wir<br />
nämlich statt der der Möglichkeit der ‚Glückseligkeit aus mir selbst‘ bzw. der<br />
‚Selbstzufriedenheit‘ (die nur die notwendige Folge, nicht der Grund der Sittlichkeit<br />
sein können) etwas anderes als Problemprinzip dieser Einheit finden<br />
und darüber hinaus diese Einheit auch als synthetische Einheit verstehen können.<br />
Versuchen wir zunächst, den letzteren Gesichtspunkt zu verfolgen: Ein<br />
gewisser Hinweis auf die in Frage kommende Synthesis scheint uns schon in<br />
der Rede <strong>des</strong> oben zitierten Textes von der ‚Einheit der Präkognition aller Handlungen‘<br />
zu liegen, zu der die (moralische) ‚Selbstbestimmung aus Prinzipien allein<br />
einen Grund‘ gebe. Dies mag uns an die ‚Synthesis der Rekognition im<br />
Begriffe‘ aus der transzendentalen <strong>Deduktion</strong> der 1. Auflage der KdrV erinnern<br />
90 156<br />
, wobei wir den Zukunftsbezug <strong>des</strong> Begriffs der Präkognition als ein<br />
Spezifikum der Praxis ansehen können.<br />
Neben den Gedanken der Präkognition stellt nun ein weiterer Zusatz zu dieser<br />
Reflexion zwei weitere Synthesisgedanken, indem er eine praktischphilosophische<br />
Interpretation aller drei Prinzipien der ‚Transzendentalphilosophie<br />
der Alten‘ formuliert:<br />
„*(g was kan mich dieses principium (g a priori) der allgemeinen Einstimung<br />
der freyheit mit sich selbst interessiren? Die freyheit nach principien empirischer<br />
Zweke hat keine durchgängige Einstimmung mit sich selbst; ich kan<br />
mir daraus nichts zuverläßiges in ansehung meiner selbst vorstellen. Es ist<br />
keine Einheit meines willens. Daher sind restringirende Bedingungen <strong>des</strong><br />
Gebrauchs derselben absolut nothwendig. Moralität aus dem principio der<br />
Einheit. Aus dem princip der warheit. Daß man sein principium, was man öffentlich<br />
bekennen darf, befolgt, was also vor jedermann gilt. Vollkommenheit<br />
88 Vgl. V 113‚5-12.<br />
89 Vgl. V 119‚7-10.<br />
90 Vgl. A 103; IV 79‚15 ff.<br />
XVI