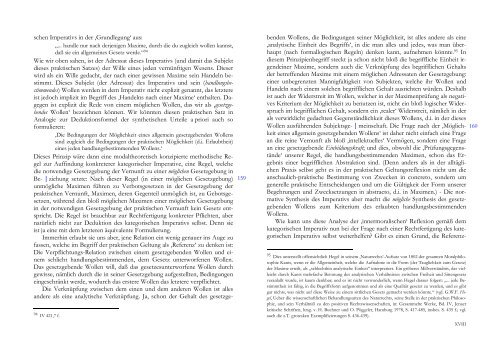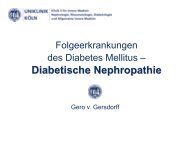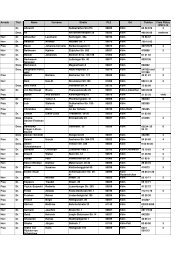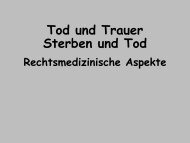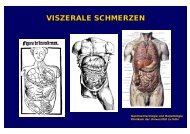Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schen Imperativs in der ‚Grundlegung‘ aus:<br />
„... handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst,<br />
daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 94<br />
Wie wir oben sahen, ist der Adressat dieses Imperativs (und damit das Subjekt<br />
dieses praktischen Satzes) der Wille eines jeden vernünftigen Wesens. Dieser<br />
wird als ein Wille gedacht, der nach einer gewissen Maxime sein Handeln bestimmt.<br />
Dieses Subjekt (der Adressat) <strong>des</strong> Imperativs und sein (handlungsbestimmen<strong>des</strong>)<br />
Wollen werden in dem Imperativ nicht explizit genannt, das letztere<br />
ist jedoch implizit im Begriff <strong>des</strong> ‚Handelns nach einer Maxime‘ enthalten. Dagegen<br />
ist explizit die Rede von einem möglichen Wollen, das wir als ‚gesetzgeben<strong>des</strong><br />
Wollen‘ bezeichnen können. Wir könnten diesen praktischen Satz in<br />
Analogie zur <strong>Deduktion</strong>sformel der synthetischen Urteile a priori auch so<br />
formulieren:<br />
‚Die Bedingungen der Möglichkeit eines allgemein gesetzgebenden Wollens<br />
sind zugleich die Bedingungen der praktischen Möglichkeit (d.i. Erlaubtheit)<br />
eines jeden handlungsbestimmenden Wollens.‘<br />
Dieses Prinzip wäre dann eine modaltheoretisch konzipierte methodische Regel<br />
zur Auffindung konkreterer kategorischer Imperative, eine Regel, welche<br />
die notwendige Gesetzgebung der Vernunft zu einer möglichen Gesetzgebung in<br />
Be- | ziehung setzte: Nach dieser Regel (in einer möglichen Gesetzgebung)<br />
unmögliche Maximen führen zu Verbotsgesetzen in der Gesetzgebung der<br />
praktischen Vernunft, Maximen, deren Gegenteil unmöglich ist, zu Gebotsgesetzen,<br />
während den bloß möglichen Maximen einer möglichen Gesetzgebung<br />
in der notwendigen Gesetzgebung der praktischen Vernunft kein Gesetz entspricht.<br />
Die Regel ist brauchbar zur Rechtfertigung konkreter Pflichten, aber<br />
natürlich nicht zur <strong>Deduktion</strong> <strong>des</strong> kategorischen Imperativs selbst. Denn sie<br />
ist ja eine mit dem letzteren äquivalente Formulierung.<br />
Immerhin erlaubt sie uns aber, jene Relation ein wenig genauer ins Auge zu<br />
fassen, welche im Begriff der praktischen Geltung als ‚Referenz‘ zu denken ist:<br />
Die Verpflichtungs-Relation zwischen einem gesetzgebenden Wollen und einem<br />
schlicht handlungsbestimmenden, dem Gesetz unterworfenen Wollen.<br />
Das gesetzgebende Wollen will, daß das gesetzesunterworfene Wollen durch<br />
gewisse, nämlich durch die in seiner Gesetzgebung aufgestellten, Bedingungen<br />
eingeschränkt werde, wodurch das erstere Wollen das letztere verpflichtet.<br />
Die Verknüpfung zwischen dem einen und dem anderen Wollen ist alles<br />
andere als eine analytische Verknüpfung. Ja, schon der Gehalt <strong>des</strong> gesetzge-<br />
94 IV 421‚7 f.<br />
159<br />
benden Wollens, die Bedingungen seiner Möglichkeit, ist alles andere als eine<br />
‚analytische Einheit <strong>des</strong> Begriffs‘, in die man alles und je<strong>des</strong>, was man überhaupt<br />
(nach formallogischen Regeln) denken kann, aufnehmen könnte. 95 In<br />
diesem Prinzipienbegriff steckt ja schon nicht bloß die begriffliche Einheit irgendeiner<br />
Maxime, sondern auch die Verknüpfung <strong>des</strong> begrifflichen Gehalts<br />
der betreffenden Maxime mit einem möglichen Adressaten der Gesetzgebung:<br />
einer unbegrenzten Mannigfaltigkeit von Subjekten, welche ihr Wollen und<br />
Handeln nach einem solchen begrifflichen Gehalt ausrichten würden. Deshalb<br />
ist auch der Widerstreit im Wollen, welcher in der Maximenprüfung als negatives<br />
Kriterium der Möglichkeit zu benutzen ist, nicht ein bloß logischer Widerspruch<br />
im begrifflichen Gehalt, sondern ein ‚realer‘ Widerstreit, nämlich in der<br />
als verwirklicht gedachten Gegenständlichkeit dieses Wollens, d.i. in der dieses<br />
Wollen ausführenden Subjektsge- | meinschaft. Die Frage nach der ‚Möglichkeit<br />
eines allgemein gesetzgebenden Wollens‘ ist daher nicht einfach eine Frage<br />
an die reine Vernunft als bloß ‚intellektuelles‘ Vermögen, sondern eine Frage<br />
an eine gesetzgebende Einbildungskraft; und dies, obwohl die ‚Prüfungsgegenstände‘<br />
unserer Regel, die handlungsbestimmenden Maximen, schon das Ergebnis<br />
einer begrifflichen Abstraktion sind. (Denn anders als in der alltäglichen<br />
Praxis selbst geht es in der praktischen Geltungsreflexion nicht um die<br />
anschaulich-praktische Bestimmung von Zwecken in concreto, sondern um<br />
generelle praktische Entscheidungen und um die Gültigkeit der Form unserer<br />
Begehrungen und Zwecksetzungen in abstracto, d.i. in Maximen.) - Die normative<br />
Synthesis <strong>des</strong> Imperativs aber macht die mögliche Synthesis <strong>des</strong> gesetzgebenden<br />
Wollens zum Kriterium <strong>des</strong> erlaubten handlungsbestimmenden<br />
Wollens.<br />
Wie kann uns diese Analyse der ‚innermoralischen‘ Reflexion gemäß dem<br />
kategorischen Imperativ nun bei der Frage nach einer Rechtfertigung <strong>des</strong> kategorischen<br />
Imperativs selbst weiterhelfen? Gibt es einen Grund, die Referenz-<br />
95 Dies unterstellt offensichtlich Hegel in seinem ‚Naturrechts‘-Aufsatz von 1802 der gesamten Moralphilosophie<br />
Kants, wenn er die Allgemeinheit, welche die Aufnahme in die Form (der Tauglichkeit zum Gesetz)<br />
der Maxime erteilt, als „schlechthin analytische Einheit“ interpretiert. Ein gröberes Mißverständnis, das vielleicht<br />
durch Kants mehrfache Betonung <strong>des</strong> analytischen Verhältnisses zwischen Freiheit und Sittengesetz<br />
veranlaßt wurde, ist kaum denkbar; und es ist nicht verwunderlich, wenn Hegel daraus folgert: „... jede Bestimmtheit<br />
ist fähig, in die Begriffsform aufgenommen und als eine Qualität gesetzt zu werden, und es gibt<br />
gar nichts, was nicht auf diese Weise zu einem sittlichen Gesetz gemacht werden könnte.“ (vgl. G.W.F. Hegel,<br />
Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten <strong>des</strong> Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie,<br />
und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften, in: Gesammelte Werke, Bd. IV, Jenaer<br />
kritische Schriften, hrsg. v. H. Buchner und O. Pöggeler, Hamburg 1978, S. 417-485, insbes. S. 435 f.; vgl.<br />
auch die z.T. grotesken Exemplifizierungen S. 436-439).<br />
XVIII<br />
160