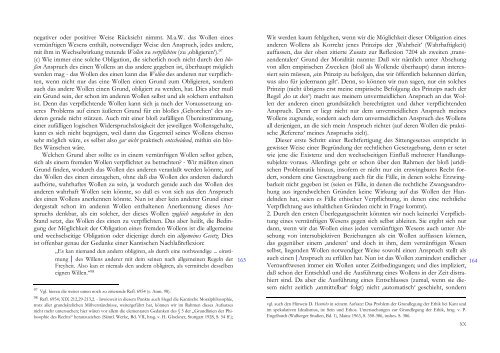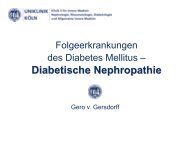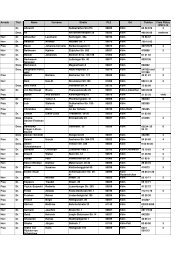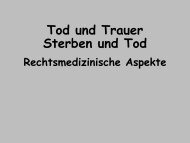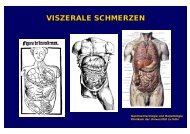Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Deduktion des Sittengesetzes - UK-Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
negativer oder positiver Weise Rücksicht nimmt. M.a.W. das Wollen eines<br />
vernünftigen Wesens enthält, notwendiger Weise den Anspruch, je<strong>des</strong> andere,<br />
mit ihm in Wechselwirkung tretende Wollen zu verpflichten (zu ‚obligieren‘). 97<br />
(c) Wie immer eine solche Obligation, die sicherlich noch nicht durch den bloßen<br />
Anspruch <strong>des</strong> einen Wollens an das andere gegeben ist, überhaupt möglich<br />
werden mag - das Wollen <strong>des</strong> einen kann das Wollen <strong>des</strong> anderen nur verpflichten,<br />
wenn nicht nur das eine Wollen einen Grund zum Obligieren, sondern<br />
auch das andere Wollen einen Grund, obligiert zu werden, hat. Dies aber muß<br />
ein Grund sein, der schon im anderen Wollen selbst und als solchem enthalten<br />
ist. Denn das verpflichtende Wollen kann sich ja nach der Voraussetzung unseres<br />
Problems auf einen äußeren Grund für ein bloßes ‚Gehorchen‘ <strong>des</strong> anderen<br />
gerade nicht stützen. Auch mit einer bloß zufälligen Übereinstimmung,<br />
einer zufälligen logischen Widerspruchslosigkeit der jeweiligen Wollensgehalte,<br />
kann es sich nicht begnügen, weil dann das Gegenteil seines Wollens ebenso<br />
sehr möglich wäre, es selbst also gar nicht praktisch entscheidend, mithin ein bloßes<br />
Wünschen wäre.<br />
Welchen Grund aber sollte es in einem vernünftigen Wollen selbst geben,<br />
sich als einem fremden Wollen verpflichtet zu betrachten? - Wir müßten einen<br />
Grund finden, wodurch das Wollen <strong>des</strong> anderen veranlaßt werden könnte, auf<br />
das Wollen <strong>des</strong> einen einzugehen, ohne daß das Wollen <strong>des</strong> anderen dadurch<br />
aufhörte, wahrhaftes Wollen zu sein, ja wodurch gerade auch das Wollen <strong>des</strong><br />
anderen wahrhaft Wollen sein könnte, so daß es von sich aus den Anspruch<br />
<strong>des</strong> einen Wollens anerkennen könnte. Nun ist aber kein anderer Grund einer<br />
dergestalt schon im anderen Wollen enthaltenen Anerkennung dieses Anspruchs<br />
denkbar, als ein solcher, der dieses Wollen zugleich umgekehrt in den<br />
Stand setzt, das Wollen <strong>des</strong> einen zu verpflichten. Das aber heißt, die Bedingung<br />
der Möglichkeit der Obligation eines fremden Wollens ist die allgemeine<br />
und wechselseitige Obligation oder diejenige durch ein allgemeines Gesetz. Dies<br />
ist offenbar genau der Gedanke einer Kantischen Nachlaßreflexion:<br />
„Es kan niemand den andern obligiren, als durch eine nothwendige ... einstimung<br />
| <strong>des</strong> Willens anderer mit dem seinen nach allgemeinen Regeln der<br />
Freyheit. Also kan er niemals den andern obligiren, als vermittelst <strong>des</strong>selben<br />
eignen Willen.“ 98<br />
97 Vgl. hierzu die weiter unten noch zu zitierende Refl. 6954 (s. Anm. 98).<br />
98 Refl. 6954; XIX 212‚29-213‚2. - Inwieweit in diesem Punkte auch Hegel die Kantische Moralphilosophie,<br />
trotz aller grundsätzlichen Mißverständnisse, weitergeführt hat, können wir im Rahmen dieses Aufsatzes<br />
nicht mehr untersuchen; hier wären vor allem die elementaren Gedanken <strong>des</strong> § 5 der „Grundlinien der Philosophie<br />
<strong>des</strong> Rechts“ heranzuziehen (Sämtl. Werke, Bd. VII, hrsg. v. H. Glockner, Stuttgart 1928, S. 54 ff.);<br />
Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir die Möglichkeit dieser Obligation eines<br />
anderen Wollens als Korrelat jenes Prinzips der ‚Wahrheit‘ (Wahrhaftigkeit)<br />
auffassen, das der oben zitierte Zusatz zur Reflexion 7204 als zweiten ‚transzendentalen‘<br />
Grund der Moralität nannte: Daß wir nämlich unter Absehung<br />
von allen empirischen Zwecken (bloß als Wollende überhaupt) daran interessiert<br />
sein müssen, ‚ein Prinzip zu befolgen, das wir öffentlich bekennen dürfen,<br />
was also für jedermann gilt‘. Denn, so können wir nun sagen, nur ein solches<br />
Prinzip (nicht übrigens erst meine empirische Befolgung <strong>des</strong> Prinzips nach der<br />
Regel ‚do ut <strong>des</strong>‘) macht aus meinem unvermeidlichen Anspruch an das Wollen<br />
der anderen einen grundsätzlich berechtigten und daher verpflichtenden<br />
Anspruch. Denn er liegt nicht nur dem unvermeidlichen Anspruch meines<br />
Wollens zugrunde, sondern auch dem unvermeidlichen Anspruch <strong>des</strong> Wollens<br />
all derjenigen, an die sich mein Anspruch richtet (auf deren Wollen die praktische<br />
‚Referenz‘ meines Anspruchs zielt).<br />
Dieser erste Schritt einer Rechtfertigung <strong>des</strong> <strong>Sittengesetzes</strong> entspricht in<br />
gewisser Weise einer Begründung der rechtlichen Gesetzgebung, denn er setzt<br />
wie jene die Existenz und den wechselseitigen Einfluß mehrerer Handlungssubjekte<br />
voraus. Allerdings geht er schon über den Rahmen der bloß juridischen<br />
Problematik hinaus, insofern er nicht nur ein erzwingbares Recht fordert,<br />
sondern eine Gesetzgebung auch für die Fälle, in denen solche Erzwingbarkeit<br />
nicht gegeben ist (seien es Fälle, in denen die rechtliche Zwangsandrohung<br />
aus irgendwelchen Gründen keine Wirkung auf das Wollen der Handelnden<br />
hat, seien es Fälle ethischer Verpflichtung, in denen eine rechtliche<br />
Verpflichtung aus inhaltlichen Gründen nicht in Frage kommt).<br />
2. Durch den ersten Überlegungsschritt könnten wir noch keinerlei Verpflichtung<br />
eines vernünftigen Wesens gegen sich selbst ableiten. Sie ergibt sich nur<br />
dann, wenn wir das Wollen eines jeden vernünftigen Wesens auch unter Absehung<br />
von intersubjektiven Beziehungen als ein Wollen auffassen können,<br />
das gegenüber einem ‚anderen‘ und doch in ihm, dem vernünftigen Wesen<br />
selbst, liegenden Wollen notwendiger Weise sowohl einen Anspruch stellt als<br />
163 auch einen | Anspruch zu erfüllen hat. Nun ist das Wollen zumin<strong>des</strong>t endlicher<br />
164<br />
Vernunftwesen immer ein Wollen unter Zeitbedingungen; und dies impliziert,<br />
daß schon der Entschluß und die Ausführung eines Wollens in der Zeit distrahiert<br />
sind. Da aber die Ausführung eines Entschlusses (zumal, wenn sie diesem<br />
nicht zeitlich ‚unmittelbar‘ folgt) nicht ‚automatisch‘ geschieht, sondern<br />
vgl. auch den Hinweis D. Henrichs in seinem Aufsatz: Das Problem der Grundlegung der Ethik bei Kant und<br />
im spekulativen Idealismus, in: Sein und Ethos. Untersuchungen zur Grundlegung der Ethik, hrsg. v. P.<br />
Engelhardt (Walberger Studien, Bd. 1), Mainz 1963, S. 350-386, insbes. S. 386.<br />
XX