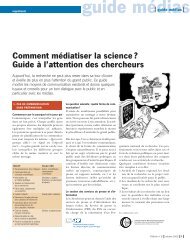Synthesebericht - Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
Synthesebericht - Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
Synthesebericht - Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gleichberechtigt an dieser Wissensproduktion und -zertifikation beteiligen und die Ausrichtung<br />
wissenschaftlicher Entwicklungen gemeinsam bestimmen. Bei einer zunehmend wissensbasierten<br />
wirtschaftlichen Entwicklung gilt es zudem auch, das Potenzial der hochqualifizierten Frauen<br />
zu nutzen. Die universitäre Hochschulforschung ist im Weiteren ein Teilarbeitsmarkt, der sich<br />
durch grosse Konkurrenz auszeichnet, da er im Unterschied zur Wirtschaft praktisch keine Positionen<br />
unterhalb der Professur kennt, welche als legitime Berufsziele gelten und auf denen in<br />
einer relativ gesicherten Anstellung verblieben werden kann. Umso wichtiger ist es, dass im Verteilungskampf<br />
um die raren Spitzenplätze das Prinzip der Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit<br />
gilt und soziale Merkmale der Personen keine Rolle spielen.<br />
Geschlechtsspezifische Verlustraten in den wissenschaftlichen Laufbahnen von Frauen und<br />
Männern<br />
Obwohl der Frauenanteil im Wissenschaftsbereich auf allen Stufen und in den Fachbereichen in<br />
den letzten Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen ist (European Commission 2006), kann noch<br />
nicht von einer paritätischen Vertretung gesprochen werden. Karrierelaufbahnen von Frauen<br />
und Männern in Wissenschaft und Forschung zeichnen sich hierbei durch drei Strukturmerkmale<br />
aus: Eine HORIZONTALE SEGREGATION nach (Sub-)Disziplinen, Fachbereichen und Wirtschaftszweigen<br />
entsteht durch geschlechtsspezifisch unterschiedliche Studienwahl und Spezialisierung<br />
(European Commission 2006; Caballero Liardet und von Erlach 2005; Lévy, Pastor, Alvarez und<br />
Crettaz von Roten 2003). Eine VERTIKALE SEGREGATION (vgl. European Commission 2000, 12f.;<br />
Lévy et al. 2003, 9) ist Ausdruck einer nicht proportionalen Vertretung von Frauen auf den jeweils<br />
anschliessenden Stufen der Qualifikations- und Positionshierarchie. Wie stark dieses Phänomen<br />
das Ergebnis von geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Verlustraten beim Übergang in<br />
und während der verschiedenen Qualifikationsphasen und Positionen einer wissenschaftlichen<br />
Laufbahn ist (metaphorisch auch als Leaky Pipeline bezeichnet, vgl. Alper 1993) und welchen<br />
Anteil der Timelag zwischen den einzelnen Stufen in den Statistiken einnimmt, kann nur mit der<br />
Analyse von Längsschnittdaten beobachten werden, wenn einzelne Kohorten bei den jeweiligen<br />
Übergängen exakt bestimmt werden. Lind und Löther (2007) können mit der Analyse von retrospektiv<br />
angelegten idealtypischen Karriereverläufen für Deutschland zeigen, dass Frauen über<br />
den ganzen wissenschaftlichen Karriereverlauf hinweg überproportional aus den wissenschaftlichen<br />
Laufbahnen herausfallen.<br />
Ein drittes Strukturmerkmal ergibt sich durch WECHSELWIRKUNGEN DER HORIZONTALEN UND VERTIKA-<br />
LEN SEGREGATION. Wenn Statistiken betrachtet werden, scheinen geschlechtsspezifische Selektionsprozesse<br />
je nach Fachbereich bei unterschiedlichen Statuspassagen und unterschiedlich<br />
stark aufzutreten (z.B. European Commission 2000, 14; Lévy und Pastor 2003, 10; Leemann<br />
2002, 102). Statistiken sind jedoch wiederum problematisch, da nicht vorhandene oder kleinere<br />
geschlechtsspezifische Verlustraten unter Umständen auf den Zuzug von ausländischen Forscherinnen<br />
zurückzuführen sind.<br />
Frauen sind heute bei den HOCHSCHULABSCHLÜSSEN (Lizentiat, Diplom) gleichberechtigt, wenn<br />
über alle Fachbereiche hinweg der Geschlechteranteil betrachtet wird. Im Jahre 2007 beträgt der<br />
Frauenanteil 51% (Bundesamt für Statistik 2008). Bisherige Studien zum DOKTORAT in der<br />
Schweiz belegen ebenfalls, dass Hochschulabgängerinnen aufgeholt und Geschlechterunterschiede<br />
bezüglich des Doktorats sich verkleinert haben (Leemann 2005), wobei der Anteil der<br />
Frauen bei den frisch Promovierten insgesamt nur 37% beträgt (European Commission 2006,<br />
21f).<br />
Zur Frage, ob die weiteren Selektionsprozesse in der wissenschaftlichen Laufbahn NACH DEM DOK-<br />
TORAT geschlechtsspezifische Merkmale aufzeigen, können zwei entgegengesetzte Hypothesen<br />
formuliert werden. Durch die geschlechtsspezifischen Selbst- und sozialen Selektionsprozesse in<br />
den Bildungslaufbahnen bis zum Doktorat sind jene Frauen, welche diesen Selektionsprozess<br />
„überlebt“ haben und weiterhin im Wissenschaftsbereich tätig sind, eine auserwählte Gruppe mit<br />
GEFO <strong>Synthesebericht</strong> | 12