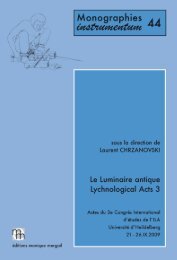M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
76<br />
Michael <strong>Blömer</strong><br />
zum Teil deutlich erkennbar um e<strong>in</strong>fache Zweigbüschel oder Äste ‒ ohne dass freilich e<strong>in</strong>e<br />
sichere botanische Bestimmung möglich wäre ‒, zeigen andere Darstellungen e<strong>in</strong>e komplexere<br />
Gestaltung, etwa mit e<strong>in</strong>em gesondert gearbeiteten Griff. 44 <strong>Die</strong> Funktion der Bündel und Zweige<br />
ist umstritten. Häufig werden sie als aspergilla, als Geräte zum Verspritzen <strong>von</strong> Flüssigkeiten<br />
im Kult, beschrieben. 45 Naheliegender sche<strong>in</strong>t jedoch, dass es sich dabei im Kontext syrischer<br />
Lokalkulte um e<strong>in</strong> Symbol für die lebenspendende Kraft der verehrten Gottheit handelt. Denn<br />
auch die verehrten Gottheiten selbst und die ihnen beigeordneten Götter s<strong>in</strong>d nicht selten<br />
mit dem gleichen Symbol ausgestattet. 46 Im Kosmos der Götter <strong>von</strong> <strong>Doliche</strong> z. B. können die<br />
sogenannten Dioskures oder Castores, die auf den dreieckigen Aufsätzen <strong>von</strong> Kultstandarten<br />
mehrfach belegt s<strong>in</strong>d, vergleichbare vegetabile Insignien tragen. 47 <strong>Die</strong> eigentümlich geformten<br />
Gottheiten mit kegelförmigen, berggestaltigen Unterleibern stehen dabei ganz offensichtlich<br />
<strong>in</strong> der Tradition altorientalischer Berggötter. 48 <strong>Die</strong>se häufig mit Wettergöttern assoziierten<br />
Gottheiten s<strong>in</strong>d regelmäßig mit vegetabilen Symbolen ausgestattet, die ihre leben- und<br />
fruchtbarkeitspendende Kraft symbolisieren. 49 Schließlich kann auch der Wettergott selbst<br />
Zweigbündel oder vergleichbare vegetabile Insignien tragen. 50<br />
44 E<strong>in</strong>fache Zweige: Deutlich mit Griffen versehen s<strong>in</strong>d die volum<strong>in</strong>ösen Bündel des Priesters Narkissos im Tempel<br />
<strong>von</strong> Chhim, vgl. Krumeich 1998, 171–200; zum Heiligtum selbst vgl. I. Périssé-Valéro, Le sanctuaire roma<strong>in</strong> de<br />
Chhim. Évolution et mutations dʼun site cultuel de la montagne libanaise, Topoi 16/2, 2009, 65–92. Ganz ähnlich<br />
gestaltet ist das Gerät auf dem Altar <strong>von</strong> Brahilya, vgl. Y. Hajjar, Une dédicace de Brahlia a Zeus et Apis, AAAS<br />
27/28, 1978/79, 187–195 (dort als P<strong>in</strong>ienzapfen gedeutet); J.-P. Rey-Coquais, Sur quelques div<strong>in</strong>ités de la Syrie<br />
antique, <strong>in</strong>: M.-M. Mactoux ‒ E. Geny (Hrsg.), Mélanges Pierre Léveque 6. Religion (Paris 1992) 247‒260 <strong>in</strong>sb.<br />
256 Taf. 2, 2; auf dem Grabmonument des Germanos aus Qartaba, P.-L. Gatier, La «colonna de Quartba» et la<br />
romanisation de la montagne libanaise, <strong>in</strong>: P. Biel<strong>in</strong>ski ‒ F. M. Stepniowski (Hrsg.), Aux pays dʼAllat. Mélanges<br />
offerts à Michal Gawl<strong>in</strong>owski (Warschau 2005) 77–98.<br />
45 Zu aspergilla allgeme<strong>in</strong> A. V. Siebert, Instrumenta Sacra. Untersuchungen zu römischen Opfer-, Kult und Priestergeräten<br />
(Berl<strong>in</strong> 1999); A. V. Siebert, Römische Opfer- und Kultgeräte. E<strong>in</strong> Beitrag zur Sachkultur römischer<br />
Opferpraxis, <strong>in</strong>: Ch. Batsch ‒ U. Egelhaaf-Gaiser ‒ R. Stepper (Hrsg.), Zwischen Krise und Alltag. Antike Religionen<br />
im Mittelmeerraum (Stuttgart 1999) 125–42 bes. 132–135. – Zur Interpretation der syrischen Zweigbündel<br />
als aspergilla: Rey-Coquais a. O. (Anm. 44) 256. P.-L. Gatier, La colonne de Qartba, <strong>in</strong>: P.-L. Gatier, Mission de<br />
Yanouh et de la haute vallée du Nahr-Ibrahim, Baal 8, 2004, 193 geht kurz auf die Zweige e<strong>in</strong> und kündigt e<strong>in</strong>e<br />
separate Studie zu diesen an. Vgl. auch Gatier a. O. (Anm. 45) 85‒86; J. Aliquot, La vie religieuse au Libanon<br />
sous lʼempire roma<strong>in</strong> (Beirut 2009) 117‒119.<br />
46 Vgl. zu Zweigbündeln bei Gottheiten <strong>in</strong> römischer Zeit etwa K. Butcher, Acolytes and Aspergilla. On Five Co<strong>in</strong><br />
Types of Heliopolis, Topoi 16/1, 2009, 169–187, wo es auf S. 186‒187 treffend heißt: »The bouquet or bunch of<br />
foliage, whatever its function, was clearly not a device particular to any one deity, and could be used alone as a<br />
symbol of the div<strong>in</strong>e, <strong>in</strong> the same way as the caduceus and purse symbols of Mercury, the standards and cornucopia<br />
of the Tyche of Heliopolis, or the ear of corn (of Jupiter or Mercury?)«. Stärker betont werden sollte freilich die<br />
Herkunft des Symbols aus der altorientalischen Ikonographie.<br />
47 Vgl. CCID Nr. 80 Taf. 22; Nr. 103 Taf. 26; Nr. 202 Taf. 39; Nr. 281Taf. 52; Nr. 512 Taf. 108. Ähnliche vegetabile<br />
Objekte tragen auch die Castores auf dem dalmatischen Altar CCID Nr. 125 Taf. 28.<br />
48 Vgl. allgeme<strong>in</strong> E. Will, Les castores dolichéniens, MelBeyrouth 27, 1947/1948, 23–36; P. Merlat, Observations<br />
sur les Castores Dolichéniens, Syria 28, 1951, 229–249.<br />
49 Vgl. z. B. die Berggötter auf den Orthostaten <strong>von</strong> A<strong>in</strong> Dara, vgl. A. Abu Assaf, Der Tempel <strong>von</strong> A<strong>in</strong> Dara, DaF 3<br />
(Ma<strong>in</strong>z 1990) Sockelreliefs E 1–7, Taf. 44 a‒b; 45 a‒b; 46 a; Sockel G 1, Seite A, Taf. 49 a; Sockel G 1, Seite C,<br />
Taf. 50b oder Aleppo, vgl. J. Gonella ‒ W. Khayyata ‒ K. Kohlmeyer, <strong>Die</strong> Zitadelle <strong>von</strong> Aleppo und der Tempel<br />
des Wettergottes. Neue Forschungen und Entdeckungen (Münster 2005) 101 Abb. 142 t. Allgeme<strong>in</strong> auch P. Calmeyer,<br />
Wandernde Berggötter, <strong>in</strong>: P. Van den Berghe ‒ G. Voet (Hrsg.), Languages and Cultures <strong>in</strong> Context. At the<br />
Crossroads of Civilizations <strong>in</strong> the Syro-Mesopotamian Realm (Leuven 1999) 1–32.<br />
50 Vgl. Bunnens 2006, 58‒59. Zum fruchtbarkeitspendenden Aspekt der Wettergötter allgeme<strong>in</strong> s. u. S. 90–92. Aus<br />
dem Westen zeigt der dreieckige Standartenaufsatz CCID Nr. 295 Taf. 58 Iupiter <strong>Doliche</strong>nus mit e<strong>in</strong>em Zweigbündel,<br />
vgl. auch die römerzeitliche Wettergottstele aus Zafer, CCID Nr. 8 Taf. 4, wo der Gott mit vegetabilem<br />
Symbol anstelle e<strong>in</strong>es Blitzes ausgestattet ist.