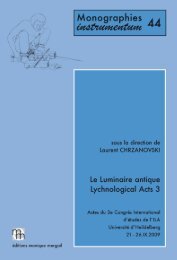M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
100<br />
Michael <strong>Blömer</strong><br />
früheste festdatierte Zeugnis für die Verehrung des Zeus Hadad <strong>in</strong> Nordsyrien. Bemerkenswert<br />
ist die Verknüpfung mit dem König, die man als Indiz für e<strong>in</strong>e enge Verb<strong>in</strong>dung des Kultes mit<br />
dem Herrscherkult werten kann.<br />
Während es somit sehr wahrsche<strong>in</strong>lich ist, dass Iupiter <strong>Doliche</strong>nus <strong>in</strong> <strong>Doliche</strong> selbst als Hadad<br />
bekannt war, bleibt der Name der Gött<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Rätsel. 207<br />
Zusammenfassung<br />
<strong>Die</strong> <strong>Stele</strong> <strong>von</strong> <strong>Doliche</strong> überliefert die erste vollständige Darstellung des im Heiligtum verehrten<br />
Götterpaares. Im unteren Register opfern zwei Männer, die durch ihre Tracht als Priester<br />
ausgewiesen s<strong>in</strong>d, auf e<strong>in</strong>em Altar. Im oberen Bildfeld stehen Gott und Gött<strong>in</strong> auf ihren<br />
Basistieren Stier und Hirsch. Das Bild des Gottes steht ganz <strong>in</strong> der Tradition des eisenzeitlichen<br />
Wettergottes. <strong>Die</strong> Darstellung der Gött<strong>in</strong> zeigt enge Bezüge zur syro-hethitischen Kubaba,<br />
wobei mit dem Stehen auf dem Hirsch e<strong>in</strong> Motiv zu fassen ist, das für Gött<strong>in</strong>nen sonst nicht<br />
bezeugt ist. Dass zahlreiche Elemente der Ikonographie des Paares altorientalische Wurzeln<br />
haben, entspricht den üblichen Darstellungskonventionen des Iupiter <strong>Doliche</strong>nus und der<br />
Iuno <strong>Doliche</strong>na. Nirgendwo jedoch ist dies so konsistent zu beobachten wie auf der <strong>Stele</strong> aus<br />
<strong>Doliche</strong>. Gleichwohl manifestiert sich <strong>in</strong> verschiedenen Details deutlich, dass es sich um e<strong>in</strong><br />
Erzeugnis der römischen Zeit handelt, das wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> das 1./2. Jh. n. Chr. datiert. E<strong>in</strong>e<br />
präzise Datierung der <strong>Stele</strong> ist allerd<strong>in</strong>gs schwierig, da der lokale Stil der Bildhauerarbeit nicht<br />
die notwendigen Anhaltspunkte liefert. Religionsgeschichtlich ist die <strong>Stele</strong> <strong>von</strong> Bedeutung, da<br />
die genaue Wiedergabe antiquarischer Details der altorientalischen Götterikonographie auf e<strong>in</strong>e<br />
Vorlage verweist, die bereits <strong>in</strong> der späten Eisenzeit im Heiligtum aufgestellt wurde und dort bis<br />
<strong>in</strong> die römische Zeit verblieb. <strong>Die</strong>s deckt sich mit dem durch die Ausgrabungen abgesicherten<br />
Befund e<strong>in</strong>er ungebrochenen Nutzung des Heiligtums spätestens vom 8. Jh. v. Chr. bis <strong>in</strong> die<br />
spätrömische Zeit.<br />
207 Vgl. aber G. Montesi, Nota <strong>Doliche</strong>na, SMSR 27, 1956, 142–145 und E. Sanzi, Sur une <strong>in</strong>scription roma<strong>in</strong>e en<br />
rapport avec le culte dolichénien, <strong>in</strong>: G. M. Belelli ‒ U. Bianchi (Hrsg.), Orientalia Sacra Urbis Romae. <strong>Doliche</strong>na<br />
et Heliopolitana, Studia Archaeologia 84 (Rom 1996) 257–259. Montesi, <strong>von</strong> Sanzi wieder aufgegriffen, sieht <strong>in</strong><br />
ederanis die late<strong>in</strong>ische Umschrift des <strong>in</strong>digenen Namens der Gött<strong>in</strong>.