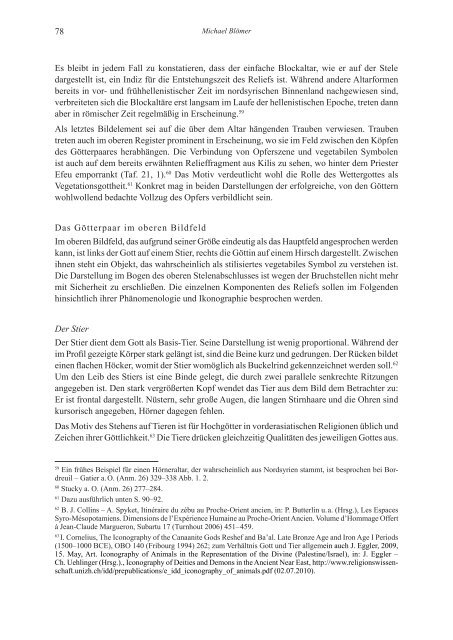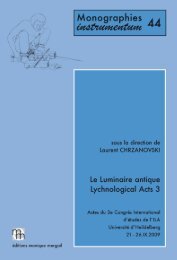M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
M. Blömer, Die Stele von Doliche, in: E. Winter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
78<br />
Michael <strong>Blömer</strong><br />
Es bleibt <strong>in</strong> jedem Fall zu konstatieren, dass der e<strong>in</strong>fache Blockaltar, wie er auf der <strong>Stele</strong><br />
dargestellt ist, e<strong>in</strong> Indiz für die Entstehungszeit des Reliefs ist. Während andere Altarformen<br />
bereits <strong>in</strong> vor- und frühhellenistischer Zeit im nordsyrischen B<strong>in</strong>nenland nachgewiesen s<strong>in</strong>d,<br />
verbreiteten sich die Blockaltäre erst langsam im Laufe der hellenistischen Epoche, treten dann<br />
aber <strong>in</strong> römischer Zeit regelmäßig <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung. 59<br />
Als letztes Bildelement sei auf die über dem Altar hängenden Trauben verwiesen. Trauben<br />
treten auch im oberen Register prom<strong>in</strong>ent <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung, wo sie im Feld zwischen den Köpfen<br />
des Götterpaares herabhängen. <strong>Die</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>von</strong> Opferszene und vegetabilen Symbolen<br />
ist auch auf dem bereits erwähnten Relieffragment aus Kilis zu sehen, wo h<strong>in</strong>ter dem Priester<br />
Efeu emporrankt (Taf. 21, 1). 60 Das Motiv verdeutlicht wohl die Rolle des Wettergottes als<br />
Vegetationsgottheit. 61 Konkret mag <strong>in</strong> beiden Darstellungen der erfolgreiche, <strong>von</strong> den Göttern<br />
wohlwollend bedachte Vollzug des Opfers verbildlicht se<strong>in</strong>.<br />
Das Götterpaar im oberen Bildfeld<br />
Im oberen Bildfeld, das aufgrund se<strong>in</strong>er Größe e<strong>in</strong>deutig als das Hauptfeld angesprochen werden<br />
kann, ist l<strong>in</strong>ks der Gott auf e<strong>in</strong>em Stier, rechts die Gött<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>em Hirsch dargestellt. Zwischen<br />
ihnen steht e<strong>in</strong> Objekt, das wahrsche<strong>in</strong>lich als stilisiertes vegetabiles Symbol zu verstehen ist.<br />
<strong>Die</strong> Darstellung im Bogen des oberen <strong>Stele</strong>nabschlusses ist wegen der Bruchstellen nicht mehr<br />
mit Sicherheit zu erschließen. <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>zelnen Komponenten des Reliefs sollen im Folgenden<br />
h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Phänomenologie und Ikonographie besprochen werden.<br />
Der Stier<br />
Der Stier dient dem Gott als Basis-Tier. Se<strong>in</strong>e Darstellung ist wenig proportional. Während der<br />
im Profil gezeigte Körper stark gelängt ist, s<strong>in</strong>d die Be<strong>in</strong>e kurz und gedrungen. Der Rücken bildet<br />
e<strong>in</strong>en flachen Höcker, womit der Stier womöglich als Buckelr<strong>in</strong>d gekennzeichnet werden soll. 62<br />
Um den Leib des Stiers ist e<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>de gelegt, die durch zwei parallele senkrechte Ritzungen<br />
angegeben ist. Den stark vergrößerten Kopf wendet das Tier aus dem Bild dem Betrachter zu:<br />
Er ist frontal dargestellt. Nüstern, sehr große Augen, die langen Stirnhaare und die Ohren s<strong>in</strong>d<br />
kursorisch angegeben, Hörner dagegen fehlen.<br />
Das Motiv des Stehens auf Tieren ist für Hochgötter <strong>in</strong> vorderasiatischen Religionen üblich und<br />
Zeichen ihrer Göttlichkeit. 63 <strong>Die</strong> Tiere drücken gleichzeitig Qualitäten des jeweiligen Gottes aus.<br />
59 E<strong>in</strong> frühes Beispiel für e<strong>in</strong>en Hörneraltar, der wahrsche<strong>in</strong>lich aus Nordsyrien stammt, ist besprochen bei Bordreuil<br />
‒ Gatier a. O. (Anm. 26) 329–338 Abb. 1. 2.<br />
60 Stucky a. O. (Anm. 26) 277‒284.<br />
61 Dazu ausführlich unten S. 90‒92.<br />
62 B. J. Coll<strong>in</strong>s – A. Spyket, It<strong>in</strong>éraire du zébu au Proche-Orient ancien, <strong>in</strong>: P. Butterl<strong>in</strong> u. a. (Hrsg.), Les Espaces<br />
Syro-Mésopotamiens. Dimensions de lʼExpérience Huma<strong>in</strong>e au Proche-Orient Ancien. Volume dʼHommage Offert<br />
à Jean-Claude Margueron, Subartu 17 (Turnhout 2006) 451– 459.<br />
63 I. Cornelius, The Iconography of the Canaanite Gods Reshef and Baʼal. Late Bronze Age and Iron Age I Periods<br />
(1500–1000 BCE), OBO 140 (Fribourg 1994) 262; zum Verhältnis Gott und Tier allgeme<strong>in</strong> auch J. Eggler, 2009,<br />
15. May, Art. Iconography of Animals <strong>in</strong> the Representation of the Div<strong>in</strong>e (Palest<strong>in</strong>e/Israel), <strong>in</strong>: J. Eggler ‒<br />
Ch. Uehl<strong>in</strong>ger (Hrsg.)., Iconography of Deities and Demons <strong>in</strong> the Ancient Near East, http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/idd/prepublications/e_idd_iconography_of_animals.pdf<br />
(02.07.2010).