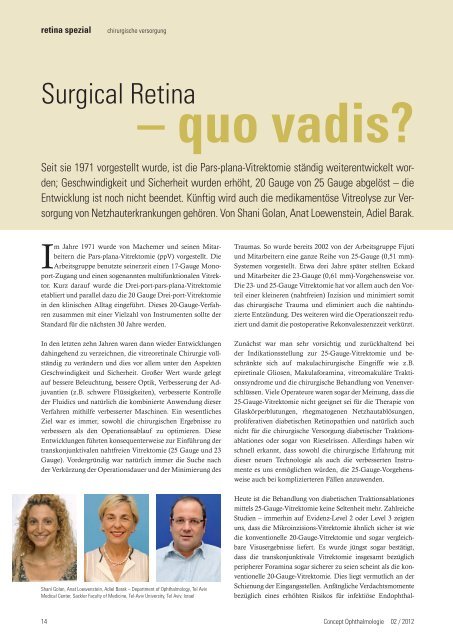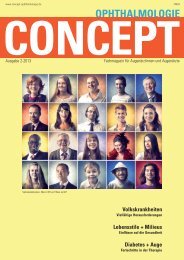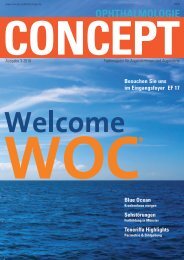Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
etina spezial chirurgische versorgung<br />
Surgical Retina<br />
Seit sie 1971 vorgestellt wurde, ist die Pars-plana-Vitrektomie ständig weiterentwickelt worden;<br />
Geschwindigkeit und Sicherheit wurden erhöht, 20 Gauge <strong>von</strong> 25 Gauge abgelöst – die<br />
Entwicklung ist noch nicht beendet. Künftig wird auch die medikamentöse Vitreolyse zur Versorgung<br />
<strong>von</strong> Netzhauterkrankungen gehören. Von Shani Golan, Anat Loewenstein, Adiel Barak.<br />
Im Jahre 1971 wurde <strong>von</strong> Machemer und seinen Mitarbeitern<br />
die Pars-plana-Vitrektomie (ppV) vorgestellt. Die<br />
Arbeitsgruppe benutzte seinerzeit einen 17-Gauge Monoport-Zugang<br />
und einen sogenannten multifunktionalen Vitrektor.<br />
Kurz darauf wurde die Drei-port-pars-plana-Vitrektomie<br />
etabliert und parallel dazu die 20 Gauge Drei-port-Vitrektomie<br />
in den klinischen Alltag eingeführt. Dieses 20-Gauge-Verfahren<br />
zusammen mit einer Vielzahl <strong>von</strong> Instrumenten sollte der<br />
Standard für die nächsten 30 Jahre werden.<br />
In den letzten zehn Jahren waren dann wieder Entwicklungen<br />
dahingehend zu verzeichnen, die vitreoretinale Chirurgie vollständig<br />
zu verändern und dies vor allem unter den Aspekten<br />
Geschwindigkeit und Sicherheit. Großer Wert wurde gelegt<br />
auf bessere Beleuchtung, bessere Optik, Verbesserung der Adjuvantien<br />
(z.B. schwere Flüssigkeiten), verbesserte Kontrolle<br />
der Fluidics und natürlich die kombinierte Anwendung dieser<br />
Verfahren mithilfe verbesserter Maschinen. Ein wesentliches<br />
Ziel war es immer, sowohl die chirurgischen Ergebnisse zu<br />
verbessern als den Operationsablauf zu optimieren. Diese<br />
Entwicklungen führten konsequenterweise zur Einführung der<br />
transkonjunktivalen nahtfreien Vitrektomie (25 Gauge und 23<br />
Gauge). Vordergründig war natürlich immer die Suche nach<br />
der Verkürzung der Operationsdauer und der Minimierung des<br />
Shani Golan, Anat Loewenstein, Adiel Barak – Department of Ophthalmology, Tel Aviv<br />
Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel Aviv, Israel<br />
– quo vadis?<br />
Traumas. So wurde bereits 2002 <strong>von</strong> der Arbeitsgruppe Fijuti<br />
und Mitarbeitern eine ganze Reihe <strong>von</strong> 25-Gauge (0,51 mm)-<br />
Systemen vorgestellt. Etwa drei Jahre später stellten Eckard<br />
und Mitarbeiter die 23-Gauge (0,61 mm)-Vorgehensweise vor.<br />
Die 23- und 25-Gauge Vitrektomie hat vor allem auch den Vorteil<br />
einer kleineren (nahtfreien) Inzision und minimiert somit<br />
das chirurgische Trauma und eliminiert auch die nahtinduzierte<br />
Entzündung. Des weiteren wird die Operationszeit reduziert<br />
und damit die postoperative Rekonvaleszenzzeit verkürzt.<br />
Zunächst war man sehr vorsichtig und zurückhaltend bei<br />
der Indikationsstellung zur 25-Gauge-Vitrektomie und beschränkte<br />
sich auf makulachirurgische Eingriffe wie z.B.<br />
epiretinale Gliosen, Makulaforamina, vitreomakuläre Traktionssyndrome<br />
und die chirurgische Behandlung <strong>von</strong> Venenverschlüssen.<br />
Viele Operateure waren sogar der Meinung, dass die<br />
25-Gauge-Vitrektomie nicht geeignet sei für die Therapie <strong>von</strong><br />
Glaskörperblutungen, rhegmatogenen Netzhautablösungen,<br />
proliferativen diabetischen Retinopathien und natürlich auch<br />
nicht für die chirurgische Versorgung diabetischer Traktionsablationes<br />
oder sogar <strong>von</strong> Rieselrissen. Allerdings haben wir<br />
schnell erkannt, dass sowohl die chirurgische Erfahrung mit<br />
dieser neuen Technologie als auch die verbesserten Instrumente<br />
es uns ermöglichen würden, die 25-Gauge-Vorgehensweise<br />
auch bei komplizierteren Fällen anzuwenden.<br />
Heute ist die Behandlung <strong>von</strong> diabetischen Traktionsablationes<br />
mittels 25-Gauge-Vitrektomie keine Seltenheit mehr. Zahlreiche<br />
Studien – immerhin auf Evidenz-Level 2 oder Level 3 zeigten<br />
uns, dass die Mikroinzisions-Vitrektomie ähnlich sicher ist wie<br />
die konventionelle 20-Gauge-Vitrektomie und sogar vergleichbare<br />
Visusergebnisse liefert. Es wurde jüngst sogar bestätigt,<br />
dass die transkonjunktivale Vitrektomie insgesamt bezüglich<br />
peripherer Foramina sogar sicherer zu seien scheint als die konventionelle<br />
20-Gauge-Vitrektomie. Dies liegt vermutlich an der<br />
Schienung der Eingangsstellen. Anfängliche Verdachtsmomente<br />
bezüglich eines erhöhten Risikos für infektiöse Endophthal-<br />
14 <strong>Concept</strong> <strong>Ophthalmologie</strong> 02 / <strong>2012</strong>