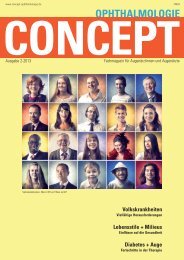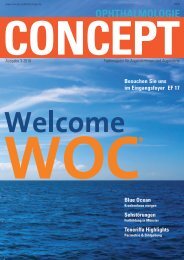Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ophthalmo-chirurgie amnionmembran-transplantation<br />
Eine unverzichtbare Therapieoption<br />
Die Transplantation kryokonservierter Amnionmembran (AMT) gehört heute zum Therapiespektrum<br />
persistierender Hornhaut-Epitheldefekte und sollte bei persistierenden Hornhautulzera<br />
frühzeitig erwogen werden. Die AMT hat vielfältige Vorzüge vor, statt, während oder<br />
nach der Keratoplastik. Von Prof. Dr. Berthold Seitz.<br />
Nicht heilende Erkrankungen der Augenoberfläche<br />
stellen immer noch eine Herausforderung dar, die<br />
ehemals oft mit mehrwöchigen stationären Liegezeiten<br />
einhergingen. Seit Ende der 1990er Jahre setzt sich bei<br />
persistierenden kornealen Epitheldefekten immer mehr die<br />
Amnionmembrantransplantation (AMT) durch. Die AM besteht<br />
aus einer einlagigen kubischen Epithelschicht, einer sehr<br />
dicken Basalmembran <strong>von</strong> 200 bis 300 nm und daran anhängend<br />
lockerem kollagenen Bindegewebe mit wenigen Fibroblasten.<br />
Damit ist der in der Literatur gut eingeführte Begriff<br />
„Membran“ für das transplantierte Gewebe streng genommen<br />
eine Fehlbezeichnung (= Misnomer). In der elektromikroskopischen<br />
Aufnahme zeigt die Basalmembran des Amnions fingerförmige<br />
Ausstülpungen.<br />
Folgende prinzipielle Eigenschaften werden der AM nachgesagt:<br />
• Stimulation der Re-Epithelialisierung<br />
• antiinflammatorische Effekte<br />
• antiinfektiöse Effekte<br />
• immunmodulatorische Effekte<br />
• Hemmung der kornealen Neovaskularisation<br />
• Hemmung der Narbenbildung<br />
• Förderung der Re-Innervation.<br />
Die AM wird in Homburg/Saar unter sterilen Bedingungen aus<br />
einer durch Kaiserschnitt geborenen Placenta präpariert [6, 11] . Die<br />
Plazenta wird uns freundlicherweise <strong>von</strong> der Gynäkologischen<br />
Klinik unseres Universitätsklinikums zur Verfügung gestellt. Daneben<br />
werden serologische Untersuchungen gefordert, wie sie<br />
für das Hornhautspendergewebe üblich sind. Die AM wird nach<br />
24<br />
Prof. Dr. med. Berthold Seitz ist Direktor<br />
der Klinik für Augenheilkunde am<br />
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS<br />
in Homburg/Saar<br />
manueller Separation vom Chorion auf etwa 3 x 4 cm große<br />
Merocel-Träger aufgenäht und bei -70°C kryofixiert.<br />
Einsatzmöglichkeiten der Amnionmembran<br />
Grundsätzlich kann die AM als (1) Transplantat, (2) natürlicher<br />
Verband oder (3) als Träger (= Carrier) genutzt werden.<br />
Zu den zwei Hauptindikationsgruppen in der <strong>Ophthalmologie</strong><br />
zählen: Nichtheilende Hornhaut-Epitheldefekte (besonders<br />
auch herpetischer Genese) [2,4,5,7] und (meist iatrogen<br />
induzierte) epibulbäre/tarsale Bindehautdefekte [20] . Darüber<br />
hinaus wird die AM heute erfolgreich auch bei akuter Verätzung<br />
[12] , bei chirurgischer Korrektur <strong>von</strong> Symblephara in<br />
reizfreien Augen [22] , in Kombination mit Limbustransplantation<br />
bei rezidivieren Pterygien mit Symblepharonbildung [21]<br />
oder für die ex vivo Expansion limbaler Stammzellen [13] eingesetzt.<br />
Bei schwerer Limbusstammzellinsuffizienz (zum Beispiel<br />
Spätstadium nach Verätzung) ist die alleinige AMT nicht<br />
ausreichend, sondern muss durch eine geeignete Variante der<br />
„Limbustransplantation“ ergänzt werden [8] .<br />
Differenzierte Technik der AMT auf die Kornea<br />
Es sollte grundsätzlich nicht <strong>von</strong> „Amnionaufnähung“ oder<br />
„Amniondeckung“ gesprochen werden. Vielmehr sollte jeder<br />
Indikationsstellung zur differenzierten Technik der AMT ein<br />
Konzept zur intendierten Wundheilung zugrunde liegen [7,9,17,18] :<br />
– Patch = Overlay: Hier wird eine große AM (z.B. 16 mm)<br />
über einem Epitheldefekt oder flachen Stromadefekt episkleral<br />
zirkulär fixiert. Die AM wirkt als natürliche Kontaktlinse. Das<br />
Epithel soll sich unter der AM schließen. Der Patch fällt nach<br />
ein bis zwei Wochen in der Regel ohne Residuen ab.<br />
– Graft = Inlay (ein- oder mehrlagig): Bei flachen Stromadefekten<br />
wird eine einschichtige AM in den Ulcusgrund eingenäht.<br />
Sie dient als Basalmembran. Das Epithel soll über der<br />
AM wachsen. Die AM wird also in die Hornhaut integriert<br />
und bleibt dort über Monate – teilweise über Jahre – nach-<br />
<strong>Concept</strong> <strong>Ophthalmologie</strong><br />
02 / <strong>2012</strong>