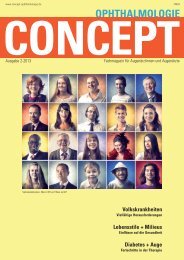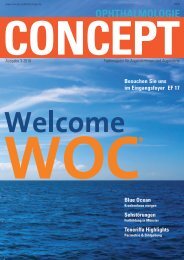Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Concept Ophthalmologie, Heft 2/2012 - Klinikum Ernst von ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3 5Fünf Jahre, drei Indikationen<br />
medizin vegf-inhibitoren<br />
Die Zulassung <strong>von</strong> Ranibizumab vor fünf Jahren wird als Meilenstein in der Augenheilkunde<br />
gesehen. Mittlerweile ist der Wirkstoff, der ins Auge injiziert wird, für drei<br />
Indikationsgebiete zugelassen. Erfahrungen zeigen, dass eine patientenindividualisierte<br />
Therapie am wirkungsvollsten ist.<br />
Noch vor fünf Jahren gab es für Patienten, die an einer<br />
feuchten altersbedingten Makuladegeneration<br />
(AMD) erkrankt waren, keine Therapieoption, die<br />
den schrittweisen Verlust des Sehvermögens verbessern konnte.<br />
Dies hat sich mit der Zulassung des Wirkstoffs Ranibizumab<br />
(Lucentis) im Januar 2007 geändert. „Heute“, so PD Dr. Mathias<br />
Maier (München) anlässlich des Jubiläums, „können wir<br />
mit der antiangiogenetischen Therapie mit VEGF-Inhibitoren<br />
Betroffenen helfen, die wir früher unbehandelt nach Hause<br />
schicken mussten.“ Anfang 2011 folgte die Indikationserweiterung<br />
zur Behandlung einer Visusbeeinträchtigung infolge eines<br />
diabetischen Makulaödems (DMÖ) und im Mai 2011 diejenige<br />
zur Behandlung infolge eines retinalen Venenverschlusses<br />
(RVV). Das Antikörperfragment wird direkt ins Auge injiziert,<br />
um den dort vorhandenen VEGF zu neutralisieren.<br />
So stoppt Ranibizumab laut den zentralen Zulassungsstudien<br />
ANCHOR 1,2 und MARINA 3 bei neun <strong>von</strong> zehn AMD-Patienten<br />
den schrittweisen Verlust der Sehkraft, über 40 Prozent<br />
der Patienten gewinnen sogar wieder Sehvermögen zurück –<br />
wie Christine K., bei der bereits mit 50 Jahren eine feuchte<br />
AMD festgestellt wurde. Sie und vier andere, erfolgreich behandelte<br />
Patienten wurden als exemplarische Fälle anlässlich<br />
eines Presseworkshops am 1. Februar <strong>2012</strong> im oberbayerischen<br />
Saulgrub vorgestellt. Das dortige Aura-Hotel Kur- und Begegnungszentrum<br />
ist eine Einrichtung des bayerischen Blinden-<br />
und Sehbehindertenbundes. Der passende Ort also, um mit<br />
Patienten und Ärzten über ihre Erfahrungen mit dem Medikament<br />
zu sprechen. Die vergleichsweise junge AMD-Patientin<br />
berichtete wie auch die anderen Betroffenen über bewahrte<br />
bzw. zurückgewonnene Lebensqualität. Die Bayerin wurde<br />
bereits Ende 2006 als eine der ersten Patientinnen <strong>von</strong> Maier<br />
regelmäßig mit dem VEGF-Hemmer behandelt, im Mai 2008<br />
erhielt sie die bisher letzte Injektion. „Seitdem ist meine AMD<br />
‚trocken‘, ich brauche keine weiteren Spritzen mehr, gehe aber<br />
regelmäßig zur Kontrolle“, berichtete die 56-Jährige, die wieder<br />
über 100 Prozent Sehkraft verfügt.<br />
Die Kombination aus regelmäßiger Kontrolle (SD-OCT, Visusbestimmung,<br />
Ophthalmoskopie) und Wiederbehandlung bei<br />
Verschlechterung hat sich im Praxisalltag schrittweise und aus<br />
34<br />
dem Wissen aus einer Million Patientenjahre etabliert. „Bei<br />
der AMD als erster Indikation mussten wir zunächst einmal<br />
Erfahrungen mit Ranibizumab sammeln. Heute wissen wir,<br />
dass sich die Therapie bewährt hat – sie wurde bei sehr vielen<br />
AMD-Patienten erfolgreich eingesetzt“, fasste Prof. Dr. Nicole<br />
Eter (Münster) die Erkenntnisse der letzten Jahre zusammen.<br />
Dabei hat sich gezeigt, dass es kein einheitliches Dosierungsschema<br />
für alle gibt, vielmehr verläuft die Krankheit bei jedem<br />
Patienten anders, weshalb sich nunmehr das sogenannte<br />
individuelle Pro-re-nata-Behandlungsschema etabliert hat.<br />
Jeder Patient erhält demnach so viele Injektionen wie nötig.<br />
Ein Dosierungsschema, das nicht nur für AMD-Patienten gilt,<br />
sondern auch bei den 2011 erfolgten Indikationserweiterungen<br />
DMÖ und RVV (siehe Grafik).<br />
Möglich wird das durch den Wirkmechanismus. Alle drei<br />
Netzhauterkrankungen beruhen in ihrer Pathophysiologie<br />
zwar auf sehr unterschiedlichen Vorgängen, haben aber die<br />
gleiche Ursache, die der Wirkstoff angreift: eine Überexpression<br />
des Wachstumsfaktors VEGF. Die Überproduktion unterscheidet<br />
sich bei den einzelnen retinalen Erkrankungen und<br />
bei jedem Patienten, was die daraus resultierenden individualisierten,<br />
d.h. auf den jeweiligen Krankheitsverlauf der Patienten<br />
zugeschnittenen Behandlungsschemata erklärt.<br />
Interdisziplinäre Zusammenarbeit verbessern<br />
Dies zeigt auch das Beispiel <strong>von</strong> Detlef P. Bei ihm entdeckte<br />
der Augenarzt Schäden an der Netzhaut, die auf einen Diabetes<br />
mellitus hindeuteten. Er schickte den Patienten zum Hausarzt,<br />
der ihn zum Diabetologen überwies. Dieser stellte den<br />
59-Jährigen medikamentös ein, bevor Dr. Susanne Eller-Woywod,<br />
niedergelassene Augenärztin in Gütersloh, die Behandlung<br />
des diabetischen Makulaödems übernahm. Heute hat sich<br />
P.s Sehleistung nach jeweils drei Injektionen auf mittlerweile<br />
100 Prozent verdoppelt, das rechte Auge leistet wieder 70 Prozent.<br />
Für Eller-Woywod sollte dieses Beispiel Schule machen.<br />
„Damit ein Diabetespatient optimal behandelt werden kann,<br />
müssen wir die bestehenden Strukturen effektiver nutzen und<br />
die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachgrup-<br />
<strong>Concept</strong> <strong>Ophthalmologie</strong><br />
02 / <strong>2012</strong>