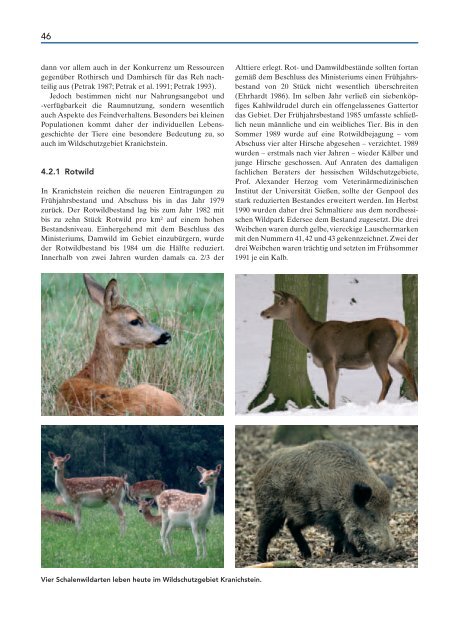Download - Institut für Tierökologie und Naturbildung
Download - Institut für Tierökologie und Naturbildung
Download - Institut für Tierökologie und Naturbildung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
46<br />
dann vor allem auch in der Konkurrenz um Ressourcen<br />
gegenüber Rothirsch <strong>und</strong> Damhirsch <strong>für</strong> das Reh nachteilig<br />
aus (Petrak 1987; Petrak et al. 1991; Petrak 1993).<br />
Jedoch bestimmen nicht nur Nahrungsangebot <strong>und</strong><br />
-verfügbarkeit die Raumnutzung, sondern wesentlich<br />
auch Aspekte des Feindverhaltens. Besonders bei kleinen<br />
Populationen kommt daher der individuellen Lebensgeschichte<br />
der Tiere eine besondere Bedeutung zu, so<br />
auch im Wildschutzgebiet Kranichstein.<br />
4.2.1 Rotwild<br />
In Kranichstein reichen die neueren Eintragungen zu<br />
Frühjahrsbestand <strong>und</strong> Abschuss bis in das Jahr 1979<br />
zurück. Der Rotwildbestand lag bis zum Jahr 1982 mit<br />
bis zu zehn Stück Rotwild pro km² auf einem hohen<br />
Bestandsniveau. Einhergehend mit dem Beschluss des<br />
Ministeriums, Damwild im Gebiet einzubürgern, wurde<br />
der Rotwildbestand bis 1984 um die Hälfte reduziert.<br />
Innerhalb von zwei Jahren wurden damals ca. 2/3 der<br />
Alttiere erlegt. Rot- <strong>und</strong> Damwildbestände sollten fortan<br />
gemäß dem Beschluss des Ministeriums einen Frühjahrsbestand<br />
von 20 Stück nicht wesentlich überschreiten<br />
(Ehrhardt 1986). Im selben Jahr verließ ein siebenköpfiges<br />
Kahlwildrudel durch ein offengelassenes Gattertor<br />
das Gebiet. Der Frühjahrsbestand 1985 umfasste schließlich<br />
neun männliche <strong>und</strong> ein weibliches Tier. Bis in den<br />
Sommer 1989 wurde auf eine Rotwildbejagung – vom<br />
Abschuss vier alter Hirsche abgesehen verzichtet. 1989<br />
wurden erstmals nach vier Jahren wieder Kälber <strong>und</strong><br />
junge Hirsche geschossen. Auf Anraten des damaligen<br />
fachlichen Beraters der hessischen Wildschutzgebiete,<br />
Prof. Alexander Herzog vom Veterinärmedizinischen<br />
<strong>Institut</strong> der Universität Gießen, sollte der Genpool des<br />
stark reduzierten Bestandes erweitert werden. Im Herbst<br />
1990 wurden daher drei Schmaltiere aus dem nordhessischen<br />
Wildpark Edersee dem Bestand zugesetzt. Die drei<br />
Weibchen waren durch gelbe, viereckige Lauschermarken<br />
mit den Nummern 41, 42 <strong>und</strong> 43 gekennzeichnet. Zwei der<br />
drei Weibchen waren trächtig <strong>und</strong> setzten im Frühsommer<br />
1991 je ein Kalb.<br />
Vier Schalenwildarten leben heute im Wildschutzgebiet Kranichstein.