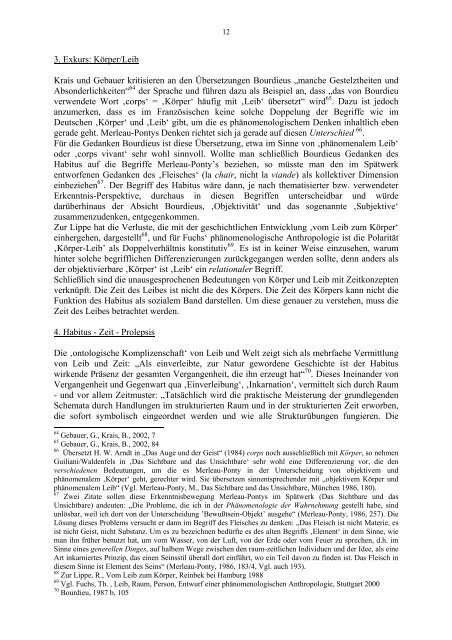Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
3. Exkurs: Körper/Leib<br />
Krais <strong>und</strong> Gebauer kritisieren an den Übersetzungen Bourdieus „manche Gestelztheiten <strong>und</strong><br />
Absonderlichkeiten“ 64 der Sprache <strong>und</strong> führen dazu als Beispiel an, dass „das von Bourdieu<br />
verwendete Wort ‚corps‘ = ‚Körper‘ häufig mit ‚Leib‘ übersetzt“ wird 65 . Dazu ist jedoch<br />
anzumerken, dass es im Französischen keine solche Doppelung der Begriffe wie im<br />
Deutschen ‚Körper‘ <strong>und</strong> ‚Leib‘ gibt, um die es phänomenologischem Denken inhaltlich eben<br />
gerade geht. Merleau-Pontys Denken richtet sich ja gerade auf diesen Unterschied 66 .<br />
Für die Gedanken Bourdieus ist diese Übersetzung, etwa im Sinne von ‚phänomenalem Leib‘<br />
oder ‚corps vivant‘ sehr wohl sinnvoll. Wollte man schließlich Bourdieus Gedanken des<br />
Habitus auf die Begriffe Merleau-Ponty’s beziehen, so müsste man den im Spätwerk<br />
entworfenen Gedanken des ‚Fleisches‘ (la chair, nicht la viande) als kollektiver Dimension<br />
einbeziehen 67 . Der Begriff des Habitus wäre dann, je nach thematisierter bzw. verwendeter<br />
Erkenntnis-Perspektive, durchaus in diesen Begriffen unterscheidbar <strong>und</strong> würde<br />
darüberhinaus der Absicht Bourdieus, ‚Objektivität‘ <strong>und</strong> das sogenannte ‚Subjektive‘<br />
zusammenzudenken, entgegenkommen.<br />
Zur Lippe hat die Verluste, die mit der geschichtlichen Entwicklung ‚vom Leib zum Körper‘<br />
einhergehen, dargestellt 68 , <strong>und</strong> für Fuchs‘ phänomenologische Anthropologie ist die Polarität<br />
‚Körper-Leib’ als Doppelverhältnis konstitutiv 69 . Es ist in keiner Weise einzusehen, warum<br />
hinter solche begrifflichen Differenzierungen zurückgegangen werden sollte, denn anders als<br />
der objektivierbare ‚Körper‘ ist ‚Leib‘ ein relationaler Begriff.<br />
Schließlich sind die unausgesprochenen Bedeutungen von Körper <strong>und</strong> Leib mit Zeitkonzepten<br />
verknüpft. Die Zeit des Leibes ist nicht die des Körpers. Die Zeit des Körpers kann nicht die<br />
Funktion des Habitus als sozialem Band darstellen. Um diese genauer zu verstehen, muss die<br />
Zeit des Leibes betrachtet werden.<br />
4. Habitus - Zeit - Prolepsis<br />
Die ‚ontologische Komplizenschaft‘ von Leib <strong>und</strong> Welt zeigt sich als mehrfache Vermittlung<br />
von Leib <strong>und</strong> Zeit: „Als einverleibte, zur Natur gewordene Geschichte ist der Habitus<br />
wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die ihn erzeugt hat“ 70 . Dieses Ineinander von<br />
Vergangenheit <strong>und</strong> Gegenwart qua ‚Einverleibung‘, ‚Inkarnation‘, vermittelt sich durch Raum<br />
- <strong>und</strong> vor allem Zeitmuster: „Tatsächlich wird die praktische Meisterung der gr<strong>und</strong>legenden<br />
Schemata durch Handlungen im strukturierten Raum <strong>und</strong> in der strukturierten Zeit erworben,<br />
die sofort symbolisch eingeordnet werden <strong>und</strong> wie alle Strukturübungen fungieren. Die<br />
64 Gebauer, G., Krais, B., 2002, 7<br />
65 Gebauer, G., Krais, B., 2002, 84<br />
66 Übersetzt H. W. Arndt in „Das Auge <strong>und</strong> der Geist“ (1984) corps noch ausschließlich mit Körper, so nehmen<br />
Guiliani/Waldenfels in ‚Das Sichtbare <strong>und</strong> das Unsichtbare‘ sehr wohl eine Differenzierung vor, die den<br />
verschiedenen Bedeutungen, um die es Merleau-Ponty in der Unterscheidung von objektivem <strong>und</strong><br />
phänomenalem ‚Körper‘ geht, gerechter wird. Sie übersetzen sinnentsprechender mit „objektivem Körper <strong>und</strong><br />
phänomenalem Leib“ (Vgl. Merleau-Ponty, M., Das Sichtbare <strong>und</strong> das Unsichtbare, München 1986, <strong>18</strong>0).<br />
67 Zwei Zitate sollen diese Erkenntnisbewegung Merleau-Pontys im Spätwerk (Das Sichtbare <strong>und</strong> das<br />
Unsichtbare) andeuten: „Die Probleme, die ich in der Phänomenologie der Wahrnehmung gestellt habe, sind<br />
unlösbar, weil ich dort von der Unterscheidung ’Bewußtsein-Objekt’ ausgehe“ (Merleau-Ponty, 1986, 257). Die<br />
Lösung dieses Problems versucht er dann im Begriff des Fleisches zu denken: „Das Fleisch ist nicht Materie, es<br />
ist nicht Geist, nicht Substanz. Um es zu bezeichnen bedürfte es des alten Begriffs ‚Element‘ in dem Sinne, wie<br />
man ihn früher benutzt hat, um vom Wasser, von der Luft, von der Erde oder vom Feuer zu sprechen, d.h. im<br />
Sinne eines generellen Dinges, auf halbem Wege zwischen den raum-zeitlichen Individuen <strong>und</strong> der Idee, als eine<br />
Art inkarniertes Prinzip, das einen Seinsstil überall dort einführt, wo ein Teil davon zu finden ist. Das Fleisch in<br />
diesem Sinne ist Element des Seins“ (Merleau-Ponty, 1986, <strong>18</strong>3/4, Vgl. auch 193).<br />
68 Zur Lippe, R., Vom Leib zum Körper, Reinbek bei Hamburg 1988<br />
69 Vgl. Fuchs, Th. , Leib, Raum, Person, Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart 2000<br />
70 Bourdieu, 1987 b, 105