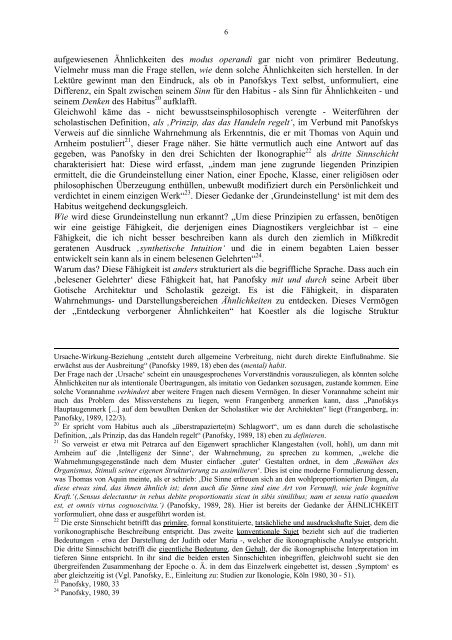Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6<br />
aufgewiesenen Ähnlichkeiten des modus operandi gar nicht von primärer Bedeutung.<br />
Vielmehr muss man die Frage stellen, wie denn solche Ähnlichkeiten sich herstellen. In der<br />
Lektüre gewinnt man den Eindruck, als ob in Panofskys Text selbst, unformuliert, eine<br />
Differenz, ein Spalt zwischen seinem Sinn für den Habitus - als Sinn für Ähnlichkeiten - <strong>und</strong><br />
seinem Denken des Habitus 20 aufklafft.<br />
Gleichwohl käme das - nicht bewusstseinsphilosophisch verengte - Weiterführen der<br />
scholastischen Definition‚ als ‚Prinzip, das das Handeln regelt‘, im Verb<strong>und</strong> mit Panofskys<br />
Verweis auf die sinnliche Wahrnehmung als Erkenntnis, die er mit Thomas von Aquin <strong>und</strong><br />
Arnheim postuliert 21 , dieser Frage näher. Sie hätte vermutlich auch eine Antwort auf das<br />
gegeben, was Panofsky in den drei Schichten der Ikonographie 22 als dritte Sinnschicht<br />
charakterisiert hat: Diese wird erfasst, „indem man jene zugr<strong>und</strong>e liegenden Prinzipien<br />
ermittelt, die die Gr<strong>und</strong>einstellung einer Nation, einer Epoche, Klasse, einer religiösen oder<br />
philosophischen Überzeugung enthüllen, unbewußt modifiziert durch ein Persönlichkeit <strong>und</strong><br />
verdichtet in einem einzigen Werk“ 23 . Dieser Gedanke der ‚Gr<strong>und</strong>einstellung‘ ist mit dem des<br />
Habitus weitgehend deckungsgleich.<br />
Wie wird diese Gr<strong>und</strong>einstellung nun erkannt? „Um diese Prinzipien zu erfassen, benötigen<br />
wir eine geistige Fähigkeit, die derjenigen eines Diagnostikers vergleichbar ist – eine<br />
Fähigkeit, die ich nicht besser beschreiben kann als durch den ziemlich in Mißkredit<br />
geratenen <strong>Ausdruck</strong> ‚synthetische Intuition‘ <strong>und</strong> die in einem begabten Laien besser<br />
entwickelt sein kann als in einem belesenen Gelehrten“ 24 .<br />
Warum das? Diese Fähigkeit ist anders strukturiert als die begriffliche Sprache. Dass auch ein<br />
‚belesener Gelehrter‘ diese Fähigkeit hat, hat Panofsky mit <strong>und</strong> durch seine Arbeit über<br />
Gotische Architektur <strong>und</strong> Scholastik gezeigt. Es ist die Fähigkeit, in disparaten<br />
Wahrnehmungs- <strong>und</strong> Darstellungsbereichen Ähnlichkeiten zu entdecken. Dieses Vermögen<br />
der „Entdeckung verborgener Ähnlichkeiten“ hat Koestler als die logische Struktur<br />
Ursache-Wirkung-Beziehung „entsteht durch allgemeine Verbreitung, nicht durch direkte Einflußnahme. Sie<br />
erwächst aus der Ausbreitung“ (Panofsky 1989, <strong>18</strong>) eben des (mental) habit.<br />
Der Frage nach der ‚Ursache‘ scheint ein unausgesprochenes Vorverständnis vorauszuliegen, als könnten solche<br />
Ähnlichkeiten nur als intentionale Übertragungen, als imitatio von Gedanken sozusagen, zustande kommen. Eine<br />
solche Vorannahme verhindert aber weitere Fragen nach diesem Vermögen. In dieser Vorannahme scheint mir<br />
auch das Problem des Missverstehens zu liegen, wenn Frangenberg anmerken kann, dass „Panofskys<br />
Hauptaugenmerk [...] auf dem bewußten Denken der Scholastiker wie der Architekten“ liegt (Frangenberg, in:<br />
Panofsky, 1989, 122/3).<br />
20 Er spricht vom Habitus auch als „überstrapazierte(m) Schlagwort“, um es dann durch die scholastische<br />
Definition, „als Prinzip, das das Handeln regelt“ (Panofsky, 1989, <strong>18</strong>) eben zu definieren.<br />
21 So verweist er etwa mit Petrarca auf den Eigenwert sprachlicher Klangestalten (voll, hohl), um dann mit<br />
Arnheim auf die ‚Intelligenz der Sinne‘, der Wahrnehmung, zu sprechen zu kommen, „welche die<br />
Wahrnehmungsgegenstände nach dem Muster einfacher ‚guter’ Gestalten ordnet, in dem ‚Bemühen des<br />
Organismus, Stimuli seiner eigenen Strukturierung zu assimilieren‘. Dies ist eine moderne Formulierung dessen,<br />
was Thomas von Aquin meinte, als er schrieb: ‚Die Sinne erfreuen sich an den wohlproportionierten Dingen, da<br />
diese etwas sind, das ihnen ähnlich ist; denn auch die Sinne sind eine Art von Vernunft, wie jede kognitive<br />
Kraft.‘(‚Sensus delectantur in rebus debite proportionatis sicut in sibis similibus; nam et sensu ratio quaedem<br />
est, et omnis virtus cognoscivita.‘) (Panofsky, 1989, 28). Hier ist bereits der Gedanke der ÄHNLICHKEIT<br />
vorformuliert, ohne dass er ausgeführt worden ist.<br />
22 Die erste Sinnschicht betrifft das primäre, formal konstituierte, tatsächliche <strong>und</strong> ausdruckshafte Sujet, dem die<br />
vorikonographische Beschreibung entspricht. Das zweite konventionale Sujet bezieht sich auf die tradierten<br />
Bedeutungen - etwa der Darstellung der Judith oder Maria -, welcher die ikonographische Analyse entspricht.<br />
Die dritte Sinnschicht betrifft die eigentliche Bedeutung, den Gehalt, der die ikonographische Interpretation im<br />
tieferen Sinne entspricht. In ihr sind die beiden ersten Sinnschichten inbegriffen, gleichwohl sucht sie den<br />
übergreifenden Zusammenhang der Epoche o. Ä. in dem das Einzelwerk eingebettet ist, dessen ‚Symptom‘ es<br />
aber gleichzeitig ist (Vgl. Panofsky, E., Einleitung zu: Studien zur Ikonologie, Köln 1980, 30 - 51).<br />
23 Panofsky, 1980, 33<br />
24 Panofsky, 1980, 39