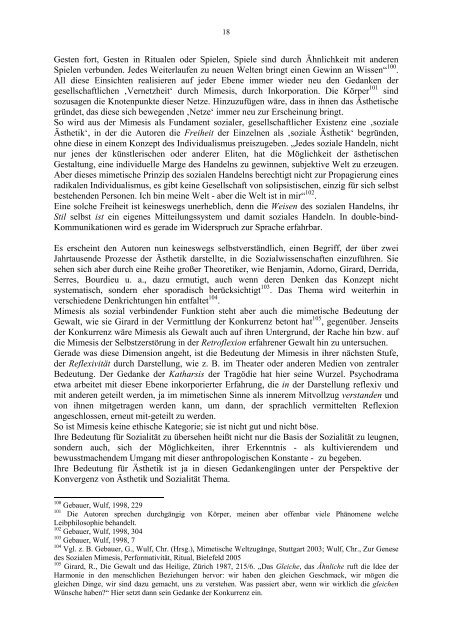Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>18</strong><br />
Gesten fort, Gesten in Ritualen oder Spielen, Spiele sind durch Ähnlichkeit mit anderen<br />
Spielen verb<strong>und</strong>en. Jedes Weiterlaufen zu neuen Welten bringt einen Gewinn an Wissen“ 100 .<br />
All diese Einsichten realisieren auf jeder Ebene immer wieder neu den Gedanken der<br />
gesellschaftlichen ‚Vernetzheit‘ durch Mimesis, durch Inkorporation. Die Körper 101 sind<br />
sozusagen die Knotenpunkte dieser Netze. Hinzuzufügen wäre, dass in ihnen das Ästhetische<br />
gründet, das diese sich bewegenden ‚Netze‘ immer neu zur Erscheinung bringt.<br />
So wird aus der Mimesis als F<strong>und</strong>ament sozialer, gesellschaftlicher Existenz eine ‚soziale<br />
Ästhetik‘, in der die Autoren die Freiheit der Einzelnen als ‚soziale Ästhetik‘ begründen,<br />
ohne diese in einem Konzept des Individualismus preiszugeben. „Jedes soziale Handeln, nicht<br />
nur jenes der künstlerischen oder anderer Eliten, hat die Möglichkeit der ästhetischen<br />
Gestaltung, eine individuelle Marge des Handelns zu gewinnen, subjektive Welt zu erzeugen.<br />
Aber dieses mimetische Prinzip des sozialen Handelns berechtigt nicht zur Propagierung eines<br />
radikalen Individualismus, es gibt keine Gesellschaft von solipsistischen, einzig für sich selbst<br />
bestehenden Personen. Ich bin meine Welt - aber die Welt ist in mir“ 102 .<br />
Eine solche Freiheit ist keineswegs unerheblich, denn die Weisen des sozialen Handelns, ihr<br />
Stil selbst ist ein eigenes Mitteilungssystem <strong>und</strong> damit soziales Handeln. In double-bind-<br />
Kommunikationen wird es gerade im Widerspruch zur Sprache erfahrbar.<br />
Es erscheint den Autoren nun keineswegs selbstverständlich, einen Begriff, der über zwei<br />
Jahrtausende Prozesse der Ästhetik darstellte, in die Sozialwissenschaften einzuführen. Sie<br />
sehen sich aber durch eine Reihe großer Theoretiker, wie Benjamin, Adorno, Girard, Derrida,<br />
Serres, Bourdieu u. a., dazu ermutigt, auch wenn deren Denken das Konzept nicht<br />
systematisch, sondern eher sporadisch berücksichtigt 103 . Das Thema wird weiterhin in<br />
verschiedene Denkrichtungen hin entfaltet 104 .<br />
Mimesis als sozial verbindender Funktion steht aber auch die mimetische Bedeutung der<br />
Gewalt, wie sie Girard in der Vermittlung der Konkurrenz betont hat 105 , gegenüber. Jenseits<br />
der Konkurrenz wäre Mimesis als Gewalt auch auf ihren Untergr<strong>und</strong>, der Rache hin bzw. auf<br />
die Mimesis der Selbstzerstörung in der Retroflexion erfahrener Gewalt hin zu untersuchen.<br />
Gerade was diese Dimension angeht, ist die Bedeutung der Mimesis in ihrer nächsten Stufe,<br />
der Reflexivität durch Darstellung, wie z. B. im Theater oder anderen Medien von zentraler<br />
Bedeutung. Der Gedanke der Katharsis der Tragödie hat hier seine Wurzel. Psychodrama<br />
etwa arbeitet mit dieser Ebene inkorporierter Erfahrung, die in der Darstellung reflexiv <strong>und</strong><br />
mit anderen geteilt werden, ja im mimetischen Sinne als innerem Mitvollzug verstanden <strong>und</strong><br />
von ihnen mitgetragen werden kann, um dann, der sprachlich vermittelten Reflexion<br />
angeschlossen, erneut mit-geteilt zu werden.<br />
So ist Mimesis keine ethische Kategorie; sie ist nicht gut <strong>und</strong> nicht böse.<br />
Ihre Bedeutung für Sozialität zu übersehen heißt nicht nur die Basis der Sozialität zu leugnen,<br />
sondern auch, sich der Möglichkeiten, ihrer Erkenntnis - als kultivierendem <strong>und</strong><br />
bewusstmachendem Umgang mit dieser anthropologischen Konstante - zu begeben.<br />
Ihre Bedeutung für Ästhetik ist ja in diesen Gedankengängen unter der Perspektive der<br />
Konvergenz von Ästhetik <strong>und</strong> Sozialität Thema.<br />
100 Gebauer, Wulf, 1998, 229<br />
101<br />
Die Autoren sprechen durchgängig von Körper, meinen aber offenbar viele Phänomene welche<br />
Leibphilosophie behandelt.<br />
102 Gebauer, Wulf, 1998, 304<br />
103 Gebauer, Wulf, 1998, 7<br />
104 Vgl. z. B. Gebauer, G., Wulf, Chr. (Hrsg.), Mimetische Weltzugänge, Stuttgart 2003; Wulf, Chr., Zur Genese<br />
des Sozialen Mimesis, Performativität, Ritual, Bielefeld 2005<br />
105 Girard, R., Die Gewalt <strong>und</strong> das Heilige, Zürich 1987, 215/6. „Das Gleiche, das Ähnliche ruft die Idee der<br />
Harmonie in den menschlichen Beziehungen hervor: wir haben den gleichen Geschmack, wir mögen die<br />
gleichen Dinge, wir sind dazu gemacht, uns zu verstehen. Was passiert aber, wenn wir wirklich die gleichen<br />
Wünsche haben?“ Hier setzt dann sein Gedanke der Konkurrenz ein.