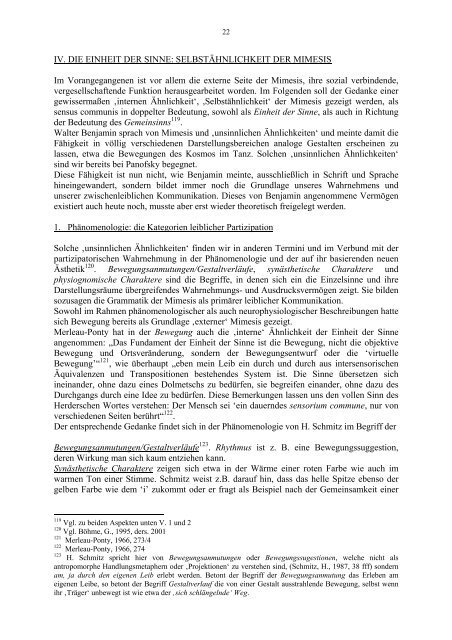Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22<br />
IV. DIE EINHEIT DER SINNE: SELBSTÄHNLICHKEIT DER MIMESIS<br />
Im Vorangegangenen ist vor allem die externe Seite der Mimesis, ihre sozial verbindende,<br />
vergesellschaftende Funktion herausgearbeitet worden. Im Folgenden soll der Gedanke einer<br />
gewissermaßen ‚internen Ähnlichkeit‘, ,Selbstähnlichkeit‘ der Mimesis gezeigt werden, als<br />
sensus communis in doppelter Bedeutung, sowohl als Einheit der Sinne, als auch in Richtung<br />
der Bedeutung des Gemeinsinns 119 .<br />
Walter Benjamin sprach von Mimesis <strong>und</strong> ‚unsinnlichen Ähnlichkeiten‘ <strong>und</strong> meinte damit die<br />
Fähigkeit in völlig verschiedenen Darstellungsbereichen analoge Gestalten erscheinen zu<br />
lassen, etwa die Bewegungen des Kosmos im Tanz. Solchen ‚unsinnlichen Ähnlichkeiten‘<br />
sind wir bereits bei Panofsky begegnet.<br />
Diese Fähigkeit ist nun nicht, wie Benjamin meinte, ausschließlich in Schrift <strong>und</strong> Sprache<br />
hineingewandert, sondern bildet immer noch die Gr<strong>und</strong>lage unseres Wahrnehmens <strong>und</strong><br />
unserer zwischenleiblichen Kommunikation. Dieses von Benjamin angenommene Vermögen<br />
existiert auch heute noch, musste aber erst wieder theoretisch freigelegt werden.<br />
1. Phänomenologie: die Kategorien leiblicher Partizipation<br />
Solche ‚unsinnlichen Ähnlichkeiten‘ finden wir in anderen Termini <strong>und</strong> im Verb<strong>und</strong> mit der<br />
partizipatorischen Wahrnehmung in der Phänomenologie <strong>und</strong> der auf ihr basierenden neuen<br />
Ästhetik 120 . Bewegungsanmutungen/Gestaltverläufe, synästhetische Charaktere <strong>und</strong><br />
physiognomische Charaktere sind die Begriffe, in denen sich ein die Einzelsinne <strong>und</strong> ihre<br />
Darstellungsräume übergreifendes Wahrnehmungs- <strong>und</strong> <strong>Ausdruck</strong>svermögen zeigt. Sie bilden<br />
sozusagen die Grammatik der Mimesis als primärer leiblicher Kommunikation.<br />
Sowohl im Rahmen phänomenologischer als auch neurophysiologischer Beschreibungen hatte<br />
sich Bewegung bereits als Gr<strong>und</strong>lage ‚externer‘ Mimesis gezeigt.<br />
Merleau-Ponty hat in der Bewegung auch die ‚interne‘ Ähnlichkeit der Einheit der Sinne<br />
angenommen: „Das F<strong>und</strong>ament der Einheit der Sinne ist die Bewegung, nicht die objektive<br />
Bewegung <strong>und</strong> Ortsveränderung, sondern der Bewegungsentwurf oder die ‘virtuelle<br />
Bewegung’“ 121 , wie überhaupt „eben mein Leib ein durch <strong>und</strong> durch aus intersensorischen<br />
Äquivalenzen <strong>und</strong> Transpositionen bestehendes System ist. Die Sinne übersetzen sich<br />
ineinander, ohne dazu eines Dolmetschs zu bedürfen, sie begreifen einander, ohne dazu des<br />
Durchgangs durch eine Idee zu bedürfen. Diese Bemerkungen lassen uns den vollen Sinn des<br />
Herderschen Wortes verstehen: Der Mensch sei ‘ein dauerndes sensorium commune, nur von<br />
verschiedenen Seiten berührt“ 122 .<br />
Der entsprechende Gedanke findet sich in der Phänomenologie von H. Schmitz im Begriff der<br />
Bewegungsanmutungen/Gestaltverläufe 123 . Rhythmus ist z. B. eine Bewegungssuggestion,<br />
deren Wirkung man sich kaum entziehen kann.<br />
Synästhetische Charaktere zeigen sich etwa in der Wärme einer roten Farbe wie auch im<br />
warmen Ton einer Stimme. Schmitz weist z.B. darauf hin, dass das helle Spitze ebenso der<br />
gelben Farbe wie dem ‘i’ zukommt oder er fragt als Beispiel nach der Gemeinsamkeit einer<br />
119 Vgl. zu beiden Aspekten unten V. 1 <strong>und</strong> 2<br />
120 Vgl. Böhme, G., 1995, ders. 2001<br />
121 Merleau-Ponty, 1966, 273/4<br />
122 Merleau-Ponty, 1966, 274<br />
123<br />
H. Schmitz spricht hier von Bewegungsanmutungen oder Bewegungssugestionen, welche nicht als<br />
antropomorphe Handlungsmetaphern oder ‚Projektionen‘ zu verstehen sind, (Schmitz, H., 1987, 38 fff) sondern<br />
am, ja durch den eigenen Leib erlebt werden. Betont der Begriff der Bewegungsanmutung das Erleben am<br />
eigenen Leibe, so betont der Begriff Gestaltverlauf die von einer Gestalt ausstrahlende Bewegung, selbst wenn<br />
ihr ‚Träger‘ unbewegt ist wie etwa der ‚sich schlängelnde‘ Weg.