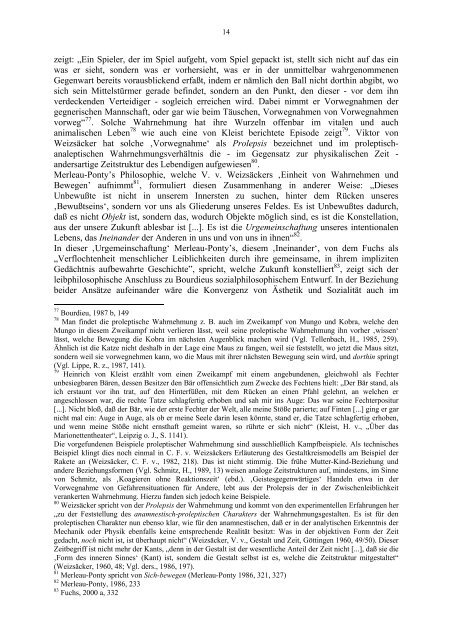Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
14<br />
zeigt: „Ein Spieler, der im Spiel aufgeht, vom Spiel gepackt ist, stellt sich nicht auf das ein<br />
was er sieht, sondern was er vorhersieht, was er in der unmittelbar wahrgenommenen<br />
Gegenwart bereits vorausblickend erfaßt, indem er nämlich den Ball nicht dorthin abgibt, wo<br />
sich sein Mittelstürmer gerade befindet, sondern an den Punkt, den dieser - vor dem ihn<br />
verdeckenden Verteidiger - sogleich erreichen wird. Dabei nimmt er Vorwegnahmen der<br />
gegnerischen Mannschaft, oder gar wie beim Täuschen, Vorwegnahmen von Vorwegnahmen<br />
vorweg“ 77 . Solche Wahrnehmung hat ihre Wurzeln offenbar im vitalen <strong>und</strong> auch<br />
animalischen Leben 78 wie auch eine von Kleist berichtete Episode zeigt 79 . Viktor von<br />
Weizsäcker hat solche ‚Vorwegnahme‘ als Prolepsis bezeichnet <strong>und</strong> im proleptischanaleptischen<br />
Wahrnehmungsverhältnis die - im Gegensatz zur physikalischen Zeit -<br />
andersartige Zeitstruktur des Lebendigen aufgewiesen 80 .<br />
Merleau-Ponty’s Philosophie, welche V. v. Weizsäckers ‚Einheit von Wahrnehmen <strong>und</strong><br />
Bewegen’ aufnimmt 81 , formuliert diesen Zusammenhang in anderer Weise: „Dieses<br />
Unbewußte ist nicht in unserem Innersten zu suchen, hinter dem Rücken unseres<br />
‚Bewußtseins‘, sondern vor uns als Gliederung unseres Feldes. Es ist Unbewußtes dadurch,<br />
daß es nicht Objekt ist, sondern das, wodurch Objekte möglich sind, es ist die Konstellation,<br />
aus der unsere Zukunft ablesbar ist [...]. Es ist die Urgemeinschaftung unseres intentionalen<br />
Lebens, das Ineinander der Anderen in uns <strong>und</strong> von uns in ihnen“ 82 .<br />
In dieser ‚Urgemeinschaftung‘ Merleau-Ponty’s, diesem ‚Ineinander‘, von dem Fuchs als<br />
„Verflochtenheit menschlicher Leiblichkeiten durch ihre gemeinsame, in ihrem impliziten<br />
Gedächtnis aufbewahrte Geschichte”, spricht, welche Zukunft konstelliert 83 , zeigt sich der<br />
leibphilosophische Anschluss zu Bourdieus sozialphilosophischem Entwurf. In der Beziehung<br />
beider Ansätze aufeinander wäre die Konvergenz von Ästhetik <strong>und</strong> Sozialität auch im<br />
77 Bourdieu, 1987 b, 149<br />
78 Man findet die proleptische Wahrnehmung z. B. auch im Zweikampf von Mungo <strong>und</strong> Kobra, welche den<br />
Mungo in diesem Zweikampf nicht verlieren lässt, weil seine proleptische Wahrnehmung ihn vorher ‚wissen‘<br />
lässt, welche Bewegung die Kobra im nächsten Augenblick machen wird (Vgl. Tellenbach, H., 1985, 259).<br />
Ähnlich ist die Katze nicht deshalb in der Lage eine Maus zu fangen, weil sie feststellt, wo jetzt die Maus sitzt,<br />
sondern weil sie vorwegnehmen kann, wo die Maus mit ihrer nächsten Bewegung sein wird, <strong>und</strong> dorthin springt<br />
(Vgl. Lippe, R. z., 1987, 141).<br />
79 Heinrich von Kleist erzählt vom einen Zweikampf mit einem angeb<strong>und</strong>enen, gleichwohl als Fechter<br />
unbesiegbaren Bären, dessen Besitzer den Bär offensichtlich zum Zwecke des Fechtens hielt: „Der Bär stand, als<br />
ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen, mit dem Rücken an einen Pfahl gelehnt, an welchen er<br />
angeschlossen war, die rechte Tatze schlagfertig erhoben <strong>und</strong> sah mir ins Auge: Das war seine Fechterpositur<br />
[...]. Nicht bloß, daß der Bär, wie der erste Fechter der Welt, alle meine Stöße parierte; auf Finten [...] ging er gar<br />
nicht mal ein: Auge in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben,<br />
<strong>und</strong> wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht“ (Kleist, H. v., „Über das<br />
Marionettentheater“, Leipzig o. J., S. 1141).<br />
Die vorgef<strong>und</strong>enen Beispiele proleptischer Wahrnehmung sind ausschließlich Kampfbeispiele. Als technisches<br />
Beispiel klingt dies noch einmal in C. F. v. Weizsäckers Erläuterung des Gestaltkreismodells am Beispiel der<br />
Rakete an (Weizsäcker, C. F. v., 1982, 2<strong>18</strong>). Das ist nicht stimmig. Die frühe Mutter-Kind-Beziehung <strong>und</strong><br />
andere Beziehungsformen (Vgl. Schmitz, H., 1989, 13) weisen analoge Zeitstrukturen auf, mindestens, im Sinne<br />
von Schmitz, als ‚Koagieren ohne Reaktionszeit‘ (ebd.). ‚Geistesgegenwärtiges‘ Handeln etwa in der<br />
Vorwegnahme von Gefahrensituationen für Andere, lebt aus der Prolepsis der in der Zwischenleiblichkeit<br />
verankerten Wahrnehmung. Hierzu fanden sich jedoch keine Beispiele.<br />
80 Weizsäcker spricht von der Prolepsis der Wahrnehmung <strong>und</strong> kommt von den experimentellen Erfahrungen her<br />
„zu der Feststellung des anamnestisch-proleptischen Charakters der Wahrnehmungsgestalten. Es ist für den<br />
proleptischen Charakter nun ebenso klar, wie für den anamnestischen, daß er in der analytischen Erkenntnis der<br />
Mechanik oder Physik ebenfalls keine entsprechende Realität besitzt: Was in der objektiven Form der Zeit<br />
gedacht, noch nicht ist, ist überhaupt nicht“ (Weizsäcker, V. v., Gestalt <strong>und</strong> Zeit, Göttingen 1960, 49/50). Dieser<br />
Zeitbegriff ist nicht mehr der Kants, „denn in der Gestalt ist der wesentliche Anteil der Zeit nicht [...], daß sie die<br />
‚Form des inneren Sinnes‘ (Kant) ist, sondern die Gestalt selbst ist es, welche die Zeitstruktur mitgestaltet“<br />
(Weizsäcker, 1960, 48; Vgl. ders., 1986, 197).<br />
81 Merleau-Ponty spricht von Sich-bewegen (Merleau-Ponty 1986, 321, 327)<br />
82 Merleau-Ponty, 1986, 233<br />
83 Fuchs, 2000 a, 332