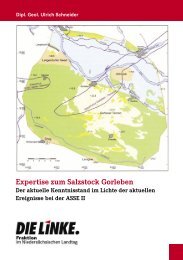Armut und Ausgrenzung verhindern - Das LINKE CMS
Armut und Ausgrenzung verhindern - Das LINKE CMS
Armut und Ausgrenzung verhindern - Das LINKE CMS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Armut</strong> <strong>und</strong> soziale <strong>Ausgrenzung</strong> 34<br />
Medien fokussieren Sicht<br />
der Mittelschicht<br />
<strong>Armut</strong> wird zwar in den Medien zum<br />
Thema, aber nur aus der Sicht der<br />
Mittelschicht. <strong>Das</strong> Schicksal der Ärmsten<br />
bleibt ausgeblendet. Im Herbst vor<br />
drei Jahren begann in Deutschland eine<br />
Debatte über die Bildung einer neuen<br />
Unterschicht, der eine von der Friedrich-<br />
Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie<br />
zugr<strong>und</strong>e lag (Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
2007). <strong>Das</strong> sogenannte Prekariat<br />
wurde als neue Gruppe in der deutschen<br />
Sozialschichtung entdeckt, das nicht<br />
mehr der klassischen Unterschicht<br />
zuzurechnen ist. Vielmehr drohen größere<br />
Teile der Mittelschicht in prekäre<br />
<strong>Armut</strong>slagen abzurutschen (Heitmeyer<br />
2008; Grabka & Frick 2008; Schultheis<br />
2005). In der sich ausbreitenden »Zone<br />
der Gefährdung« sind f<strong>und</strong>amentale<br />
Sicherheiten nicht mehr gegeben, weil<br />
immer mehr Menschen von Arbeitslosigkeit<br />
<strong>und</strong> unsicheren Arbeitsverhältnissen<br />
betroffen sind. Diese Debatte<br />
griffen die Medien auf, weil es um die<br />
Ängste der Mittelschicht geht. Dagegen<br />
tauchen in der Diskussion die dauerhaft<br />
Armen, die soziale Unterschicht,<br />
die Ausgeschlossenen nur am Rande<br />
auf. Während für das Prekariat die Aussicht<br />
auf Wiedergewinnung sozialen<br />
Anschlusses nicht ganz unrealistisch<br />
erscheint, herrscht in den »Zonen der<br />
<strong>Ausgrenzung</strong>« längst lethargische Hoffnungslosigkeit<br />
– also bei Menschen,<br />
die dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen<br />
sind, alten <strong>und</strong> kranken Menschen<br />
sowie MigrantInnen (Castel 2000,<br />
S. 13).<br />
<strong>Armut</strong> als Folge sozialer<br />
<strong>Ausgrenzung</strong><br />
<strong>Armut</strong> ist Folge eines dynamischen<br />
Prozesses sozialer <strong>Ausgrenzung</strong>, man<br />
spricht auch von Exklusion. In der europäischen<br />
Debatte über <strong>Armut</strong>sprozesse<br />
<strong>und</strong> Elendsquartiere hat der Begriff<br />
der Exklusion einige Prominenz erlangt,<br />
nachdem er in die EU-<strong>Armut</strong>s-Berichtserstattung<br />
eingeflossen war (Kronauer<br />
2002; Bude & Willisch 2008). Im direkten<br />
Vergleich mit den gängigen <strong>Armut</strong>skonzepten<br />
geht es bei Exklusion nicht<br />
in erster Linie um eine Zustandsbeschreibung<br />
individuellen Ressourcenmangels.<br />
Vielmehr rücken die sozialen<br />
Prozesse in den Vordergr<strong>und</strong>, die<br />
zum Ausschluss von der gleichberechtigten<br />
Teilhabe am gesellschaftlichen<br />
Reichtum führen. <strong>Armut</strong> ist daher als<br />
Resultat der fortschreitenden Anhäufung<br />
von negativen Selektionsmerkmalen<br />
im Sperrfeuer sich überschneidender<br />
Exklusionsprozesse zu verstehen.<br />
Kronauer (2007) betont, dass es bei<br />
der Exklusion nicht um »<strong>Ausgrenzung</strong><br />
aus der Gesellschaft« gehen kann, sondern<br />
dass es sich um »<strong>Ausgrenzung</strong> in<br />
der Gesellschaft« handelt. Die Unterscheidung<br />
von Zentrum <strong>und</strong> Peripherie<br />
ist fürs Verständnis besser geeignet.<br />
Im Zentrum der Gesellschaft finden<br />
sich jene Sozialräume, die aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Ressourcen- <strong>und</strong> Machtausstattung<br />
besonders attraktiv sind. Im Kampf<br />
um die knappen Güter eines guten <strong>und</strong><br />
schönen Lebens setzen sich besonders<br />
leicht die Bevölkerungsgruppen durch,<br />
die selbst schon am Besten mit Ressourcen<br />
ausgestattet sind: Geld, Bildung <strong>und</strong><br />
Sozialkontakte, Insiderwissen, sozial<br />
angemessene Verhaltenskodizes <strong>und</strong><br />
Unterscheidungsformen, Macht, Status<br />
<strong>und</strong> Prestige. Exklusion bedeutet, dass<br />
den Ausgegrenzten nur die ressourcen<strong>und</strong><br />
statusarmen Peripherien bleiben:<br />
Hochhaussiedlungen im sozialen Wohnungsbau<br />
oder verarmte Innenstadtgettos<br />
<strong>und</strong> prekäre Beschäftigungsverhältnisse.<br />
Hier gelingt der Anschluss<br />
an wichtige Versorgungsbereiche mehr<br />
schlecht als recht.<br />
Exklusion setzt an der unzureichenden<br />
Integration in den Arbeitsmarkt an.<br />
Durch andauernde Arbeitslosigkeit verfestigt<br />
sich rasch die Gewissheit, von<br />
der Gesellschaft nicht gebraucht zu werden,<br />
keine Bedeutung für die Mitmenschen<br />
zu haben, als Überflüssiger entwertet<br />
zu sein (Bude 1998). Auf der anderen<br />
Seite mündet Dauerarbeitslosigkeit<br />
in <strong>Armut</strong>, wodurch sich der Ausschluss<br />
von allen Lebensbereichen, in denen<br />
Geld die Eintrittskarte ist, weiter verschärft.<br />
Doch ziehen die durch <strong>Armut</strong><br />
verursachten Integrationsprobleme bei<br />
Weitem größere Kreise. Die betroffenen<br />
Menschen geraten rasch in den Sog<br />
sozialer Desintegration. Ohne Geld ist<br />
der Anschluss ans soziale Leben, der<br />
Kino-, Theater-, Museumsbesuch, die<br />
Vereinsmitgliedschaft, ein Bier in der<br />
Kneipe, die Einbindung in den arbeitenden<br />
Fre<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Bekanntenkreis nur<br />
schwer aufrechtzuerhalten. Die Verengung<br />
der Lebenskreise grenzt die Entfaltung<br />
der eigenen Persönlichkeit immer<br />
stärker auf die am sozialen Rand vorgef<strong>und</strong>enen<br />
wertlosen Teilhabe- <strong>und</strong> Teilnahme-Möglichkeiten<br />
ein.<br />
Der Ausschluss aus den einzelnen<br />
Lebensfeldern führt schließlich zur Überlagerung<br />
sozialer <strong>Ausgrenzung</strong>sformen,<br />
sodass die von <strong>Armut</strong> betroffenen Menschen<br />
in ein »Feld der Exklusion« eingeschlossen<br />
werden (vgl. auch Kapitel<br />
7 über »<strong>Armut</strong> verfestigt sich«).<br />
»Hat jedoch der Ausschluss aus einem<br />
Folgen für den Einschluß in ein anderes<br />
Subsystem, dann mehren sich die<br />
Mißerfolge <strong>und</strong> verstärkt sich die Abweichung:<br />
Keine zertifizierte Ausbildung,<br />
keine reguläre Beschäftigung, keine<br />
ges<strong>und</strong>e Ernährung, kein ausreichendes<br />
Einkommen, keine dauerhaften Intimbeziehungen,<br />
keine elterliche Verantwortung,<br />
kein Interesse an den politischen<br />
Angelegenheiten, kein Zugang zur<br />
Rechtsberatung, keine ausreichende<br />
Krankenversicherung« (Bude 2008, S. 18).<br />
<strong>Das</strong> Bedrohliche der Exklusion resultiert<br />
daraus, dass es kein punktuelles Phänomen<br />
bleibt (Ludwig-Mayerhofer & Barlösius<br />
2001, S. 45). Wenn die Integration<br />
in die Gesellschaft an einer Stelle<br />
anfängt zu erodieren, dann verstärken<br />
sich die sozialen Abstiegsprozesse<br />
rasch über verschiedene Lebenslagen<br />
hinweg. Arbeitslosigkeit verursacht Einkommensarmut,<br />
beides führt zum Rückzug<br />
vom kulturellen Leben, sodass über<br />
eine Begrenzung der Lebenskreise auch<br />
das Netzwerk an sozialen Beziehungen<br />
schrumpfen wird.<br />
Die individuelle Seite: psychische<br />
Desintegration<br />
Die soziale Seite der Exklusion ergänzt<br />
die individuelle Seite, die man als psychische<br />
Desintegration beschreiben<br />
kann. Wie wir aus der psychologischen<br />
Stress- <strong>und</strong> Belastungsforschung<br />
wissen, führen erschwerte Lebensumstände,<br />
die unter <strong>Armut</strong> <strong>und</strong> <strong>Ausgrenzung</strong><br />
entstehen, zur Resignation, zur<br />
Hilflosigkeit, zum individuellen Rückzug<br />
(Bonß, Keupp & Koenen 1984). Mit<br />
wachsendem Abstand zum gesellschaftlichen<br />
Leben schwinden alle Hoffnungen,<br />
jemals den Weg zurück in die legitimen<br />
Sphären der Teilhabe <strong>und</strong> Anerkennung<br />
zu finden. Damit vollziehen die<br />
Betroffenen ihren sozialen Ausschluss<br />
in gewissem Sinne selbst. Um eine Indi-