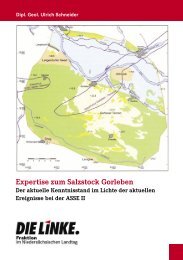Armut und Ausgrenzung verhindern - Das LINKE CMS
Armut und Ausgrenzung verhindern - Das LINKE CMS
Armut und Ausgrenzung verhindern - Das LINKE CMS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Armut</strong> <strong>und</strong> soziale <strong>Ausgrenzung</strong> 36<br />
ergibt, zerstört schließlich das psychische<br />
F<strong>und</strong>ament der eigenen Selbstbejahung<br />
<strong>und</strong> Selbstakzeptanz (Margalit<br />
1997, S. 43).<br />
Praktische <strong>und</strong> politische<br />
Konsequenzen<br />
Am Ende meines Beitrags möchte<br />
ich abschließend einen Ausblick auf<br />
die praktischen <strong>und</strong> politischen Konsequenzen<br />
geben, die aus den dargelegten<br />
Bef<strong>und</strong>en zu ziehen sind. Dabei<br />
sollte deutlich geworden sein, dass sich<br />
<strong>Armut</strong> nicht auf Einkommensarmut reduzieren<br />
lässt. Zur Abschaffung von <strong>Armut</strong><br />
reicht es nicht aus, nur das Arbeitslosengeld<br />
II zu erhöhen. Denn die soziale<br />
<strong>Ausgrenzung</strong> enthält dem betroffenen<br />
Menschen allgemeine Lebenschancen<br />
vor <strong>und</strong> macht ihn dadurch als Person<br />
überflüssig. Aus dieser sozialen<br />
Entwertung ergibt sich schließlich die<br />
viel zu beobachtende Resignation <strong>und</strong><br />
Selbstaufgabe. Die Betroffenen kümmern<br />
sich nicht mehr um zentrale Alltagsbereiche,<br />
um Arbeit, Einkommen,<br />
Wohnung <strong>und</strong> soziale Kontakte. Die<br />
Frage lautet also, was ist zu unternehmen,<br />
um diese Dynamik von sozialer<br />
Exklusion <strong>und</strong> individueller Desintegration<br />
zu durchbrechen? Nur dann werden<br />
<strong>Armut</strong>, Elend, Tristesse, Not <strong>und</strong> Leid<br />
nicht mehr das Schicksal so vieler Menschen<br />
sein.<br />
Bürgergeld einführen<br />
Am Anfang steht die Einführung eines<br />
Bürgergeldes, das für einen auskömmlichen,<br />
abgesicherten <strong>und</strong> schamfreien<br />
Lebensunterhalt sorgt. <strong>Das</strong> Bürgergeld<br />
muss oberhalb des soziokulturellen Existenzminimums<br />
liegen, um <strong>Armut</strong> <strong>und</strong><br />
Ausschluss wirkungsvoll <strong>und</strong> dauerhaft<br />
zu bekämpfen (Gorz 2000, S. 110 ff.).<br />
<strong>Das</strong> ist besonders wichtig, weil die F<strong>und</strong>amente<br />
der Arbeitsgesellschaft erodieren.<br />
Aufgr<strong>und</strong> struktureller Voraussetzungen<br />
ist mit Vollbeschäftigung<br />
nicht mehr zu rechnen. <strong>Das</strong> Bürgergeld<br />
muss deshalb soziale Sicherung auf<br />
dem Niveau eines sozial akzeptablen<br />
Lebensstandards garantieren – unabhängig<br />
von der Präsenz auf dem Arbeitsmarkt<br />
(Sonnenfeld 2001, S. 82). Aufgr<strong>und</strong><br />
von Massenarbeitslosigkeit geht es hier<br />
um die Verwirklichung eines sozialen<br />
Gr<strong>und</strong>rechts. Sicherlich muss darüber<br />
gesprochen, diskutiert <strong>und</strong> gestritten<br />
werden, was sich genau als soziokulturell<br />
akzeptabler Lebensstandard definieren<br />
lässt. Dieser liegt aufgr<strong>und</strong> vorliegender<br />
Erfahrungswerte auf jeden<br />
Fall oberhalb der jetzigen Bezugshöhen<br />
des Arbeitslosengelds II. Ohne konkrete<br />
Modelle hier diskutieren zu können, darf<br />
Bürgergeld aber nicht wie bisher als ein<br />
Almosen gegeben werden (hierzu etwa<br />
Engler 2005). Es muss einen allgemeinen<br />
Rechtsanspruch geben, der dem<br />
Einzelnen nicht entzogen werden kann,<br />
damit der Bezug von Sozialleistungen<br />
nicht zur entwürdigenden Bittstellerei<br />
wird.<br />
Neue Integrations- <strong>und</strong> Anerkennungsformen<br />
Die Einführung eines Bürgergelds darf<br />
nicht auf eine moralische Entlastung<br />
der Gesellschaft von der Verantwortung<br />
für sozialen Ausschluss reduziert<br />
bleiben. Ein besonderer Stellenwert<br />
kommt der Schaffung neuer Integrations-<br />
<strong>und</strong> Anerkennungsformen zu. Nur<br />
dann können die Ausgeschlossenen <strong>und</strong><br />
sozial Benachteiligten tatsächlich den<br />
Status eines vollwertigen Mitglieds der<br />
modernen Gesellschaft erlangen. Um<br />
<strong>Armut</strong> aufzuheben, müssen die Integrationspfade<br />
in die Gesellschaft, in<br />
die verschiedensten Institutionen <strong>und</strong><br />
Lebensbereiche für alle Menschen verlässlich<br />
offen stehen. Die Teilhabechancen<br />
am gesellschaftlichen Leben dürfen<br />
nicht soziale Ungleichheiten nach<br />
dem Prinzip weiter festigen: Derjenige,<br />
der nichts hat, bleibt auch von allen<br />
anderen Dingen ausgeschlossen. Wertschätzung<br />
<strong>und</strong> Achtung in der Gesellschaft<br />
dürfen kein knappes Gut mehr<br />
sein, sondern müssen zu einer Selbstverständlichkeit<br />
im sozialen Umgang<br />
miteinander werden. Dabei geht es<br />
nicht allein um eine Veränderung von<br />
Moral, Werten <strong>und</strong> Verhalten. Jeder<br />
Mensch muss eine sinnvolle Aufgabe<br />
in seinem Leben übernehmen können,<br />
über die er Würde <strong>und</strong> Selbstachtung<br />
erlangen kann. Arbeit ist nicht nur bloßes<br />
Mittel der Existenzsicherung. Vielmehr<br />
begründen sich aus einer umfassenden<br />
Teilhabe <strong>und</strong> Teilnahme am<br />
sozialen Leben elementare Selbstbestimmungs-<br />
<strong>und</strong> Mitbestimmungsrechte.<br />
Anstatt die Menschen durch Ein-Euro-<br />
Jobs zu ihrem »Glück« zu zwingen,<br />
könnte man mit ihnen gemeinsam überlegen,<br />
welche Arbeiten sie sich zutrauen,<br />
wo sie gebraucht werden, ob sie vielleicht<br />
selbst Projekte entwerfen wollen<br />
(Willisch 2008, S. 329 ff.). Ein zweiter<br />
Arbeitsmarkt abseits vom Verwertungsdruck<br />
könnte niedrigschwellige Arbeitsmöglichkeiten<br />
für diejenigen schaffen,<br />
die aufgr<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher, physischer<br />
<strong>und</strong> psychischer Einschränkungen<br />
nicht mehr in der Konkurrenzgesellschaft<br />
mithalten können. Die Arbeit<br />
müsste wieder lernen, sich den Menschen<br />
zuzuwenden, anstatt über Rationalisierungsprogramme<br />
nur noch darauf<br />
zu zielen, den Einzelnen überflüssig<br />
zu machen. Arbeit ist andererseits<br />
nicht alles. Die Integrationspfade müssen<br />
sich auch in andere Gesellschaftsbereiche<br />
öffnen, indem auf ganz unterschiedlichen<br />
Ebenen Beteiligungsformen<br />
geschaffen werden, die nicht überfordern<br />
<strong>und</strong> wieder ausgrenzend wirken.<br />
Psychosoziale Unterstützungsangebote<br />
für die Müden, Hilflosen <strong>und</strong> Resignierten<br />
müssen ausgebaut werden. Es<br />
reicht nicht, nur für soziale Absicherung<br />
<strong>und</strong> ein Angebot auf Integration<br />
<strong>und</strong> Anerkennung zu sorgen, wenn die<br />
Menschen den Glauben an ihre Fähigkeiten<br />
<strong>und</strong> Möglichkeiten längst verloren<br />
haben. Professionelle Unterstützung<br />
als auch freiwillige Gemeinwesenarbeit<br />
sollen Menschen ein niedrigschwelliges<br />
Integrationsangebot mit menschlichem<br />
Antlitz unterbreiten. Im Mittelpunkt<br />
muss dabei der Aufbau von positiven<br />
Erfahrungs- <strong>und</strong> Handlungsbereichen<br />
stehen. Diese können das biographisch<br />
angelegte Misstrauen derjenigen,<br />
die gegenüber Gesellschaft,<br />
Arbeitsmarkt <strong>und</strong> bürokratischen Institutionen<br />
ihren Ausschluss erfahren haben,<br />
überwinden. Dafür müssen psychosoziale<br />
Angebote stärker vernetzt <strong>und</strong><br />
auf Kooperation ausgerichtet sein, um<br />
adäquat helfen <strong>und</strong> unterstützen zu<br />
können, ohne selbst wieder ausgrenzend<br />
zu wirken. Gerade Menschen aus<br />
<strong>Armut</strong>slagen reagieren häufig gegenüber<br />
den Institutionen der Gesellschaft,<br />
die sie als ausgrenzend erlebt haben,<br />
mit einer gehörigen Portion Misstrauen.<br />
Dabei darf sich die psychosoziale Pro-