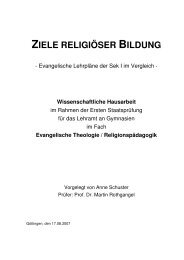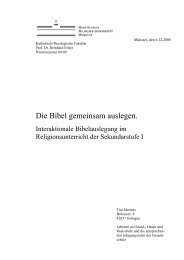Interaktivität - Theo-Web
Interaktivität - Theo-Web
Interaktivität - Theo-Web
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
200 Daniel Schüttlöffel: Bibeldidaktische Interaktionsangebote in multimedialen Kinderbibeln<br />
3.7.2 Freiarbeit und Freiarbeitsmaterialien<br />
Im Freiarbeitsansatz wird selbstständiges Lernen konkret. HORST KLAUS BERG<br />
definiert „Freiarbeit“ aus der Sicht der Schüler/innen als „eine Form des Lernens,<br />
die sich an den individuellen Bedürfnissen des einzelnen Lernenden ausrichtet<br />
und einen Prozess selbstständiger Arbeit ermöglicht“ (Berg 1998, 82). Worin die<br />
individuellen Bedürfnisse bestehen und was zu einem Prozess selbstständigen und<br />
aneignungsorientierten Lernens gehört, präzisiert CHRISTINE LEHMANN (1999,<br />
279; 2007, 274) unter Berücksichtigung des von ihr entwickelten Konzepts selbstständigen<br />
Lernens: „Unter Freiarbeit ist die Freiheit des Lernenden zu verstehen,<br />
Inhalte und Materialien entlang eigener Fragen und Interessen auszuwählen, zu<br />
bearbeiten und dabei auch über Ziele, Zeitenteilung, Arbeitsmethoden, Ergebnisdokumentation<br />
sowie Sozialpartner selbst zu entscheiden.“ Sie weist nachdrücklich<br />
darauf hin, dass Freiarbeit im Unterschied zu anderen Formen selbstgesteuerten<br />
Lernens auch die freie Wahl des Inhalts erlaubt. Indem Freiarbeit diese Möglichkeiten<br />
der Selbst- bzw. (im Hinblick auf konkreten Unterricht) Mitbestimmung<br />
hinsichtlich der eigenen Lernprozesse gewährt, „trägt [sie] im Rahmen allgemeiner<br />
Bildung dazu bei, den Prozeß der Subjektwerdung, d.h. die Entwicklung zu einem<br />
erfahrungs- und handlungsfähigen Subjekt in Individualität, Sozialität und Mitgeschöpflichkeit<br />
zu unterstützen“ (Lehmann 1999, 279).<br />
LEHMANN sieht indes die Bedeutung des Freiarbeitsansatzes nicht auf die<br />
(Selbst)Bildung des Kindes beschränkt, sondern innerhalb der (Religions)Didaktik<br />
umfassender: „Freiarbeit als eine Dimension Offenen Unterrichts spielt in pädagogischer,<br />
allgemein- und fachdidaktischer Praxis und <strong>Theo</strong>rie im Zusammenhang<br />
mit einer inneren Reform der Schule [...] eine zunehmend wichtige Rolle“<br />
(Lehmann 1999, 279). Dass Freiarbeit mehr ist als eine Methode wird auch bei<br />
BERG deutlich, der Jahre nach seiner ersten Definition Freiarbeit als pädagogisches<br />
Konzept so umschreibt: „Es ist vor allem gekennzeichnet durch eine verändertes<br />
Menschenbild (Selbstverantwortung), durch eine veränderte Kindorientierung<br />
(Selbsttätigkeit), einen veränderten Unterrichtsanspruch (Leistung und<br />
Differenzierung), einen veränderten Lernbegriff (aktiver Umgang mit Wissen)<br />
und eine veränderte Berufsrolle der Lehrenden (Diagnose, Beratung, Förderung)“<br />
(Berg 2002, 56).<br />
Wenn Freiarbeit jeder Schüler/in die freie Wahl von Lerninhalten, Methoden und<br />
Sozialform lässt, kann es nicht mehr Aufgabe der Lehrkraft sein, jede Schüler/in<br />
dahingehend individuell zu beraten. Stattdessen tritt die Lehrkraft zurück und<br />
stellt ein vorbereitetes Lernarrangement bereit, an dem sich die Schüler/innen<br />
orientieren können, aus dem sie wählen können und das mögliche Sozialformen<br />
anzeigt. Schwerpunkt der Lehrertätigkeit wird die Konzeption und ständige Anpassung<br />
und Verbesserung des Lernarrangements. Wesentliches Element des<br />
Lernarrangements sind Freiarbeitsmaterialien. Ihre Relevanz für „neue Formen<br />
des Lehrens und Lernens“ wird z.B. in einer von LEHMANN durchgeführten<br />
Befragung von vierzig Lehrer/innen deutlich (vgl. Lehmann 1999, 31f): Auf die<br />
Frage nach notwendigen Hilfen für die Durchführung von Freiarbeit rangieren die<br />
Materialien an erster Stelle. Außerdem spiegelt sich die Mittelpunktstellung der<br />
Freiarbeitsmaterialien im reichhaltigen Angebot von Verlagen; LEHMANN berichtet<br />
sogar von der Neugründung zahlreicher kleinerer Verlage, die sich auf die<br />
Entwicklung entsprechender Materialien spezialisiert haben (vgl. Lehmann 1999,<br />
33).<br />
Auffallend sei die didaktische Vielfalt von Freiarbeitsmaterialien, die nach<br />
LEHMANN ab ca. 1990 einsetzt. LEHMANN kritisiert, dass die Materialien der<br />
ersten und zweiten Generation „in ihrer didaktischen Funktion häufig als Wieder-