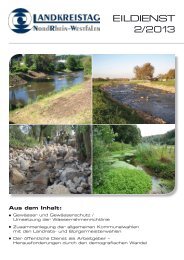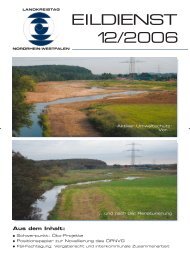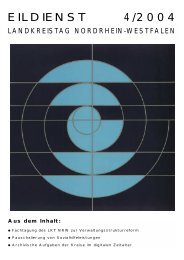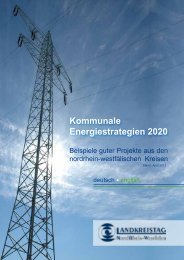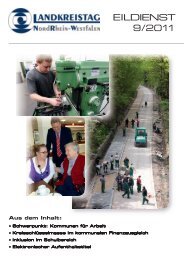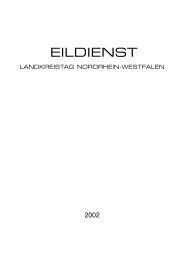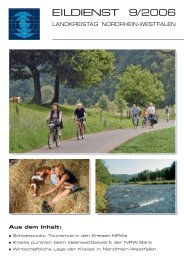Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Themen<br />
können deshalb nicht mehr sein als eine<br />
Zwischenbilanz, die zudem gewiss nicht<br />
alle Aspekte des Systemwechsels ausleuchten<br />
kann. Insbesondere fehlt es an einer<br />
grundlegenden, durch Tatsachenmaterial<br />
erhärteten Untersuchung über die Auswirkungen,<br />
die der Systemwechsel auf die<br />
Aufgabenerledigung in den Kreisen gehabt<br />
hat 2 . Was die hauptamtlichen Landräte<br />
insoweit neu und anders gemacht haben,<br />
kann nur beispielhaft und damit kursorisch<br />
angesprochen werden. Ob damit ein der<br />
Realität entsprechendes Bild der Verwaltungswirklichkeit<br />
in den Kreisen gezeichnet<br />
werden kann, erscheint schon deshalb<br />
zweifelhaft. Unmöglich ist es aber, schon<br />
jetzt die Dimension der Veränderung in der<br />
Verwaltungswirklichkeit und der Politik in<br />
den Kreistagen festzustellen. Hierfür fehlt<br />
die Datenbasis. Die Zeit seit Vollzug des<br />
Systemwechsels ist wohl auch noch zu<br />
kurz, um eine wirkliche Bilanz ziehen zu<br />
können. Die folgenden Ausführungen sollten<br />
deshalb lediglich als eine erste vorläufige<br />
und vorsichte Bewertung verstanden<br />
werden. Hinzu kommt, dass der Verfasser<br />
ein externer Beobachter ist, der die politische<br />
Wirklichkeit in den Kreisen selbst nicht<br />
unmittelbar erlebt – und zudem als Verbandsgeschäftsführer<br />
nicht schlecht über<br />
„seine“ Kreise und Landräte reden sollte<br />
und möchte. Auch das erleichtert das<br />
Unterfangen, eine erste Bilanz zu ziehen,<br />
nicht unbedingt.<br />
Dem Thema möchte ich mich in vier Schritten<br />
nähern. Zunächst soll die Diskussion<br />
um den Systemwechsel in den nordrheinwestfälischen<br />
Kreisen noch einmal kurz<br />
aufgegriffen werden. Sodann will ich auf<br />
die neue Aufgabenstruktur für die hauptamtlichen<br />
Landräte in Nordrhein-Westfalen<br />
und danach auf das eigentlich interessante<br />
Feld, nämlich die Lebenswirklichkeit<br />
in den Kreisen eingehen. Abschließend<br />
möchte ich dann noch einen Blick in die<br />
Zukunft wagen, wobei ich Änderungsbedarf<br />
nicht aussparen werde.<br />
2<br />
Die Untersuchungen von Klaus Schulenburg,<br />
Direktwahl und kommunalpolitische Führung,<br />
1999, bzw. Die Kommunalpolitik in den Kreisen<br />
Nordrhein-Westfalens, 2001, befassen sich mit<br />
der Einschätzung der Abschaffung der Doppelspitze,<br />
nicht hingegen mit den Auswirkungen auf<br />
die Kommunalpolitik in den Kreisen.<br />
3<br />
Den Verlauf der Diskussion zeichnen nach: Anne-<br />
Kathrin Lingk, die Reform der nordrhein-westfälischen<br />
Kommunalverfassung, 1999, S. 111 ff.,<br />
und Schulenburg, Direktwahl, S. 105 ff.<br />
4<br />
Dazu Rossa, Stadtverwaltung zwischen Leistungskraft<br />
und Vasallentum, StuGR 1987, 239,<br />
243; Schleberger, Zur Reformbedürftigkeit des<br />
Kommunalverfassungsrechts in Nordrhein-Westfalen,<br />
NWVBL 1988, 161, 163 f.; Behrens/Bock,<br />
Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung –<br />
Durch Änderung der Kommunalverfassung<br />
Nordrhein-Westfalen, NWVBL 1988, 357, 358.<br />
Vgl. auch Schulenburg, Direktwahl, S. 107.<br />
2. Das Für und Wider in der<br />
Diskussion um die Änderung<br />
der Kreisordnung NW<br />
Über die Reform der Kommunalverfassung<br />
im Jahre 1994 ist lange diskutiert worden 3 .<br />
Zu Beginn ging es um eine Stärkung des<br />
Ehrenamtes. Konstatiert wurde insoweit<br />
eine zeitliche Überlastung der ehrenamtlichen<br />
Ratsmitglieder, eine Parteipolitisierung<br />
der Rats- und Verwaltungsarbeit<br />
sowie eine mangelnde Eindeutigkeit der<br />
Kompetenzabgrenzung zwischen Rat und<br />
Hauptverwaltungsbeamten 4 . In dem sogenannten<br />
„Schleberger-Papier“, das von<br />
einer Kommission der KPV am 26. September<br />
1987 vorgelegt wurde 5 , ging es vor<br />
allem darum, Steuerungs- und Kontrollkompetenzen<br />
des Rates zu konzentrieren,<br />
indem etwa der Ausschließlichkeitskatalog<br />
nach § 28 GO a. F. reduziert und die kommunale<br />
Führung gestärkt werden sollte.<br />
Seinerzeit ist erstmals vorgeschlagen worden,<br />
Ratsvorsitz und Verwaltungsleitung<br />
auf einen hauptamtlichen Bürgermeister zu<br />
konzentrieren und die bis dahin bestehende<br />
Zweiköpfigkeit aufzugeben, damit eine<br />
bessere Kompetenzabgrenzung zwischen<br />
Rat und Hauptverwaltungsbeamten<br />
ermöglicht werden konnte 6 . In der SPD<br />
war diese Lösung lange Zeit umstritten.<br />
Der Hagener Parteitag vom 14./15.<br />
Dezember 1991 hatte sich für die Beibehaltung<br />
der Doppelspitze ausgesprochen.<br />
Dieser Beschluss wurde erst während des<br />
laufenden Gesetzgebungsverfahrens auf<br />
dem Parteitag am 15./16. Januar 1994 in<br />
Bielefeld aufgehoben; auch die SPD hat<br />
sich seinerzeit für die Zusammenlegung<br />
der Ämter des Bürgermeisters und des<br />
Gemeindedirektors sowie des Landrates<br />
und des Oberkreisdirektors ausgesprochen<br />
7 . Ob eine tiefe Überzeugung von der<br />
Richtigkeit dieser Entscheidung hierfür<br />
maßgebend gewesen ist, lässt sich heute<br />
kaum noch aufklären. Große Bedeutung<br />
dürfte aber das Vorhaben der CDU gehabt<br />
5<br />
Abgedruckt in StuGR 1987, Heft 11, S. I ff. und<br />
bei Mombaur, Neue Kommunalverfassung für<br />
Nordrhein-Westfalen?, 1988, S. 101 ff.<br />
6<br />
Mombauer, Neue Kommunalverfassung für<br />
Nordrhein-Westfalen, 1988, S. 101 ff.<br />
7<br />
Dazu Oebbecke, Die neue Kommunalverfassung<br />
in Nordrhein-Westfalen, DÖV 1995, 701,<br />
7<strong>02</strong>.; zur Diskussion der Novellierung der<br />
Gemeindeordnung ausführlich Schulenburg,<br />
Direktwahl, S. 106 ff; Anne-Kathrin Lingk, Die<br />
Reform der nordrhein-westfälischen Kommunalverfassung1999,<br />
S. 111 – 213.<br />
8<br />
Vgl. Held/Wilmbusse, Das neue Kommunalverfassungsrecht<br />
Nordrhein-Westfalen, 1994, S.<br />
14; Schulenburg, Direktwahl, S. 113.<br />
9<br />
Schulenburg, ebd., S. 113.<br />
10<br />
Über Einordnung der neuen Kommunalverfassung<br />
in Nordrhein-Westfalen als „nordrheinwestfälische<br />
Ratsverfassung" Oebbecke,<br />
DÖV 1995, 7<strong>04</strong>.<br />
haben, über die Frage der Direktwahl ein<br />
Volksbegehren abhalten zu lassen 8 . Wichtig<br />
ist weiter, dass die Mehrheit innerhalb<br />
der SPD „erkauft“ wurde durch gleichzeitige<br />
Festlegung auf die Direktwahl und die<br />
Verbindung von Rats- und Bürgermeisterwahl<br />
durch identische Wahlperioden 9 .<br />
Letztlich haben sich politisch die Befürworter<br />
einer Angleichung der nordrhein-westfälischen<br />
Kommunalverfassung an die süddeutsche<br />
Ratsverfassung durchgesetzt 10 .<br />
Unumstritten war die Zusammenführung<br />
der Ämter von Bürgermeister und Gemeindedirektor<br />
sowie Landrat und Oberkreisdirektor<br />
dabei keineswegs. Das gilt auch für<br />
die Änderungen, die auf der Kreisebene<br />
vollzogen worden sind.<br />
Im Gegensatz zu gewissen Verschränkungs-<br />
und Überschneidungsproblemen<br />
bei verschiedenen Organen auf der<br />
Gemeindeebene, die vor allem für die<br />
Großstädte konstatiert worden sind 11 , hat<br />
der <strong>Landkreistag</strong> Nordrhein-Westfalen für<br />
die nordrhein-westfälischen Kreise festgestellt,<br />
dass es Probleme dieser Art mit<br />
erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten<br />
zwischen den einzelnen Organen auf der<br />
Kreisebene nicht gegeben hat. Hier war<br />
die Überzeugung groß, dass sich das bisherige<br />
System der Funktionsteilung zwischen<br />
ehrenamtlichem Landrat und Oberkreisdirektoren<br />
nachhaltig bewährt hat 12 .<br />
Dabei spielte eine bedeutende Rolle, dass<br />
die Funktionsabgrenzung zwischen Oberkreisdirektor<br />
und Kreistag in der Kreisverfassung<br />
auch in der Vergangenheit besser<br />
gelungen war als dies bei der Gemeindeordnung<br />
der Fall war. So gab es auch früher<br />
schon eine unentziehbare Zuständigkeit<br />
des Oberkreisdirektors für Geschäfte<br />
der laufenden Verwaltung; das Rückholrecht<br />
des Kreistages und damit eine Ursache<br />
für das Problem der Machtverschränkung<br />
auf der Gemeindeebene ist in der<br />
Kreisordnung unbekannt. Nach § 26 Abs.<br />
1 Satz 1, 2. Halbs. KrO NW steht dem<br />
Kreistag neben den enumerativ aufgeführ-<br />
11<br />
Dazu Rossa, Stadtverwaltung zwischen Leistungskraft<br />
und Vasallentum, StuGR 1987, 239,<br />
243; Sc hleberger, Zur Reformbedürftigkeit<br />
des Kommunalverfassungsrechts in Nordrhein-<br />
Westfalen, NWVBL 1988, 161, 163 f.; B e h -<br />
r e n s / B o c k, Sicherung der kommunalen<br />
Selbstverwaltung – Durch Änderung der Kommunalverfassung<br />
Nordrhein-Westfalen, NWVBL<br />
1988, 357, 358.<br />
12<br />
Dazu Lingk, Reform, S. 129 f. Vgl. auch B o r -<br />
cherding, Abschaffung der Doppelspitze<br />
und Perspektiven der neuen Kommunalverfassung,<br />
ED LKT NW 1999, 403, 403 f.; Leiding<br />
e r, Revision des kommunalen Verfassungsrecht<br />
– notwendig und sinnvoll, ED LKT NW<br />
1989, 345, 347. Dies entsprach im übrigen<br />
auch der generellen Einschätzung für den<br />
kreisangehörigen Raum. Dazu Behrens/<br />
B o c k, NWVBL 1988, 358.<br />
145