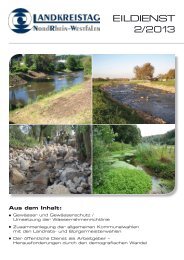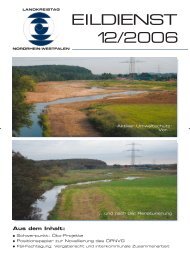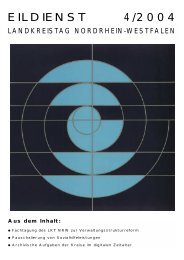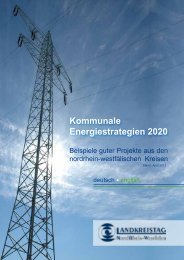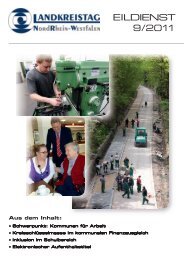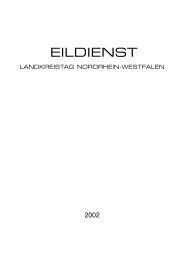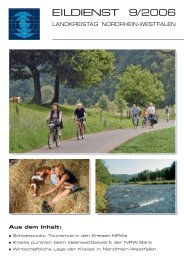Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hinweise auf Veröffentlichungen<br />
Bestimmung eines Lebenspartnerschaftsnamens<br />
oder für die Lebenspartnerschaftsurkunde,<br />
erleichtern die Umsetzung dieses neuen Rechtsinstitutes<br />
in der Praxis.<br />
Besonders hilfreich ist die Aufbereitung der speziellen<br />
Regelungen in den einzelnen Bundesländern.<br />
Diese länderspezifischen Ausführungsbestimmungen<br />
sind zusätzlich in einer Gesamtübersicht<br />
anschaulich zusammengestellt, sodass<br />
die Unterschiede auf den ersten Blick erkennbar<br />
sind.<br />
Für Standesbeamte, Sachbearbeiter in den<br />
jeweils zuständigen Behörden, Notare und<br />
Gemeindevorstände, die mit der Umsetzung des<br />
Lebenspartnerschaftsgesetzes betraut sind, bietet<br />
diese Darstellung eine unentbehrliche<br />
Arbeitshilfe. Ebenso erhalten Meldebehörden<br />
und Sozialämter wertvolle Einblicke in die neue<br />
Materie.<br />
Andreas Stadler, Die Enteignung zur<br />
Verwirklichung von Festsetzungen eines<br />
Bebauungsplans, Reihe: Beiträge zur<br />
Raumplanung und zum Siedlungs- und<br />
Wohnungswesen, Band 201, 2001, 323<br />
Seiten, € 24,00, ISBN 3-88497,-178-6,<br />
ZIR Zentralinstitut für Raumplanung an der<br />
Universität Münster, Wilmergasse 12 - 13,<br />
48143 Münster.<br />
Bei der in § 85 Abs. 1 Nr. 1 BauGB geregelten<br />
Enteignung zur Verwirklichung von Festsetzungen<br />
eines Bebauungsplans handelt es sich um<br />
die praktisch bedeutsamste städtebauliche Enteignung.<br />
Der Zweck der Enteignung besteht<br />
darin, die Festsetzungen des Bebauungsplans zu<br />
vollziehen und mittels staatlichen Zwangs<br />
durchzusetzen. Die Enteignung ist dabei an den<br />
Bebauungsplan gebunden und gleichzeitig<br />
durch ihn legitimiert; sie ist planakzessorisch.<br />
Der Verfasser arbeitet heraus, dass die bebauungsplanakzessorische<br />
Enteignung im Gegensatz<br />
zum zweistufig angelegten Regelmodell der<br />
Administrativenteignung dreistufig angelegt ist.<br />
Zwischen die gesetzliche Festlegung des<br />
abstrakten Enteignungszweckes in § 85 Abs. 1<br />
Nr. 1 BauGB und das förmliche Enteignungsverfahren<br />
schiebt sich als weitere Stufe der Bebauungsplan.<br />
Bei der Betrachtung der ersten Stufe widmet sich<br />
der Autor insbesondere der Frage, ob die generalklauselartige<br />
Bestimmung des Enteignungszweckes<br />
in § 85 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dem Gesetzmäßigkeitsprinzip<br />
des Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG<br />
genügt und ob eine weitere Konkretisierung des<br />
Enteignungszweckes durch Planungsentscheidungen<br />
der Gemeinde verfassungsrechtlich<br />
zulässig ist.<br />
Nach dem Blick auf die Ebene des förmlichen<br />
Gesetzes wendet sich der Verfasser der zweiten<br />
Entscheidungsstufe, nämlich der kommunalen<br />
Bebauungsplanung zu. Im Vordergrund stehen<br />
hier die Fragen nach einer enteignungsrechtlichen<br />
Vorwirkung des Bebauungsplans sowie<br />
den sich aus einer solchen Vorwirkung ergebenden<br />
Anforderungen an die bauleitplanerische<br />
Abwägung.<br />
Schließlich veranschaulicht der Autor für die dritte<br />
Stufe, das förmliche Enteignungsverfahren,<br />
welche enteignungsrechtlichen Prüfungen die<br />
Enteignungsbehörde noch vorzunehmen hat.<br />
Insbesondere wird dargestellt, ob und inwieweit<br />
die auf der vorausgegangenen Planungsstufe<br />
getroffenen Entscheidungen nachgeprüft werden<br />
können oder müssen.<br />
Frank Schreiber, Das Regelungsmodell<br />
des Genehmigung im integrierten Umweltschutz,<br />
Ein Beitrag zur Lehre vom Verbot<br />
mit Erlaubnisvorbehalt unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Richtlinie<br />
96/61/EG des Rates vom 24. September<br />
1996 über die integrierte Vermeidung und<br />
Verminderung der Umweltverschmutzung,<br />
Reihe: Schriften zum Umweltrecht, Band<br />
98, 2000, 271 Seiten, € 68,00, ISBN 3-<br />
428-09930-3, Duncker & Humblot GmbH,<br />
Postfach 4103 29, 12113 Berlin.<br />
Die bislang praktizierten Steuerungsinstrumente<br />
des deutschen Umweltverwaltungsrechts sind in<br />
zunehmendem Maße inkompatibel mit den<br />
Regelungsansätzen des neueren europäischen<br />
Umweltrechts. Diesen Friktionen widmet sich<br />
Frank Schreiber in seiner Dissertation anhand<br />
der Genehmigung im gemeinschaftsrechtlichen<br />
Konzept des integrierten Umweltschutzes, wie<br />
es von der sog. IVU-Richtlinie (RL 96/61/EG des<br />
Rates vom 24. September 1996) gefordert wird.<br />
Einleitend werden ein dogmengeschichtlicher<br />
Aufriß der Lehre vom Verbot mit Erlaubnisvorbehalt<br />
sowie eine Systematisierung des Konzepts<br />
des integrierten Umweltschutzes geliefert.<br />
Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet die<br />
Darstellung der materiell-rechtlichen Anforderungen<br />
der IVU-Richtlinie an die Genehmigung<br />
von Industrieanlagen. Ausführlich werden u. a.<br />
der Standard der „besten verfügbaren Techniken“,<br />
die Anforderungen an die Festlegung von<br />
Emissionsgrenzwerten und die Notwendigkeit<br />
der Abkehr von der gebundenen Entscheidung<br />
behandelt.<br />
Der Autor kommt dabei zu dem Ergebnis, daß<br />
die Einräumung von Gestaltungsspielräumen<br />
unerläßlich ist. Als verfassungsrechtliche Probleme<br />
der integrierten Anlagenzulassung werden<br />
die Zulässigkeit eines Versagungsermessens und<br />
die Grenzen der Beschränkung der Bestandskraft<br />
der Genehmigung untersucht. Den Abschluß<br />
bildet eine Rekonstruktion der Lehre vom Verbot<br />
mit Erlaubnisvorbehalt, die die Funktion behördlicher<br />
Ermächtigungen zur Rechtsgestaltung in<br />
den Blick nimmt.<br />
Die Untersuchung wendet sich an alle, die in<br />
Wissenschaft und Praxis mit den Anpassungsproblemen<br />
des deutschen Verwaltungsrechts<br />
an die gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen<br />
beschäftigt sind. Industrie, Umweltverbänden<br />
und Verwaltung liefert sie umfassende<br />
Informationen über die IVU-Richtlinie, die<br />
wegen der noch immer ausstehenden Umsetzung<br />
dieser Richtlinie von besonderer<br />
Bedeutung sind.<br />
Versteyl/Sondermann, Bundes-Bodenschutzgesetz,<br />
Kommentar, 20<strong>02</strong>,<br />
XXXIX, 633 Seiten, in Leinen € 88,00,<br />
ISBN 3-406-36682-1, Verlag C. H. Beck,<br />
Postfach 40 03 40, 80703 München.<br />
Bodenschutz – eine Herausforderung für den<br />
Praktiker. Ziel der bundeseinheitlichen Regelungen<br />
ist der Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen.<br />
Dies soll erreicht werden durch<br />
– die Verpflichtung zur Vermeidung von Gefahren<br />
für den Boden bei jeder Bodennutzung<br />
oder sonstigen Einwirkung auf den Boden;<br />
– eine Zustandsverantwortlichkeit der Grundstückseigentümer<br />
und -besitzer;<br />
– Sanierungspflichten der Verursacher schädlicher<br />
Bodenveränderungen bzw. der Grundstücksverantwortlichen;<br />
– Vorsorgepflichten zur Sicherung der ökologischen<br />
Leistungsfähigkeit des Bodens, mit<br />
besonderer Konkretisierung für den Bereich<br />
der Landwirtschaft;<br />
– detaillierte Verfahrensvorschriften für die Altlastensanierung.<br />
Der Kommentar erläutert praxisnah die Vorschriften<br />
des neuen Gesetzes und der dazu<br />
ergangenen Bodenschutz- und Altlastenverordnung.<br />
Gesondert berücksichtigt sind landesrechtliche<br />
Besonderheiten. Eine Übersicht über<br />
die verschiedenen Behörden erleichtert die tägliche<br />
Arbeit. Die Autoren sind als Praktiker auf<br />
dem Gebiet des Umweltrechts tätig und durch<br />
zahlreiche Publikationen bestens ausgewiesen.<br />
Das Werk wendet sich an Unternehmen, Verbände,<br />
Behörden, Rechtsanwälte, Richter,<br />
Hochschullehrer sowie an Referendare und Studenten.<br />
Marcus Schladebach, Der Einfluß des<br />
europäischen Umweltrechts auf die kommunale<br />
Bauleitplanung, Reihe: Schriften<br />
zum Umweltrecht, Band 105, 2000, 324<br />
Seiten, € 72,00, ISBN 3-428-1<strong>02</strong>14-2,<br />
Duncker & Humblot GmbH, Postfach 4103<br />
29, 12113 Berlin.<br />
Durch die Vorgaben des europäischen Umweltrechts<br />
sind im Städtebaurecht neue Entwicklungen<br />
zu verzeichnen. Anläßlich der umfassenden<br />
Novellierung, des BauGB zum 1.1.1998 wurden<br />
die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung,<br />
die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und<br />
die Vogelschutz-Richtlinie in ihren bauplanungsrechtlich<br />
relevanten Teilen in den neuen § 1a<br />
Abs. 2 Nr. 3, 4 BauGB eingefügt und damit in die<br />
Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB einbezogen.<br />
Nach der Darstellung von Grundlagen und Wirkungsweise<br />
des europäischen Umweltrechts im<br />
Allgemeinen und der untersuchungsrelevanten<br />
Richtlinien im Besonderen wendet sich der Autor<br />
der im Mittelpunkt der Arbeit stehenden Frage<br />
zu, ob und in welcher Weise die genannten<br />
Richtlinien die kommunale Bauleitplanung, insbesondere<br />
das Abwägungsgebot, beeinflussen.<br />
Hinsichtlich der UVP-Richtlinie wird festgestellt,<br />
daß der ihre Bedeutung bestimmende § 1a Abs.<br />
2 Nr. 3 BauGB die von den §§ 2, 17 UVPG<br />
geschaffene Rechtslage konsolidiert. Außerdem<br />
wird auf die aktuellen Weiterentwicklungen der<br />
UVP im Planungsrecht verwiesen. Diese zeigen<br />
an. daß die Bedeutung der UVP künftig weiter<br />
ausgebaut werden wird. Schladebach untersucht,<br />
welche Regelung das Verhältnis von UVP<br />
und Bauleitplanung im Kommissionsentwurf<br />
zum UGB erfahren hat.<br />
Weiter reichende Rechtsfolgen als die UVP weisen<br />
die FFH- und die Vogelschutz-Richtlinie auf.<br />
Soweit die durch sie verfolgten naturschutzrechtlichen<br />
Zielsetzungen von der Bauleitplanung<br />
erheblich beeinträchtigt werden können.<br />
folgt daraus ein grundsätzliches Planungsverbot.<br />
Da dieses nur aufgrund einzelner Ausnahmetat-<br />
161