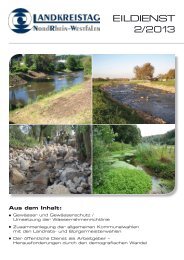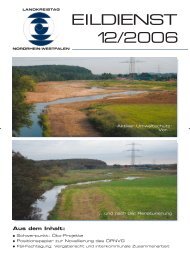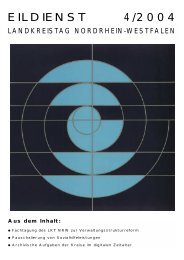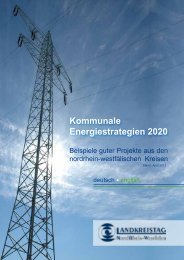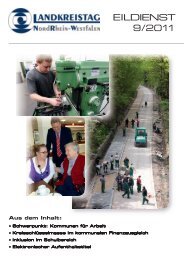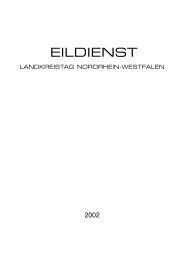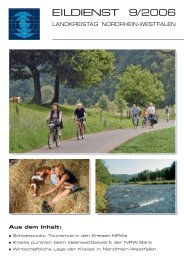Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Eildienst 04/02 - Landkreistag NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Themen<br />
Nach einer 50-jährigen erfolgreichen Entwicklung<br />
von der Montanunion zur politischen<br />
Union stellt sich für den Europäischen<br />
Rat angesichts der Erweiterung von<br />
15 auf 27 (28) Mitgliedern und im Problemhorizont<br />
der Globalisierung die Frage,<br />
ob die EU als bedeutende Wirtschaftsmacht<br />
den weltpolitischen Herausforderungen<br />
gewachsen ist, ob ihre Kompetenzen<br />
ziel- und aufgabengerecht sind und ob<br />
ihre politischen Binnenstrukturen den<br />
Anforderungen nach Transparenz, Effizienz<br />
und Demokratisierung genügen.<br />
Die Grundsatzerklärung ist wie fast alle Verlautbarungen<br />
des Europäischen Rates<br />
inhaltlich euphorisch, weitschweifig, nicht<br />
immer eindeutig und wegen des Zwangs<br />
zur Einstimmigkeit sehr allgemein gefasst.<br />
Aus ihr lassen sich folgende Fragestellungen<br />
herausfiltern, die zugleich den Auftragsrahmen<br />
an den Konvent bilden, ohne damit ein<br />
gegenständliche Beschränkung der Beratungsthemen<br />
vorzunehmen. Eine Neuverteilung<br />
und Abgrenzung der Zuständigkeiten<br />
in der EU soll allerdings den „acquis<br />
communautaire“ (jetziger Aufgabenbestand<br />
der EU) im Prinzip nicht antasten.<br />
Der Europäische Rat sieht folgende Problemfelder,<br />
zu denen er Fragen aufwirft:<br />
Zuständigkeitsverteilung<br />
Lassen sich die öffentlichen Aufgaben der<br />
EU und der Mitgliedstaaten mit ihren staatlichen,<br />
regionalen und kommunalen<br />
Untergliederungen auf die jeweilige Ebene<br />
sachgerecht aufteilen? Kann dabei das<br />
Spannungsverhältnis von Effizienz und<br />
Subsidiarität so aufgelöst werden, dass<br />
Bürgernähe und wirksame Aufgabenerfüllung<br />
zu verantwortlichen Kosten erreicht<br />
werden kann? Ist es sinnvoll, für die EU<br />
einen numerus clausus von Zuständigkeiten<br />
vorzusehen, sodass alle anderen<br />
öffentlichen Aufgaben den Mitgliedstaaten<br />
vorbehalten sind? Ist bei solch strenger<br />
Kompetenztrennung die für die weitere<br />
Integration der EU notwendige Kohärenz<br />
sicherzustellen? Und in diesem Zusammenhang:<br />
Soll den Ländern, Regionen und<br />
Kommunen der Mitgliedstaaten eine auf<br />
ihre Aufgaben zugeschnittene Zuständigkeitsgarantie<br />
eingeräumt werden?<br />
Die Gesamtheit dieser Fragen zielt auf die<br />
Gefahr einer zunehmenden Aufgabenkonzentration<br />
auf EU-Ebene als Folge der<br />
Komplexität der wirtschaftlichen, sozialen<br />
und kulturellen Verhältnisse und die daraus<br />
resultierende dichte ebenenübergreifende<br />
Aufgabenverflechtung. Der Rat weist aber<br />
zugleich auch auf die besondere Stellung<br />
der EU in der Welt und die sich hiermit<br />
ergebende Verantwortung hin, aus der er<br />
für die EU die entsprechenden Verantwortungskompetenzen<br />
ableitet und einfordert.<br />
Institutionelle Reformen<br />
Sind die Handlungsinstrumente im Bereich<br />
der Normsetzung klarer zu kategorisieren<br />
und so abzustufen, dass den Mitgliedstaaten<br />
ein größerer Gestaltungsraum bleibt?<br />
Genügen statt Vollregelungen Rahmenregelungen?<br />
Wie kann bei der Normsetzung<br />
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
Rechnung getragen werden? Welche Ermessens-<br />
und Handlungsspielräume sind<br />
den zuständigen Exekutivbehörden auf<br />
EU- und mitgliedstaatlicher Ebene für eine<br />
sinnvolle Rechtsanwendung einzuräumen?<br />
In das Zentrum der Probleme der demokratischen<br />
Legitimation der EU, der Kreation<br />
ihrer Organe, der Effizienz ihrer Arbeit<br />
und der Transparenz der Entscheidungsprozesse<br />
führen die folgenden Fragen:<br />
Wie kann eine „europäische Öffentlichkeit“<br />
hergestellt werden? Wie lässt sich die<br />
Autorität und Handlungseffizienz der<br />
Kommission verbessern? Soll ihr Präsident<br />
vom Europäischen Rat, vom Europäischen<br />
Parlament oder in direkter Wahl vom Volk<br />
gewählt werden? Sollen die Kompetenzen<br />
des Europäischen Parlamentes gestärkt<br />
werden? Soll das Mitentscheidungsrecht<br />
ausgeweitet werden? Ist das Wahlrecht<br />
zum Europäischen Parlament zu reformieren?<br />
Sollen bei den Wahlbezirken die<br />
nationalen Grenzen eingehalten werden<br />
oder soll es auch grenzüberschreitende<br />
Wahlbezirke geben?<br />
Muss die Rolle des Europäischen Rates und<br />
des Ministerrat gestärkt werden? Sind<br />
unterschiedliche Entscheidungsverfahren<br />
für legislative und exekutive Befugnisse<br />
sinnvoll? Soll der Rat öffentlich tagen? Sind<br />
die Beteiligungsverfahren zwischen den<br />
Organen zu straffen und zu beschleunigen?<br />
Kann das Einstimmigkeitsprinzip weiter<br />
eingeschränkt und durch Mehrheitsentscheidungen<br />
ersetzt werden? Ist an den<br />
unterschiedlich fachlichen Formationen<br />
des Rates festzuhalten? Ist ein halbjährige<br />
Turnus der Präsidentschaft sinnvoll?<br />
Eine weitere Frage wird aufgeworfen, die<br />
das bestehend Organgefüge der EU<br />
grundsätzlich berührt:<br />
Soll zur Stärkung der demokratischen Legitimation<br />
der EU ein Organ geschaffen werden,<br />
in dem die Parlamente der Mitgliedstaaten<br />
repräsentiert sind? Soll dieses<br />
Organ nur ein Kontrollrecht über die Einhaltung<br />
der EU-Kompetenzordnung, insbesondere<br />
über die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips<br />
haben oder sollen ihm auch<br />
echte Mitwirkungskompetenzen in EU-<br />
Agenden eingeräumt werden?<br />
Der EU-Rat hält es im Interesse der Transparenz<br />
und besseren Übersicht für notwendig,<br />
die vier Verträge (EGKS, EAG, EG<br />
EU) zu einem einheitlichen Vertragswerk<br />
zusammenzufassen. Dies wäre auch eine<br />
Gelegenheit, eine inhaltliche Straffung und<br />
Synchronisierung der Begriffe vorzunehmen,<br />
um die rechtslogische Stringenz der<br />
EU-Normen zu verbessern, was bei der<br />
Sprachenproblematik und den unterschiedlichen<br />
Rechtskulturen nicht einfach<br />
ist.<br />
Ferner soll geprüft werden, ob die „Charta<br />
der Grundrechte“, vom Europäischen Rat<br />
in Nizza im Dezember 2000 als „Empfehlung“<br />
angenommen, in den einheitlichen<br />
Vertrag eingefügt werden soll. Die Charta,<br />
der man bislang nur einen Empfehlungscharakter<br />
zugebilligt hat, würde dadurch<br />
ähnlich wie das Grundgesetz der BRD<br />
echte und unmittelbar geltende Rechte<br />
und Pflichten begründen. In diesem Teil<br />
der Grundsatzerklärung spricht der Europäische<br />
Rat erstmalig von einem zu erstellendem<br />
„Verfassungstext“ und verbindet<br />
damit Fragen nach den „Kernbestandteilen“<br />
einer solchen „Verfassung“: „Die<br />
Werte, für die die Union eintritt?“, „Die<br />
Grundrechte und -pflichten der Bürger?“,<br />
„Das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten<br />
in der Union?“<br />
Mit der Einsetzung eines „Konvents zur<br />
Zukunft Europas“ zum 1. März 20<strong>02</strong>, der<br />
insgesamt 105 Mitglieder umfasst, konkretisierte<br />
der Europäische Rat seine Absicht,<br />
die Verträge einer eingehenden Prüfung<br />
durch ein politisch und fachlich<br />
zusammengesetztes Gremium („Konvent“)<br />
zu unterwerfen. Der Konvent soll<br />
Vorschläge für eine Stärkung der demokratischen<br />
Legitimation, Vertiefung der Integration<br />
und Vereinfachung und Effizienzsteigerung<br />
der Entscheidungsprozesse der<br />
EU bis Mitte/Ende 2003 ausarbeiten. Diese<br />
sollen einer Regierungskonferenz im Jahr<br />
20<strong>04</strong> zur Beratung und gegebenenfalls zur<br />
Entscheidung vorgelegt werden.<br />
Der Konvent weist eine ähnliche Mitgliederstruktur<br />
wie der „Konvent der Grundrechtscharta“<br />
auf, zahlenmäßig mit folgendem<br />
Unterschied: zu den 16 Mitgliedern<br />
des EU-Parlaments, den 30 Mitgliedern der<br />
nationalen Parlamente und den 15 Vertretern<br />
der Staats- und Regierungschefs der<br />
Mitgliedsstaaten entsendet die EU-Kommission<br />
2 Mitglieder und die 13 Beitrittskandidaten<br />
(einschließlich Türkei) entsenden<br />
13 Regierungs- und 26 Parlamentsvertreter.<br />
Präsident des Konvents ist der ehemalige<br />
französische Staatschef Giscard<br />
d‘Estaing, dem zwei Vizepräsidenten zugeordnet<br />
sind. Zur Vorbereitung und besseren<br />
Steuerung des Beratungsprozesses ist<br />
ein 12-köpfiges Präsidium vorgesehen.<br />
In der konstituierenden Sitzung des Konvents<br />
am 22. März 20<strong>02</strong>, in der 80 der 105<br />
Mitglieder je 3-minütige Statements abgaben,<br />
wurden bereits die unterschiedlichen<br />
und gegensätzlichen Auffassungen zu<br />
einer EU-Reform skizzenhaft deutlich.<br />
139