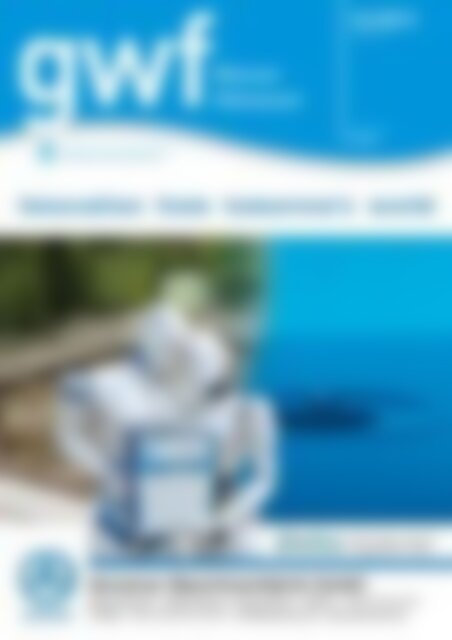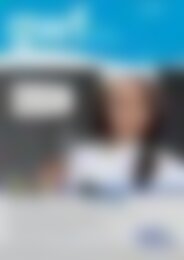gwf Wasser/Abwasser Wasser aus Talsperren (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12/2011<br />
Jahrgang 152<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Innovation from tomorrow’s world<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH<br />
Reherweg 28 . 31855 Aerzen / Deutschland . Telefon: + 49 / 51 54 / 8 10<br />
Telefax: + 49 / 51 54 / 81 91 91 . info@aerzener.de . www.aerzener.de
E20001-F380-P760<br />
Präzise Messung und<br />
fehlerfreie Abrechnung<br />
mit bis zu 10 Jahren bewährter Batteriebetriebszeit<br />
SITRANS F M MAG 8000 CT<br />
Eine zuverlässige Verrechnung ist unerlässlich,<br />
um die wertvolle Ressource<br />
<strong>Wasser</strong> zu bewahren. Der für den<br />
eichpflichtigen Verkehr zugelassene<br />
SITRANS F M MAG 8000 CT ist ein<br />
batteriebetriebener, elektronischer<br />
<strong>Wasser</strong>zähler, der neue Maßstäbe für<br />
Leistung und Genauigkeit setzt.<br />
Der Verzicht auf bewegliche Teile gewährleistet<br />
eine lange Lebensdauer und<br />
Zuverlässigkeit selbst unter rauen<br />
Bedingungen. Die Unabhängigkeit von<br />
der Netzversorgung wird durch eine<br />
bewährte Batteriebetriebszeit von<br />
bis zu 10 Jahren sichergestellt.<br />
SITRANS F M MAG 8000 CT ermöglicht<br />
präzise Messung und fehlerfreie<br />
Abrechnung. Jahr für Jahr.<br />
• Schutzart IP68 für maximalen<br />
Mehrwert Ihrer Investition<br />
• Zuverlässige und genaue<br />
Messwerte nach OIML R49<br />
Klassen 1–2 und MI-001<br />
Klasse 2<br />
• Schnittstelle für die offene<br />
Kommunikation zur Integration<br />
künftiger Upgrades<br />
www.siemens.de/durchfluss
Standpunkt<br />
<strong>Wasser</strong> <strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong> –<br />
Garant für eine sichere <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Symposium anlässlich 40 Jahre Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren e.V. (ATT)<br />
Am 23. November 2010 kamen in Siegen<br />
beim <strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein<br />
über 120 Fachleute <strong>aus</strong> <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen,<br />
Forschungs einrichtungen<br />
und Umwelt- und Gesundheitsbehörden<br />
zu einem Erfahrungs<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch<br />
zu sammen. Im Mittelpunkt des Symposiums<br />
standen neben den Fragen zur neuen Trinkwasserverordnung<br />
und zur Oberflächengewässerverordnung<br />
solche zum Einsatz<br />
neuer Techniken, zum Umgang mit Viren und<br />
Spurenstoffen sowie zum sicheren Betrieb und<br />
geeigneter Organisation.<br />
Zur Zeit wirken in der ATT 33 Versorgungsunternehmen<br />
unterschiedlicher gesellschaftsrechtlicher<br />
Struktur und sechs Forschungsund<br />
Hochschulinstitute zusammen. Sie verfolgen<br />
das Ziel, die Erkenntnisse bei Gewinnung,<br />
Aufbereitung und Fortleitung von Trinkwasser<br />
<strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong> voran zu treiben und<br />
praxistaugliche Empfehlungen für den Betrieb<br />
weiter zu entwickeln.<br />
Etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung<br />
werden heute mit Trinkwasser <strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong><br />
versorgt – ein <strong>Wasser</strong> von hervorragender<br />
Qualität. Der Anteil von Trinkwassertalsperren<br />
in den Mittelgebirgsregionen ist<br />
besonders hoch. Die Mitglieder in der ATT<br />
stellen heute mehr als 450 Mio. m³/Jahr <strong>aus</strong><br />
über 70 <strong>Talsperren</strong> als Trinkwasser bereit.<br />
Insbesondere durch die Zusammenführung<br />
der Kenntnisse und Erfahrungen im Rahmen<br />
der Wiedervereinigung der Bunde s-<br />
republik <strong>aus</strong> Ost und West hat sich der Fokus<br />
der ATT deutlich erweitert. Standen zu Zeiten<br />
der Gründung der ATT Fragen des Nährstoffrückhaltes<br />
im Vordergrund, so sind es<br />
heute Fragen des Spurenstoffrückhaltes oder<br />
des Umgangs mit bakteriologischen Belastungen.<br />
Dabei verfolgen die <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
stets den integralen Ansatz des<br />
Multi-Barrieren-Systems, der bereits im Einzugsgebiet<br />
mit dem Ressourcenschutz<br />
beginnt. Über einen gezielten und sicheren<br />
Betrieb der Stauanlagen kann wesentlich auf<br />
eine gute Rohwasserqualität eingewirkt werden.<br />
Diese ist erforderlich, um einen zuverlässigen<br />
Betrieb der <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
zu gewährleisten. Dabei spielen<br />
heute auch Wirtschaftlichkeit und Betrieb<br />
unter besonderen Betriebsbedingungen eine<br />
große Rolle. Daher beteiligt sich die ATT intensiv<br />
an der Fortschreibung des Regelwerks und<br />
engagiert sich im Benchmarking.<br />
Die Anforderungen an die Unternehmen<br />
im rechtlichen Bereich ergeben sich immer<br />
stärker aufgrund von Entscheidungen auf<br />
europäischer Ebene. Daneben werden Klimawandel<br />
und demografische Entwicklung neue<br />
Antworten erfordern. Mit den <strong>Talsperren</strong> verfügen<br />
die Unternehmen über anpassungsfähige<br />
wasserwirtschaftliche Anlagen, die<br />
durch geänderte Betriebsregeln an veränderte<br />
Anforderungen angepasst werden können<br />
und damit zukunftsfähig sind.<br />
Mit der jetzigen Ausgabe sowie einer folgenden<br />
werden die Vorträge des Symposiums<br />
über aktuelle Erkenntnisse <strong>aus</strong> dem Betrieb<br />
und über Ergebnisse von Forschungsarbeiten<br />
zu Gewinnung, Aufbereitung und Fortleitung<br />
von Trinkwasser <strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong> vorgestellt.<br />
Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer<br />
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren e.V. (ATT)<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1111
INhalt<br />
Den ersten Teil der Referate, die<br />
beim Symposium „40 Jahre<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren“ Ende 2010<br />
in Siegen gehalten wurden, lesen<br />
Sie ab Seite 1166<br />
ATT Symposium<br />
Grußwort<br />
1166 J. Alth<strong>aus</strong><br />
40 Jahre Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwasser<br />
1168 D. Müller<br />
40 Jahre Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren – <strong>Wasser</strong>verband<br />
Siegen-Wittgenstein<br />
1174 K. Pütz<br />
Zusammenwachsen West und Ost<br />
in der ATT<br />
1178 W. Such<br />
Gründung der ATT und ihre<br />
Entwicklung<br />
1196 St. Panglisch u. a.<br />
Modernisierung/Neubau der SEBES<br />
Trinkwasseraufbereitungsanlage<br />
Esch/Sauer – Praxis-Bericht von<br />
Pilotuntersuchungen mit Keramikmembranen<br />
Refurbishment/New Construction of the SEBES<br />
Drinking Water Treatment Plant Esch/Sauer<br />
1202 E. Jüngel<br />
Der Weg zum <strong>Talsperren</strong><br />
Benchmarking<br />
The Way to the Dam-Benchmarking<br />
1206 H.-J. Brauch<br />
Organische Spurenstoffe in<br />
Gewässern – Vorkommen und<br />
Bewertung<br />
Organic Trace Pollutants in Aquatic Systems<br />
Fachaufsätze<br />
1188 W. Scharf<br />
Integrale <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung<br />
– ein ganzheitlicher Ansatz<br />
The Holistic Reservoir Watershed-Scale<br />
Approach<br />
Dezember 2011<br />
1112 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Inhalt<br />
Effiziente und dennoch sichere <strong>Abwasser</strong>behandlung – gerade hinsichtlich<br />
mikrobieller Verunreinigungen – steht im Fokus der aktuellen Ausgabe. <br />
Ab Seite 1116<br />
Nachrichten <strong>aus</strong> der Branche zu Trinkwasserqualität<br />
und Umweltbelastungen, Trinkwasserpreisen und<br />
Klimawandel ab Seite 1132<br />
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
1116 Innovativ und klimaschonend – Der Bremer<br />
Umweltdienstleister hanse<strong>Wasser</strong> hat mit<br />
kliEN ein zukunftsweisendes Energiekonzept<br />
entwickelt<br />
1118 Systemtechnik – <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
mit System „Made in Germany“ für Litauens<br />
Lebenmittelindustrie<br />
1121 Biogaserzeugung <strong>aus</strong> Bleichereikonzentrat<br />
1122 <strong>Abwasser</strong> kontrolliert reinigen mit UV-Licht<br />
1123 UV-Desinfektions-Technologie für<br />
ukrainische Kläranlage<br />
1124 Membranspezialist <strong>aus</strong> Gelsenkirchen an<br />
Antarktisstation beteiligt<br />
1126 Kostengünstige Wartung und Spülung<br />
von Schmutzwasserkanälen<br />
1128 Dichtheitsprüfungen in Sonderprofilen<br />
mit LAMPE Kanaldichtkissen – den „größten<br />
Absperrblasen der Welt“<br />
1130 Pilotprojekt HAMBURG WATER Cycle in der<br />
Jenfelder Au dreifach gefördert<br />
Netzwerk Wissen<br />
Aktuelles <strong>aus</strong> Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
1144 iro-Leiter Prof. Thomas Wegener im<br />
Interview<br />
1146 Am Puls der Zeit: Rohrleitungen in neuen<br />
Energieversorgungskonzepten<br />
1149 Das Institut für Rohrleitungsbau arbeitet<br />
und forscht praxisnah<br />
1150 Zwickendes Zwerchfell und blubbernde<br />
Bäuche bei deftigen „Ollnburger<br />
Gröönkohlabend“<br />
1152 Praxisnah studiert man in der „Übermorgenstadt“<br />
1155 Mit dem Kanu unterwegs auf Oldenburgs<br />
<strong>Wasser</strong>straßen<br />
1158 Prüf- und Forschungsarbeit auf dem Gebiet<br />
der Hochdruckwasserstrahltechnik<br />
1160 Forschungsschwerpunkt „<strong>Abwasser</strong>wärmerückgewinnung“<br />
1161 Hoch aufgelöste Messdaten in der<br />
Schmutzfrachtmodellierung von Kanalsystemen<br />
1131 Phosphor-Rückgewinnung <strong>aus</strong><br />
Schlammkonzentrat<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1113
INhalt<br />
In der Rubrik „Netzwerk Wissen“ wird das Institut für Rohrleitungsbau (iro) in<br />
Oldenburg porträtiert. Im Interview der Leiter des Instituts, Prof. Dipl.-Ing.<br />
Thomas Wegener, dazu Wissenswertes rund ums Studium sowie eine <strong>Vorschau</strong><br />
auf das nächste Rohrleitungsforum im Februar 2012 mit Vorfreude auf den<br />
bereits legendären „Ollnburger Gröönkohlabend“. Ab Seite 1143<br />
Nachrichten<br />
Branche<br />
1132 Mehr Sicherheit für die Trinkwasserqualität<br />
in Gebäuden<br />
1133 Umweltbelastungen mit Fischen ermitteln<br />
– Neue Richtlinie VDI 4230 Blatt 4 zur<br />
Bioindikation<br />
1134 Landeswasserversorgung investiert in die<br />
Zukunft – Trinkwasserpreis steigt – Kostentransparenz<br />
schafft Vertrauen<br />
1135 Wie kommt der Bodensee mit dem Klimawandel<br />
zurecht? – Mit dem Forschungsprojekt<br />
KLIMBO wollen Wissenschaftler in<br />
die Zukunft blicken<br />
1136 Auslobung zum Muelheim Water<br />
Award 2012 startet im Januar<br />
1136 50 Jahre kreative Ingenieurleistungen<br />
1137 Aus ITT wird Xylem<br />
1138 Ideen treffen Entscheider – Nachbericht<br />
zum Kongress der <strong>Wasser</strong>- und Energiewirtschaft<br />
en 3 in Berlin<br />
Vereine, Verbände, Organisationen<br />
1142 DVGW zur möglichen Anrufung des Vermittlungs<strong>aus</strong>schusses<br />
zum CO 2 -Speicherungsgesetz<br />
– Strenges Monitoring etwaiger Risiken<br />
unterirdischer CO 2 -Lagerung erforderlich<br />
Recht und Regelwerk<br />
1163 Ankündigung eines neuen Projektkreises<br />
und „Call for experts“<br />
1163 DVGW-Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
1164 Ankündigung zur Fortschreibung des<br />
DVGW-Regelwerks<br />
1165 DWA-Vorhabensbeschreibung<br />
Praxis<br />
1212 Glasfaserliner <strong>aus</strong> dem H<strong>aus</strong>e Insituform –<br />
DIBt-Zulassung Z-42.3-475 am 30. September<br />
2011 erteilt<br />
1214 Mit Torpedo in die Tiefe – Verlegung einer<br />
Stahlleitung DN 300 mit ZM-Auskleidung<br />
im Raketenverfahren<br />
Produkte und Verfahren<br />
1216 Neue Aktivkohle-Serie von Siemens –<br />
AquaCarb-CX auf Basis von Kokosnussschalen<br />
ergänzt Angebot zur Behandlung<br />
von Oberflächenwasser<br />
1216 Geführtes Radar revolutioniert die<br />
Trennschichtmessung<br />
1217 Mit NOVAIR und NOVAQUA besserer<br />
Wirkungsgrad<br />
1218 Pumpen mit „Allmind“ intelligent<br />
über wachen und regeln<br />
Dezember 2011<br />
1114 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Inhalt<br />
Im Test: Kanalsanierung mit Glasfaserliner.<br />
Ab Seite 1212<br />
Zur Sache<br />
1219 Gutachter im <strong>gwf</strong>-Peer-Review-<br />
Verfahren 2011<br />
Information<br />
1221 Impressum<br />
1222 Termine<br />
Recht und Steuern<br />
Recht und Steuern im Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>fach, Ausgabe 11–12, 2011<br />
Dieses Heft enthält folgende Beilage:<br />
– HTI Hezel KG, Herrenberg<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> im Janaur 2012<br />
u. a. mit diesen Fachbeiträgen :<br />
CO 2 -Fußabdruck für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Stabilisierung und Enthärtung mit<br />
Auf bereitungsstoffen auf Kalksteinbasis –<br />
Begriffe und Reaktionen<br />
Druckstoßsicherung der Zubringerleitung „Laichinger<br />
Alb“ der Landeswasserversorgung mittels<br />
Druckbehälter und Wirbelkammerdioden<br />
Erscheinungstermin: 23.01.2012
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Innovativ und klimaschonend<br />
Der Bremer Umweltdienstleister hanse<strong>Wasser</strong> hat mit kliEN ein zukunftsweisendes<br />
Energiekonzept entwickelt<br />
Die <strong>Abwasser</strong>reinigung ist ein zwingend notwendiger Bestandteil einer jeden Stadt, gleichzeitig aber auch<br />
immer sehr energieintensiv. Deshalb sind energieeffizientes Arbeiten und der Einsatz von regenerativen<br />
Energien für den Bremer Umweltdienstleister nicht nur wichtige Themen, sondern eine ökologische sowie<br />
ökonomische Verpflichtung – und sogar ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell.<br />
Beste Referenz und innovatives Vorbild:<br />
die hanse<strong>Wasser</strong> Kläranlage in Seeh<strong>aus</strong>en.<br />
Die Klimaziele von hanse<strong>Wasser</strong><br />
sind klar definiert: Bereits 2013<br />
soll der im Jahresmittel erzeugte<br />
Strom (24 Millionen kwh) für die<br />
Kläranlage in Seeh<strong>aus</strong>en zu 100 Prozent<br />
<strong>aus</strong> umweltfreundlicher Eigenproduktion<br />
kommen. Dies wird u. a.<br />
erreicht durch den Betrieb der<br />
neuen 2-Megawatt-Windenergieanlage,<br />
den Neubau der Blockheizkraftwerkanlage,<br />
die komplette Verstromung<br />
des Klärgases und die<br />
energetische Optimierung des Kläranlagenbetriebes.<br />
Bis 2015 ist die<br />
CO 2 -Neutralität des gesamten<br />
Unternehmens geplant. Ob in den<br />
Kläranlagen Seeh<strong>aus</strong>en und Farge,<br />
bei dem Energieverbrauch der<br />
Gebäude und Standorte oder auch<br />
im Fuhrpark: alle Unternehmensbereiche<br />
sollen dann klimaneutral<br />
sein. Hinter diesen Zielen steht das<br />
Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekt<br />
kliEN, das sich in drei Teilprojekte<br />
gliedert:<br />
""<br />
kliEN Business: wirtschaftlich<br />
noch energieeffizienter werden<br />
""<br />
kliEN Innovation: innovativ<br />
klimaschonend wachsen<br />
""<br />
kliEN Responsibility: nachhaltig<br />
Verantwortung übernehmen<br />
„Wir wollen als Unternehmen in der<br />
<strong>Abwasser</strong>branche eine Vorbildfunktion<br />
einnehmen und Klimaschutz<br />
aktiv in allen Bereichen leben. Nur<br />
dann sind wir wirklich glaubwürdig.<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> sind energieeffizientes<br />
Arbeiten und der Einsatz<br />
von regenerativen Energien für hanse<strong>Wasser</strong><br />
nicht nur ökologisch sinnvoll,<br />
sondern ermöglichen uns auch<br />
ökonomische Vorteile“, verdeutlicht<br />
hanse<strong>Wasser</strong> Geschäftsführer Jörg<br />
Broll-Bickhardt den ganzheitlichen<br />
Ansatz des Projekts kliEN.<br />
kliEN Innovation<br />
Von den nachhaltigen Erfahrungen<br />
des Klima- und Energieeffizienzprojekts<br />
sollen auch die Kunden von<br />
hanse<strong>Wasser</strong> profitieren. Dafür<br />
steht kliEN Innovation mit innovativen<br />
und umweltfreundlichen Produkten,<br />
die die Energiekosten von<br />
Kommunen und Industrie langfristig<br />
senken und die CO 2 -Emissionen<br />
mindern. Wie aber sieht die Dienstleistung<br />
von hanse<strong>Wasser</strong> in der<br />
Praxis <strong>aus</strong>?<br />
Im ersten Schritt erfolgt eine<br />
Erfassung der Rahmendaten der<br />
Kläranlage, also eine detaillierte<br />
INFO<br />
Auszeichnung zum „Klimaschutzbetrieb CO 2 -20“<br />
2011: Joachim Lohse, Umweltsenator Bremen,<br />
gratuliert den hanse<strong>Wasser</strong> Geschäftsführern<br />
Uwe Dahl (li) und Jörg Broll-Bickhardt (re).<br />
Die hanse<strong>Wasser</strong> Bremen GmbH betreibt mit rund 400 Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern das 2300 Kilometer lange Bremer Kanalnetz.<br />
Zwei Kläranlagen in Seeh<strong>aus</strong>en und Farge reinigen jährlich rund<br />
55 Millionen Kubikmeter <strong>Abwasser</strong> <strong>aus</strong> Bremen, den benachbarten<br />
Gemeinden sowie für industrielle Kunden. Von der initiative umwelt<br />
unternehmen erhielt hanse<strong>Wasser</strong> die Auszeichnung „Klimaschutzbetrieb<br />
CO 2 -20“. Durch den Betrieb eigener Windenergieanlagen<br />
senkte hanse<strong>Wasser</strong> seinen CO 2 -Ausstoß am Standort Seeh<strong>aus</strong>en in<br />
den vergangenen fünf Jahren um über 20 Prozent.<br />
Dezember 2011<br />
1116 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
Datensammlung als solide Arbeitsgrundlage<br />
mittels eines schriftlichen<br />
Fragebogens zur Effizienzanalyse,<br />
komplementiert durch fachkundige<br />
Begehungen und<br />
Messungen. Dokumentiert werden:<br />
""<br />
Anlagen-Effizienz<br />
""<br />
Energieverbrauch<br />
""<br />
Personal-Effizienz<br />
Eine Analyse und Bewertung der<br />
Daten folgt im zweiten Schritt. Über<br />
die detaillierten Analysen und<br />
Bewertungen der Ergebnisse<br />
erstellt hanse<strong>Wasser</strong> einen Bericht,<br />
der mit dem Führungspersonal der<br />
jeweiligen Anlage diskutiert wird.<br />
Im Anschluss daran bespricht hanse<strong>Wasser</strong><br />
gemeinsam mit den<br />
Betreibern mögliche Maßnahmen<br />
von der Umsetzung bis zur Betriebsführung<br />
der Kläranlage. Dabei empfiehlt<br />
hanse<strong>Wasser</strong> kein kliEN Innovation<br />
Produkt, was das Unternehmen<br />
nicht schon selbst erfolgreich<br />
umgesetzt hat. „Die beste Referenz<br />
für ein innovatives Vorbild betreiben<br />
wir mit unserer eigenen Kläranlage“,<br />
erklärt Jörg Broll-Bickhardt.<br />
„Die Auszeichnung zum „Klimaschutzbetrieb<br />
CO 2 -20“ 2011 ist für<br />
uns eine wichtige Bestätigung und<br />
zeigt, dass wir auf dem richtigen<br />
Weg sind.“<br />
Kontakt:<br />
hanse<strong>Wasser</strong> Bremen GmbH,<br />
Schiffbauerweg 2,<br />
D-28237 Bremen,<br />
E-Mail: kontakt@hanse<strong>Wasser</strong>.de,<br />
www.hansewasser.de<br />
Aerzen - one step ahead<br />
Innovation from tomorrow’s world<br />
Delta Hybrid ist die weltweit erste Baureihe von Drehkolbenverdichtern.<br />
Sie ist eine Synergie <strong>aus</strong> Gebläse- und Verdichtertechnik und bietet durch<br />
die Verschmelzung der Vorteile beider Systeme völlig neue Möglichkeiten in<br />
der Unter- und Überdruck-Erzeugung.<br />
Folgende Vorteile zeichnen die Zukunftstechnologie Delta Hybrid <strong>aus</strong>:<br />
• Höchste Energieeffizienz und Reduzierung der Life-Cycle-Costs<br />
• Zuverlässigkeit und Langlebigkeit<br />
• Niedrige Schallpegel, Verzicht auf Absorptionsmaterial<br />
• Platzsparend, einfachste Handhabung und Reduzierung der<br />
Wartungskosten<br />
• Erweiterte Einsatz- und Druckbereiche<br />
Erleben Sie den Quantensprung bei zweiwelligen<br />
Drehkolbenmaschinen!<br />
Mehr erfahren Sie unter www.delta-hybrid.com<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH<br />
Reherweg 28 . 31855 Aerzen / Deutschland . Telefon: 0 51 54 / 8 10<br />
Telefax: 0 51 54 / 81 91 91 . info@aerzener.de . www.aerzener.de<br />
Oldenbourg+123x176.indd 23<br />
23.11.2011 11:17:15 Uhr<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1117
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Systemtechnik<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung mit System „Made in Germany“<br />
für Litauens Lebensmittelindustrie<br />
von Günter Müller-Czygan<br />
<strong>Abwasser</strong>technische Lösungen „Made in Germany“ genießen weltweit einen guten Ruf, besonders wenn es um<br />
die technologische Ausstattung und die Qualität des behandelten <strong>Abwasser</strong>s bzw. Prozesswassers geht. Gerade<br />
in der Industrie ist die Nachfrage nach Prozesswasserbehandlungsanlagen international deutlich gestiegen.<br />
Das heißt aber auch, dass im internationalen Geschäft neue Anbieter auf den Markt drängen, die versuchen,<br />
allein über den Preis einen Auftrag zu gewinnen – wohlwissend, dass deutsche Unternehmen diesen Preiswettbewerb<br />
in der Regel verlieren. Denn zahlreiche Vergabeentscheidungen werden alleine unter dem Aspekt des<br />
Kaufpreises vollzogen. Vorteile deutscher Anbieter in punkto Nachhaltigkeit, Effizienz und Betriebssicherheit<br />
fallen vielerorts nicht ins Gewicht. Wenn deutsche Unternehmen in diesem Wettbewerb bestehen wollen,<br />
müssen sie neue Wege gehen. Dieser Beitrag zeigt anhand eines realisierten Projektes, wie HST Hydro-Systemtechnik<br />
(HST) diese Aufgabe mit innovativer Verfahrenstechnik, optimiertem Projektmanagement und der<br />
Fügekompetenz der Systemtechnik sowie einem zuverlässigen Partner vor Ort umgesetzt hat.<br />
Das Projektteam<br />
vor Ort<br />
bei der<br />
B<strong>aus</strong>tellenbesichtigung.<br />
In der Nähe von Litauens zweitgrößter<br />
Stadt Kaunas (etwa<br />
350 000 Einwohner) entstand eine<br />
der modernsten <strong>Abwasser</strong>behandlungsanlagen<br />
in der Lebensmittelindustrie<br />
des baltischen Landes für<br />
das litauische Unternehmen UAB<br />
Samsonas. Neben einem Schlachtbetrieb<br />
und rund 20 Lebensmittelmärkten<br />
gehört zu dem Unternehmen<br />
auch ein fleischverarbeitender<br />
Betrieb. Die Entscheidung<br />
für die von HST entwickelte Lösung<br />
zum Bau einer schlüsselfertigen,<br />
modernen Kläranlage bestehend<br />
<strong>aus</strong> einer Flotation zur Fettabscheidung<br />
und nachfolgender SBR-Stufe<br />
zur biologischen <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
fiel trotz der höheren Anschaffungskosten.<br />
Der Grund für den Bau<br />
der neuen Kläranlage sind Verordnungen<br />
<strong>aus</strong> Brüssel, die von dem<br />
Unternehmen UAB Samsonas<br />
ebenso wie von vielen anderen<br />
Unternehmen in dem EU-Land<br />
Litauen erfüllt werden müssen.<br />
Dazu zählte auch die Vorgabe, bis<br />
Ende 2010 das im Betrieb anfallende<br />
Prozesswasser gemäß EU-<br />
Richtlinie zu behandeln.<br />
Zusammen mit dem litauischen<br />
Partner UAB ENEKA begann HST im<br />
Frühjahr 2010 mit der Errichtung der<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung am Produktionsstandort<br />
Sylvianas. Der Bauherr<br />
hatte die Lösung sowohl in technischer<br />
als auch in finanzieller Hinsicht<br />
intensiv geprüft. Trotz der damals<br />
anhaltenden Wirtschaftskrise und<br />
hartem Preiswettbewerb mit lokalen<br />
Anbietern waren die technischen<br />
und auch finanziellen Vorteile<br />
eindeutig auf Seiten des HST-Angebots.<br />
Maßgebend war neben der<br />
innovativen technischen Lösung,<br />
dass HST dem litauischen Kunden<br />
einen Lieferantenkredit über 85 %<br />
der Errichtungskosten anbieten<br />
konnte und damit eine günstige<br />
Finanzierung ermöglichte. Nur so<br />
war es dem litauischen Betrieb letztendlich<br />
möglich, deutsche Technologie<br />
einzusetzen. Außerdem be -<br />
legte eine Expertise der Universität<br />
Kaunas, dass die notwendigen Reinigungswerte<br />
nur mit der Lösung<br />
von HST sicher einzuhalten sind.<br />
Aus der Analyse zahlreicher<br />
Angebote und unter Beachtung<br />
der Kenntnisse über die Vergabepraxis<br />
in verschiedenen Ländern,<br />
wie z. B. Kroatien, Rumänien oder in<br />
anderen baltischen Staaten, konnten<br />
die Ingenieure von HST die<br />
wesentlichen Faktoren für Preisunterschiede<br />
im industriellen <strong>Abwasser</strong>sektor<br />
kleinerer und mittelgroßer<br />
Betriebe erfassen und bewerten.<br />
Im Wesentlichen sind es<br />
Lohn- und Fertigungsstrukturen,<br />
die Anbietern <strong>aus</strong> Ländern mit<br />
Dezember 2011<br />
1118 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
einem niedrigeren Lohnniveau<br />
eine höhere Auftragschance<br />
er möglichen. Aber auch einfachere,<br />
teilweise kompakte bzw.<br />
modulartig aufgebaute Technologien<br />
auf einem geringeren Qualitätsniveau<br />
werden am Markt<br />
an geboten mit dem Versprechen,<br />
die lokalen Umweltbestimmungen<br />
vollumfänglich einzuhalten. Dem<br />
<strong>Abwasser</strong>laien auf der Käuferseite<br />
erschließt sich in dem begrenzten<br />
Zeitraum der Beschaffung in keiner<br />
Weise, ob sich der niedrigere Einkaufspreis<br />
am Ende tatsächlich<br />
rechnet. Um nun in diesen Märkten<br />
bestehen zu können, erforderte es<br />
einer angepassten und zum Teil<br />
andersartigen Herangehensweise<br />
in der Planung und Projektabwicklung.<br />
Mit dieser Marktsituation sah<br />
sich HST auch im Zuge des Angebotsverfahrens<br />
bei UAB Samsonas<br />
konfrontiert.<br />
HST-Systemlösung – Platz<br />
sparend, kostenoptimiert<br />
und deutlich verkürzte<br />
Bauzeit<br />
In der Entwicklung der <strong>Abwasser</strong>lösung<br />
für den litauischen Lebensmittelbetrieb<br />
konnten diese<br />
Erkenntnisse von HST vollumfänglich<br />
angewendet und erfolgreich<br />
umgesetzt werden. Dabei war ein<br />
wesentliches Ziel, sowohl die Vorteile<br />
kompakter bzw. modulartig<br />
aufgebauter Technologien als auch<br />
die Effizienz- und Qualitätsvorteile<br />
deutscher Lösungen optimal zu<br />
kombinieren. Ergebnis aller Überlegungen<br />
waren letztendlich zwei<br />
wesentliche B<strong>aus</strong>teine. Zum einen<br />
erfolgte eine bereits für kommunale<br />
Lösungen erarbeitete effiziente und<br />
Preis reduzierende Splittung der<br />
Leistungsanteile in HST-seitige und<br />
lokale Arbeitsleistung. Auf der<br />
anderen Seite wurden noch einmal<br />
sämtliche Leistungsteile auf maximale<br />
Standardisierungsmöglichkeiten<br />
überprüft. Ziel beider B<strong>aus</strong>teine<br />
war und ist es, den hohen Leistungsaufwand<br />
an Engineering und<br />
Lohnfertigung eines Standardabwasserprojektes<br />
auf das wirklich<br />
erforderliche Maß zu reduzieren. Bei<br />
der Splittung von Leistungsanteilen<br />
wurde darauf geachtet, dass ein<br />
hohes Maß an Ausführungsleistung<br />
an lokale Partner ohne Einbußen an<br />
die gewünschte Qualität vergeben<br />
werden konnte. Die vorgesehene<br />
Standardisierung bezog sich nicht<br />
nur auf die Vereinheitlichung technischer<br />
Komponenten, sondern<br />
auch auf organisatorische Vorgänge,<br />
um die relativ hohen Lohnkosten<br />
weiter zu reduzieren. Mit<br />
UAB ENEKA konnte ein litauisches<br />
Unternehmen vor Ort gefunden<br />
werden, das die gewünschten<br />
Anforderungen an einen lokalen<br />
Partner optimal erfüllte.<br />
Die maschinentechnische<br />
Ausrüstung und<br />
die Verfahrenstechnik<br />
Die gesamte maschinentechnische<br />
Ausrüstung außerhalb der Behandlungsbecken<br />
konnte in Containern<br />
untergebracht werden. Dies er -<br />
laubte die Vorfertigung und Funktionsprüfung<br />
der Komponenten in<br />
der deutschen Fertigung von HST<br />
und verkürzte den Aufbau und die<br />
Inbetriebnahme vor Ort auf ein<br />
Minimum.<br />
Das maschinentechnische Herzstück<br />
der Anlage stellt eine Druckentspannungsflotation<br />
<strong>aus</strong> glasfaserverstärktem<br />
Kunststoff (GFK)<br />
dar. Die festgesetzten Standardmaße<br />
der Flotation erlaubten es,<br />
dass eine Form für die Behälterherstellung<br />
erneut verwendet werden<br />
konnte. In der Flotation werden die<br />
für einen fleischverarbeitenden<br />
Betrieb üblichen hohen Fettanteile<br />
nach vorheriger Grobstoffentfernung<br />
dem <strong>Abwasser</strong> entnommen.<br />
Anschließend erfolgt die weitere<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung in der SBR-<br />
Stufe. Das SBR-Verfahren eignet sich<br />
Die neue<br />
Kläranlage<br />
in Litauen<br />
kurz vor der<br />
Inbetriebnahme.<br />
<br />
Der<br />
trichterförmige<br />
Schlammzyklon<br />
<strong>aus</strong><br />
Edelstahl.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1119
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
ideal für <strong>Abwasser</strong>situationen, wie<br />
sie in le bensmittelverarbeitenden<br />
Betrieben in der Regel anfallen.<br />
Dank dem Misch- und Ausgleichsbehälter<br />
werden die stark mengenund<br />
frachtbezogenen Schwankungen<br />
im <strong>Abwasser</strong>zulauf vollständig<br />
kompensiert und garantieren damit<br />
für den biologischen Prozess ideale<br />
und konstante Betriebsbedingungen.<br />
HST hatte bereits für den osteuropäischen<br />
Markt Standardmodule<br />
für SBR-Lösungen entwickelt,<br />
so dass auch die Planungszeit des<br />
SBR-Anlagenteils erheblich reduziert<br />
wurde.<br />
Dank der grundsätzlichen Entscheidung<br />
des Bauherrn, alle HST<br />
SBR-Anlagen mit innovativer Automationstechnik<br />
<strong>aus</strong> der eigenen<br />
Entwicklung <strong>aus</strong>zurüsten, kann nun<br />
jederzeit der ideale Betriebspunkt<br />
erreicht werden, und der notwendige<br />
Luftbedarf wird auf das<br />
tatsächlich erforderliche Maß<br />
beschränkt. Auch im bautechnischen<br />
Bereich zeichnet sich die HST-<br />
Lösung durch einen hohen Innovationsgrad<br />
<strong>aus</strong>. Üblicherweise werden<br />
SBR-Reaktoren und Misch- und<br />
Ausgleichsbecken zeitintensiv als<br />
Betonbecken errichtet. Der Einsatz<br />
von Edelstahlbehältern in Form verschraubbarer<br />
modulartiger Einzelelemente<br />
ermöglichte es, dass<br />
die notwendigen Prozessbehälter<br />
innerhalb weniger Tage errichtet<br />
werden konnten. Als Bauvorleistung<br />
war lediglich ein Fundament<br />
nötig.<br />
Das Modell des<br />
HST-Schlammzyklons.<br />
Ein Novum für Litauen und die<br />
baltischen Staaten stellt der für die<br />
Schlammspeicherung entwickelte<br />
HST Schlammzyklon <strong>aus</strong> Edelstahl<br />
dar. Wird der anfallende Überschussschlamm<br />
der biologischen<br />
Behandlungsstufe üblicherweise in<br />
normalen Becken zwischengelagert,<br />
führt die besondere Trichterform<br />
des Schlammzyklons in Kombination<br />
mit einer gezielten<br />
Schlammeinleitung bereits innerhalb<br />
von 3–5 Tagen zu einer deutlichen<br />
Abtrennung von Trübwasser.<br />
Durch die Trichterform wird darüber<br />
hin<strong>aus</strong> zudem eine Eindickung<br />
ermöglicht, die um 3–4 % höher<br />
<strong>aus</strong>fällt als in üblichen Schlammstapelbehältern.<br />
Dadurch erfolgen<br />
eine Reduzierung an notwendigem<br />
Speichervolumen und eine höhere<br />
Verringerung des <strong>Wasser</strong>anteils im<br />
anfallenden Schlamm. Weniger<br />
<strong>Wasser</strong> im Schlamm bedeutet eine<br />
erhebliche Volumen- und damit<br />
eine deutliche Kostenreduzierung<br />
für die Schlammentsorgung. Die<br />
Fertigstellung und Inbetriebnahme<br />
der <strong>Abwasser</strong>behandlung mit einer<br />
Leistung von 100 m³ am Tag erfolgte<br />
Ende 2010.<br />
Fazit<br />
Das Beispiel in Litauen hat gezeigt,<br />
dass trotz hartem Preiswettbewerb<br />
Lösungen „Made in Germany“ durch<br />
innovative Ideen im internationalen<br />
Markt gute Chancen haben. Mit<br />
Hilfe einer Standardisierungsmatrix<br />
verschiedener Einzeltechnologien,<br />
wie z. B. chemisch-physikalische Be -<br />
handlung mit Flotation, biologische<br />
Reinigung mit SBR-Technik, Desinfektion<br />
mit UV, und mit standardisierten<br />
Abfolgen im Projektmanagement<br />
wird zeitnah eine passende<br />
Lösung für internationale<br />
Kunden entwickelt. Die Splittung<br />
des Gesamtprojektes in drei wesentliche<br />
Leistungsbereiche fördert die<br />
lokale Akzeptanz und führt zu einer<br />
steigenden Wettbewerbsfähigkeit:<br />
Leistungsbereich eins enthält die<br />
Kernkompetenz von HST mit allen<br />
wesentlichen Engineering-Leistungen<br />
und den Kernprodukten der<br />
angebotenen Lösung. Leistungsbereich<br />
zwei umfasst alle Leistungen,<br />
die entweder lokal erbracht oder in<br />
eigener Regie erstellt werden können,<br />
je nach Leistungsfähigkeit des<br />
lokalen Partners. Leistungsbereich<br />
drei definiert alle Leistungen, die<br />
zwingend lokal zu erbringen sind.<br />
Im Schnitt können so etwa 70 % der<br />
Leistungen durch lokale Firmen<br />
erbracht werden, die nach den festgelegten<br />
Qualitätsvorgaben, ebenfalls<br />
„Made in Germany“, arbeiten.<br />
Das stärkt die Akzeptanz beim<br />
Kunden und beim lokalen Partner.<br />
Engineeringleistungen<br />
made by<br />
HST in<br />
Deutschland.<br />
Kontakt:<br />
HST Hydro-Systemtechnik GmbH,<br />
Dipl.-Ing. Günter Müller-Czygan,<br />
Sophienweg 3, D-59872 Meschede,<br />
E-Mail: g.mueller@systemtechnik.net,<br />
www.systemtechnik.net<br />
Dezember 2011<br />
1120 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
Biogaserzeugung <strong>aus</strong> Bleichereikonzentrat<br />
Die Schweighofer Gruppe, ein<br />
österreichisches Familienunternehmen<br />
mit dem Kernbereich Holzindustrie,<br />
beauftragte Aquantis mit<br />
dem Bau einer <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
mit Biogaserzeugung am<br />
Standort der Schweighofer Fiber<br />
GmbH in Hallein. Aquantis ist ein<br />
Tochterunternehmen von Veolia<br />
Water Solutions & Technologies. Die<br />
neue Anlage wird künftig täglich<br />
rund 5700 m³ <strong>Wasser</strong> mit einer organischen<br />
Fracht von 62 Tonnen CSB<br />
reinigen und dabei auf umweltverträgliche<br />
Weise Biogas mit einer<br />
Feuerungsleistung von etwa 4 MWh<br />
produzieren.<br />
Das in der Produktion entstehende<br />
<strong>Abwasser</strong> wird zurzeit in<br />
einer werkseigenen anaeroben/<br />
aeroben Behandlungsanlage gereinigt<br />
und anschließend in die Salzach<br />
als Vorfluter eingeleitet. Durch<br />
die Umstellung der Produktion wird<br />
zukünftig zusätzlich ein Bleichereikonzentrat<br />
entstehen, das einen<br />
Zuwachs an organischen Inhaltsstoffen<br />
bewirkt. Für eine energetische<br />
Nutzung zur Herstellung von<br />
Biogas und zur Entlastung der<br />
bisherigen Anaerob-Anlage wird<br />
die Erweiterung der vorhandenen<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlungsanlage notwendig.<br />
Die Kernkomponenten der<br />
neuen Anlage sind leistungsfähige<br />
BIOBED ® EGSB Reaktoren. Im Interesse<br />
einer hohen Betriebssicherheit<br />
wurden die BIOBED ® Reaktoren mit<br />
einer moderaten Raumbelastung<br />
<strong>aus</strong>gelegt. Darüber hin<strong>aus</strong> weisen<br />
sie keine Einbauten innerhalb des<br />
aktiven Reaktionsvolumens auf, so<br />
dass die Menge an anaerober Biomasse<br />
maximiert und damit die<br />
Luftbild des Standortes Hallein. © Schweighofer Fiber – Heli-Sky<br />
Schlammbelastung minimiert werden<br />
kann. Das entstehende Biogas<br />
wird dem vorhandenen Biomassenheizkraftwerk<br />
zugeführt und trägt<br />
mit seiner Leistung wesentlich zur<br />
Reduzierung der Betriebskosten<br />
und zur Verminderung des Carbon<br />
Footprints bei. Die Schweighofer<br />
Gruppe entlastet somit nicht nur<br />
erheblich ihre Energiebilanz, sondern<br />
erzielt eine nachhaltige Verbesserung<br />
ihrer umweltrelevanten<br />
Bilanz insgesamt.<br />
Der Neubau ist Teil eines umfassenden<br />
Investitionsprogramms zur<br />
strategischen Neu<strong>aus</strong>richtung dieses<br />
Standorts, der sich auf die<br />
Herstellung von hochwertigem<br />
Zellstoff und Bioenergie konzentriert.<br />
Die Schweighofer Fiber GmbH<br />
erzeugt derzeit mit rund 200 Be -<br />
schäftigten jährlich etwa 160 000<br />
Tonnen Zellstoff, überwiegend für<br />
die europäische Papierindustrie.<br />
Gleichzeitig ist das Unternehmen<br />
einer der bedeutendsten Lieferanten<br />
von erneuerbarer Energie im<br />
Bundesland Salzburg und einer der<br />
wichtigsten Holzabnehmer in<br />
Österreich.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.vws-aquantis.de<br />
Kontakt:<br />
Aquantis GmbH,<br />
Dr. Martin Brockmann,<br />
Lise-Meitner-Straße 4a,<br />
D-40878 Ratingen,<br />
Tel. (02102) 99754-0,<br />
Fax (02102) 99754-89,<br />
E-Mail: aquantis@veoliawater.com,<br />
www.vws-aquantis.com<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1121
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
<strong>Abwasser</strong> kontrolliert reinigen mit UV-Licht<br />
Viele Industrieabwässer enthalten organische Verunreinigungen, die in kommunalen Kläranlagen nicht abgebaut<br />
werden können. Forscher am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in<br />
Stuttgart haben in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern ein automatisiertes Reinigungssystem entwickelt,<br />
das die organischen Schadstoffe mittels UV-Licht abbaut und bereits während der Behandlung den<br />
Reinigungserfolg kontrolliert.<br />
Ob Steak oder Käse, Karosserieblech<br />
oder Kolben, Farben<br />
oder Papier: Für den Herstellungsprozess<br />
von Lebensmitteln, Metallteilen<br />
und Chemikalien sowie die<br />
Reinigung von Produktionsanlagen<br />
wird <strong>Wasser</strong> benötigt. Ein Teil dieses<br />
Prozesswassers wird dabei mit organischen<br />
Verbindungen verunreinigt,<br />
die in den kommunalen Kläranlagen<br />
nicht oder nur schwer abgebaut<br />
werden. In diesen Fällen müssen die<br />
Abwässer bereits vor der Einleitung<br />
in das Kanalnetz behandelt werden.<br />
Derzeitige Verfahren stoßen an ihre<br />
Grenzen: Denn gelöste Verunreinigungen<br />
können nicht durch Filtration<br />
entfernt werden. Membranverfahren<br />
konzentrieren die Schadstoffe,<br />
bauen sie aber nicht ab und<br />
thermische Verfahren verbrauchen<br />
generell viel Energie.<br />
Eine Lösung, mit der organische<br />
Schadstoffe oxidativ – ohne den<br />
Einsatz von Chemikalien – <strong>aus</strong> dem<br />
<strong>Wasser</strong> entfernt werden, haben Forscher<br />
am Fraunhofer-Institut für<br />
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik<br />
IGB in dem von der Europäischen<br />
Union geförderten Projekt<br />
„Light4CleanWater“ entwickelt. In<br />
Vollautomatisierter Prototyp zur Reinigung von<br />
Industrieabwasser mit UV-Licht. © Fraunhofer IGB<br />
Zusammenarbeit mit ihren Partnern<br />
haben sie eine Demonstrationsanlage<br />
gebaut, welche die oxidative<br />
Behandlung mittels UV-Licht mit<br />
einer Echtzeit-Messung des gesamten<br />
organisch gebundenen Kohlenstoffs<br />
(total organic carbon, TOC) als<br />
Maß für den Reinigungserfolg und<br />
einer vollautomatischen Steuerung<br />
kombiniert.<br />
Im Reaktionstank der Anlage<br />
strahlt wahlweise eine Mitteldruckoder<br />
ein Vakuum-UV-Lampe energiereiches<br />
UV-Licht in das <strong>Abwasser</strong>.<br />
Treffen für das Auge unsichtbare,<br />
sehr energiereiche Strahlen von nur<br />
172 Nanometer Wellenlänge auf<br />
<strong>Wasser</strong>moleküle, werden <strong>aus</strong> diesen<br />
hochreaktive Hydroxylradikale<br />
abgespalten. In einer Kettenreaktion<br />
lösen diese die Bildung weiterer<br />
Radikale <strong>aus</strong>. „Treffen diese<br />
Radikale auf organische Schadstoffe,<br />
werden sie in kleinere, biologisch<br />
abbaubare Verbindungen<br />
wie kurzkettige organische Säuren<br />
zerlegt“, erläutert Verfahrensingenieurin<br />
Christiane Chaumette die Wirkung<br />
der UV-Strahlung.<br />
Um sicherzustellen, dass nur sauberes<br />
<strong>Wasser</strong> die Anlage verlässt,<br />
wird während der UV-Behandlung<br />
kontinuierlich eine Probe <strong>aus</strong> dem<br />
Reaktionstank gezogen und auf den<br />
Gehalt an organischem Kohlenstoff<br />
(TOC) analysiert. Ist der zuvor eingestellte<br />
Grenzwert erreicht, wird das<br />
gereinigte <strong>Abwasser</strong> automatisch<br />
her<strong>aus</strong>- und weiteres verunreinigtes<br />
<strong>Wasser</strong> in den Reaktionstank hineingepumpt.<br />
„100 Liter <strong>Abwasser</strong> pro<br />
Stunde kann der Laborprototyp auf<br />
diese Weise behandeln. Im Praxistest<br />
wurde der Farbstoff Methylenblau<br />
innerhalb nur weniger Minuten<br />
vollständig entfernt. Und selbst bei<br />
hoch belastetem <strong>Abwasser</strong> <strong>aus</strong> der<br />
Papierherstellung konnten wir den<br />
TOC auf den erforderlichen Grenzwert<br />
reduzieren“, so Chaumette.<br />
Der Prototyp steht nun Industriebetrieben<br />
zur Verfügung, um den<br />
Abbau organischer Verunreinigungen<br />
in realem <strong>Abwasser</strong> zu untersuchen.<br />
Denn kein <strong>Abwasser</strong> gleicht<br />
dem anderen. „Kriterien für den<br />
Erfolg der <strong>Abwasser</strong>reinigung sind<br />
neben der Art der Verunreinigungen<br />
auch deren Konzentration und<br />
das anfallende Volumen“, weiß die<br />
Verfahrensingenieurin. Letzteres ist<br />
wichtig, um den Energieverbrauch<br />
abzuschätzen. „Die Daten liefern<br />
uns die Grundlage für ein kostengünstiges<br />
industrielles System, welches<br />
im Betrieb Abwässer effektiv<br />
und ohne den Einsatz chemischer<br />
Hilfsstoffe behandelt“, ergänzt<br />
Abteilungsleiter Siegfried Egner im<br />
Hinblick auf geplante Arbeiten.<br />
Das Projekt „Light4CleanWater“<br />
wurde im 7. Forschungsrahmenprogramm<br />
von der EU gefördert. Projektpartner<br />
waren SICO Technology<br />
GmbH (Österreich), HECKMANN<br />
POLSKA Produkcja Metalowa i Maszyn<br />
Sp. z o.o. (Polen), UVASOL Limited<br />
(Großbritannien), E.R.S. – Steuerungstechnik<br />
– GmbH & Co. KG und<br />
LFE Laboratorium für industrielle<br />
Forschung GmbH & Co Entwicklungs<br />
KG (Deutschland), BAMO<br />
Mesures SAS (Frankreich), ADINSA<br />
Aditivos industriales y servicios para<br />
el agua S.L und VILA Electroquimica,<br />
S.A. (Spanien). Als Forschungspartner<br />
war neben dem Fraunhofer IGB<br />
die spanische ITAV Technologias<br />
avanzadas inspiralia SL beteiligt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.igb.fraunhofer.de<br />
Dezember 2011<br />
1122 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
UV-Desinfektions-Technologie für ukrainische Kläranlage<br />
Berson hat zwei seiner InLine+ UV<br />
Desinfektions-Systeme an die<br />
Kläranlage der Stadt Tschernihiw<br />
(Einwohnerzahl 350 000), im Nord-<br />
Osten von Kiew, der Hauptstadt der<br />
Ukraine geliefert. Die Berson UV<br />
Systeme desinfizieren Abwässer vor<br />
der Einleitung in den Desna.<br />
„Desinfektion ist notwendig, um<br />
zu verhindern, dass Abwässer mit<br />
hoher mikrobieller Belastung durch<br />
pathogene Viren, Parasiten und<br />
Bakterien in den Desna fließen und<br />
somit nicht nur die Standards für<br />
ukrainische Badegewässer zu erreichen,<br />
sondern auch um die Hauptwasserversorgung für<br />
viele Gemeinden flussabwärts einschließlich der Stadt<br />
Kiew sicherzustellen“, erklärt der Direktor der <strong>Wasser</strong>werke<br />
Tschernihiws, Sergey Shkin. “Che mische Desinfektion<br />
mit Chlor war keine Option, da wir unangenehme<br />
Nebenprodukte wie Trihalome thane (THMs) und halogenierte<br />
Essigsäuren (HAAs) vermeiden wollten.“ Die<br />
entstehen, wenn Chlor mit organischen Stoffen des<br />
<strong>Abwasser</strong>s reagiert. Da Chlor ein gefährliches Gas ist,<br />
sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich,<br />
um die Regeln für Transport und Lagerung sowie für die<br />
Sicherheit der Arbeiter zu erfüllen. „Chlorung würde<br />
einerseits zusätzliche Kosten erzeugen. Andererseits<br />
sind viele gefährliche Bakterien und Parasiten, wie Cryptosporidium<br />
und Giardia, resistent gegen Chlor. Deshalb<br />
haben wir uns für die UV-Technologie entschieden“, fügt<br />
Shkin hinzu.<br />
Für die <strong>Wasser</strong>werke von Tschernihiw wurden zwei<br />
Berson InLine 16000 Systeme gewählt, die parallel zueinander<br />
betrieben werden. Jede UV-Kammer ist mit zwölf<br />
Mitteldruck Multiwave® UV Lampen <strong>aus</strong>ge stattet, die<br />
automatisch abgewischt werden; Pro Kammer können<br />
Ab wässer mit einer Durchflussrate von 2000 m 3 /Std.<br />
(4000 m 3 /Std. Total) behandelt werden. In den geschlossenen<br />
Behandlungskammern kann der Druckverlust<br />
durch das InLine-Design gering gehalten werden, sie<br />
sind sehr kompakt und brauchen wenig Platz. So können<br />
diese Systeme auch in sehr kleinen Gebäuden installiert<br />
werden. Das <strong>Abwasser</strong> wird dem System allein durch die<br />
Schwerkraft zugeführt.<br />
„Wir waren sehr von der kompakten Bauweise der<br />
Berson Systeme beeindruckt“ fährt Sergey Shkin fort,<br />
„auch von der geschlossenen Bauweise, da dies ein<br />
wich tiger zusätzlicher Sicherheitsaspekt ist. Zudem hat<br />
uns die Anwendung in etlichen Referenzanlagen in der<br />
Ukraine – im Trinkwasser- und <strong>Abwasser</strong>bereich – die<br />
Entscheidung für die Berson UV Einheiten leicht<br />
gemacht.<br />
Kontakt:<br />
Berson UV-techniek,<br />
Xander Lamers,<br />
Postfach 90, NL-5670 AB Nuenen (Niederlande),<br />
Tel. +31 40 290 7777, Fax +31 40 283 5755,<br />
E-Mail: sales@bersonuv.com, www.bersonuv.com<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1123
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Membranspezialist <strong>aus</strong> Gelsenkirchen<br />
an Antarktisstation beteiligt<br />
Die A3 Water Solutions GmbH,<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigungsspezialist<br />
<strong>aus</strong> Gelsenkirchen und Tochterunternehmen<br />
der EnviTec Biogas AG,<br />
liefert die <strong>Abwasser</strong>reinigungs- und<br />
Trinkwasseraufbereitungsanlage für<br />
eine neue Forschungsstation in der<br />
Antarktis.<br />
An der Ostküste der Antarktis<br />
soll die in Duisburg testweise aufgebaute<br />
Forschungsstation des indischen<br />
National Centre of Antarctic<br />
and Ocean Research (NCAOR) bald<br />
installiert werden. Sie wird <strong>aus</strong> 134<br />
Containern bestehen, rund 1000<br />
Tonnen wiegen, drei Geschosse<br />
hoch sein und aufgeständert auf<br />
Stahlpfeilern auf einer Grundfläche<br />
von etwa 1500 Quadratmetern stehen.<br />
Der Aufbau ist für den antarktischen<br />
Sommer geplant und soll im<br />
April 2012 abgeschlossen sein.<br />
Bild der zukünftigen Forschungsstation Bharati in<br />
der Antarktis. © bof/ims<br />
Baufeld in der Antarktis. © KAEFER<br />
Probeaufbau eines Stationssegments in Duisburg. © KAEFER<br />
Dann geht die komplette Station in<br />
Betrieb. Bis zu 25 Wissenschaftler<br />
werden dann dort leben und ar -<br />
beiten.<br />
Zuständig für den Bau der Station<br />
ist das Bremer Unternehmen<br />
KAEFER. Als Partner für die H<strong>aus</strong>technik<br />
wurde die Firma YIT verpflichtet.<br />
A3 Water Solutions GmbH<br />
fungiert als Unterauftragnehmer für<br />
die Gewerke „<strong>Abwasser</strong>reinigungsanlage“<br />
und „Trinkwassergewinnungsanlage“.<br />
Zur Anwendung kommt bei der<br />
Kläranlage von A3 Water Solutions<br />
das so genannte Membranbelebungsverfahren<br />
(MBR). Anders als<br />
bei der konventionellen <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
wird das <strong>Abwasser</strong> dabei<br />
nicht über ein Sedimentationsbecken<br />
(Absetzbecken) von der<br />
aktiven Biomasse getrennt, sondern<br />
mit Hilfe von Membranfiltern, die<br />
durch ihre feinen Poren sogar Bakterien<br />
<strong>aus</strong> Flüssigkeiten filtern können.<br />
Die Ablaufqualität <strong>aus</strong> dieser<br />
Art der <strong>Abwasser</strong>reinigung ist extrem<br />
hochwertig, so dass das <strong>Wasser</strong><br />
<strong>aus</strong> diesen Anlagen der EU-Badegewässerrichtlinie<br />
entspricht und<br />
dadurch auch in die sensitiven<br />
Gewässer der Antarktis direkt eingeleitet<br />
werden kann. Ein Teil des aufbereiteten<br />
<strong>Abwasser</strong>s wird innerhalb<br />
der Station auch als Toilettenspülwasser<br />
wieder verwendet.<br />
Weiterer Vorteil der A3-Kläranlagen<br />
ist die Platz sparende und kompakte<br />
Bauweise, weshalb die Anlagentechnik<br />
auch beispielsweise auf<br />
Schiffen zum Einsatz kommt.<br />
Bei den MBR-Anlagen verbaut<br />
A3 Water Solutions MaxFlow Membranmodule<br />
der Firma MMF MaxFlow<br />
Membran Filtration GmbH. Die<br />
Membranfiltermodule sind seit Jahren<br />
in der kommunalen und industriellen<br />
<strong>Abwasser</strong>aufbereitung im<br />
Blick in die <strong>Abwasser</strong>reinigungsanlage.<br />
© A3 Water Solutions<br />
Dezember 2011<br />
1124 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
Einsatz. Sie zeichnen sich durch ihre<br />
robuste und Platz sparende Bauform<br />
und den sehr geringen Spülluftbedarf<br />
<strong>aus</strong>. Dadurch ist ihr Einsatz<br />
sehr effizient und energiesparend.<br />
Durch die Verwendung von<br />
Membranplatten sind die Module<br />
äußerst verzopfungsresistent.<br />
Auch die Trinkwassergewinnung<br />
basiert auf Membrantechnik. Beim<br />
Umkehrosmoseverfahren wird das<br />
aufzubereitende <strong>Wasser</strong> über eine<br />
Membran geleitet, die <strong>aus</strong>schließlich<br />
<strong>Wasser</strong>moleküle passieren lässt.<br />
Dadurch entsteht ein sehr reines<br />
<strong>Wasser</strong>, das sogar komplett salzfrei<br />
ist. Um dem <strong>Wasser</strong> nach dieser<br />
sehr weitgehenden Reinigung diejenigen<br />
Salze zuzuführen, die der<br />
menschliche Körper benötigt, wird<br />
das <strong>Wasser</strong> anschließend über einen<br />
Calcidfilter aufgehärtet.<br />
Kontakt:<br />
A3 Water Solutions GmbH,<br />
Steffen Richter, Vertriebsleiter,<br />
Magdeburger Straße 16a,<br />
D-45881 Gelsenkirchen,<br />
Tel. (0209) 98 099 821,<br />
E-Mail: steffen-richter@a3-gmbh.com,<br />
www.a3-gmbh.com<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage. © A3 Water Solutions<br />
www.gelsenwasser.de<br />
Klar vorOrt<br />
Mit maßgeschneiderten<br />
<strong>Abwasser</strong>lösungen für Kommunen<br />
Fair. Mittelständisch. Kommunal:<br />
Als erfahrener <strong>Abwasser</strong>dienstleister stellen<br />
wir Ihrer Kommune unser Know-how<br />
zur Verfügung und entwickeln nach Ihren<br />
Vorgaben bedarfs- und umwelt gerechte<br />
Konzepte. Mit Effizienz und partnerschaftlichem<br />
Engagement.<br />
Setzen Sie auf überzeugende Klärung:<br />
unter Telefon 0209 708 - 1935 oder<br />
loesung@gelsenwasser.de.<br />
Foto: Kläranlage, Emmerich am Rhein<br />
Anzeige <strong>Abwasser</strong>konzept 176x123.indd 1 27.09.10 09:14<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1125
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Kostengünstige Wartung und Spülung<br />
von Schmutzwasserkanälen<br />
<strong>Wasser</strong> ist ein kostbares Gut und der schonende Umgang mit ihm ein Muss. Doch viele Kommunen lernen<br />
gerade auch die Kehrseite des <strong>Wasser</strong>sparens ihrer Bürger kennen. Denn durch das geringere <strong>Wasser</strong>aufkommen<br />
werden Ablagerungen und Verstopfungen in Schmutzwasserkanälen immer häufiger zu einem teuren<br />
Problem. So entwickelte REHAU als Spezialist für nachhaltiges <strong>Wasser</strong>management einen Kanalschacht mit<br />
einem selbstständigen Schwallspülsystem. Ziel der Entwicklung war dabei, dass der neue Spülschacht rein<br />
mechanisch arbeitet und dammbruchartige Spülwellen mit einer hohen Sohlschubspannung in Kanälen<br />
erzeugt.<br />
Sinkender <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
In der Politik und der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
herrschte lange Zeit die<br />
Ansicht eines stetig anwachsenden<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauchs vor. Während<br />
1983 der Pro-Kopf-Verbrauch noch<br />
bei etwa 150 Litern lag, wurde für<br />
das Jahr 2000 bereits eine Zunahme<br />
um gut die Hälfte auf 220 Litern<br />
angenommen. Tatsächlich sinkt der<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauch der Bundesbürger<br />
jedoch deutlich. So lag er 2007 nur<br />
noch bei 127 Liter pro Kopf.<br />
Bild 1. Stetig sinkender <strong>Wasser</strong>verbrauch pro<br />
Bundesbürger.<br />
Bild 2. Darstellung des Demographischen Wandels<br />
am Beispiel Ostdeutschland: Entwicklung der<br />
Bevölkerungszahl von 2005–2020.<br />
Ein Grund für den Rückgang des<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauchs ist sicher darin zu<br />
sehen, dass mit der kostbaren Ressource<br />
heute in vielen Bereichen<br />
des alltäglichen Lebens schonender<br />
umgegangen wird. Jedoch führte<br />
dies in den letzten Jahren zu einer<br />
drastischen Reduzierung des Trockenwetterabflusses<br />
in <strong>Abwasser</strong>kanälen.<br />
Die geringeren <strong>Wasser</strong>spiegelhöhen<br />
und Abflussgeschwindigkeiten<br />
und damit auch<br />
die verminderten Sohlschubspannungen<br />
verursachen, dass sich teilweise<br />
Ablagerungen an der Fließsohle<br />
der Kanäle bilden. Besonders<br />
Kanäle mit geringem Gefälle sind<br />
hiervon betroffen, was zu einer<br />
Verringerung der hydraulischen<br />
Leistungsfähigkeit führt (Bild 1).<br />
Die Auswirkung sind häufigere<br />
und längere Entlastungsereignisse<br />
in die angeschlossenen Vorfluter,<br />
die dann starkem hydraulischen<br />
Stress und hohen Schmutzwasserfrachten<br />
<strong>aus</strong>gesetzt werden. Der<br />
Schmutz- und Spülstoß am Anfang<br />
eines Regenereignisses befördert<br />
darüber hin<strong>aus</strong> hohe Schadstofffrachten.<br />
Falls in Mischwasserkanalisation<br />
abgeleitet wird, stellt dies<br />
die angeschlossenen Kläranlagen<br />
vor große Her<strong>aus</strong>forderungen. Die<br />
Geruchsbelästigung sowie die biogene<br />
Schwefelsäurekorrosion bei<br />
Betonrohren und Betonschächten<br />
sind weitere unangenehme Auswirkungen<br />
der Ablagerungen.<br />
Zu der geschilderten Problematik<br />
kommt verschärfend die Bevölkerungsabwanderung<br />
<strong>aus</strong> vielen<br />
strukturschwachen Regionen hinzu.<br />
Hierdurch sinkt der <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
noch weiter. Dies führte<br />
dazu, dass beispielsweise in Ostdeutschland<br />
<strong>aus</strong> heutiger Sicht<br />
überdimensionale <strong>Wasser</strong>werke,<br />
Rohrleitungsnetze und Entsorgungsanlagen<br />
gebaut wurden. Und<br />
dieser Effekt wird sich noch verstärken.<br />
Denn das ifo-Institut errechnete<br />
2003, dass zwischen 2005 und<br />
2020 die Bevölkerungszahl dort um<br />
insgesamt 7 Prozent abnehmen<br />
wird. Ein Aspekt mit dem nicht nur<br />
Ostdeutschland zu kämpfen hat<br />
(Bild 2).<br />
Trennkanalisation<br />
und die Kehrseite der<br />
Ökologie-Medaille<br />
Die vermehrte Neuverlegung von<br />
Kanalrohren in Trennkanalisation,<br />
bei der Schmutz- und Regenwasser<br />
getrennt voneinander abgeleitet<br />
werden, ist unbestritten der richtige<br />
Weg, um Kläranlagen und Kanäle<br />
nicht durch Regenwasser zu überlasten.<br />
Dies führt jedoch auf der<br />
anderen Seite dazu, dass der <strong>Wasser</strong>durchfluss<br />
in den Kanälen nochmals<br />
verringert wurde und zukünftig<br />
weiter reduziert wird. Allein im<br />
Zeitraum von 2001 bis 2004 wurden<br />
70 von 100 Metern in Trennkanalisation<br />
neu verlegt (Bild 3).<br />
Die Ablagerungen und Verstopfungen<br />
sind für immer mehr Kommunen<br />
ein großes und auch teures<br />
Problem, welches aufgrund der<br />
geschilderten Problematik stetig an<br />
Aktualität gewinnt. Um dem entgegen<br />
zu wirken, werden manuelle<br />
Reinigungen per Spülwagen eingesetzt.<br />
Dabei wird aber oftmals<br />
teures Frischwasser zur Reinigung<br />
Dezember 2011<br />
1126 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
verwendet. Auch ein Rückbau überdimensionierter<br />
Rohre scheidet oft<br />
<strong>aus</strong> Wirtschaftlichkeitsgründen <strong>aus</strong><br />
– sofern nicht gerade eine Sanierung<br />
ansteht – da die Rohre meist<br />
zu tief im Untergrund verlegt sind.<br />
Um diese Her<strong>aus</strong>forderungen zu<br />
bewältigen, ist es notwendig, die<br />
von Ablagerungen betroffenen<br />
Kanäle regelmäßig und vor allem<br />
kostengünstig zu reinigen. Um<br />
Frischwasser und Energie einzusparen,<br />
sollten deshalb Reinigungsstrategien<br />
entwickelt werden, die<br />
bereits vorhandenes <strong>Wasser</strong> und<br />
dessen Energie nutzen, um den<br />
Kanal von Ablagerungen zu befreien.<br />
Lösung: Kanalschacht mit<br />
integriertem Kanalspüler<br />
Als Spezialist für nachhaltiges <strong>Wasser</strong>management<br />
hat sich REHAU<br />
dieser Sache angenommen und<br />
sein Programm mit dem neuen<br />
AWASCHACHT WATERFLUSH um<br />
eine effiziente und wirtschaftliche<br />
Lösung zur Schwallspülung von<br />
Kanälen erweitert (Bild 4).<br />
Mit dem neuen Spülschacht <strong>aus</strong><br />
Polypropylen werden selbst ge -<br />
ringste Zuflüsse an Regen-, Brauchund<br />
Dachwasser gesammelt und<br />
dann in einen wirkungsvollen<br />
Spülschwall umgesetzt. Ablagerungen<br />
werden so kontinuierlich zu<br />
den Kläranlagen transportiert und<br />
die Ursachen von Geruchsbelästigung<br />
und Abflusshindernissen in<br />
Trennkanalsystemen wirkungsvoll<br />
bekämpft. Der Spülschacht arbeitet<br />
dabei selbsttätig ohne Fremdenergie.<br />
Der Kanalschacht mit seiner wartungsarmen<br />
Spülvorrichtung kann<br />
durch seine Variabilität entweder<br />
direkt bei der Neuplanung des Kanalnetzes<br />
integriert werden oder auch<br />
nachträglich mit einer seitlichen<br />
Anbindung an den Haupt kanal.<br />
Die Funktionsweise von AWA-<br />
SCHACHT WATERFLUSH ist denkbar<br />
einfach: Beispielweise fließt über<br />
einen Straßenablauf Regenwasser<br />
in den Spülschacht, das sich im<br />
Schacht oberhalb des Fließgerinnes<br />
sammelt. Der <strong>Wasser</strong>pegel steigt<br />
kontinuierlich an und damit auch<br />
ein beweglicher Überlauf im Spülmodul.<br />
Erreicht der <strong>Wasser</strong>spiegel<br />
schließlich den Deckel der Spülvorrichtung,<br />
startet der Kanalspüler<br />
selbstständig. Innerhalb weniger<br />
Sekunden entleeren sich dammbruchartig<br />
bis zu 630 Liter <strong>Wasser</strong>,<br />
die je nach Situation mit bis zu 31<br />
Litern pro Sekunde mehrere 100<br />
Meter spülen.<br />
Die regelmäßige und vor allem<br />
kostenneutrale Reinigung des<br />
Kanals wird nur mit der Kraft des<br />
angestauten <strong>Wasser</strong>s – ohne zusätzliche<br />
Energie – durchgeführt. So<br />
werden dank dem neuen Spülschachtsystem<br />
teure, manuelle Reinigungen<br />
der Schmutzwasserkanäle<br />
überflüssig. Zudem sind<br />
damit massive Kosteneinsparungen<br />
bei der Wartung des Kanalsystems<br />
möglich. Als besondere Serviceleistung<br />
unterstützt REHAU Bauherren<br />
kostenfrei bei der Planung und Auslegung<br />
der Projekte.<br />
Bild 3. Neuverlegung von Kanalrohren in<br />
Trennkanalisation von 1980–2004.<br />
Bild 4. WATERFLUSH.<br />
Durchgängige<br />
Kanalnetzlösung <strong>aus</strong> PP<br />
Das Schachtsystem von REHAU bildet<br />
zusammen mit den Hochlastkanalrohrsystemen<br />
AWADUKT PP<br />
SN10/16 RAUSISTO eine durchgängige<br />
Kanalnetzlösung <strong>aus</strong> Polypropylen,<br />
mit denen Sanierungen und<br />
Sonderabschreibungen für vorzeitig<br />
zu erneuernde <strong>Abwasser</strong>haltungen<br />
vermieden werden können.<br />
Entscheidende Kriterien für die<br />
Zukunftssicherheit der Rohr-,<br />
Schacht- und Formteilfamilie sind<br />
der vollwandige Aufbau <strong>aus</strong> füllstofffreiem<br />
Polypropylen, das<br />
durchgängige SL-Sicherheitsdichtsystem<br />
sowie die Widerstandsfähigkeit<br />
gegen hohe statische und<br />
dynamische Belastungen.<br />
Die REHAU Kanalnetzlösung<br />
wurde durch das IKT – Institut für<br />
Unterirdische Infrastruktur gGmbH in<br />
einer Langzeitprüfung erfolgreich auf<br />
Fremdwasserdichtheit getestet und<br />
als erste auf dem Markt mit dem Prüfsiegel<br />
„IKT Geprüft – Fremdwasserdicht“<br />
<strong>aus</strong>gezeichnet. Zudem liegt für<br />
die Kanalnetzlösung ein bisher einzigartiges<br />
Gutachten vor: Die Landesgewerbeanstalt<br />
Nürnberg (LGA)<br />
attestiert dem System nach umfangreichen<br />
Prüfungen eine Nutzungsdauer<br />
von mindestens 100 Jahren.<br />
Quellen:<br />
Statistisches Bundesamt Fachserie 19<br />
Reihe 2.1 „Umwelt“ – Öffentliche <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>beseitigung,<br />
6. September 2006, S. 7.<br />
Statistisches Bundesamt, 2006.<br />
Statistisches Bundesamt, Berechnung des<br />
ifo Instituts, 2003.<br />
Autor/Kontakt:<br />
Heiko Leihbecher,<br />
Produktmarketing <strong>Abwasser</strong>technik<br />
REHAU AG + Co,<br />
Ytterbium 4,<br />
D-91058 Erlangen,<br />
Tel. (09131) 92-50,<br />
Fax (09131) 771430,<br />
E-Mail: erlangen@rehau.com,<br />
www.rehau.com<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1127
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Dichtheitsprüfungen in Sonderprofilen<br />
mit LAMPE Kanaldichtkissen –<br />
den „größten Absperrblasen der Welt“<br />
Dichtheitsprüfungen<br />
in<br />
Sonderprofilen<br />
mit LAMPE<br />
Kanaldichtkissen.<br />
<strong>Wasser</strong> fließt unter dem fast drucklosen, nicht<br />
verbauten Kanaldichtkissen ab, ohne dass sich<br />
dieses bewegt.<br />
Dichtheitsprüfungen und Rohrabsperrungen<br />
in runden Rohren<br />
sind in der heutigen Zeit für<br />
viele Fachfirmen ein tägliches<br />
Geschäft. Bedauerlicherweise stoßen<br />
noch immer viele Auftragnehmer,<br />
Auftraggeber und Planer bei<br />
Dichtheitsprüfungen und Rohrabsperrungen<br />
in Sonderprofilen an<br />
ihre Grenzen. „Das muss nicht sein,<br />
mit dem richtigen Know-how und<br />
der richtigen Ausrüstung sind auch<br />
Arbeiten in Sonderprofilen sehr einfach<br />
zu erledigen.“ So der O-Ton von<br />
Nico Helmker, Mitarbeiter der Firma<br />
LAMPE, welche seit über 25 Jahren<br />
Kanaldichtkissen für Rohrabsperrungen<br />
und Dichtheitsprüfungen<br />
für alle Kanalprofile herstellt und<br />
weltweit vertreibt. Egal ob ge -<br />
normte und nicht-genormte Eiprofile,<br />
Maulprofile, Drachenprofile,<br />
Rechteckprofile oder achteckige<br />
Profile, mit den LAMPE Kanaldichtkissen<br />
stellt kein Profil mehr ein Problem<br />
dar. „Selbst Dichtheitsprüfungen<br />
in Großprofilen mit Trockenwetterrinne<br />
sind für unsere Kunden<br />
mit LAMPE Kanaldichtkissen eine<br />
Kleinigkeit“, so Helmker weiter.<br />
„Durch die besondere Bauart der<br />
nicht dehnbaren LAMPE-Kanaldicht<br />
kissen legt sich das Material<br />
beim Aufblasen immer rund um<br />
den Kanal an, das Profil spielt dabei<br />
keine Rolle, für eine 100 %ige<br />
Abdichtung sorgt dabei die fest<br />
aufgebrachte Schaumstoff-Spezialdichtung.“<br />
Weitere Vorteile, wie der nicht<br />
notwendige zusätzliche Verbau,<br />
sprechen für sich:<br />
Dass LAMPE Kanaldichtkissen in<br />
allen Profilen eingesetzt werden<br />
können, ist nur einer von vielen Vorteilen<br />
dieser besonderen „Absperrblasen“.<br />
Ein weiterer, wichtiger Vorteil<br />
ist es, dass LAMPE Kanaldichtkissen<br />
ohne zusätzlichen Verbau<br />
eingesetzt werden können. „Ein Vorteil,<br />
der sich <strong>aus</strong> der besonderen<br />
Konstruktion und Arbeitsweise der<br />
Geräte ergibt“, erklärt Nico Helmker.<br />
Im Gegensatz zu herkömmlichen<br />
Absperrblasen dehnen sich die<br />
LAMPE Kanaldichtkissen beim Aufblasen<br />
nicht <strong>aus</strong>, sondern legen sich<br />
schon bei sehr wenig Druck einmal<br />
komplett um die Rohrwandung an.<br />
„Aus diesem Grund ziehen sich<br />
LAMPE Kanaldichtkissen bei Druckverlust<br />
auch nicht zusammen, sondern<br />
liegen immer noch mit der vollen<br />
Fläche an der Rohrwandung an.<br />
Eine dehnbare Absperrblase dagegen<br />
zieht sich bereits bei geringem<br />
Druckverlust wieder zusammen<br />
und verliert damit ihren formschlüssigen<br />
Reibschluss zur Rohrwandung,<br />
was eine axiale Bewegung<br />
des Gerätes zur Folge hat. Aus<br />
diesem Grund ist ein zusätzlicher<br />
Verbau von herkömmlichen, dehnbaren<br />
Absperrblasen auch unumgänglich,<br />
da sonst eine große<br />
Gefahr von diesen Geräten <strong>aus</strong>gehen<br />
kann“, so Helmker weiter.<br />
LAMPE Kanaldichtkissen unterliegen<br />
nur einer physikalischen<br />
Grenze: Der maximale Sperrdruck<br />
(Gegendruck hinter dem Kissen)<br />
darf maximal halb so groß sein wie<br />
der Arbeitsdruck im Kissen (bei den<br />
gängigen 1 bar Geräten also 5 m<br />
<strong>Wasser</strong>säule = 0,5 bar Gegendruck).<br />
Bevor sich die Geräte bewegen<br />
würden, würde ein physikalischer<br />
Druck<strong>aus</strong>gleich (Innendruck =<br />
Sperr druck/Gegendruck) zu einer<br />
Undichtigkeit an der Kanalsohle<br />
führen, wodurch erst langsam <strong>Wasser</strong><br />
unter dem Kissen abläuft, bevor<br />
sich das Kissen in irgendeiner Weise<br />
bewegen würde. „Deswegen ist ein<br />
zusätzlicher Verbau von LAMPE<br />
Kanaldichtkissen nicht notwendig<br />
und unnötige Zeitverschwendung.<br />
Wenn die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen<br />
wie Einsatzortkontrolle,<br />
Kontrolle der Gerätebeschaffenheit<br />
und Einsatzkontrolle der<br />
Geräte laut gültiger Betriebsanleitung<br />
eingehalten werden, sind<br />
LAMPE Kanaldichtkissen, auch ohne<br />
Dezember 2011<br />
1128 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
zusätzlichen Verbau, absolut sicher.<br />
Gegenteilige Meinungen beruhen<br />
dort auf einer großen Unwissenheit<br />
und Ignoranz gegenüber einer im<br />
H<strong>aus</strong>e LAMPE seit über 25 Jahren<br />
vorhandenen Erfahrung im Um -<br />
gang mit solchen Geräten.“ So das<br />
Statement <strong>aus</strong> dem H<strong>aus</strong>e LAMPE.<br />
Neben den weiteren, erwiesenen<br />
Vorteilen wie der Reparierbarkeit,<br />
der geringen Gewichte und der<br />
Schachtgängigkeit aller Geräte bis<br />
2200 mm machen besonders die<br />
großen Einsatzreichweiten ohne<br />
Dehnung, basierend auf einem speziellen<br />
Faltungsprinzip, sowie die<br />
nahezu endlose Lebensdauer (verarbeitet<br />
wird ein spezielles gewebeverstärktes<br />
Material, welches die<br />
positive Eigenschaft besitzt, nicht<br />
zu verspröden), die original LAMPE<br />
Kanaldichtkissen zu der ökonomischen<br />
Alternative im Bereich der<br />
pneumatischen Rohrabsperrung.<br />
Traditionen und Innovationen<br />
seit 65 Jahren!<br />
Bereits seit nunmehr 1946 etabliert<br />
sich die Firma LAMPE unter anderem<br />
im Bereich der pneumatischen<br />
Prüf- und Absperrtechnik. In den<br />
65 Jahren ihres Bestehens konnte<br />
sich das Unternehmen immer wieder<br />
durch neue Innovationen einen<br />
Namen machen. Neben den be -<br />
währten Kanaldichtkissen mit Doppelkonus,<br />
welche schon Anfang der<br />
80er-Jahre von der Firma entwickelt<br />
und patentiert wurden, ist man<br />
besonders stolz auf die jüngsten<br />
Innovationen und Entwicklungen<br />
im Bereich der Absperr- und Prüftechniken.<br />
Hierzu gehören unter<br />
anderem Dichtkissen mit Rohrbypass,<br />
welche den automa tischen<br />
Abtransport von <strong>Wasser</strong> durch eine<br />
B<strong>aus</strong>telle ohne Hilfe von Pumpen<br />
ermöglichen, die 2 bar Geräte-Serie<br />
für Sperrdrücke bis 10 m <strong>Wasser</strong>säule,<br />
sowie die neue Economy-<br />
Serie, als preisgünstige und ökonomische<br />
Alternative für Rohrabsperrungen<br />
in kleineren Durchmessern<br />
bis 600 mm mit allen Vorteilen und<br />
Qualitäten der LAMPE Kanaldichtkissen.<br />
Als jüngsten großen Clou gelang<br />
es dem Unternehmen, die ersten<br />
nicht-dehnbaren Kanaldichtkissen<br />
für Dichtheitsprüfungen bis<br />
3200 mm und ein Absperrgerät bis<br />
3600 mm zu entwickeln, welche<br />
sich zu diesem Zeitpunkt schon auf<br />
diversen B<strong>aus</strong>tellen bewährt haben.<br />
„Solche Entwicklungen wären ohne<br />
die lange Erfahrung unserer Firma<br />
in der Entwicklung und Herstellung<br />
von pneumatischen Absperrgeräten<br />
und unserem hohen Verantwortungsbewusstsein<br />
gegenüber der<br />
Sicherheit der Anwender undenkbar<br />
gewesen“, äußert sich Nico<br />
Helmker abschließend.<br />
Aber auch in Zukunft wird die<br />
Firma LAMPE ihr Lieferprogramm<br />
im Bereich Absperr- und Kanalsanierungstechniken<br />
weiter <strong>aus</strong>bauen,<br />
so entsteht unter anderem<br />
Neu: LAMPE Kanaldichtkissen der Economy-Serie<br />
bis 600 mm: unschlagbar im Preis-Leistungsverhältnis!<br />
Das größte Kanaldichtkissen aller Zeiten: 3600 mm!<br />
zur Zeit in Stadtoldendorf ein<br />
großer Mietpark an LAMPE Kanaldichtkissen<br />
für Rohrabsperrungen<br />
und Dichtheitsprüfungen bis<br />
2200 mm, um den immer größer<br />
werdenden Kurzzeitbedarf an<br />
pneumatischen Rohrabsperrungen<br />
abdecken zu können.<br />
Kontakt:<br />
LAMPE GmbH, Warteweg 46, D-37627 Stadtoldendorf,<br />
Tel. (05532) 2033, Fax (05532) 4499,<br />
E-Mail info@lampegmbh.de, www.lampegmbh.de<br />
Solare Klärschlammtrocknung<br />
mit dem WendeWolf ®<br />
Verdunstetes <strong>Wasser</strong> muss<br />
nicht entsorgt werden<br />
Kosteneinsparung bei der<br />
Entsorgung bis über 70%<br />
Weltweit seit über 15 Jahren<br />
erfolgreich im Einsatz<br />
IST-Anlagenbau GmbH | Ritterweg 1 | 79400 Kandern | GERMANY<br />
Tel. +49 7626 9154 0 | Fax +49 7626 9154 30<br />
info@wendewolf.com | www.wendewolf.com<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1129
Fokus<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Pilotprojekt HAMBURG WATER Cycle<br />
in der Jenfelder Au dreifach gefördert<br />
Das von der Stadt Hamburg geplante Neubauprojekt „Jenfelder Au“ wird für die Umsetzung des HAMBURG<br />
WATER Cycles, einem innovativen Konzept zur <strong>Abwasser</strong>entsorgung, von nun an gleich dreifach gefördert.<br />
Neben Mitteln <strong>aus</strong> dem EU-Life+ Programm erhält das Projekt Fördergelder des Bundesministeriums für<br />
Bildung und Forschung (BMBF) sowie des Bundeministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Damit<br />
steht dem Bau des HAMBURG WATER Cycles in der Jenfelder Au nichts mehr im Wege.<br />
Baufeld Jenfelder Au.<br />
Der HAMBURG WATER Cycle<br />
wurde von HAMBURG WASSER,<br />
dem Trinkwasserver- und <strong>Abwasser</strong>entsorger<br />
der Hansestadt, entwickelt.<br />
Dahinter verbirgt sich ein<br />
Entwässerungskonzept, das eine<br />
getrennte Ableitung von Toilettenabwasser<br />
(Schwarzwasser) und sonstigem<br />
häuslichen <strong>Abwasser</strong> (Grauwasser)<br />
vorsieht. Das Grauwasser soll<br />
energiesparend dezentral behandelt<br />
werden. Das Schwarzwasser wird mit<br />
Vakuumtechnik konzentriert erfasst<br />
und in einer Biogasanlage gemeinsam<br />
mit weiteren organischen Abfällen<br />
behandelt. Das dabei produzierte<br />
Biogas wird in einem Block-<br />
Heizkraftwerk in Elektrizität und<br />
Wärme transformiert. Aus den Reststoffen<br />
der Biogasanlage (Gärresten)<br />
können hochwertige Produkte zur<br />
Bodenverbesserung und Düngung<br />
hergestellt werden.<br />
Wissenschaftlich begleitet wird<br />
das Bauvorhaben von dem BMBFgeförderten<br />
Verbundprojekt „Demonstrationsvorhaben<br />
Stadtquartier Jenfelder<br />
Au – Die Kopplung von regenerativer<br />
Energiegewinnung mit<br />
innovativer Stadtentwässerung (kurz<br />
KREIS)“. Insgesamt sind an dem Verbundprojekt<br />
sechs wissenschaftliche<br />
Einrichtungen und vier Praxispartner<br />
beteiligt, die in den nächsten drei<br />
Jahren das innovative Energie- und<br />
Entwässerungskonzept HAMBURG<br />
WATER Cycle in der Jenfelder Au<br />
umsetzen. Die Förderung <strong>aus</strong> dem<br />
europäischen Life+ Programm<br />
bezieht sich auf Planung, Bau und<br />
Inbetriebnahme der neuartigen Infrastruktur<br />
für das Quartier. Die einjährige<br />
Förderung des BMWi unterstützt<br />
HAMBURG WASSER bei der<br />
Weiterentwicklung des Konzeptes zur<br />
energetischen Optimierung.<br />
Kontakt:<br />
HAMBURG WASSER,<br />
Ole Braukmann,<br />
Billhorner Deich 2, D-20539 Hamburg,<br />
Tel. (040) 78 88-88 222,<br />
E-Mail: ole.braukmann@hamburgwasser.de,<br />
www.hamburgwatercycle.de<br />
Über den<br />
HAMBURG WATER Cycle<br />
Funktionskreislauf HWC.<br />
HWC Grafik.<br />
Mit dem Konzept des HAM-<br />
BURG WATER Cycle (HWC)<br />
verfolgt HAMBURG WASSER<br />
einen ganzheitlichen Ansatz<br />
zur <strong>Abwasser</strong>entsorgung und<br />
Energieversorgung im urbanen<br />
Raum. Dabei werden die Infrastrukturbereiche<br />
<strong>Wasser</strong> und<br />
Energie als ineinander greifende<br />
und sich ergänzende<br />
Aufgabenfelder betrachtet. Das<br />
schont die Ressource Trinkwasser<br />
und hilft gleichzeitig,<br />
das anfallende <strong>Abwasser</strong> zur<br />
Energiegewinnung zu nutzen.<br />
www.hamburgwatercycle.de<br />
Dezember 2011<br />
1130 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Fokus<br />
Phosphor-Rückgewinnung <strong>aus</strong> Schlammkonzentrat<br />
Phosphor ist ein lebenswichtiges<br />
Element, endlich und nicht er -<br />
setzbar. Die weltweit wirtschaftlich<br />
erschließbaren Reserven reichen<br />
noch etwa 100 Jahre. Wissenschaftler<br />
des KIT haben ein Ver fahren zur<br />
Rückgewinnung von Phosphor entwickelt,<br />
das derzeit auf der Kläranlage<br />
Neuburg an der Donau eingesetzt<br />
wird. In Zusammenarbeit mit<br />
der Firma MSE <strong>aus</strong> Karlsbad-Ittersbach<br />
will das KIT nun eine mobile<br />
Anlage zur Schlamm entwässerung<br />
so um dieses Ver fahren ergänzen,<br />
dass <strong>aus</strong> dem entstehenden Schlammkonzentrat<br />
Phosphor zurückgewonnen<br />
werden kann.<br />
Derzeit laufen mit der MSE (Mobile<br />
Schlammentwässerungs GmbH),<br />
einer Tochter der EnBW Kraftwerke<br />
AG, Versuche zur Charakterisierung<br />
der verschiedenen Abwässer, die sich<br />
unter Zentrifugalkraft von den Feststoffen<br />
abgetrennt haben. Dies sei<br />
„ein wichtiger Schritt vor den Kurzund<br />
Langzeitexperimenten, die<br />
anschließend folgen werden“, erklärt<br />
Fortschritt: KIT-Wissenschaftler ergänzen mobile<br />
Anlagen zur Schlammentwässerung mit ihrem<br />
Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung. © Foto: MSE<br />
Dr. Rainer Schuhmann, der Leiter des<br />
Kompetenzzentrums für Materialfeuchte<br />
(CMM) am KIT.<br />
Mit dem Einsatz der neuen<br />
Technik „könnten auch Kläranlagen<br />
ihren Verpflichtungen nachkommen,<br />
deren Schlammrückstand<br />
mobil entwässert wird“, so der Projektleiter<br />
der MSE, Dr. Rudolf Turek.<br />
Und diese Anforderungen werden<br />
drängender: Der Bund diskutiert<br />
derzeit eine prozentuale Rückgewinnungsverpflichtung<br />
auf der<br />
Grundlage eines Arbeitsentwurfs<br />
des Bundesumweltministeriums<br />
vom April 2011. Darin verlangt dieses<br />
von Wissenschaftlern wie auch<br />
von der Industrie und Kläranlagenbe<br />
trieben, nach Möglichkeiten<br />
der Rückgewinnung zu suchen.<br />
Der Phosphor wird in einem am<br />
KIT entwickelten Verfahren zurückgewonnen.<br />
Die Wissenschaftler des<br />
Fachbereiches Umwelttechnologie<br />
des CMM gewinnen mittels Kristallisation<br />
in der <strong>Abwasser</strong>phase gelöstes<br />
Phosphat zurück. Dieses einfache<br />
und effektive Prinzip, so<br />
erklärt Rainer Schuhmann, „liefert<br />
ein hochwertiges Düngemittel, das<br />
neben Phosphor noch weitere<br />
Pflanzennährstoffe enthält und hervorragend<br />
pflanzenverfügbar ist“.<br />
Kontakt:<br />
Karlsruher Institut für Technologie,<br />
Kaiserstraße 12, D-76131 Karlsruhe,<br />
Tel. (0721) 608-0, Fax (0721) 608-44290,<br />
E-Mail: info@kit.edu, www.kit.edu<br />
GeoTHERM<br />
expo & congress<br />
1. + 2. März 2012<br />
Messe Offenburg<br />
Europas größte Fachmesse<br />
mit Kongress für Oberflächennahe<br />
und Tiefe Geothermie<br />
Messe Offenburg-Ortenau GmbH<br />
Schutterwälder Str. 3 · 77656 Offenburg · Germany<br />
Fon +49 (0)781 - 9226 - 32 · Fax +49 (0)781 - 9226 - 77<br />
E-Mail: geotherm@messeoffenburg.de<br />
www.geotherm - offenburg.de
Nachrichten<br />
Branche<br />
Mehr Sicherheit für die Trinkwasserqualität<br />
in Gebäuden<br />
© Rainer Sturm/Pixelio<br />
Mehrere Neuerungen in der<br />
Trinkwasserverordnung<br />
(TrinkwV) stärken die Qualitätsstandards<br />
für Trinkwasser. Im Fokus stehen<br />
die Trinkwasser-Installationen<br />
in Gebäuden. Diese dürfen die Qualität<br />
des Trinkwassers nicht beeinträchtigen.<br />
So müssen seit November<br />
die Trinkwasser-Installationssysteme<br />
auch in gewerblich genutzten<br />
Gebäuden wie Mietshäusern auf<br />
Legionellen untersucht werden. Bisher<br />
bestand diese Pflicht nur für<br />
öffentliche Gebäude. Verbindlich<br />
sind nun auch technische Regeln<br />
für den Bau und Betrieb von neuen<br />
Trinkwasserversorgungsanlagen.<br />
Dadurch soll vermieden werden,<br />
dass für Trinkwasser-Installationen<br />
ungeeignete Ma terialien verwendet<br />
werden, <strong>aus</strong> denen sich Stoffe in das<br />
Trinkwasser lösen könnten. Als erstes<br />
Land in der Europäischen Union<br />
(EU) führt Deutschland zudem<br />
einen Grenzwert für Uran im Trinkwasser<br />
ein.<br />
Trinkwasser-Installationen in<br />
ge werblich genutzten Gebäuden,<br />
also entsprechend Trinkwasserverordnung<br />
auch in Mietshäusern,<br />
müssen seit November 2011 auf<br />
Legionellen untersucht werden. Das<br />
legt die 1. Verordnung zur Änderung<br />
der Trinkwasserverordnung<br />
vom 03. Mai 2011 fest. Bisher galt<br />
diese Regelung nur für Gebäude, in<br />
denen <strong>Wasser</strong> an die Öffentlichkeit<br />
abgegeben wird. Die Verordnung<br />
führt zudem für Legionellen erstmals<br />
einen so genannten „technischen<br />
Maßnahmenwert“ ein. Er<br />
liegt bei 100 „koloniebildenden Einheiten“<br />
in 100 Milliliter <strong>Wasser</strong>. Wird<br />
dieser Wert erreicht oder überschritten,<br />
kann das Gesundheitsamt den<br />
Anlagenbetreiber dazu verpflichten,<br />
die Ursache der Belastung zu<br />
ermitteln und zu beheben. Legionellen<br />
können schwere, teils tödliche<br />
Lungenentzündungen sowie<br />
das grippeähnliche Pontiac-Fieber<br />
hervorrufen. Sie sind nicht von<br />
Mensch zu Mensch ansteckend,<br />
sondern gelangen durch das Einatmen<br />
von Aerosolen in den Körper.<br />
Gefährliche Legionellenmengen<br />
können im warmen <strong>Wasser</strong> entstehen,<br />
wenn zum Beispiel durch Baufehler<br />
in den Anlagen die erforderlichen<br />
Temperaturen (Kaltwasser<br />
< 25 und Warmwasser > 55 °C) nicht<br />
eingehalten werden.<br />
Um die Qualität des Trinkwassers<br />
in Deutschland noch besser vor Verunreinigungen<br />
zu schützen, regelt<br />
die Trinkwasserverordnung nun<br />
den Einsatz von Installationsbauteilen<br />
strenger: Installationsbetreiber<br />
werden auf die Einhaltung der allgemein<br />
anerkannten Regeln der<br />
Technik verpflichtet. Sie dürfen ab<br />
sofort nur Leitungen und Armaturen<br />
einsetzen, die allenfalls ein Minimum<br />
an Stoffen abgeben und nachweislich<br />
entsprechend geprüft wurden.<br />
Ein solcher Nachweis geht <strong>aus</strong><br />
Prüfzeichen hervor. Der Hintergrund<br />
für die Neuregelung: Aus fehlerhaft<br />
<strong>aus</strong>gewählten Installationsmaterialien<br />
können sich Chemikalien<br />
lösen und ins Trinkwasser<br />
gelangen. Das kann seine Qualität<br />
beeinträchtigen und auch das<br />
Wachstum von Bakterien nach sich<br />
ziehen, etwa Legionellen. Hinzu<br />
kommt ferner ein besserer Schutz<br />
vor Verunreinigung mit <strong>Wasser</strong>, das<br />
keine Trinkwasserqualität hat, wie<br />
Regenwasser oder <strong>Wasser</strong> <strong>aus</strong> der<br />
Heizungsanlage. Betreiber müssen<br />
durch Einbau einer so genannten<br />
„Sicherungseinrichtung“ nun dafür<br />
sorgen, dass kein <strong>Wasser</strong> minderer<br />
Qualität durch Rückfließen in das<br />
Trinkwassernetz gelangen kann.<br />
Eine weitere Änderung der<br />
TrinkwV betrifft das Schwermetall<br />
Uran. Seit dem 01. November führt<br />
Deutschland als einziges Land in<br />
der EU einen Uran-Grenzwert für<br />
Trinkwasser ein. Er legt eine Obergrenze<br />
von 10 Mikrogramm pro<br />
Liter <strong>Wasser</strong> fest. Relevant ist diese<br />
Änderung aber nur für wenige,<br />
meist kleine Trinkwassergewinnungsgebiete,<br />
in denen Uran lokal<br />
in höheren Konzentrationen vorkommen<br />
kann. Das Metall ist relativ<br />
giftig und unterliegt jetzt in<br />
Deutschland einem Trinkwasser-<br />
Grenzwert, der im weltweiten Vergleich<br />
sehr niedrig ist. Dieser<br />
schützt auch empfindliche Personen<br />
zuverlässig vor dem nierentoxischen<br />
Potenzial des Urans.<br />
Weitere Informationen und Links:<br />
Die geänderte Trinkwasserverordnung:<br />
http://www.gesetze-im-internet.de/<br />
trinkwv_2001/BJNR095910001.html<br />
UBA-Broschüre „Rund ums Trinkwasser“:<br />
http://www.umweltbundesamt.de/<br />
uba-info-medien/4083.html<br />
UBA-Hintergrundpapier „Legionellen im<br />
Trinkwasser“:<br />
http://www.umweltbundesamt.de/<br />
uba-info-medien/3983.html<br />
Dezember 2011<br />
1132 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Umweltbelastungen mit<br />
Fischen ermitteln<br />
Neue Richtlinie VDI 4230 Blatt 4 zur Bioindikation<br />
Die Kontrolle von Schadstoffen mit Hilfe von Fischen liefert<br />
wichtige Belege für den Zustand unserer Umwelt. Besonders<br />
für die Überwachung in Gewässern eignen sie sich gut<br />
als Indikatororganismen. Gegenüber vielen anderen Bioindikatoren<br />
haben sie den Vorteil, dass sie als Bestandteil der<br />
menschlichen Nahrungskette einen direkten Transfer des Risikos<br />
auf den Menschen ermöglichen. Der neue Richtlinienentwurf<br />
VDI 4230 Blatt 4 der Kommission Reinhaltung der Luft im<br />
VDI und DIN (KRdL) beschreibt die Probenahme von Brachsen<br />
als Akkumulationsindi katoren.<br />
Eine zuverlässige Indikation des Gewässerzustands durch<br />
Organismen kann nur dann erreicht werden, wenn qualitativ<br />
hochwertige Proben vorliegen. Damit kommt der Probenahme<br />
eine zentrale Bedeutung zu. Das Ziel des Richtlinienentwurfs<br />
ist die Definition von Standards für den Erhalt<br />
reproduzier barer und repräsentativer Umweltproben, um<br />
über Zeit und Raum vergleichbare Ergebnisse über den stofflichen<br />
Umweltzustand zu erhalten.<br />
Die Richtlinie beschreibt die Probenahme der Fischart<br />
Abramis brama (Brachsen) von der Planung bis zur Durchführung<br />
im Labor. Im Anhang finden sich zudem hilfreiche Beispiele<br />
für Probedatenformulare sowie Hinweise zur Altersbestimmung<br />
von Fischen.<br />
Die Richtlinie VDI 4230 Blatt 4 (Entwurf) „Biologische Verfahren<br />
zur Erfassung von Umweltbelastungen (Bioindikation);<br />
Passives Biomonitoring mit Fischen als Akkumula tionsindikatoren;<br />
Probenahme“ ist seit Oktober 2011 zum Preis von<br />
€ 62,20 in deutscher Fassung beim Beuth Verlag in Berlin<br />
erhältlich. Unter Tel. (030) 2601-2260 ist der Verlag erreichbar.<br />
Die Einspruchsfrist endet am 31. Januar 2012. Onlinebestellungen<br />
sind unter www.vdi.de/richtlinien oder www.beuth.<br />
de möglich.<br />
Die Fachzeitschrift<br />
für Gasversorgung<br />
und Gaswirtschaft<br />
Sichern Sie sich regelmäßig diese führende Publikation.<br />
Lassen Sie sich Antworten geben auf alle Fragen zur<br />
Gewinnung, Erzeugung, Verteilung und Verwendung von<br />
Gas und Erdgas.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S -<br />
Recht und Steuern im Gas und <strong>Wasser</strong>fach.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Weitere Informationen:<br />
www.vdi.de<br />
VDI 4230 Blatt 4 beschreibt die Probenahme von Brachsen<br />
als Akkumulationsindikatoren.<br />
© LfL; Institut für Fischerei, Starnberg<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.<strong>gwf</strong>-gas-erdgas.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag<br />
www.<strong>gwf</strong>-gas-erdgas.de<br />
<strong>gwf</strong> Gas/Erdgas erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München
Nachrichten<br />
Branche<br />
Landeswasserversorgung investiert in die Zukunft<br />
Trinkwasserpreis steigt – Kostentransparenz schafft Vertrauen<br />
Nach vielen Jahren der Preisstabilität<br />
werden sich die Kosten<br />
für das Trinkwasser der Landeswasserversorgung<br />
(LW) in den nächsten<br />
vier Jahren jährlich um durchschnittlich<br />
2,1 Cent je 1000 Liter<br />
erhöhen, von momentan 41,4 Cent<br />
je Kubikmeter auf 49,7 Cent je<br />
Das Versorgungsgebiet im Überblick.<br />
Kubikmeter im Jahr 2015. Für rund<br />
drei Millionen Bürgerinnen und Bürger<br />
im Land ergibt sich dar<strong>aus</strong> eine<br />
jährliche Preis steigerung von 1,1<br />
Prozent bei einem mittleren Trinkwasserpreis<br />
in Baden-Württemberg<br />
von 1,87 Euro je Kubikmeter. Ein<br />
Vier-Personen-H<strong>aus</strong>halt zahlt somit<br />
im Durchschnitt jährlich 3,80 Euro<br />
mehr, eine Einzelperson 96 Cent –<br />
der Preis für eine Butterbrezel.<br />
Betroffen sind die 106 LW-Verbandsmitglieder,<br />
also rund 250 Städte<br />
und Gemeinden in Baden-Württemberg<br />
und Bayern, wie Aalen, Ellwangen,<br />
Esslingen, Fellbach, Geislingen,<br />
Göppingen, Kirchheim unter Teck,<br />
Ludwigsburg, Schorndorf, Schwäbisch<br />
Gmünd, Stuttgart, Ulm und<br />
Waiblingen.<br />
Die Preissteigerung hat verschiedene<br />
Ursachen. Besonders stark<br />
machen sich die jährlich wiederkehrenden<br />
Energiepreiserhöhungen<br />
zum Betrieb der elektrischen Förderpumpen<br />
in Verbindung mit den<br />
steuerlichen Belastungen zur Finanzierung<br />
der Energiewende, dem so<br />
genannten Erneuerbare-Energien-<br />
Gesetz, bemerkbar. Daneben steigen<br />
der Aufwand zum Erhalt der<br />
zum großen Teil mehr als vierzig<br />
Jahre alten Anlagen und der finanzielle<br />
Aufwand für die notwend igen<br />
Anlagenerweiterungen. Hinzu<br />
kommt, dass die <strong>Wasser</strong>abgabe weiterhin<br />
rückläufig ist und dies zum<br />
Anstieg des spezifischen <strong>Wasser</strong>preises<br />
beiträgt. Bei den Personalkosten<br />
schlagen bei gleichbleibender<br />
Personalzahl lediglich die tariflichen<br />
Preissteigerungen zu Buch.<br />
Derzeit erneuert die Landeswasserversorgung<br />
für rund 4,8 Millionen<br />
Euro die Brunnenreihe der Fassung<br />
1 im Donauried bei Niederstotzingen.<br />
Diese Anlage ist seit<br />
nunmehr 95 Jahren ununterbrochen<br />
und ohne größeren Investitionsbedarf<br />
in Betrieb, sie gehört zu<br />
den wichtigsten <strong>Wasser</strong>gewinnungsanlagen<br />
der LW und muss<br />
daher langfristig erhalten werden.<br />
Um das Grundwasser <strong>aus</strong> dem Do -<br />
nau ried auch im Fall von Verunreinigungen<br />
als Trinkwasser abgeben zu<br />
können, wird im <strong>Wasser</strong>werk Langenau<br />
momentan eine Grundwasserfilteranlage<br />
gebaut. Sie kostet rund<br />
9,05 Millionen Euro. Mit ihr kann die<br />
LW dem Grundwasser auch Spurenstoffe<br />
in geringsten Konzentrationen,<br />
wie beispielsweise Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
<strong>aus</strong> der<br />
Landwirtschaft oder Ölrückstände<br />
und Chemikalien <strong>aus</strong> Unfällen und<br />
<strong>aus</strong> der täglichen Nutzung, sicher<br />
entnehmen. Die Filteranlage trägt<br />
also dazu bei, dass die Trinkwasserqualität<br />
auch in kritischen Betriebssituationen<br />
immer zuverlässig ge -<br />
währleistet ist.<br />
Im Rahmen eines so genannten<br />
Energiemanagements wurde der<br />
Energieverbrauch des Unternehmens<br />
zur Schonung der Ressourcen<br />
und zur Reduzierung der Kosten<br />
unter die Lupe genommen und hinsichtlich<br />
der Verbrauchswerte minimiert.<br />
Im Mittelpunkt des Interesses<br />
standen dabei die großen Pumpen,<br />
die das Trinkwasser <strong>aus</strong> dem<br />
Do nauried über 100 Kilometer über<br />
die Schwäbische Alb hinweg in den<br />
Mittleren Neckarraum fördern. Sie<br />
benötigen den größten Teil der<br />
Energie. Zudem werden die An -<br />
lagen zur Energierückgewinnung<br />
fortlaufend weiter <strong>aus</strong>gebaut. Dazu<br />
gehören Turbinen, die <strong>aus</strong> der überschüssigen<br />
Energie des Trinkwassers<br />
im Leitungsnetz Strom gewinnen.<br />
Das Ziel aller Maßnahmen ist, die<br />
LW-Anlagen in einem guten Zu -<br />
stand zu erhalten und den Betrieb<br />
in bewährter Weise unter wirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten auf<br />
hohem Niveau weiter zu führen. Wie<br />
in den vergangenen 95 Betriebsjahren<br />
steht die Versorgungssicherheit<br />
im Mittelpunkt aller Entscheidungen.<br />
Trotz der beschlossenen Preiserhöhungen<br />
wird die Landeswasserversorgung<br />
auch zukünftig zu<br />
den preisgünstigsten Fernwasserversorgungsunternehmen<br />
bundesweit<br />
gehören.<br />
Kontakt:<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Schützenstraße 4,<br />
D-70182 Stuttgart,<br />
Tel. (0711) 2175-0,<br />
Fax (0711) 2175-1202,<br />
E-Mail: lw@lw-online.de,<br />
www.lw-online.de<br />
Dezember 2011<br />
1134 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Wie kommt der Bodensee mit dem<br />
Klimawandel zurecht?<br />
Mit dem Forschungsprojekt KLIMBO wollen Wissenschaftler in die Zukunft blicken<br />
Der Klimawandel findet nicht<br />
irgendwann in ferner Zukunft<br />
statt, er ist bereits voll im Gange.<br />
Umso wichtiger ist es, sich schon<br />
jetzt Gedanken darüber zu machen,<br />
welche Einflüsse die Klimaveränderung<br />
auf den wichtigen Trinkwasserspeicher<br />
Bodensee haben wird<br />
und Szenarien zu entwickeln, wie<br />
man damit am besten umgehen<br />
und die Gewässerqualität im See<br />
erhalten kann. Das ist das Fazit der<br />
Tagung „Klimawandel am Bodensee“,<br />
die am Institut für Seenforschung<br />
der LUBW Landesanstalt<br />
für Umweltschutz, Messungen und<br />
Naturschutz Baden-Württemberg<br />
(ISF) in Langenargen durchgeführt<br />
wurde. Sie war zugleich die Auftaktveranstaltung<br />
zum gleichnamigen<br />
Forschungsprojekt, kurz KLIMBO<br />
genannt, das als so genanntes Interreg-IV-Projekt<br />
von der EU und der<br />
Schweiz gefördert wird.<br />
Zu Beginn der Tagung machte<br />
der Leiter der Abteilung „<strong>Wasser</strong>“<br />
bei der baden-württembergischen<br />
LUBW, Burkhard Schneider, klar,<br />
dass nach wie vor die Konzentrationen<br />
des wichtigsten Treibh<strong>aus</strong>gases<br />
CO 2 weiter zunehmen. Der heutige<br />
weltweite CO 2 -Ausstoß übertreffe<br />
© EPei Wikipedia<br />
sogar noch die schlimmsten Szenarien.<br />
Umso wichtiger sei es, sich<br />
rechtzeitig gegen die Folgen zu<br />
wappnen. Das Projekt KLIMBO<br />
werde hierzu einen wichtigen Beitrag<br />
leisten. Schneider stellte das<br />
neue Forschungsprojekt dabei in<br />
eine langjährige Klimaforschungstradition<br />
am See.<br />
Für Prof. Hans Mehlhorn vom<br />
Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ist KLIMBO die logische<br />
Erweiterung des in den vergangenen<br />
Jahren entwickelten Informationssystems<br />
BodenseeOnline. Das<br />
Projekt ermöglicht eine modellhafte<br />
Nachbildung der Vorgänge im See<br />
und, darauf aufbauend, Vorhersagen<br />
zum hydrodynamischen Verhalten<br />
des Sees, seiner <strong>Wasser</strong>qualität<br />
sowie Aussagen zu biologischen<br />
Vorgängen im See. In dieser Tradition<br />
soll KLIMBO in Zukunft<br />
Entscheidungsgrundlagen und<br />
mög liche Handlungsoptionen für<br />
den vorsorgenden Gewässerschutz<br />
aufzeigen.<br />
Kontakt:<br />
LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen<br />
und Naturschutz Baden-Württemberg,<br />
Griesbachstraße 1, D-76185 Karlsruhe,<br />
Tel. (0721) 5600-1300,<br />
Fax (0721) 5600-1324,<br />
E-Mail: pressestelle@lubw.bwl.de,<br />
www.lubw.baden-wuerttemberg.de<br />
INFO<br />
Das Programm des neuen Forschungsprojekts, an dem baden-württembergische und schweizer Institutionen beteiligt sind, wurde<br />
auf der Tagung in Langenargen der Öffentlichkeit vorgestellt. Es umfasst Simulationen zukünftiger Wetterverhältnisse und entsprechender<br />
Einflüsse auf den See, etwa auf die Schichtung, die Erneuerung des Tiefenwassers und damit verbunden die Entwicklung<br />
der Sauerstoffkonzentration am Seegrund. Diese ist auch für die zukünftige Trinkwasserversorgung der Region von<br />
großer Bedeutung. Aber es soll nicht nur modelliert, sondern auch gemessen werden. So hat bereits eine mehrjährige Messkampagne<br />
zur Analyse langfristiger <strong>Wasser</strong><strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>chprozesse beispielsweise zwischen Flachwasserzone und Freiwasser bereich<br />
begonnen.<br />
Auch einem wichtigen angewandten Aspekt widmet sich KLIMBO: So soll die potenzielle Nutzung des Wärme- und Kälteinhalts<br />
des Sees zum Heizen und Kühlen von Gebäuden mit Hilfe von Wärmepumpen erkundet werden. In der Schweiz wird diese<br />
Energiequelle bereits genutzt. Auch am Bodensee gebe es bereits entsprechende Anfragen, wurde auf der Tagung berichtet. Vor<br />
einer Genehmigung müssen aber zunächst wichtige Fragen zur umwelt-verträglichen Nutzung dieser Energiequelle geklärt werden,<br />
so etwa die Auswirkungen der Rückführung von erwärmtem – oder gekühltem – <strong>Wasser</strong> auf die Schichtung im See sowie<br />
mög licher Folgen der zusätzlichen Erwärmung im Sommer und der Auskühlung im Winter.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1135
Nachrichten<br />
Branche<br />
Auslobung zum Muelheim Water Award 2012<br />
startet im Januar<br />
Der Muelheim Water Award geht<br />
in die vierte Runde: Die Ausschreibung<br />
für das Jahr 2012 steht<br />
kurz bevor. Die Bewerbungsfrist<br />
läuft vom 01. Januar bis 29. Februar<br />
2012, 12.00 Uhr MEZ. Das Auslobungsthema<br />
lautet wieder: „Fortschritte<br />
in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und der <strong>Abwasser</strong>entsorgung“.<br />
Der Muelheim Water Award ist<br />
mit einem Preisgeld in Höhe von<br />
insgesamt 20 000,00 Euro dotiert. Er<br />
richtet sich an nationale und internationale<br />
Bewerber <strong>aus</strong> ganz<br />
Europa.<br />
Die Durchführung und Organisation<br />
des Preises erfolgt im Auftrag<br />
der Träger RWE Aqua GmbH und<br />
RWW Rheinisch-Westfälische <strong>Wasser</strong>werksgesellschaft<br />
mbH durch<br />
die IWW Rheinisch-Westfälisches<br />
Institut für <strong>Wasser</strong>forschung ge -<br />
meinnützige GmbH.<br />
Die Verleihung des Muelheim<br />
Water Award 2012 erfolgt im Rahmen<br />
der 5. Water Contamination<br />
Emergencies Conference, die vom<br />
19. bis 21. November 2012 in Mülheim<br />
an der Ruhr stattfinden wird.<br />
Mit dem Muelheim Water Award<br />
werden her<strong>aus</strong>ragende Projekte zur<br />
praxisorientierten Forschung und/<br />
oder Implementierung innovativer<br />
Konzepte <strong>aus</strong>gezeichnet. Sie sollen<br />
zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen<br />
Situation in Europa beitragen.<br />
Eingeschlossen sind auch<br />
Ingenieur-, Management- oder Planungsleistungen.<br />
Er wird alle zwei<br />
Jahre vergeben.<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.muelheim-water-award.com<br />
Im Jahr 2010 sprach sich die<br />
international besetzte Jury für die<br />
Prämierung des Projekts von Prof.<br />
Dr. Thomas Egli und seines interdisziplinären<br />
Teams des Schweizer<br />
<strong>Wasser</strong>forschungsinstituts Eawag<br />
und der <strong>Wasser</strong>versorgung Zürich<br />
<strong>aus</strong>. „Entwicklung neuer, auf Durchflusszytometrie<br />
basierender Methoden<br />
für die mikrobiologische Analyse<br />
von Trinkwasser und ihre<br />
Anwendung in der Praxis “ lautete<br />
der Titel des Gewinnerprojektes.<br />
Egli und sein Team überzeugten die<br />
Jury mit einer neuen praxistauglichen<br />
Methode zur Bewertung<br />
von Trinkwässern <strong>aus</strong> hygienischer<br />
Sicht.<br />
Kontakt:<br />
Koordinationsbüro des<br />
Muelheim Water Award,<br />
c/o IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für <strong>Wasser</strong>forschung gGmbH,<br />
Moritzstraße 26,<br />
D-45476 Mülheim an der Ruhr,<br />
Tel. (0208) 40303-0,<br />
Fax (0208) 40303-80,<br />
E-Mail: info@muelheim-water-award.com,<br />
www.muelheim-water-award.com<br />
www.wassertermine.de<br />
50 Jahre kreative Ingenieurleistungen<br />
Die Franz Fischer Ingenieurbüro<br />
GmbH feiert in diesem Jahr ihr<br />
50-jähriges Bestehen. Unter dem<br />
Motto Kreative Ingenieurleistungen<br />
für eine intakte Umwelt erbringt sie<br />
Planungs- und Beratungsleistungen<br />
in den Bereichen <strong>Wasser</strong>, <strong>Abwasser</strong>,<br />
Straßen, Gewässer und Energie.<br />
Qualität und Zuverlässigkeit bilden<br />
die Basis für langjährige Kundenbeziehungen<br />
mit vorwiegend<br />
öffent lichen Auftraggebern. Das<br />
fortgeschrittene Qualitätsmanagement<br />
ist seit 15 Jahren zertifiziert –<br />
die gesteckten Ziele und deren<br />
Erfüllung sind im Internet einsehbar.<br />
Zu den langjährigen Standorten<br />
Dortmund, Erftstadt, Koblenz<br />
und Solingen ist im vergangenen<br />
Jahr der Standort Düsseldorf neu<br />
hinzugekommen.<br />
Neben den klassischen Ingenieurleistungen<br />
bildet die technischwirtschaftliche<br />
und organisatorische<br />
Beratung einen wesentlichen<br />
Schwerpunkt. Das Tätigkeitsfeld in<br />
diesem Bereich erstreckt sich von<br />
der Vermögensbewertung für Ka -<br />
nal, Straße und Versorgung über<br />
Beitrags- und Gebührenkalkulationen<br />
bis hin zu Kanalsanierungsstrategien,<br />
Pavement-Management-<br />
Systemen und Organisationskonzepten<br />
zur Dichtheitsprüfung. Die<br />
hierfür erforderlichen EDV-Dienstleistungen<br />
werden durch die<br />
Dezember 2011<br />
1136 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Schwesterfirma Teamplan EDV<br />
GmbH erbracht.<br />
Auch die Weiterbildung wird<br />
groß geschrieben, sowohl im eigenen<br />
Unternehmen, als auch darüber<br />
hin<strong>aus</strong>. So haben schon vier Mitarbeiter<br />
als Referenten beim Lehrgang<br />
zum Zertifizierten Berater<br />
Grundstücks entwässerung mitgewirkt.<br />
Und bereits zum 14. Mal veranstaltet<br />
die Franz Fischer Ingenieurbüro<br />
GmbH das Fachgespräch<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft, diesmal zum<br />
Thema „Kanalnetzmanagement“.<br />
Die Veranstaltung findet am<br />
26. Januar in Köln statt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.fischer-teamplan.de<br />
Vorstand und Geschäftsführer: Olaf Krahn, Dr. Wolfgang Kampfmann,<br />
Ralf Ostermann, Axel Pohle, Ralf Puderbach, Bernd Schumacher, Peter<br />
Möseler, Erwin Wagner, Michael Hippe (v.l.n.r.).<br />
Aus ITT wird Xylem<br />
Xylem Water Solutions Deutschland<br />
GmbH ist der neue Name<br />
der ITT Water & Wastewater<br />
Deutschland GmbH (vormals ITT<br />
Flygt Pumpen GmbH). Mit dieser<br />
Umfirmierung macht die Vertriebsorganisation<br />
für die Marken<br />
Flygt, Wedeco, Leopold, Sanitaire<br />
und Godwin seit November einen<br />
neuen Entwicklungsschritt.<br />
Hintergrund der neuen Namensgebung<br />
ist die Ausgliederung der<br />
<strong>Wasser</strong>technikunternehmen <strong>aus</strong><br />
der ITT Corporation. Xylem bedient<br />
den globalen Markt für <strong>Wasser</strong>technik<br />
und -dienstleistungen über ein<br />
Vertriebsnetz <strong>aus</strong> direkter Vertriebsstruktur<br />
und indirekten Partnern.<br />
Die Produkte und Leistungen<br />
betreffen den gesamten <strong>Wasser</strong>kreislauf<br />
und sind entscheidend für<br />
Gewinnung, Verteilung und Nutzung<br />
sowie Behandlung und Kontrolle<br />
von <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong>.<br />
„Dies ist ein wesentlicher Schritt<br />
hin zu einem Unternehmen, das<br />
durch seine Fokussierung <strong>aus</strong>schließlich<br />
im Bereich <strong>Wasser</strong> und<br />
<strong>Abwasser</strong> neue Akzente setzen<br />
wird. Diese einzigartige Ausrichtung<br />
ermöglicht es uns, in Verbindung<br />
mit unserer jahrzehntelangen<br />
Erfahrung der Innovationsführer<br />
mit dem Anspruch höchster Qualität<br />
für unsere Kunden zu sein“, sagt<br />
Kl<strong>aus</strong> Katzfuß-Krakau, Geschäftsführer<br />
der deutschen Vertriebsorganisation<br />
mit Sitz in Langenhagen.<br />
Dafür bietet Xylem Water Solutions<br />
wie gewohnt eine breite und in sich<br />
verzahnte Produkt- und Servicepalette<br />
mit marktführenden Technologien<br />
und hoher Anwendungskompetenz.<br />
Das Portfolio besteht<br />
<strong>aus</strong> <strong>Wasser</strong>-, <strong>Abwasser</strong>- und Entwässerungspumpen,<br />
Rührwerkstechnik,<br />
der Ausrüstung für die primäre<br />
und sekundäre biologische Reinigung<br />
sowie Produkten für die Filtration,<br />
UV-Desinfektion und Ozon-<br />
Oxidation. Damit unterstützt Xylem<br />
Water Solutions ihre Kunden <strong>aus</strong><br />
der Kommune, dem Bau und Bergbau,<br />
der Landwirtschaft und der<br />
Industrie bei der Bewältigung ihrer<br />
wasser- und umwelttechnischen<br />
sowie infrastrukturellen Her<strong>aus</strong>forderungen.<br />
Der Name Xylem (sprich: ’zīləm)<br />
kommt <strong>aus</strong> dem Griechischen und<br />
bezeichnet ein komplexes Leitgewebe<br />
der höheren Pflanzen. Es<br />
dient vornehmlich dem <strong>Wasser</strong>transport<br />
– von den Wurzeln bis in<br />
die Blätter. Technisch gesehen ist<br />
genau das unsere Kernkompetenz.<br />
Das Unternehmen verbindet damit<br />
den Anspruch, integrierte und<br />
höchst effiziente Lösungen zu<br />
schaffen, die für die Kunden eine<br />
intelligente <strong>Wasser</strong>nutzung ermöglichen.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.flygt.de<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Grasstraße 11 • 45356 Essen<br />
Telefon (02 01) 8 61 48-60<br />
Telefax (02 01) 8 61 48-48<br />
www.aquadosil.de<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1137
Nachrichten<br />
Branche<br />
Ideen treffen Entscheider<br />
Nachbericht zum Kongress der <strong>Wasser</strong>- und Energiewirtschaft en 3 in Berlin<br />
andel’s Hotel, Berlin.<br />
Wenn sich die Spitzenkräfte <strong>aus</strong><br />
<strong>Wasser</strong>- und Energiewirtschaft<br />
zum Branchengipfel treffen,<br />
haben sie dafür eine feste Adresse:<br />
das andel’s Hotel in Berlin, wohin<br />
das Netzwerk e.qua am 21./22.<br />
November zur bereits zweiten Ausgabe<br />
des Fachkongresses en 3<br />
(energy. environment. engineering.)<br />
eingeladen hatte. Mit über 250<br />
Besuchern, 40 Ausstellern in der<br />
integrierten Messe und einem innovativen<br />
Programm dokumentierte<br />
die Veranstaltung eindrucksvoll, wie<br />
ein Event doppelt wachsen kann –<br />
in Größe und Qualität.<br />
Das Vorabendprogramm<br />
Bereits zur Messeeröffnung im Rahmen<br />
der Vorabendveranstaltung<br />
konnte Ralf Strothteicher, Mitglied<br />
im Aufsichtsgremium des Netzwerks<br />
e.qua, das auch dieses Jahr<br />
als Schirmherr der en 3 fungierte,<br />
zahlreiche Gäste begrüßen. Belohnt<br />
wurde deren rechtzeitiges Erscheinen<br />
durch eine kurzweilige Innovationshow:<br />
„10 Minutes“ – sechs<br />
Referenten à zehn Minuten Redezeit,<br />
die zusammen eine Stunde<br />
Information über hochaktuelle<br />
technische Ansätze boten.<br />
Moderiert von Sabine Thümler,<br />
Pressesprecherin der Berliner<br />
Stadtreinigung, diesjähriger Sponsor<br />
der en 3 , wandte sich das unterhaltsame<br />
Format zunächst scheinbar<br />
Altbekanntem zu: Mario Spiewack<br />
vom Zentrum für Produkt-,<br />
Verfahrens- und Prozessinnovationen<br />
(ZPVP) referierte über die<br />
Renaissance der Stromgewinnung<br />
mittels <strong>Wasser</strong>rädern in Fließgewässern.<br />
Ihm schloss sich Saskia<br />
Wohlgemuth von der EURAWAS-<br />
SER Aufbereitungs- und Entsorgungs<br />
GmbH an, die den FlocFormer,<br />
eine neuartige Methode zur<br />
Klärschlammkonditionierung vorstellte.<br />
Dr. Lutz Schulze, Referatsleiter<br />
des acqua è vita <strong>Wasser</strong>forum<br />
e. V., verlieh der Forderung nach<br />
sauberem Trinkwasser inhaltlich<br />
Nachdruck, bevor Taco Holthuizen,<br />
Mitglied des Ingenieur-Pools eZeit,<br />
den „Dämmungswahn“ bei der<br />
energetischen Betrachtung von<br />
Gebäuden hinterfragte und stattdessen<br />
Systemlösungen für eine<br />
Vollversorgung mit Gratisenergie<br />
vorstellte, darunter den innovativen<br />
Wärmespeicher eTank. Mit dem<br />
Programm kliEN – Klimaschutz und<br />
Energieeffizienz brachte Volker<br />
Broekmans von hanse<strong>Wasser</strong> den<br />
Besuchern eine Neuheit des Bremer<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgers näher.<br />
Und als Schlussredner der Innovationsshow<br />
zeichnete Mark Biesalski,<br />
Leiter der Uhrig Kanaltechnik,<br />
seine Vision von der Nutzung<br />
industrieller Abwärme über das<br />
Nahwärmenetz Kanal.<br />
Dass das andel’s Hotel beim<br />
Nachliefern der im Anschluss an die<br />
Innovationsshow heiß begehrten<br />
Berliner Currywurst oft länger als<br />
die programmatischen „10 Minutes“<br />
benötigte, mag als Flexibilitätstest<br />
für die Besucher gewertet werden.<br />
T<strong>aus</strong>chgeschäfte zwischen jenen<br />
Gästen, die Currywurst ohne Brot<br />
ergattert hatten, und solchen, die<br />
Brot ohne Currywurst auf ihren Tellern<br />
vorfanden, kamen der allgemeinen<br />
Kommunikation jedenfalls<br />
zu Gute.<br />
Am Ende dürfte niemand mit<br />
knurrendem Magen das Highlight<br />
des Vorabendprogramms aufgesucht<br />
haben: ein mitreißender Vortrag<br />
von Management-Coach Jörg<br />
Löhr, der im Rahmen des Themas<br />
„Erfolg und Motivation in Zeiten der<br />
Veränderung“ beispielsweise erläuterte,<br />
warum man manch „quakenden<br />
Frosch“ in die Luft werfen<br />
müsse, um her<strong>aus</strong>zufinden, wie viel<br />
„Adler-Potenzial“ in den eigenen<br />
Mitarbeitern stecke. Nicht zuletzt<br />
die rhetorische Brillanz des Redners<br />
sorgte dafür, dass die Zuhörer noch<br />
lange – und bestgelaunt – seine<br />
Thesen beim abendlichen Zusammenkommen<br />
im sky.café hoch über<br />
den Dächern der Hauptstadt diskutierten.<br />
Der Kongresstag<br />
Am zweiten Veranstaltungstag<br />
schlossen sich pünktlich um 9 Uhr<br />
die Türen des gut gefüllten Kongresssaals<br />
hinter den Besuchern der<br />
en 3 , wo sie – nach einem Kaffee<br />
während des morgendlichen Messerundgangs<br />
– von Gunda Röstel<br />
herzlich zur Fachtagung begrüßt<br />
wurden. Die ehemalige Spitzenpolitikerin<br />
von Bündnis 90/Die Grünen,<br />
heute kaufmännische Geschäftsführerin<br />
der Stadtentwässerung<br />
Dresden, führte in diesem Jahr als<br />
bestens aufgelegte Moderatorin<br />
durch die Veranstaltung.<br />
Dezember 2011<br />
1138 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Mit Dr. Christiane Markard, Leiterin<br />
des Fachbereichs „Gesundheitlicher<br />
Umweltschutz, Schutz der<br />
Ökosysteme“ im Umweltbundesamt,<br />
die für ihren kurzfristig verhinderten<br />
Kollegen Jochen Flasbarth,<br />
Präsident des Umweltbundesamtes,<br />
eingesprungen war, und Berlins<br />
scheidendem Wirtschaftssenator<br />
Harald Wolf wünschten gleich zwei<br />
Grußredner der en 3 gutes Gelingen.<br />
Besonders Harald Wolf lobte die<br />
differenzierende Diktion der Veranstaltung<br />
und ihr zu Berlin passendes<br />
Leitthema „energy. environment.<br />
engineering.“ sowie die Arbeit des<br />
Netzwerks e.qua, das immer wieder<br />
durch sein gen<strong>aus</strong>o frisches wie<br />
fachlich fundiertes Auftreten auffällt.<br />
Den Auftakt der Fachbeiträge<br />
<strong>aus</strong> <strong>Wasser</strong>- und Energiewirtschaft<br />
machte Dr. Michael Beckereit, der<br />
über die energetischen Maßnahmen<br />
des <strong>Wasser</strong>versorgers HAM-<br />
BURG WASSER berichtete und als<br />
dessen Geschäftsführer betonte,<br />
dass Wirtschaftlichkeit immer ein<br />
wichtiges Umsetzungskriterium für<br />
sein Unternehmen sein müsse.<br />
Vertiefend auf das Thema Energie<br />
eingehend stellte er auch die ebenfalls<br />
von ihm geführte HAMBURG<br />
ENERGIE vor.<br />
Über zukunftsfähige Konzepte<br />
und Technologien für eine energieeffiziente<br />
und ressourcenschonende<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft referierte<br />
MinDirig Wilfried Kr<strong>aus</strong>, Leiter der<br />
Abteilungen „Nachhaltigkeit, Klima,<br />
Energie“ sowie „Zukunftsvorsorge –<br />
Forschung für Grundlagen und<br />
Nachhaltigkeit“ im Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung<br />
(BMBF). In seinem Vortrag formulierte<br />
er nicht nur die Erwartungen<br />
der Politik an die <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
sondern warb auch für das neu für<br />
die Branche aufgelegte Förderprogramm<br />
„Nachhaltiges <strong>Wasser</strong>management“<br />
(NaWaM).<br />
Die an den Beitrag von Wilfried<br />
Kr<strong>aus</strong> anschließende Kaffee-P<strong>aus</strong>e<br />
bot den Teilnehmern Gelegenheit<br />
zum gedanklichen Aust<strong>aus</strong>ch, vor<br />
allem aber, die Stände der Aussteller<br />
Auch heuer war die Ausstellung wieder gut besucht.<br />
in der Messehalle zu besuchen. Das<br />
bereits 2010 bewährte Konzept,<br />
Ausstellung und Catering räumlich<br />
miteinander zu verbinden, war auch<br />
in diesem Jahr sichtbar förderlich<br />
für die Besucherfrequenz auf den<br />
Präsentationflächen.<br />
Teil 2 des Kongressprogramms<br />
wurde durch ein interessantes Referat<br />
über energetische Potenziale für<br />
den wasserwirtschaftlichen Betrieb<br />
der Hauptstadt eingeläutet, das der<br />
technische Vorstand der Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe, Dr. Georg Grunwald,<br />
eloquent vortrug. Darin<br />
machte er deutlich, dass Energieautarkie<br />
nicht alleine das Kriterium<br />
für die energetische Bewertung<br />
der Anlagen des Unternehmens<br />
sein dürfe.<br />
In Vertretung für den Vorstandsvorsitzenden<br />
der EMSCHERGENOS-<br />
SENSCHAFT, Dr. Jochen Stemplewski,<br />
berichtete dessen Abteilungsleiter<br />
Strategisches Flussgebietsmanagement,<br />
Ekkehard Pfeiffer,<br />
über innerbetriebliche Projekte des<br />
Zweckverbands und dessen energetische<br />
Innovationen für die<br />
<strong>Wasser</strong> wirtschaft.<br />
Dass man nicht nur energetisch<br />
Gutes tun, sondern auch darüber<br />
reden sollte, bekannte – ungeachtet<br />
aller hanseatischen Zurückhaltung<br />
– der Geschäftsführer der Bremer<br />
hanse<strong>Wasser</strong>, Jörg Broll-Bickhardt.<br />
In seinem Vortrag gewährte er Einblicke<br />
<strong>aus</strong> erster Hand zu Unternehmensprojekten<br />
wie das bereits in<br />
der Innovationsshow vorgestellte<br />
Programm kliEN, mit denen der private<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorger sein ambitioniertes<br />
Ziel „hanse<strong>Wasser</strong> – 2015<br />
klimaneutral“ verfolgt.<br />
Praktischen Verfahrens- und Produktbezug<br />
zu den in den Kongressbeiträgen<br />
vorgestellten Konzepten<br />
erhielten die Besucher während der<br />
<strong>aus</strong>giebigen Mittagsp<strong>aus</strong>e an den<br />
Ständen in der Messehalle. Hier<br />
sorgten drei loungeähnliche „Themeninseln“<br />
für eine übersichtliche<br />
Strukturierung der Aussteller und<br />
boten zugleich ein atmosphärisches<br />
Umfeld, um bei spannenden<br />
Gesprächen das kulinarische Angebot<br />
genießen zu können.<br />
Nach der Mittagsp<strong>aus</strong>e wurde<br />
der Kongress zunächst mit einer<br />
Preisverleihung im Rahmen des von<br />
e.qua bundesweit durchgeführten<br />
Ideenwettbewerbs „Leuchtturmprojekte“<br />
fortgesetzt. Als erster Preisträger<br />
der Kampagne durfte sich die<br />
<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1139
Nachrichten<br />
Branche<br />
Gemeinde Wildau <strong>aus</strong> dem brandenburgischen<br />
Landkreis Dahme-<br />
Spreewald über eine kostenlose<br />
Machbarkeitsstudie freuen, mit der<br />
das Netzwerk die Ideenskizze „Energiegebiet<br />
Wildau“ prämierte. Kommunen<br />
sind auch weiterhin aufgerufen,<br />
an dem von Modera torin<br />
Gunda Röstel noch einmal kurz vorgestellten<br />
Wettbewerb im Bereich<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzung teilzunehmen.<br />
Hatte sich der Kongress bis<br />
hierher vor allem mit dem Schwerpunkt<br />
<strong>Abwasser</strong> beschäftigt, kam<br />
jetzt auch die Fachrichtung <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
zu Wort. Hermann<br />
Löhner, Leiter <strong>Wasser</strong>anlagen- und<br />
Beschaffung der EnBW Regional<br />
AG, und Dr. Michael Plath von der<br />
DVGW-Forschungsstelle an der TU<br />
Hamburg Harburg zeigten anhand<br />
nachvollziehbarer Praxisbeispiele<br />
auf, wie unerwartet hoch die energetischen<br />
Potenziale auch in dieser<br />
Sparte der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
sind.<br />
Über die wirtschaftlichen Sorgen<br />
wasserwirtschaftlicher Unternehmen<br />
in vielen Regionen Deutschlands<br />
informierte der hochinteressante<br />
Vortrag von Jens-Erik Wegner,<br />
Geschäftsführer der LWG – L<strong>aus</strong>itzer<br />
<strong>Wasser</strong> GmbH & Co. KG. Anhand der<br />
von seinem Unternehmen ergriffenen<br />
Maßnahmen zur Stärkung der<br />
LWG in einer strukturschwachen<br />
Region wie der L<strong>aus</strong>itz konnte er<br />
aber auch nachdrücklich belegen,<br />
auf welche Weise sich Her<strong>aus</strong>forderungen<br />
heute als Chance nutzen<br />
lassen.<br />
Über die Entwicklung der Energiewirtschaft<br />
<strong>aus</strong> der Perspektive<br />
eines Energieversorgungsunternehmens<br />
(EVU) sprach der Generalbevollmächtigte<br />
Technik, Dr. Hans-<br />
Josef Zimmer, des Baden-Württembergischen<br />
Energiekonzerns EnBW.<br />
Vor dem Hintergrund der geplanten<br />
Energiewende erläuterte er den<br />
Fachbesuchern Aussichten zur Versorgungssicherheit<br />
– nicht nur für<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Aussteller<br />
Firma<br />
Produkthighlight<br />
Firma<br />
Produkthighlight<br />
Firma<br />
Produkthighlight<br />
Netzwerk e.qua<br />
OTT System GmbH & Co.<br />
Gelsenwasser AG/<br />
Stadtentwässerung<br />
Dresden<br />
Uhrig Kanaltechnik GmbH<br />
Brandenburger Liner<br />
GmbH & Co. KG<br />
Herborner Pumpenfabrik<br />
Frank & Krah Wickelrohr GmbH<br />
UNITECHNICS KG<br />
Umwelttechnische Systeme<br />
HOBAS Rohre GmbH<br />
HUBER SE<br />
VTA Deutschland GmbH<br />
NIVUS GmbH<br />
GFM Beratende<br />
Ingenieure GmbH<br />
PEWO Energietechnik GmbH<br />
Schneider Electric GmbH<br />
hanse<strong>Wasser</strong> Bremen GmbH<br />
Kompendium<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
MAGNUM Flächenbelüfter<br />
Pilotprojekt<br />
"Wärme <strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong>"<br />
Therm-Liner<br />
Brandenburger Heatliner ®<br />
Permanent-Magnet-Motor IE3<br />
PKS ® -THERMPIPE-Rohrsystem<br />
<strong>Wasser</strong>verschlusssystem FRK-3<br />
HOBAS NC Line ®<br />
Wärmet<strong>aus</strong>cher, HOBAS GFK<br />
Vortriebsrohre, HOBAS GFK<br />
Industrierohrsysteme<br />
ThermWin ® Verfahren,<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmet<strong>aus</strong>cher RoWin<br />
VTA- Nanofloc-Mikroturbinen<br />
und Desintegrationsanlagen<br />
Die nächste Generation der<br />
Durchflussmessungen<br />
Pilotprojekt<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
Straubing<br />
Halbschalen-Absorber<br />
Doppelmantelwärmeübertrager<br />
Automatisierungstechnik und<br />
Energieverteilung<br />
KLIEN Klimaschutz und<br />
Energie-Effizienz, Energie-<br />
Effizienz-Analysen für<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigungs-<br />
Anlagen<br />
KASAG Langnau<br />
GWU-Umwelttechnik GmbH/<br />
Flow-Tec<br />
EURAWASSER Aufbereitungsund<br />
Entsorgungs GmbH<br />
ABB Automation<br />
Products GmbH<br />
Bierhals <strong>Wasser</strong> Consult/<br />
VTAA<br />
KUBRA GmbH Industrieund<br />
Kunststofftechnik<br />
acqua è vita<br />
<strong>Wasser</strong>forum e.V.<br />
eco.s<br />
ENREGIS GmbH<br />
KMG<br />
REHAU AG + Co<br />
Druckrohrwärmet<strong>aus</strong>cher<br />
KASAG PRESSUREPIPE ® ,<br />
Reinigbarer Wärmet<strong>aus</strong>cher<br />
KASAG CLEAN ®<br />
Flow-Dar: Mobiles berührungsloses<br />
Durchfulssmessgerät<br />
Innovative Klärschlammkonditionierung<br />
mit dem<br />
FlocFormer<br />
AC500 Ihre SPS für Pumpen<br />
PSE Softstarter<br />
Energieanalysen zur Steigerung<br />
der Energieeffizienz in <strong>Wasser</strong>und<br />
<strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
Schacht für <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
in Entwicklung<br />
Zertifizierung von Anlagen<br />
der Trinkwasserinstallation<br />
zur Erhöhung der Sicherheit<br />
der Trinkwasserversorgung<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnung<br />
und Planungsleistungen für<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzungsprojekte<br />
Symbiose <strong>aus</strong> Energie<br />
und <strong>Wasser</strong><br />
innovative Erdwärmeerschließungskonzepte<br />
SPR Wickelrohrverfahren:<br />
für grabenlose Sanierung<br />
der <strong>Abwasser</strong>kanäle<br />
Nordipipe:<br />
Liner für grabenlose<br />
Sanierung der Druckrohre<br />
Nachhaltiges<br />
<strong>Wasser</strong>management<br />
ZPVP Zentrum für Produkt-,<br />
Verfahrens- und<br />
Prozessinnovationen GmbH<br />
Viessmann<br />
Deutschland GmbH<br />
HTI Bär- & Ollenroth<br />
Handel KG<br />
DWA Deutsche Vereinigung<br />
für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong><br />
und Abfall e.V.<br />
Hei-Tech<br />
Umweltcluster<br />
Bayern<br />
Blue Synergy GmbH<br />
eZeit Ingenieure GmbH<br />
Phoenix Contact<br />
Deutschland GmbH<br />
Dutch Solar Systems B.V.<br />
Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe<br />
Jaske & Wolf<br />
Mobile<br />
Flusswasserkraftanlage<br />
RIVER RIDER<br />
Wärmepumpen für Grundwasser<br />
und <strong>Abwasser</strong>wärmetechnik<br />
Effiziente und wassersparende<br />
Bewässerung<br />
DWA- Regelwerk,<br />
Fachpublikationen<br />
Wärmet<strong>aus</strong>cher für<br />
Duschwasser Recoh-vert,<br />
Recoh-tray, Recoh-multivert<br />
Arbeitskreis<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
Energy Converter High-Flex<br />
eTank Solarspeicher<br />
Steuerungstechnik<br />
Duschwasserwärmet<strong>aus</strong>cher<br />
<strong>Wasser</strong>- und Stromversorgung<br />
in einer Mediensäule für<br />
Wochenmärkte u.Ä.<br />
Automatisch Selbstreinigender<br />
Wärmet<strong>aus</strong>cher DUPUR ®<br />
Dezember 2011<br />
1140 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Nach einer zweiten Kaffee-P<strong>aus</strong>e – noch einmal<br />
Gelegenheit für einen Besuch der Messe und den fachlichen<br />
Aust<strong>aus</strong>ch unter Kollegen – steuerte die en 3 auf<br />
den Schlussteil der Tagung zu.<br />
Darin zeigte die Vorstandsvorsitzende der Berliner<br />
Stadtreinigung BSR, Vera Gäde-Butzlaff, eindrucksvoll<br />
auf, welchen Beitrag ein städ tisches Entsorgungsunternehmen<br />
zur Energieversorgung der Hauptstadt leisten<br />
kann und mit welchen Maßnahmen die BSR ihr Klimaschutzabkommen<br />
mit der Stadt Berlin erfüllt.<br />
Das „Kongress-Finale“ gebührte einem „Altbekannten“,<br />
der aufgrund großer Resonanz im Vorjahr erneut<br />
als Schlussredner der Veranstaltung eingeladen worden<br />
war: Prof. Dr. Dr. Radermacher, Mitglied des Club of<br />
Rome, fesselte die Zuhörer erneut mit einem gen<strong>aus</strong>o<br />
nachdenklichen wie spannend vorgetragenen Plädoyer<br />
für den Klimaschutz und schärfte – nach zahlreichen<br />
branchenspezifischen Vorträgen – noch einmal das<br />
Bewusstsein für das „große Ganze“, um einer weiteren<br />
Erderwärmung mit den letzten verbleibenden Mitteln<br />
entgegenzu treten.<br />
Wer wollte, konnte den späten Nachmittag zu einem<br />
letzten Come Together in der Messe nutzen, auf der sich<br />
in diesem Jahr ein besonders breites Spektrum an Fach<strong>aus</strong>stellern<br />
mit zahlreichen Verfahrens- und Produkt-<br />
Highlights präsentiert hat (siehe Tabelle).<br />
Schlussbemerkung des Schirmherrn<br />
„Das Netzwerk e.qua bedankt sich herzlich bei allen Ausstellern,<br />
den verehrten Besuchern, jedem Referenten und<br />
unserem Sponsor BSR für einen interessanten Branchengipfel<br />
und einen gelungenen Kongress en 3 .<br />
Ein besonderer Dank gilt unserer tollen Moderatorin,<br />
Gunda Röstel, die ganz im Sinne von e.qua mit viel Charme<br />
und einer ordentlichen Portion Humor durch den Kongresstag<br />
geführt hat. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen zur<br />
dritten Ausgabe der Veranstaltung 2012 in Berlin und wünschen<br />
schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel.“<br />
<br />
<br />
Andreas Koschorreck<br />
Geschäftsführer e.qua<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Das führende<br />
Fachorgan für<br />
<strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong><br />
Jedes zweite Heft mit<br />
Sonderteil R+S<br />
Recht und Steuern im<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
Von Experten<br />
für Experten<br />
Informieren Sie sich regelmäßig über alle technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
und <strong>Abwasser</strong> behandlung.<br />
Firma/Institution<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
2Hefte<br />
gratis<br />
zum<br />
Kennenlernen!<br />
✁<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Str. 145, 81671 München<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0)931 / 4170-492<br />
oder per Post: Leserservice <strong>gwf</strong> • Postfach 91 61 • 97091 Würzburg<br />
Ja, senden Sie mir die nächsten beiden Ausgaben des Fachmagazins <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<br />
<strong>Abwasser</strong> gratis zu. Nur wenn ich überzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen<br />
nach Erhalt des zweiten Hefts schriftlich absage, bekomme ich <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<br />
<strong>Abwasser</strong> für zunächst ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von € 170,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 15,- / Ausland: € 17,50) pro Halbjahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) € 85,- zzgl. Versand<br />
pro Halbjahr.<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
PAGWFW1011<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>gwf</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene<br />
Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag<br />
oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Nachrichten<br />
Vereine, Verbände und Organsisationen<br />
DVGW zur möglichen Anrufung des Vermittlungs<strong>aus</strong>schusses<br />
zum CO 2 -Speicherungsgesetz<br />
Strenges Monitoring etwaiger Risiken unterirdischer CO 2 -Lagerung erforderlich<br />
Anlässlich der in Kürze zu erwartenden<br />
Entscheidung der Bundesregierung,<br />
den Vermittlungs<strong>aus</strong>schuss<br />
zu einem Kompromiss über<br />
das CO 2 -Speicherungsgesetz anzurufen,<br />
hat der DVGW Deutscher Verein<br />
des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches bei<br />
der potenziellen Anwendung der<br />
CO 2 -Speicher-Technologie zur Vorsicht<br />
gemahnt und ein strenges<br />
Monitoring etwaiger Risiken gefordert.<br />
Der DVGW begrüßt, dass es<br />
sich bei dem vom Bundestag<br />
beschlossenen und vom Bundesrat<br />
zuletzt abgelehnten Gesetz zur<br />
Abscheidung, zum Transport und<br />
zur unterirdischen Speicherung von<br />
Kohlendioxid lediglich um ein<br />
Demonstrationsgesetz handelte.<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> erkennt der<br />
DVGW auch schwer kalkulierbare<br />
Risiken bei der CO 2 -Speicher-Technologie,<br />
weil sich viele Aspekte der<br />
Anwendung noch im Forschungsstadium<br />
befinden. Insbesondere bei<br />
der unterirdischen CO 2 -Lagerung<br />
gebe es noch viele offene Fragen,<br />
die in künftigen Forschungs- und<br />
Demonstrationsprojekten beantwortet<br />
werden müssten. Die Grundsätze<br />
eines vorsorgenden Gewässerschutzes<br />
müssten hierbei umfassend<br />
berücksichtigt werden.<br />
So sei etwa die Frage, welche<br />
hydrochemischen oder geohydraulischen<br />
Auswirkungen die Speicherung<br />
von Kohlendioxid im Untergrund<br />
auf die Ressource Grundwasser<br />
haben könne, bislang nicht<br />
hinreichend beantwortet worden.<br />
Insbesondere Fragen der Dichtigkeit<br />
der vorgesehenen Speicher, der<br />
Verdrängung von Tiefensalzwässern<br />
in obere Grundwasserleiter und der<br />
noch unklaren Zusammensetzung<br />
des zur Verpressung zugelassenen<br />
Kohlendioxids seien noch offen. In<br />
diesem Zusammenhang sei ein<br />
strenges und umfassendes Monitoring<br />
bereits weit vor Beginn einer<br />
Verpressungsmaßnahme und über<br />
längere Zeiträume erforderlich. Die<br />
Forschungsergebnisse müssten<br />
unter angemessener Beteiligung<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft transparent<br />
dargestellt und offen kommuniziert<br />
werden, fordert der DVGW.<br />
Das kontrovers diskutierte CCS-<br />
Gesetz (Carbon Dioxide Capture<br />
and Storage) war im Sommer<br />
zunächst vom Bundestag beschlossen<br />
worden. Der Bundesrat stimmte<br />
in seiner Plenarsitzung am 23. September<br />
2011 jedoch mehrheitlich<br />
gegen den Entwurf. Deutschland<br />
hätte bis Juni diesen Jahres eine<br />
entsprechende EU-Richtlinie zum<br />
CCS umsetzen müssen. Die Bundesregierung<br />
müsste nun CO 2 -Speicher<br />
für das gesamte Bundesgebiet <strong>aus</strong>schließen<br />
oder den Vermittlungs<strong>aus</strong>schuss<br />
von Bund und Ländern<br />
anrufen, um einen Kompromiss herbeizuführen.<br />
Die Umsetzung der<br />
EU-Richtlinie zum CCS in deutsches<br />
Recht sollte eine Perspektive für<br />
eine klimaverträgliche Energieversorgung<br />
und eine CO 2 -emissionsarme<br />
Industrieproduktion aufzeigen.<br />
Davon losgelöst, begrüßt der<br />
DVGW, dass die Erstellung der technischen<br />
Regeln für den CO 2 -Transport<br />
in Pipelines analog § 49 Energiewirtschaftsgesetz<br />
geregelt ist<br />
und damit auf dem bewährten Instrument<br />
der technischen Selbstverwaltung<br />
des Gasfaches im DVGW<br />
gründet. Der DVGW wird daher entsprechende<br />
technische Regeln für<br />
die Errichtung und den Betrieb von<br />
Anlagen zum Transport von Kohlendioxid<br />
unter Beteiligung aller interessierten<br />
Kreise erstellen. Inter national<br />
(ISO) und europäisch (CEN)<br />
ist die normative Behandlung von<br />
Transport und Speicherung von<br />
Kohlendioxid ebenfalls auf den Weg<br />
gebracht. Die deutsche Spiegelung<br />
des ISO-Themenspektrums wird<br />
offiziell im DVGW-geführten Normen<strong>aus</strong>schuss<br />
Gastechnik (NAGas<br />
im DIN e.V.) erfolgen.<br />
Auf europäischer Ebene (CEN)<br />
wird das entsprechende Normungskomitee<br />
für Gasinfrastruktur (CEN/TC<br />
234) vom NAGas im DIN und somit<br />
ebenfalls vom DVGW geführt. Über<br />
die Normungsschiene DIN-CEN-ISO<br />
ist somit der nationale Regelsetzer<br />
DVGW direkt eingebunden.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.dvgw.de<br />
Dezember 2011<br />
1142 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
NETZWERK WISSEN<br />
Aktuelles <strong>aus</strong> Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Studienort Oldenburg im Porträt<br />
Zum 26. Oldenburger Rohrleitungsforum im Februar 2012:<br />
""<br />
iro-Leiter Prof. Thomas Wegener im Interview<br />
""<br />
Am Puls der Zeit: Rohrleitungen in neuen Energieversorgungskonzepten<br />
""<br />
Das Institut für Rohrleitungsbau arbeitet und forscht praxisnah<br />
""<br />
Zwickendes Zwerchfell und blubbernde Bäuche beim „Ollnburger Gröönkohlabend“<br />
Zur Jade Hochschule und Oldenburg:<br />
""<br />
Praxisnah studiert man in der Übermorgenstadt<br />
""<br />
Mit dem Kanu unterwegs auf Oldenburgs <strong>Wasser</strong>straßen<br />
Forschungs-Vorhaben und -Ergebnisse<br />
""<br />
Prüf- und Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Hochdruckwasserstrahltechnik<br />
""<br />
Forschungsschwerpunkt „<strong>Abwasser</strong>wärmerückgewinnung“<br />
""<br />
Hoch aufgelöste Messdaten in der Schmutzfrachtmodellierung von Kanalsystemen
NETZWERK WISSEN Einleitung<br />
Vortrag von Prof. Thomas Wegener<br />
beim 25. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
Wir haben für jeden etwas Interessantes<br />
im Angebot!<br />
iro-Leiter Prof. Thomas Wegener lüftet das Erfolgsgeheimnis<br />
des Oldenburger Rohrleitungsforums<br />
Am 9. und 10. Februar 2012 trifft sich die Fachwelt <strong>aus</strong> der Baubranche im niedersächsischen Oldenburg zum<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum. Der Leiter des Instituts für Rohrleitungsbau (iro), welches das Forum organisiert,<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, erklärt im Interview mit <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> |<strong>Abwasser</strong>, warum man an diesen<br />
zwei Tagen nicht um Oldenburg herumkommt, und stellt die Frage, welche Rolle Rohrleitungen in der<br />
Energieversorgung der Zukunft einnehmen können.<br />
<strong>gwf</strong>: Im Februar nächsten Jahres startet<br />
wieder ein neues Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum. Das erste fand im<br />
Jahr 1987 statt, also jährt sich das<br />
Großereignis zum 26. Mal. Herr Prof.<br />
Wegener, entwickelt sich da Routine<br />
oder sind Sie schon aufgeregt?<br />
Prof. Thomas Wegener: Jetzt noch<br />
nicht, es sind ja noch einige Wochen<br />
bis zum Forum, aber ich gebe zu: In<br />
den Tagen und Stunden, bevor es<br />
dann losgeht, da kommt schon ein<br />
wenig Lampenfieber.<br />
<strong>gwf</strong>: Was erhoffen Sie sich von der<br />
Veranstaltung?<br />
Prof. Thomas Wegener: Was ich<br />
mir – auch für alle iro-Mitarbeiter<br />
und Helfer – wünsche, ist eine gut<br />
besuchte Veranstaltung. Mit möglichst<br />
vielen Tagungsteilnehmern<br />
<strong>aus</strong> Deutschland und dem angrenzenden<br />
Ausland sind alle Mühen<br />
der Vorbereitung entlohnt.<br />
<strong>gwf</strong>: Wo setzen Sie dieses Mal<br />
Schwerpunkte?<br />
Prof. Thomas Wegener: Der<br />
Schwer punkt der Veranstaltung ist<br />
im Titel zu erkennen: „Rohrleitungen<br />
– in neuen Energieversorgungs konzepten“.<br />
Rohrleitungen – streng nach<br />
Medien getrennt – sind langlebige<br />
Wirtschaftsgüter. Vor dem Hintergrund<br />
der rasant fortschreitenden<br />
Diskussion und der sich dar<strong>aus</strong> ergebenden<br />
Entwicklung um die Energieversorgung<br />
der nächsten Jahrzehnte<br />
muss schon gefragt werden,<br />
welche Rolle Rohrleitungen haben<br />
Dezember 2011<br />
1144 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
können. Oder um es mit einem Beispiel<br />
auf den Punkt zu bringen:<br />
schon heute muss man sich in einem<br />
Neubaugebiet fragen, ob sich der<br />
flächende ckende Ausbau des Gasverteilnetzes<br />
noch ökonomisch darstellen<br />
lässt. Darüber und über die<br />
dar<strong>aus</strong> entstehenden Folgen lässt<br />
sich trefflich diskutieren.<br />
<strong>gwf</strong>: Die Veranstaltung entwickelte<br />
sich 1985 <strong>aus</strong> einer Ringvorlesung<br />
und richtete sich zunächst nur an Studenten.<br />
Mittlerweile hat das Forum<br />
eine Größe erreicht, die den nationalen<br />
Rahmen bei Weitem sprengt. Auch<br />
internationale Gäste und Aus steller<br />
sind dabei. Was denken Sie, worin<br />
liegt das Geheimnis des Erfolgs?<br />
Prof. Thomas Wegener: Es gibt eine<br />
Reihe von Faktoren, die auf die Entwicklung<br />
günstig einwirken konnten.<br />
Dazu zählt der frühe Zeitpunkt der<br />
Veranstaltung im Wirtschaftsjahr.<br />
Dazu zählt die Umgebung der Hochschule,<br />
das besondere Flair, mit den<br />
vielen, vielen helfen den Studenten<br />
und Studentinnen, welches sich hier<br />
entwickeln kann – man ist eben nicht<br />
in einer mehr oder minder <strong>aus</strong>wechselbaren<br />
Messehalle. Aber auch die<br />
Ge schichte ist wichtig. Das Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum wurde groß in<br />
den Zeiten nach dem Mauerfall, als<br />
sich viele Ingenieure und Techniker<br />
<strong>aus</strong> den Neuen Ländern orientieren<br />
wollten und mussten, als die Baubranche<br />
boomte. Dieses Treffen der<br />
Branche hat sich damals etabliert und<br />
ist es bis heute ge blieben.<br />
Zur Person<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener ist seit 2001 Geschäftsführer der iro<br />
GmbH Oldenburg und seit 2003 Mitglied des Vorstands des iro e.V.<br />
Außerdem lehrt er seit dem 1. September 1999 an der Hochschule in<br />
Oldenburg, der jetzigen Jade Hochschule. Er ist dort Professor für<br />
„Baubetriebslehre“.<br />
Vor seiner Hochschullaufbahn war Prof. Wegener in verschiedenen<br />
Funktionen (Bauleitung, Oberbauleitung, Abteilungsleitung und<br />
Niederlassungsleitung) im Rohrleitungs- und Anlagenbau in Deutschland<br />
und einem guten halben Dutzend Ländern in Europa unterwegs.<br />
„Dort habe ich viel gelernt über die Materie, aber auch über Land und<br />
Leute sowie zum unterschiedlichen Verständnis zur Berufsauffassung“,<br />
erklärt Prof. Wegener in der Rückschau.<br />
<strong>gwf</strong>: Welchen Nutzen können Ingenieure<br />
denn <strong>aus</strong> der Veranstaltung<br />
ziehen?<br />
Prof. Thomas Wegener: Wir versuchen<br />
bei dieser Veranstaltung die<br />
gesamte Bandbreite der Thematik<br />
Rohrleitungen abzudecken. Das<br />
gelingt eigentlich nicht, auch wenn<br />
wir über 120 Referenten und Moderatoren<br />
im Einsatz haben, die in fünf<br />
parallel laufenden Vortragsreihen<br />
ihre Themen zu besonderen Überschriften<br />
vortragen. Was uns<br />
gelingt, ist, dass wir für jeden, der<br />
am Thema Rohrleitungen interessiert<br />
ist, irgendetwas Interessantes<br />
im Angebot haben. Ob <strong>Wasser</strong> oder<br />
<strong>Abwasser</strong>, ob Gas oder Fernwärme,<br />
ob es Verfahrenstechnik oder Materialentwicklung<br />
oder Rechtsfragen<br />
oder Managementprobleme anbelangt:<br />
Es ist für alle Teilnehmer etwas<br />
dabei, was ihnen dann am Arbeitsplatz<br />
später von Nutzen sein kann.<br />
<strong>gwf</strong>: … und die Aussteller?<br />
Prof. Thomas Wegener: Die wissen,<br />
dass hier im Februar die Rohrleitungswelt<br />
zusammenströmt. Man<br />
weiß, dass man sich auf dem Forum<br />
in Oldenburg an diesen zwei Tagen<br />
nicht <strong>aus</strong> dem Wege gehen kann,<br />
man weiß auch, dass man hier in<br />
Oldenburg mit seinem Produkt, seiner<br />
Dienstleistung vertreten sein<br />
muss, um in der Folgesaison zu<br />
punkten. Letztlich erspart man sich<br />
viele, viele Kilometer der Akquisition.<br />
<strong>gwf</strong>: Bei der Organisation des Forums<br />
sind auch Studenten der Jade Hochschule<br />
eingebunden. Welche Chancen<br />
bietet die Veranstaltung den<br />
Studenten?<br />
Prof. Thomas Wegener: Das liegt<br />
auf der Hand: „Kontakte schaden<br />
nur dem, der sie nicht hat“, pflegte<br />
mein langjähriger Chef Günter<br />
Bruns von der Firma Ludwig Freytag<br />
oft zu sagen. Hier kann der Einstieg<br />
in die Berufswelt gesucht und auch<br />
gefunden werden. Abgesehen<br />
davon, dass man sich durch die Mithilfe<br />
bei Auf- und Abbau des Forums<br />
noch einige Euro zum Studentenbudget<br />
dazuverdienen kann.<br />
<strong>gwf</strong>: Ihr persönliches Forumshighlight<br />
im nächsten Jahr: Guss-Rohrsysteme<br />
oder doch eher Grünkohlabend?<br />
Prof. Thomas Wegener: Ach wissen<br />
Sie, es gibt so viele sinnvolle und<br />
tolle Rohrsysteme für die unterschiedlichsten<br />
Einsatzzwecke, da<br />
will ich mich gar nicht beschränken.<br />
Vom Grünkohlabend hoffe ich, dass<br />
er auch diesmal für unsere Gäste ein<br />
weiteres Highlight wird und somit<br />
den Besuch hier in Oldenburg<br />
abrundet.<br />
<strong>gwf</strong>: Herr Professor Wegener, vielen<br />
Dank für das Interview.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1145
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Am Puls der Zeit: Rohrleitungen in neuen<br />
Energieversorgungskonzepten<br />
Das iro lädt zum 26. Oldenburger Rohrleitungsforum im Februar 2012<br />
Beim Institut für Rohrleitungsbau (iro) läuft der Countdown für das 26. Oldenburger Rohrleitungsforum.<br />
Dieses findet am 9. und 10. Februar 2012 in der niedersächsischen Universitätsstadt statt. Eins steht schon im<br />
Vorfeld fest: Es wird wie jedes Jahr eine Veranstaltung der Superlative für die Branche.<br />
25. Oldenburger Rohrleitungsforum: Gedrängel auf dem Freigelände …<br />
Das Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
Die jetzige Traditionsveranstaltung startete ganz klein. Das Forum entwickelte sich <strong>aus</strong><br />
der Ringvorlesung zum Thema Rohrleitungen, die seit 1985 wöchentlich stattfand –<br />
zunächst für Studierende und ab 1986 dann auch für Ingenieure <strong>aus</strong> der Praxis. Aus der<br />
freien Wirtschaft kam der Vorschlag, die Vorlesungsreihe im Winter abzuhalten, wenn es<br />
witterungsbedingt weniger Arbeit in der Baubranche gibt. Außerdem wäre eine mehrtägige<br />
Blockveranstaltung attraktiver, besonders für diejenigen, die von außerhalb anreisen<br />
würden.<br />
Im Januar 1987 wurde das 1. Oldenburger Rohrleitungsforum ins Leben gerufen. In<br />
einem Hörsaal der Fachhochschule Oldenburg referierten insgesamt 12 Experten zwei<br />
Tage lang zum Thema „Kunststoffrohre im Bauwesen“. Knapp 100 Teilnehmer besuchten<br />
die Veranstaltung und 10 Fachfirmen stellten <strong>aus</strong>. Im nächsten Jahr sollte sich die<br />
Teilnehmerzahl sogar schon verdoppeln.<br />
Ab diesem Zeitpunkt war der Erfolgszug des Forums nicht mehr zu stoppen. 1993 gab<br />
es bereits 700 Teilnehmer und 83 Aussteller, sodass nun auch das zweite Obergeschoss<br />
der Fachhochschule mitgenutzt wurde. Im Jahr darauf musste zum ersten Mal einigen<br />
Teilnehmern und Ausstellern abgesagt werden, da die Räumlichkeiten der Fachhochschule<br />
mittlerweile nicht mehr <strong>aus</strong>reichten.<br />
Zum zehnten Jubiläum des Oldenburger Rohrleitungsforums 1996 machte die starke<br />
internationale Beteiligung zum Thema „Horizontal Drilling“ deutlich, dass das Interesse<br />
an dem Oldenburger Rohrleitungsforum bereits über die Grenzen Deutschlands hin<strong>aus</strong>geht.<br />
Und die Nachfrage steigt weiterhin an. Viele Teilnehmer schätzen das praxisnahe<br />
Konzept des Forums und die Kooperation zwischen freier Wirtschaft und der Fachhochschule.<br />
Das diesmalige Forum steht<br />
unter dem Leitthema „Rohrleitungen<br />
– in neuen Energieversorgungskonzepten“.<br />
Mit der Wahl dieses<br />
Schwerpunktes liegen die Veranstalter<br />
am Puls der Zeit. Denn die<br />
viel zitierte Energiewende – weg<br />
von Kohlenwasserstoffwirtschaft und<br />
Atomstrom hin zu neuen Systemen<br />
auf der Basis regenerativer Energieträger<br />
– ist unbestrittener Megatrend<br />
des angehenden 21. Jahrhunderts<br />
und wird es in den kommenden<br />
Jahrzehnten bleiben.<br />
Die Frage, welche Rolle spielt das<br />
Rohr im Rahmen der neuen Versorgungskonzepte,<br />
soll beim Forum<br />
2012 <strong>aus</strong>führlich erörtert werden.<br />
Denn die klassische Aufgabenteilung<br />
– Rohrleitungen für die Fernwärme,<br />
die Gasversorgung, die<br />
Trink- und Löschwasserbereitstellung<br />
und für den Regen- und<br />
Schmutzwassertransport – scheint<br />
ins Wanken zu geraten.<br />
Energiespeicher Gasleitung<br />
Schmutzwasser ist nicht nur<br />
Schmutzwasser, sondern ein Wärmeenergieträger,<br />
der sich mitunter<br />
sinnvoll nutzen lässt. Gasversorgungsleitungen,<br />
deren Ende in der<br />
Verteilung in den nächsten Dekaden<br />
vorhergesagt wird, werden als<br />
Energiespeicher für die regenerativen<br />
Energien erkannt, um diese in<br />
den Zeiten des Stromüberschusses<br />
zu nutzen.<br />
Und so sind auch die Vortragsblöcke<br />
entsprechend gewählt: „Erdgasnetze<br />
und modifizierte Nutzung“,<br />
„Energiequelle <strong>Abwasser</strong>wärme<br />
oder Klimaschutz“ oder<br />
„Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit<br />
– Innovative Konzepte im Energie-<br />
Dezember 2011<br />
1146 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
und <strong>Abwasser</strong>sektor“ stehen im<br />
Fokus des Interesses beim 26.<br />
Ol denburger Rohrleitungsforum.<br />
Daneben stehen aber auch Themenklassiker<br />
wie HDD, GFK-Rohrsysteme<br />
oder Pipelinebau wieder<br />
auf dem Programm.<br />
Gleich in der Eröffnungsrunde<br />
des Kongresses informiert Dietmar<br />
Schütz, der Präsident des Bundesverbandes<br />
Erneuerbarer Energien<br />
e. V. (BEE), die Besucher, wohin der<br />
Zug in punkto Versorgungskonzepte<br />
absehbar fährt. Darauf folgt<br />
ein Highlight mit Oldenburger<br />
Lokalbezug: die Präsentation des<br />
Pilotprojektes „<strong>Abwasser</strong>wärme in<br />
Oldenburg“, das der Oldenburgisch-<br />
Ostfriesische <strong>Wasser</strong>verband (OOWV)<br />
gemeinsam mit dem iro quasi vor<br />
dessen „H<strong>aus</strong>tür“ realisiert.<br />
Ein Thema der Zukunft sind<br />
„Smart grids“ oder Intelligente<br />
Netze: In Oldenburg wird die Möglichkeit<br />
einer Konvergenz von Netzinfrastrukturen<br />
vor dem Hintergrund<br />
moderner Informations- und<br />
Regelungstechnik beleuchtet. So -<br />
weit ein kleiner Ausschnitt des viel<br />
umfangreicheren Programms.<br />
3000 Besucher 2011<br />
Das Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
ist seit vielen Jahren eine Veranstaltung<br />
der Superlative für die<br />
Fachbranche und ein Muss im Terminkalender<br />
von Ingenieuren und<br />
Unternehmen im Rohrleitungsbau.<br />
… vor dem Tagungsbüro …<br />
Auf der Jubiläumsveranstaltung<br />
2011 tummelten sich geschätzte<br />
3000 Besucher, davon gut 900 angemeldete<br />
Teilnehmer, 112 Referenten,<br />
31 Moderatoren und 70 Ehrengäste.<br />
Dazu kamen die Aussteller. Auf<br />
einer Fläche im Gebäude der Jade<br />
Hochschule von etwa 2360 m 2<br />
waren 292 Stände, noch mal<br />
27 Stände standen im Außenbereich<br />
des Hochschulgebäudes auf<br />
einer Freifläche von 960 m 2 . Insgesamt<br />
präsentierten sich auf dem<br />
25. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
330 Firmen an 319 Messeständen,<br />
die von etwa 900 Personen betreut<br />
wurden.<br />
Um eine solche Riesenveranstaltung<br />
auf die Beine zu stellen, ist<br />
straffes Organisationsmanagement<br />
gefragt und trotzdem kann vieles<br />
erst kurz vor der Veranstaltung in<br />
Angriff genommen werden. „Auch<br />
wenn es gut vorbereitet wurde,<br />
muss es dann in sehr kurzer Zeit<br />
fertig gestellt sein“, erklärt Ina Kleist,<br />
die für die Gesamtorganisation des<br />
Forums zuständig ist. Die iro-Mitarbeiterin<br />
betreut die Referenten und<br />
Moderatoren, bearbeitet die Vorträge<br />
und verwaltet die Teilnehmeranmeldungen.<br />
Sie ist Ansprechpartnerin<br />
für alle Fragen zum Forum.<br />
Allein für den Endspurt beschäftigt<br />
das iro 70 Studierende der Jade<br />
Hochschule, um den Um- und Rückbau<br />
der Hochschule zu realisieren.<br />
Rückschau – Stimmen vom<br />
25. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
Dr.-Ing. Werner Brinker,<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg,<br />
Forumsbeitrag zum<br />
Pressegespräch 2011<br />
„Unsere zukünftige Aufgabe wird es sein, die Mittel-<br />
und Niederspannungssysteme zu optimieren.<br />
Die Volatilität der Einspeisung von Strom <strong>aus</strong> Wind<br />
und Photovoltaik-Anlagen zwingt uns, nach neuen<br />
Stromsenken in der Anwendung des Stroms <strong>aus</strong><br />
regenerativen Energien zu suchen. Als Stromsenken<br />
bieten sich auf den ersten Blick Kühlhäuser<br />
der Ernährungswirtschaft und des Lebensmittelhandels<br />
an. In ähnlicher Weise könnte man Strom<br />
nicht nur in Form von Kälte, sondern auch in Form<br />
von Wärme speichern. Zum Beispiel in einem separaten<br />
Wärmekreislauf von öffentlichen Schwimmbädern<br />
und Hallenbädern oder auch durch eine<br />
große Anzahl von elektrisch betriebenen Wärmepumpen<br />
für Ein- und Mehrfamilienhäuser.“<br />
Christian Günner,<br />
Bereichsleiter Grundlagen und<br />
Systementwicklung HAMBURG WASSER,<br />
Forumsbeitrag zum Pressegespräch 2011<br />
„Ganz wichtig ist das Begreifen von „<strong>Abwasser</strong>“<br />
als eine Ressource mit dem Potenzial einer<br />
Teilstrombehandlung vor Ort und der Mehrfachnutzung.<br />
Der Paradigmenwechsel, wonach <strong>Abwasser</strong><br />
nicht als Belastung anzusehen ist, die weggeschafft<br />
werden muss, sondern Regen- und Schmutzwasser<br />
als ökonomisch nutzbare Ressource betrachtet werden<br />
soll, ist weiter voranzutreiben. Dar<strong>aus</strong> folgen<br />
u. a. die Integration der Versorgungssektoren und<br />
neue Geschäftsmodelle. Die Grenzen zwischen den<br />
Infrastruktursparten verwischen dabei immer mehr.<br />
Die Integration von <strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
zeigt sich z. B. dort, wo <strong>Abwasser</strong> zur<br />
Wiederverwendung aufbereitet wird, bei der Nutzung<br />
von <strong>Abwasser</strong>-Wärme oder bei der Einspeisung<br />
von Bioerdgas <strong>aus</strong> Klärschlamm in das städtische<br />
Gasnetz. Der Weg dahin geht über die Durchführung<br />
von großtechnischen „Pilot“-Projekten.“<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1147
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Weite Informationen<br />
Online-Anmeldung:<br />
http://www.iro-online.de/index.php?id=158-<br />
Programm:<br />
http://www.iro-online.de/index.php?id=107-<br />
P+R:<br />
http://www.iro-online.de/index.php?id=115-<br />
„Wir versuchen innerhalb der studentischen<br />
Hilfskräfte ein paar –<br />
wenn auch sehr flache – Hierarchien<br />
zu gestalten. Schließlich gibt es ja<br />
immer ein paar Studenten, die auch<br />
im letzten Jahr schon dabei waren.<br />
Das rettet uns“, schätzt Kleist. Allein<br />
in der Zeit der Veranstaltung fallen<br />
etwa 2000 Hilfskraftstunden an.<br />
Kapazitäten am Anschlag<br />
„Zum 26. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
erwarten wir ähnliche Zahlen<br />
wie in den Vorjahren. Wir sind mit<br />
unserer Kapazität auf allen Ebenen<br />
am Anschlag“, fasst Kleist zusammen.<br />
Das heißt im Klartext: Es gibt keinen<br />
Platz! In der Hochschule ist während<br />
des Forums kein Durchkommen.<br />
Auch draußen auf dem Freigelände<br />
drängen sich die Besucher. Donnerstagmittag<br />
ist jeder Teilnehmer froh,<br />
wenn er in der Mensa – nachdem er<br />
die Schlange der Essens<strong>aus</strong>gabe<br />
überstanden hat – noch einen freien<br />
Stuhl ergattern kann.<br />
Die Organisatorin rät Besuchern<br />
dringend davon ab, mit dem Auto<br />
zum Veranstaltungsort zu kommen.<br />
Denn die wenigen Parkplätze, die es<br />
gibt, sind für Referenten und Moderatoren<br />
des Forums reserviert. Allen<br />
anderen Tagungsteilnehmern empfiehlt<br />
sie „P+R“.<br />
Auch 2012 wird wieder mit etwa<br />
3000 Teilnehmern gerechnet. Allerdings<br />
ist die Anmeldephase noch<br />
nicht abgeschlossen. „Wie immer<br />
um diese Zeit, gleich nachdem das<br />
Programmheft r<strong>aus</strong>kommt, melden<br />
sich viele Teilnehmer an. Dann ist<br />
die Situation eher schleppend. Kurz<br />
vor Weihnachten kommt noch mal<br />
ein Schwung und Anfang Januar<br />
gibt es auch noch einmal eine große<br />
Anmeldewelle. Am Ende ist das<br />
H<strong>aus</strong> voll“, resümiert Kleist.<br />
Gerne würde sich auch die eine<br />
oder andere Firma noch mit einem<br />
Ausstellungsstand präsentieren,<br />
doch es ist kein Quadratmeter Fläche<br />
mehr zu vergeben. Kleist dazu:<br />
„Selbst einigen potenziellen Ausstellern,<br />
die sich in diesem Jahr<br />
innerhalb der Anmeldefrist als Aussteller<br />
angemeldet haben, haben<br />
wir absagen müssen. Auch die Warteliste<br />
ist lang.“ Für 2012 konnten<br />
332 Firmen einen der begehrten<br />
Standplätze ergattern, darunter<br />
auch Unternehmen <strong>aus</strong> der Schweiz,<br />
Österreich, Dänemark, Italien und<br />
den Niederlanden.<br />
Kontakt<br />
Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18<br />
26121 Oldenburg<br />
Tel. (0441) 36 10 39-0<br />
Fax (0441) 36 10 39-10<br />
E-Mail: ina.kleist@iro-online.de<br />
Internet: www.iro-online.de<br />
… und bei den Vorträgen.<br />
Dezember 2011<br />
1148 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Das Institut für Rohrleitungsbau<br />
arbeitet und forscht praxisnah<br />
Gleich zwei Jubiläen feierte das Institut für Rohrleitungsbau im<br />
Jahr 2011: das 25. Oldenburger Rohrleitungsforum und das 10-jährige<br />
Bestehen der iro GmbH.<br />
Das „Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg<br />
e.V.“, kurz „iro“, wurde 1988 als<br />
An-Institut zur damaligen Fachhochschule<br />
Oldenburg gegründet.<br />
Träger des iro ist ein gemeinnütziger<br />
Verein, dem aktuell über 250<br />
Mitglieder <strong>aus</strong> Forschung, Industrie,<br />
Behörden und Fachverbänden<br />
angehören.<br />
Das iro arbeitet an der Schnittstelle<br />
zwischen der Lehre an der<br />
Fachhochschule auf der einen Seite<br />
und der Praxis in der freien Wirtschaft<br />
auf der anderen Seite. Eine wichtige<br />
Aufgabe besteht darin, Studierende<br />
an Themen der unterirdischen Infrastruktur<br />
heranzuführen. So absolvieren<br />
am Institut jährlich zehn Studierende<br />
ihr Praktikum, schrei ben ihre<br />
Bachelor- oder Masterarbeit. Studierende<br />
können das Wissen, das sie<br />
sich in der Hochschule angeeignet<br />
haben, im iro als wissenschaftliche<br />
Hilfskräfte bei der Mitarbeit an diversen<br />
Projekten vertiefen. Fast durchgehend<br />
arbeiten zwischen fünf und<br />
zehn Studenten im iro.<br />
Arbeit am iro ist<br />
ein Sprungbrett in den Job<br />
Für sie ist das ein Sprungbrett in<br />
den späteren Job. Da viele an Projekten<br />
mitarbeiten, die von Unternehmen<br />
getragen werden, ergibt es<br />
sich oft, dass nach Abschluss des<br />
Projekts und des Studiums ein entsprechendes<br />
Angebot <strong>aus</strong> der Wirtschaft<br />
kommt. „Man hat sich ja<br />
bereits schon kennen gelernt, ein<br />
unschätzbarer Vorteil im Wettbewerb<br />
der Unternehmen um fähige<br />
Köpfe“, erläutert iro-Leiter und Professor<br />
für Baubetriebslehre an der<br />
Jade Hochschule Prof. Dipl.-Ing.<br />
Thomas Wegener den Vorteil einer<br />
solch engen Kooperation.<br />
Ingenieure auf dem gesamten<br />
Rohrleitungssektor weiterzubilden<br />
sowie praxisnah zu forschen und zu<br />
entwickeln, sind weitere Aufgabenschwerpunkte.<br />
Neben unterschiedlichen<br />
Projekten organisiert das iro<br />
regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen:<br />
darunter das bekannte<br />
Oldenburger Rohrleitungsforum,<br />
das in diesem Jahr sein 25-jähriges<br />
Jubiläum feierte, den iro-Workshop<br />
„Qualitätssicherung bei Gashochdruckleitungen“<br />
oder der iro-Treffpunkt<br />
Gasverteilleitungen. Darüber<br />
hin<strong>aus</strong> bietet das iro unterschiedliche<br />
Seminare zur produktbezogenen<br />
Weiterbildung an, bei denen<br />
Firmen und Verbände die Möglichkeit<br />
haben, sich in einem Fachseminar<br />
zu präsentieren.<br />
Als das iro 1988 gegründet<br />
wurde, war noch nicht abzusehen,<br />
welche Erfolgsgeschichte das Institut<br />
schreiben sollte, wie hoch der<br />
Bedarf war, sich nicht nur mit den zu<br />
transportierenden Medien zu<br />
beschäftigen, sondern sich auch<br />
intensiv um „das Mittel zum Zweck“<br />
zu kümmern: die Rohrleitung. Im<br />
Laufe der Zeit erledigten die iro-<br />
Ingenieure erste Auftragsarbeiten.<br />
Aus formalen und steuerrechtlichen<br />
Gründen wurde es deshalb notwendig,<br />
Projekte mit „Gewinnerzielungsabsicht“<br />
<strong>aus</strong> dem Verein <strong>aus</strong>zugliedern.<br />
Das war die Geburtsstunde<br />
der iro GmbH Oldenburg.<br />
iro GmbH Oldenburg feiert<br />
10-Jähriges<br />
Die Gesellschaft ist eine 100-prozentige<br />
Tochterfirma des Instituts<br />
für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule<br />
Oldenburg e.V. Sie<br />
wurde 2001 gegründet. In den zehn<br />
Jahren, die sie jetzt besteht, hat sie<br />
sich zu einem wichtigen Bestandteil<br />
Bürogebäude des Instituts für Rohrleitungsbau<br />
in Oldenburg.<br />
der Firmenstruktur entwickelt. Derzeit<br />
beschäftigt die iro GmbH<br />
Oldenburg sechs Ingenieure unter<br />
Leitung von Prof. Wegener.<br />
Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt<br />
im Bereich der Auftragsforschung.<br />
Die Leistungen reichen von der Beratung<br />
bei Fragen zum Rohrleitungsbau<br />
über die Durchführung von<br />
Materialprüfungen und die Erstellung<br />
von Gutachten bis hin zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.<br />
Außerdem werden in der gesellschaftseigenen<br />
Forschungshalle Versuche<br />
und Tests durchgeführt, die im<br />
Wesentlichen Unternehmen bei der<br />
Produktentwicklung unterstützen.<br />
Über mangelnde Aufträge kann das<br />
iro dabei nicht klagen. Im Gegenteil:<br />
„Es ist sogar so, dass in der Regel<br />
mehr Aufgaben an uns heran getragen<br />
werden, als wir mit den wenigen<br />
Mitarbeitern zu bearbeiten in der<br />
Lage sind. Aber wir tun halt, was wir<br />
können“, sagt Prof. Wegener.<br />
Für die nächste Zeit ist vorgesehen,<br />
die Versuchseinrichtungen zu<br />
vervollständigen und insbesondere<br />
Studierende in den Versuchsbetrieb<br />
einzubinden. Die Anfertigungen praxisorientierter<br />
Ingenieurarbeiten sind<br />
ein wesentliches Ziel des Instituts, das<br />
die iro GmbH Oldenburg unterstützt.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1149<br />
Weitere<br />
Informationen<br />
www.iro-online.de
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Zwickendes Zwerchfell und blubbernde Bäuche<br />
beim deftigen „Ollnburger Gröönkohlabend“<br />
Was dem Berliner sein Bär, ist dem Oldenburger der Grünkohl. Nicht umsonst schmückt sich die Stadt mit<br />
dem Titel „Kohltourhauptstadt“. Klar, dass beim geselligen Teil des Rohrleitungsforums die Speisen<strong>aus</strong>wahl<br />
feststeht. Grünkohl und Pinkel kommen am ersten Kongressabend auf den Tisch. Der „Ollnburger Gröönkohlabend“<br />
hat eine so lange Tradition wie das Forum selbst.<br />
Gen<strong>aus</strong>o wie das Rohrleitungsforum<br />
über die Jahre immer größer<br />
wurde, wuchs auch der Stapel<br />
mit Anmeldungen für den Grünkohlabend.<br />
Das beeinflusste natürlich<br />
die Wahl der Lokalität. So zog<br />
man vom Hengelbräu, der ersten<br />
Oldenburger Gasth<strong>aus</strong>brauerei, in<br />
der das Essen in den ersten Jahren<br />
stattfand, übers Gesellschaftsh<strong>aus</strong><br />
„Wöbken“ in Hundsmühlen (immerhin<br />
Platz für 420 Gäste) in die oberen<br />
Festsäle der Weser-Ems-Halle.<br />
Doch selbst die hier vorhandenen<br />
680 Plätze reichten nicht mehr <strong>aus</strong>.<br />
2011 schnabulierten über 900 Gäste<br />
ihren Grünkohl erstmalig in der<br />
Kongresshalle der Weser-Ems-Halle.<br />
Endlich mussten keine Absagen<br />
mehr verschickt werden.<br />
Gut so. Denn je mehr Gäste,<br />
desto höher der Erlös <strong>aus</strong> dem Losverkauf<br />
der alljährlichen Tombola.<br />
Mit der Endsumme unterstützen die<br />
Veranstalter soziale Projekte mit<br />
Lokalkolorit, etwa die jährliche<br />
Weihnachtsaktion der Nordwest-<br />
Zeitung, der Oldenburger Regionalzeitung,<br />
die Kindern in Not hilft,<br />
oder kleinere Hilfsorganisationen in<br />
der Region, die auf Spenden angewiesen<br />
sind.<br />
2011 wurden beim Grünkohlabend<br />
Lose für rund 4600 Euro verkauft.<br />
Die Summe wurde dem Kinderhospiz<br />
Löwenherz e.V. in Syke<br />
bei Bremen übergeben als Beitrag<br />
zum Bau eines Jugendhospizes für<br />
schwerstkranke Jugendliche und<br />
junge Erwachsene. Da ist grün nicht<br />
nur die Farbe des Grünkohls, sondern<br />
auch die Farbe der Hoffnung.<br />
Wackeltenöre reizen<br />
zum Lachen<br />
Wenn zu fortgeschrittener Zeit am<br />
Abend die Bäuche noch nicht blubbern,<br />
fängt spätestens mit den<br />
Grünkohlbräuche in Oldenburg<br />
© Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH<br />
© Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH<br />
Grünkohl ist <strong>aus</strong> der niedersächsischen Küche nicht wegzudenken und<br />
in der Hochburg der Kohlpflanze, in Oldenburg, läuft ohne Grünkohl mit<br />
Pinkel (geräucherte Grützwurst) auf dem Tisch im Winter gar nichts.<br />
Wenn der erste Frost klirrt, beginnt die Ernte. Der Genuss hält von<br />
November bis März an. Zahlreichen Bräuchen frönen die Oldenburger<br />
während der Saison in den Herbst- und Wintermonaten: Vereine und<br />
Firmen gehen auf Kohlfahrt und küren ihren Kohlkönig, häufig kombiniert<br />
mit der regionaltypischen Sportart Boßeln (Gummikugelweitwurf).<br />
Die Stadt Oldenburg lädt einmal im Jahr hochrangige Persönlichkeiten<br />
<strong>aus</strong> Politik, Wirtschaft und Kultur ein, um anlässlich des „Defftig<br />
Ollnborger Gröönkohl-Ätens“ im politischen Berlin für sich zu werben<br />
und einen Politiker als „Oldenburger Kohlkönig“ zu küren. Die Liste der<br />
Amtsträger umfasst alle wichtigen Namen der deutschen Politik. Auch<br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Christian Wulff<br />
trugen den Titel bereits. Amtierender Grünkohlkönig ist Bundeswirtschaftsminister<br />
Philipp Rösler. Der Veranstalter hofft, dass sich der<br />
König während der „Amtszeit“ für die Interessen der Stadt einsetzt.<br />
Jeder König hat die Pflicht, die Stadt Oldenburg mindestens einmal während<br />
der Regentschaft zu besuchen.<br />
Bei soviel Kult um den Kohl verwundert es auch nicht, dass Oldenburg<br />
als einzige Stadt ein Grünkohl-Studium anbietet. Das Vorlesungsverzeichnis<br />
2011/2012 verteilt die Grünkohl-Akademie. Bei den teilnehmenden<br />
Forschungsinstituten erhält man so schmackhafte Dinge wie<br />
Grünkohl-Marmelade, Oldenburger Pinkel-Mostrich oder das allseits<br />
beliebte Kohlkönig-Brot.<br />
Weitere Informationen: www.kohltourhauptstadt.de<br />
Dezember 2011<br />
1150 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Showeinlagen das Zwerchfell an zu<br />
zwicken. So strapazierten zum Beispiel<br />
in diesem Jahr die Wackeltenöre<br />
weniger mit ihrem Gesang als<br />
mit Grimassen, großen Gesten und<br />
vollem Körpereinsatz in maximaler<br />
Schräglage – fallen sie nun um, oder<br />
hält die Fußhalterung? – die Lachmuskeln<br />
der Gäste. Muskeleinsatz<br />
der ganz anderen Art zeigte das<br />
Künstlerpaar „Nos Ipsi“. An der Vertikalstange<br />
waren Bauchmuskeln<br />
und Bizeps gefragt, um nicht auf<br />
den Boden der Tatsachen zurückgeholt<br />
zu werden.<br />
Ein großes Hallo gibt es jedes Mal<br />
bei der Kür des neuen Kohlkönigs.<br />
Mit den Insignien seiner Macht,<br />
Urkunde und dem Orden „das goldene<br />
Schwein“, schreitet er zu seiner<br />
ersten Amtshandlung: der Ziehung<br />
der 16 Losgewinner. Auf die warten<br />
hochkarätige Preise. So durfte sich<br />
der diesjährige Gewinner des ersten<br />
Preises über eine Brunchfahrt an<br />
Bord eines imposanten Windjammers<br />
während der Kieler Woche<br />
sowie zwei Übernachtungen im<br />
Steigenberger Conti-Hansa freuen.<br />
Sind alle Gewinner gezogen,<br />
endet der offizielle Teil der Veranstaltung,<br />
was nicht heißt, dass Musik<br />
und Genuss schon vorbei wären.<br />
Denn erst nach Mitternacht zieht es<br />
die Gäste in ihre Hotels zurück.<br />
Über 900 Gäste kamen zum Grünkohlabend in die Weser-Ems-Halle.<br />
Übrigens warnt der Veranstalter<br />
vor „gestörten Verdauungsabläufen“,<br />
dem latenten Restrisiko bei<br />
übermäßigem Grünkohlverzehr.<br />
Dieses könne aber in Grenzen<br />
gehalten werden „durch verantwortungsvollen<br />
Umgang mit den<br />
fleischlichen Beilagen der Oldenburger<br />
Identitätspflanze und durch<br />
prophylaktische Einnahme des<br />
einen oder anderen klaren Schnapses“.<br />
Gegen Lachmuskelkater allerdings<br />
fehlt ein solch wirksames<br />
Gegenmittel.<br />
Losverkauf für den guten Zweck.<br />
Spendenaktion beim nächsten Grünkohlabend<br />
Das Künstlerpaar „Nos Ipsi“ an<br />
der Vertikalstange.<br />
Der Erlös des Losverkaufs kommt 2012 der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) zu<br />
Gute. In Zusammenarbeit mit dem Oldenburger Pius Hospital wird ein „Oldenburger<br />
Typisierungstag“ <strong>aus</strong>gerichtet. Die DKMS typisiert per Blutentnahme oder Wangenabstrich<br />
freiwillige Stammzellspender. Stammzellen benötigen Menschen (meist Kinder<br />
und junge Erwachsene), die z. B. an Leukämie oder aplastischer Anämie erkrankt sind,<br />
damit sie eine Überlebenschance haben. Alle typisierten Menschen gehen in eine internationale<br />
Datenbank ein und werden dort bis zu ihrem 60. Lebensjahr gespeichert.<br />
Diese Typisierung finanziert sich nicht <strong>aus</strong> öffentlichen Mitteln. Jede „Bestimmung der<br />
Gewebemerkmale“ kostet die DKMS 50 Euro. Diese Summe umfasst größtenteils die<br />
Laborkostenrechnung, alle anderen Aktionen und Personalkosten übernehmen die<br />
Krankenkassen.<br />
Mit dem Erlös <strong>aus</strong> der Spendenaktion des Grünkohlabends sollen diese Kosten, die<br />
durch die Untersuchung bereitwilliger Spender entstehen, gedeckt werden. Dabei bleiben<br />
die Veranstalter ihrem Motto treu, regionale Hilfsprojekte zu unterstützen. Denn alle<br />
Gelder werden für Typisierungen vor Ort, also im Pius Hospital, Oldenburg (Sprechstunde<br />
jeden Dienstag von 10°° bis 16°° Uhr), verwendet.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1151
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Praxisnah studiert man in der „Übermorgenstadt“<br />
Seit 2009 schmückt sich Oldenburg in Niedersachsen mit der Jade Hochschule und<br />
dem Titel „Stadt der Wissenschaft“<br />
An der Jade Hochschule im niedersächsischen Oldenburg werden Ingenieure <strong>aus</strong>gebildet, die optimal auf ihr<br />
späteres Berufsleben vorbereitet sind. Schon während ihres Studiums sammeln die Studenten Praxiserfahrungen<br />
und knüpfen Kontakte zur Industrie. Wer später eine Karriere in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft starten möchte,<br />
studiert an der Jade Hochschule im Fachbereich Bauwesen und Geoinformation am Standort Oldenburg.<br />
Fortbewegungsmittel Nr. 1 in Oldenburg: das Fahrrad.<br />
© Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH/Thorsten Ritzmann<br />
Deutschlandstipendium: Jade Hochschule sahnt ab<br />
Die Jade Hochschule hat erstmalig zum Wintersemester 2011/2012 Deutschlandstipendien<br />
an insgesamt 26 Studierende der Hochschule vergeben. Dabei sind die Weichen für<br />
eine neue Stipendienkultur gestellt: Private Geldgeber und öffentliche Hand übernehmen<br />
jeweils die Hälfte der Fördermittel von monatlich 300 Euro für jedes Stipendium.<br />
Als eine von wenigen Hochschulen konnte die Hochschule den vollen Förderrahmen<br />
des Bundes <strong>aus</strong>schöpfen. „Dies spricht für eine enge und gute Kooperation mit der regionalen<br />
Wirtschaft und eine hohe Akzeptanz der Jade Hochschule von Seiten der ansässigen<br />
Unternehmen“, äußerte sich eine Sprecherin der Hochschule gegenüber <strong>gwf</strong>-<br />
<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>.<br />
Neben der finanziellen Unterstützung und der Belohnung für gute Studienleistung<br />
erhalten die Stipendiaten darüber hin<strong>aus</strong> Kontakt zu Unternehmen und potenziellen<br />
Arbeitgebern. Das Stipendium ist unabhängig vom Einkommen der Eltern, wird nicht<br />
auf das BAföG angerechnet und ist rückzahlungsfrei. Förderer erhalten durch das Programm<br />
Kontakt zu den Spitzenkräften von morgen und können schon heute einen Beitrag<br />
gegen den Fachkräftemangel leisten.<br />
Das Deutschlandstipendium bietet Förderern, Studierenden und der Hochschule die<br />
Möglichkeit, engen Kontakt zu pflegen. Das Netzwerk wird so gestärkt und Teilnehmer<br />
und Förderer leisten einen Beitrag für die Zukunft der Region.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.jade-hs.de/studierende/foerderungen/stipendien/deutschlandstipendium/<br />
Studentenstädte erkennt man<br />
gemeinhin am Fahrradaufkommen.<br />
Wenn es danach geht, hat sich<br />
das im westlichen Niedersachsen<br />
gelegene Oldenburg den Titel Universitätsstadt<br />
redlich verdient. Auf<br />
rund 162 000 Einwohner kommen<br />
geschätzte 250 000 Fahrräder. Dies<br />
ist nicht nur umweltbewussten Bürgern<br />
zu verdanken, sondern auch<br />
den über 10 000 Studenten der Carl<br />
von Ossietzky Universität.<br />
Natürlich sind auch die insgesamt<br />
2000 Studenten der Jade<br />
Hochschule am Standort Oldenburg<br />
auf zwei Rädern unterwegs.<br />
Immerhin schreibt sich die Hochschule<br />
<strong>aus</strong>drücklich das Prädikat<br />
„umweltfreundlich“ auf ihre Flügel.<br />
Das passt gut ins Bild einer jungen<br />
Hochschule, denn die Jade Hochschule<br />
mit den drei Standorten in<br />
Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth<br />
ist in ihrer jetzigen Form<br />
gerade mal zwei Jahre alt (vorher<br />
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven).<br />
Gegründet wurde sie in 2009 –<br />
einem ganz besonderen Jahr für die<br />
Stadt. Für dieses Jahr verlieh der<br />
Stifterverband der Deutschen Wissenschaft<br />
Oldenburg den Titel<br />
„Stadt der Wissenschaft“. Die Gründung<br />
einer modernen Hochschule,<br />
die sich versteht als „forschende,<br />
familien- und umweltfreundliche<br />
Hochschule, die auch in der Lehre<br />
neue Wege beschreiten möchte“,<br />
trägt das Konzept „Übermorgenstadt“<br />
der Stadtväter.<br />
Hinter diesem Begriff versteckt<br />
sich weniger eine technikverliebte<br />
Zukunftsvision mit fliegenden<br />
Robotern oder Magnetschwebe-<br />
Dezember 2011<br />
1152 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
bahnen, die die Stadt durchqueren<br />
sollen, als vielmehr handfeste Ideen,<br />
in welche Richtung sich die Stadt<br />
bis 2014 entwickelt haben soll,<br />
damit sie sich als Wissenschaftsund<br />
Wirtschaftsstandort gegen<br />
andere Städte behaupten kann. Die<br />
Neuauflage der Hochschule war da<br />
ein wichtiger Punkt.<br />
An der Jade Hochschule sind in<br />
insgesamt 30 Bachelor- und 8 Masterstudiengängen<br />
6700 Studenten<br />
eingeschrieben. 190 Professoren<br />
unterrichten nicht nur, sondern<br />
betreuen die Studenten persönlich<br />
und helfen, Kontakte zu potenziellen<br />
Arbeitgebern zu vermitteln. Die<br />
Jade Hochschule verteilt sich auf<br />
drei Studienorte:<br />
""<br />
Wilhelmshaven mit den drei<br />
Fachbereichen Ingenieurwissenschaften,<br />
Wirtschaft sowie<br />
Management, Information,<br />
Technologie<br />
""<br />
Elsfleth mit dem Fachbereich<br />
Seefahrt<br />
""<br />
Oldenburg mit den zwei Fachbereichen<br />
Architektur sowie<br />
Bauwesen und Geoinformation<br />
Wer später in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Schwerpunkt Trinkwasserversorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorgung,<br />
Fuß fassen möchte, studiert an der<br />
Jade Hochschule Bauingenieurwesen.<br />
In Teilbereichen werden Grundlagen<br />
auch den Wirtschaftsingenieuren<br />
der Bauwirtschaft vermittelt.<br />
1000 Studenten<br />
im Fachbereich Bauwesen<br />
Mit derzeitig rund 1000 Studierenden<br />
gehört der Fachbereich Bauwesen<br />
am Standort Oldenburg zu den<br />
größten Baufachbereichen in<br />
Deutschland. In diesen Fachbereich<br />
fallen der Studiengang Bauingenieurwesen<br />
(Schwerpunkte: Baumanagement,<br />
Europäisches Baumanagement,<br />
Konstruktiver Ingenieurbau,<br />
Verkehrswesen, <strong>Wasser</strong>bau<br />
und Umwelttechnik, Bauingenieurwesen-Technische<br />
und kulturelle<br />
Integration) sowie die Studiengänge<br />
Wirtschaftsingenieurwesen-<br />
Bauwirtschaft, Management und<br />
Engineering im Bauwesen, Facility<br />
Management und Immobilienwirtschaft.<br />
Obwohl die Jade Hochschule<br />
selber noch jung ist, hat die Ausbildung<br />
von Bauingenieuren in Oldenburg<br />
eine lange Tradition. Bereits im<br />
Herbst 1877 wurde in der Nähe<br />
Oldenburgs eine Winter-B<strong>aus</strong>chule<br />
für Bauhandwerker gegründet, die<br />
Dr. Elmar Schreiber,<br />
Präsident der Jade Hochschule<br />
„Um optimale Leistungen erbringen zu<br />
können, muss vor allem die Atmosphäre<br />
zwischen allen Akteuren – sowohl nach innen<br />
als auch nach außen – stimmen. Deshalb<br />
arbeiten wir dafür, dass wir eine Hochschule<br />
sind, in der der Mensch im Mittelpunkt steht“.<br />
1938 zur „Staatsb<strong>aus</strong>chule, Fachschule<br />
für Hoch- und Tiefbau in<br />
Oldenburg“ wurde, 1968 zur „Staatlichen<br />
Ingenieurakademie“ und<br />
durch Zusammenschluss mit der<br />
Seefahrtschule in Elsfleth im Jahr<br />
1971 schließlich zur „Fachhochschule<br />
Oldenburg“.<br />
Derzeit wird in Oldenburg für<br />
angehende Bauingenieure ein sehr<br />
großes Portfolio an Veranstaltungen<br />
vorgehalten. Das liegt daran, dass<br />
im Fachbereich Bauwesen und Geoinformation<br />
fast 50 Lehrende tätig<br />
sind. Neben dem Pflichtprogramm<br />
Das Hauptgebäude der Jade Hochschule in Oldenburg mit dem<br />
Fachbereich Bauwesen. © Jade Hochschule<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1153
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener,<br />
Professor für Baubetriebslehre,<br />
Geschäftsführer der iro GmbH<br />
„Unsere Absolventen sollen von der Wirtschaft<br />
nach ihrem Studium nach kurzer Einarbeitungszeit<br />
eingesetzt werden können. Das ist durch<strong>aus</strong><br />
nicht selbstverständlich. Da ist der enge<br />
Schulterschluss, der Kontakt zwischen<br />
Wissenschaft und Wirtschaft erforderlich.“<br />
wird so auch eine Reihe von Spezialitäten<br />
vorgehalten. Studenten können<br />
sich zum Beispiel in zahlreichen<br />
Veranstaltungen umfangreiches<br />
Wissen im Bereich Siedlungswasserwirtschaft<br />
aneignen.<br />
Durch die enge Verzahnung der<br />
Hochschule mit dem Institut für<br />
Rohrleitungsbau (iro) wird zudem<br />
im Bereich Rohrleitungen ein starker<br />
Akzent gesetzt. „Die Studierenden<br />
können sich in der Vertiefung<br />
des Studiums sehr, sehr breit aufstellen<br />
und zielgerichtet studieren.<br />
So gibt es einiges zum Thema Rohrleitungen<br />
und Rohrleitungsbau. Das<br />
findet man meines Erachtens sonst<br />
nirgendwo“, meint Prof. Dipl.-Ing.<br />
Thomas Wegener, der an der Jade<br />
Hochschule die Professur für Baubetriebslehre<br />
innehat und gleichzeitig<br />
seit 2001 das Amt des Geschäftsführers<br />
bei der iro GmbH Oldenburg<br />
bekleidet.<br />
Gute Noten beim aktuellen<br />
CHE-Hochschulranking<br />
Beim aktuellen Hochschulranking<br />
des Centrums für Hochschulentwicklung<br />
(CHE) erhält die Jade<br />
Hochschule gute Bewertungen. Am<br />
Standort Oldenburg sind speziell<br />
die Wirtschaftsingenieure überdurchschnittlich<br />
zufrieden mit den<br />
Studienbedingungen. Für Praxisbezug,<br />
Betreuung durch Lehrende<br />
und Unterstützung fürs Auslandsstudium<br />
verteilen die befragten<br />
Studenten Bestnoten.<br />
Damit schneidet die Hochschule<br />
in den Augen der Studenten genau<br />
in den Bereichen sehr gut ab, auf<br />
Campus in Oldenburg.<br />
© Jade Hochschule<br />
die sie besonderen Wert legt: starker<br />
Praxisbezug, internationale Ausrichtung<br />
und eine hohe Qualität in<br />
der Lehre. Der Präsident der Jade<br />
Hochschule Dr. Elmar Schreiber<br />
bringt dieses Selbstverständnis auf<br />
den Punkt: „Die Jade Hochschule<br />
steht für eine hohe Qualität in der<br />
Lehre und ein gutes Betreuungsverhältnis<br />
zwischen Lehrenden und<br />
Lernenden. Sie orientiert sich in der<br />
Forschung an den Bedürfnissen der<br />
Menschen und Märkte und gehört<br />
seit Jahren zu den forschungsstärksten<br />
Fachhochschulen des<br />
Landes.“<br />
„Change Management“: neues Modell für Studierende<br />
Der richtige Umgang mit Veränderungen in einem Unternehmen wird für die Führungsebene immer wichtiger.<br />
Deshalb hat die Jade Hochschule diesen Themenkomplex jetzt in das Curriculum für angehende<br />
Manager im Bauwesen aufgenommen. „Unsere Absolventen werden später in Führungspositionen tätig<br />
sein und müssen sich früh genug auf diese wichtige Kommunikations-Aufgabe vorbereiten“, sagt Prof. Dr.<br />
Kirsten Plog, die seit 1996 das Lehrgebiet Personal- und Verhandlungsführung an der Hochschule vertritt.<br />
„Veränderungen sind heute an der Tagesordnung, aber weder Firmen<br />
noch Menschen können sich daran gewöhnen“, weiß Plog. Zwei Jahre<br />
hat die Kommunikationswissenschaftlerin zu diesem Themenbereich<br />
geforscht und nun auch ein Handbuch dazu veröffentlicht. Auf über 200<br />
Seiten wird ein Hundert-Punkte-Programm für erfolgreiche Veränderungen<br />
<strong>aus</strong>führlich erklärt und zur spezifischen Nutzung aufbereitet. „Wie<br />
sag ich’s dann den Betroffenen und Beteiligten? Wie können wir alle an<br />
einem Strang ziehen, wer muss mit ins Boot, wer kann rudern? Das sind<br />
nur einige Fragen, die das „Begleitbuch für Veränderungen“ beantwortet<br />
und in den Seminaren mit den Studierenden bearbeitet werden.<br />
Zahlreiche Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter unterliegen<br />
Einflussfaktoren wie zum Beispiel Wettbewerbsdruck, Globalisierung<br />
oder Wirtschaftslage und erfahren einen hohen Handlungsdruck.<br />
Prof. Dr. Kirsten Plog (rechts<br />
im Bild) in einem Seminar<br />
zum Change Management.<br />
© Jade Hochschule<br />
Jedes Unternehmen braucht aber ein individuelles Change Management,<br />
das sich dem Unternehmen anpasst.<br />
Weitere Informationen: www.jade-hs.de<br />
Dezember 2011<br />
1154 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Dass die Jade Hochschule zu den<br />
forschungsstärksten Hochschulen<br />
des Landes zählt, liegt an drei An-<br />
Instituten und 15 In-Instituten, die<br />
zahlreiche Forschungsprojekte realisieren<br />
(zwei aktuelle Forschungsprojekte<br />
des iro unter der Rubrik<br />
Netzwerk Wissen Aktuell). Speziell<br />
für den Standort Oldenburg im<br />
Fachbereich Bauwesen sind als An-<br />
Institute das Institut für Materialprüfung<br />
(IfM) und das Institut für<br />
Rohrleitungsbau (iro) zu nennen<br />
sowie das In-Institut für Mess- und<br />
Auswertetechnik (IMA).<br />
Praxisnähe wird<br />
großgeschrieben<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt, den<br />
sich die Jade Hochschule auf die<br />
Fahnen schreibt, ist Praxisnähe. Wer<br />
in Oldenburg studiert, ist ganz nah<br />
dran am Job. Dafür steht zum einen<br />
das Themenspektrum, das sich am<br />
aktuellen Arbeitsmarkt orientiert.<br />
Zum anderen kommen alle Dozenten<br />
<strong>aus</strong> der Praxis und halten den<br />
Kontakt zur Wirtschaft. Prof. Wegener<br />
erklärt die Zielsetzung: „Unsere<br />
Absolventen sollen von der Wirtschaft<br />
nach ihrem Studium nach<br />
kurzer Einarbeitungszeit eingesetzt<br />
werden können. Das ist durch<strong>aus</strong><br />
nicht selbstverständlich. Da ist der<br />
enge Schulterschluss, der Kontakt<br />
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft<br />
erforderlich.“<br />
Im Bereich Trinkwasserversorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
arbeitet die Hochschule eng zusammen<br />
mit dem großen regionalen<br />
Flächenversorger und -entsorger,<br />
dem Oldenburgisch-Ostfriesischen<br />
<strong>Wasser</strong>verband (OOWV), zu dem<br />
traditionell gute Verbindungen<br />
bestehen. Die örtliche EWE AG ist<br />
ebenfalls bei einigen Veranstaltungen<br />
im Boot. Teilweise bestehen<br />
auch Kooperationen mit Institutionen<br />
der nächsten Großstadt wie<br />
zum Beispiel der hanse<strong>Wasser</strong> Bremen<br />
GmbH, dem größten privaten<br />
Dienstleister rund um <strong>Wasser</strong> und<br />
<strong>Abwasser</strong> in Norddeutschland.<br />
Die Jade Hochschule punktet bei<br />
angehenden Bauingenieuren also<br />
mit Studieninhalten, Praxisbezug<br />
und Kontakten zur Wirtschaft. Wer<br />
zudem kurze Wege, kleine Mieten<br />
und familiäre Atmosphäre im Hochschulbetrieb<br />
zu schätzen weiß, der<br />
ist in Oldenburg genau richtig.<br />
Kontakt<br />
Jade Hochschule<br />
University of Applied Sciences<br />
Ofener Straße 16/19<br />
26121 Oldenburg<br />
Tel. (0441) 7708-0<br />
Fax (0441) 7708-1000<br />
Internet: www.jade-hs.de<br />
E-Mail: presse@jade-hs.de<br />
Mit dem Kanu unterwegs auf<br />
Oldenburgs <strong>Wasser</strong>straßen<br />
<strong>Wasser</strong>ratten nähern sich der Stadt über Hunte und Küstenkanal<br />
bis zum Oldenburger Hafen<br />
Oldenburg ist eine Stadt des <strong>Wasser</strong>s und der <strong>Wasser</strong>straßen: Über 100 Kilometer Gräben, Bäche, Teiche, Seen<br />
sowie die Flüsse Hunte und Haaren und der Küstenkanal prägen das Stadtbild und das Umland. Idyllisch liegt<br />
der Alte Stadthafen im Herzen Oldenburgs. Hektischer geht’s im Industrieteil des Oldenburger Hafens zu. Hier<br />
ist ein großer Umschlagplatz der Binnen- und Seeschifffahrt.<br />
<strong>Wasser</strong>begeisterte<br />
Besucher<br />
sollten sich Oldenburg von<br />
Flussseite her nähern, genauer<br />
gesagt im Kanu über die Hunte. So<br />
erlebt man die Stadt <strong>aus</strong> ganz anderer<br />
Perspektive. Der knapp 190 Kilometer<br />
lange Nebenfluss der Weser<br />
schlängelt sich südwestlich von<br />
Oldenburg durch die Marschlandschaft.<br />
Hier starten wir unsere Kanutour.<br />
In der saftigen, grünen „Buschhagenniederung“<br />
kreuzen gleich<br />
mehrere Wege für Fuß-, Rad- und<br />
<strong>Wasser</strong>wanderer. Vom Kanu <strong>aus</strong> lassen<br />
wir den Blick über das Gebiet<br />
<br />
Citypaddeln auf Oldenburgs <strong>Wasser</strong>straßen: erste Testfahrt mit Bürgermeister,<br />
Gästeführern, Geschäftsführung OTM und Kooperationspartner Yeti Sport & Reisen<br />
am 13. Juli 2010. © Pressebüro Stadt Oldenburg/OTM.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1155
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Die Cäcilienbrücke kann um 3,50 m angehoben<br />
werden, damit Binnenschiffe passieren können.<br />
© Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH/Verena Brandt<br />
zwischen Osternburger Kanal und<br />
Hunte schweifen: Röhrichte, Flutrasen,<br />
Seggen- und Binsenrieder und<br />
feuchte Grünlandbrachen mit<br />
Sumpfdotterblumenwiesen soweit<br />
das Auge reicht. Früher wurden<br />
große Bereiche der Buschhagenniederung<br />
als Rieselwiesen genutzt.<br />
Heute zeugen von dieser Bewässerungstechnik<br />
nur noch die zahlreichen<br />
Gräben und Siele.<br />
1927 wurde die Hunte<br />
begradigt und angehoben<br />
Doch so sah die Buschhagenniederung<br />
nicht immer <strong>aus</strong>. Bevor der<br />
Mensch eingriff, fand sich hier eine<br />
feuchte Auenlandschaft mit Erlenbruchwald.<br />
1927 veränderte sich<br />
das Gebiet drastisch: Um den Küstenkanal<br />
mit <strong>Wasser</strong> zu speisen,<br />
wurde die Hunte in diesem Jahr<br />
begradigt, erneut verlegt und auf<br />
ein Niveau von fünf Metern über<br />
Normalnull angehoben. Dies führte<br />
dazu, dass die Buschhagenniederung<br />
eingedeicht werden musste.<br />
Paddelt man weiter Richtung<br />
Oldenburg, trifft man bald auf den<br />
Küstenkanal. Die 70 Kilometer lange<br />
Bundeswasserstraße verbindet über<br />
die Untere Hunte Weser und Ems.<br />
Hunte und Küstenkanal verlaufen in<br />
diesem Streckenabschnitt parallel,<br />
sodass wir hier schwere Binnenfrachtschiffe<br />
vorbeiziehen sehen.<br />
Kurz darauf, noch oberhalb der<br />
Schleuse, teilt sich die Hunte.<br />
Die Alte Hunte wird durch einen<br />
Düker von Süden nach Norden<br />
geleitet und verläuft dann nördlich<br />
des Küstenkanals. Unterhalb der<br />
Stadtautobahn wurden umfangreiche<br />
wasserbauliche Maßnahmen<br />
2006 abgeschlossen. Im Zuge einer<br />
Neugestaltung des Flussbades<br />
OLANTIS erhielt die Alte Hunte, die<br />
hier auch Mühlenhunte genannt<br />
wird, in diesem Bereich ein neues,<br />
naturnah gestaltetes Bett. Die Mühlenhunte<br />
fließt anschließend am<br />
Schlossgarten und an der Huntestraße<br />
entlang und speist unterhalb<br />
des Stautors den Alten Hafen.<br />
Am Stautor mündet, von Westen<br />
kommend, ein weiterer Fluss, der<br />
das Stadtbild Oldenburg prägt, in<br />
die Hunte: die Haaren. Dass die<br />
Oldenburger wasserverliebt und für<br />
jeden Spaß zu haben sind, beweist<br />
die Waschzuber-Regatta auf der<br />
Haaren, die bis 2009 alljährlich stattfand.<br />
An den Flussufern am Heiligengeistwall<br />
versammelten sich die<br />
Zuschauer, um die Bottich-Paddler<br />
anzufeuern und zu sehen, wer als<br />
erster durchs Ziel treibt.<br />
Geschichte zum Anfassen bei<br />
Schleuse und Kraftwerk<br />
Unsere Kanutour geht indes parallel<br />
zum Küstenkanal auf der Neuen<br />
Hunte weiter. Hier treffen wir bald<br />
auf zwei geschichtsträchtige Bauwerke:<br />
Schleuse und Kraftwerk. Die<br />
Schleuse Oldenburg stellt die Verbindung<br />
der Hunte in den Küstenkanal<br />
und in das westdeutsche<br />
Kanalnetz her. Seit fast 75 Jahren<br />
steht dieses Bauwerk der Schifffahrt<br />
zur Verfügung. Sechs Jahre von<br />
1922 bis 1928 wurde die Schleuse<br />
gebaut. Ihre Kammer misst 105 m<br />
Länge und 12 m Breite. Der überwundene<br />
Höhenunterschied ist<br />
abhängig vom <strong>Wasser</strong>stand in der<br />
Hunte, deren Unterlauf als Küstengewässer<br />
abhängig ist von den<br />
Gezeiten. Bei Tideniedrigwasser<br />
beträgt der Unterschied etwa<br />
5,40 m. Gespeist wird die Schleuse<br />
mit <strong>Wasser</strong> <strong>aus</strong> dem Küstenkanal.<br />
Für eine Schleusung werden zwischen<br />
3700 m³ (bei Tidenhochwasser)<br />
und 7000 m³ <strong>Wasser</strong> (bei Tidenniedrigwasser)<br />
benötigt.<br />
Jährlich passieren etwa 5000<br />
Binnenschiffe die Schleuse, die<br />
dabei zwei Millionen Gütertonnen<br />
Ladung befördern. Auch etliche<br />
Freizeitschiffer nutzen den Kanal<br />
und die Schleuse.<br />
Direkt neben der Schleuse befindet<br />
sich eine St<strong>aus</strong>tufe in der Hunte.<br />
Die St<strong>aus</strong>tufe entstand mit dem Bau<br />
des Küstenkanals, um die <strong>Wasser</strong>stände<br />
der Hunte, des Küstenkanals<br />
und der Mühlenhunte zu regulieren.<br />
Hier wurde 1927 das <strong>Wasser</strong>kraftwerk<br />
an der Hunte in Betrieb<br />
Im Industrieteil des Oldenburger Hafens werden jährlich 1,2 Millionen<br />
Tonnen landwirtschaftliche und b<strong>aus</strong>toffliche Güter umgeschlagen.<br />
© Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH/Verena Brandt<br />
Dezember 2011<br />
1156 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
genommen. Es reguliert auch heute<br />
noch die <strong>Wasser</strong>stände von Hunte,<br />
Mühlenhunte und Küstenkanal.<br />
Gleichzeitig nutzt es den Höhenunterschied<br />
von gut fünf Metern an<br />
dieser Stelle, um Strom zu erzeugen.<br />
Das Laufwasserkraftwerk ist<br />
mit Kaplan-Turbinen mit einer<br />
Gesamtleistung von 700 kW <strong>aus</strong>gerüstet.<br />
Da der <strong>Wasser</strong>stand der<br />
Hunte abhängig ist von Ebbe und<br />
Flut, ist auch die Fallhöhe im Unterwasser<br />
tideabhängig und schwankt<br />
zwischen 1,80 m und 6,20 m.<br />
Obwohl die Stromerzeugung hier<br />
nicht im Vordergrund steht, erzeugt<br />
das <strong>Wasser</strong>kraftwerk Jahr für Jahr<br />
rund zwei Millionen Kilowattstunden<br />
Strom. Wer will, begibt sich auf<br />
eine Zeitreise ins <strong>Wasser</strong>kraftwerk:<br />
Die Turbinen stammen noch <strong>aus</strong> der<br />
Zeit von etwa 1930.<br />
Eine umweltfreundliche Neuerung<br />
ist die 2006 fertig gestellte<br />
Fischtreppe. Sie ermöglicht Wanderfischen,<br />
den Höhenunterschied der<br />
künstlich erzeugten <strong>Wasser</strong>stände<br />
zu überbrücken. Über 36 Einzelbecken<br />
meistern Lachse, Meerforellen<br />
und Flussneunaugen den Aufstieg<br />
in Richtung Huntemündung oder<br />
Flussoberlauf problemlos.<br />
Achtung Berufsschifffahrt<br />
am Zusammenfluss mit<br />
dem Kanal<br />
Nicht ganz so problemlos überwinden<br />
die Kanuten den Höhenunterschied.<br />
Wir müssen jetzt r<strong>aus</strong> <strong>aus</strong><br />
dem <strong>Wasser</strong> und unser Kanu schultern.<br />
Am Kraftwerk ist umtragen<br />
angesagt! Danach heißt es aufpassen.<br />
Denn ab dem Zusammenfluss<br />
mit dem Küstenkanal bis zur Mündung<br />
in die Weser ist die Hunte Bundeswasserstraße<br />
und das heißt, ab<br />
hier treffen wir auf Berufsschifffahrt<br />
und motorisierte Freizeitschifffahrt.<br />
Bis wir unser Ziel, den Oldenburger<br />
Stadthafen, erreichen, passieren<br />
wir noch einige imposante Brückenbauwerke:<br />
Zunächst die Hochstraße Oldenburg:<br />
Die Autobahnbrücke (A 28)<br />
der stadtnahen Südumgehung<br />
Oldenburgs ist mit 1450 m das<br />
längste Brückenbauwerk Niedersachsens<br />
und überzieht die Hunte,<br />
den Küstenkanal und den Osternburger<br />
Kanal.<br />
Danach die Cäcilienbrücke: Sie<br />
ist die einzige verbliebene Hebebrücke<br />
über die Hunte bzw. den Küstenkanal<br />
mit einer Spannweite von<br />
40,80 m und verbindet die Innenstadt<br />
mit dem Stadtteil Osternburg.<br />
An beiden Ufern stehen je zwei<br />
geklinkerte Türme, dazwischen<br />
spannt sich die Fahrbahn <strong>aus</strong> Stahl,<br />
die zwei asphaltierte Spuren für<br />
Autos und Fahrräder und eine durch<br />
eine Wand abgegrenzte Fußgängerspur<br />
auf jeder Seite besitzt. Die<br />
Hebevorrichtung zieht die Fahrbahn<br />
mit einer MAN-Maschinenanlage<br />
und Stahlseilen um 3,50 m nach<br />
oben, um die Durchfahrt für Schiffe<br />
zu ermöglichen.<br />
Kurz vor dem Hafen die Amalienbrücke:<br />
Im Gegensatz zur Cäcilienbrücke<br />
ist die aktuelle Amalienbrücke<br />
eine durchgängige Brücke. Eine<br />
lange Auffahrt führt die Fahrbahn<br />
bis in etwa 8 m Höhe über den<br />
Kanal und ermöglicht damit auch<br />
Binnenschiffen eine Durchfahrt. Die<br />
Fahrbahn umfasst zwei Fahrstreifen<br />
und auf jeder Seite je einen breiten<br />
Fuß- und Radweg.<br />
Im Hafen werden<br />
1,2 Millionen Tonnen Güter<br />
umgeschlagen<br />
Nachdem diese Brücke unterquert<br />
ist, haben wir unser Ziel erreicht:<br />
den Oldenburger Hafen. Der hat<br />
mehr zu bieten, als man auf den<br />
ersten Blick vermutet. Östlich liegt<br />
der Wirtschaftshafen für die Binnenund<br />
Seeschifffahrt vor uns. Hier werden<br />
hauptsächlich Getreide, Futterund<br />
Düngemittel umgeschlagen,<br />
gefolgt von Sand und Kies, insgesamt<br />
jährlich 1,2 Millionen Tonnen.<br />
Damit gehört der Oldenburger<br />
Hafen zu den umschlagsstärksten<br />
Binnenhäfen Niedersachsens. Die<br />
Umschlagsarbeit erledigen 7 Kräne,<br />
4 Verladebrücken, 1 Umschlagstutzen<br />
für Ölprodukte sowie insgesamt<br />
11 Mobilkräne.<br />
Sie fertigten im Jahr 2009 insgesamt<br />
1041 Binnen- und 104 Seeschiffe<br />
ab. Gleichzeitig ist der Oldenburger<br />
Hafen Durchgangsstation<br />
für Binnenschiffe, die zwischen dem<br />
Rhein-Ruhr-Revier und dem Weser-<br />
Ems-Revier unterwegs sind.<br />
Wir wollen es aber gemütlicher<br />
haben und wenden unser Kanu in<br />
den westlichen Teil des Hafens. Hier<br />
steht eher die Freizeitnutzung im<br />
Vordergrund. Deshalb treffen wir an<br />
dieser Stelle vor allem Motor-,<br />
Segel- und Ausflugsboote. Nach<br />
dieser kräftezehrenden Tour ist<br />
Erholung für die Muskeln und noch<br />
eine kleine Stärkung für den Magen<br />
angesagt. Beides bekommt man im<br />
Schwan am Oldenburger Stadthafen.<br />
Hier kann man im Biergarten<br />
direkt an der Kaimauer stilecht sein<br />
Pangasiusfilet oder Tagliatelle mit<br />
Lachs genießen und den Blick verträumt<br />
über die kleinen Segelboote<br />
streifen lassen.<br />
Idyllisch zeigt<br />
sich der Westteil<br />
des Hafens:<br />
Blick vom Stau<br />
auf die Hafenpromenade.<br />
© Oldenburg<br />
Tourismus und<br />
Marketing GmbH/<br />
Verena Brandt<br />
Weitere<br />
Informationen:<br />
www.oldenburg.de<br />
www.oldenburgtourist.de<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1157
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Prüf- und Forschungsarbeit auf dem Gebiet der<br />
Hochdruckwasserstrahltechnik<br />
Seit Gründung des iro ist der Themenkomplex Reinigung von <strong>Abwasser</strong>leitungen und -kanälen mit Hochdruckwasserstrahltechnologie<br />
ein Schwerpunkt in der Arbeit des Instituts sowie der iro GmbH Oldenburg.<br />
Viele Projekte wurden in der Vergangenheit zu diesem Thema praktisch durchgeführt und auch in der Theorie<br />
umfangreich erfasst, was sich in dem Buch „Reinigung von <strong>Abwasser</strong>kanälen mit Hochdruckspülung“<br />
(iro-Schriftenreihe Band 11) widerspiegelt. Das Buch ist 2007 in der nunmehr dritten Auflage erschienen.<br />
Bild 1. 2009 wurde eine Forschungshalle errichtet, um der immer größeren Nachfrage<br />
nach Prüfungen nach DIN 19523 gerecht zu werden.<br />
Insbesondere die Untersuchung<br />
von Rohren hinsichtlich ihrer<br />
Widerstandskraft gegenüber den<br />
Einwirkungen der Hochdruckwasserstrahlen<br />
beschäftigt das iro seit<br />
jeher intensiv. Über viele Jahre Vorreiter<br />
in der Forschung und Ausführung<br />
von Prüfungen auf diesem<br />
Gebiet hat das iro seinerzeit einen<br />
speziellen Spülstand entworfen und<br />
umfangreiche Messtechnik angeschafft.<br />
Unter den Stichworten<br />
„Hamburger Spülversuch, Schweizer<br />
Norm und DIN V 19517“ wurden<br />
über die Jahre regelmäßig Untersuchungen<br />
und später Prüfungen<br />
durchgeführt, deren Anzahl sich<br />
nicht mehr fassen lässt. Nach dem<br />
Rückzug der DIN V 19517 war das<br />
iro maßgeblich an der Entwicklung<br />
und Ausgestaltung der heute gültigen<br />
DIN 19523 „Anforderungen und<br />
Prüfverfahren zur Ermittlung der<br />
Hochdruckstrahlbeständigkeit und<br />
-spülfestigkeit von Rohrleitungsteilen<br />
für <strong>Abwasser</strong>leitungen und<br />
-kanäle“ beteiligt und führt heute<br />
entsprechende Prüfungen <strong>aus</strong>.<br />
In DIN 19523 werden zwei Arten<br />
der Prüfung unterschieden. Die<br />
„Werkstoffprüfung“ prüft mit einer<br />
definierten Belastung durch eine<br />
einstrahlige Düse die Widerstandsfähigkeit<br />
des Rohrmaterials gegenüber<br />
der HD-<strong>Wasser</strong>strahlbelastung.<br />
Hierbei wird ein kurzes Rohrstück<br />
als Prüfmuster in den bereits<br />
erwähnten Spülstand eingebaut<br />
und die Prüfung in drei Prüfzyklen<br />
durchgeführt. Die Praxisprüfung<br />
erfordert hingegen den Aufbau<br />
einer mindestens 15 m langen<br />
Versuchsstrecke, die drei Rohrverbindungen<br />
und vier nachträglich<br />
montierte Anschlüsse aufweist. Mit<br />
einer genormten Reinigungsdüse<br />
wird die Prüfstrecke in 60 Zyklen<br />
befahren. Sämtliche Prüfungen werden<br />
<strong>aus</strong>schließlich mit DKD geprüfter<br />
Messtechnik und somit in entsprechend<br />
hoher Genauigkeit <strong>aus</strong>geführt.<br />
Bild 2. Versuche zum Ausblasrisiko verschiedener Reinigungsdüsen in<br />
Projektphase 2.<br />
Dezember 2011<br />
1158 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Aktuell NETZWERK WISSEN<br />
Fragen …<br />
… zum Projekt „Ausblasen<br />
von Geruchverschlüssen<br />
infolge Hochdruckreinigung“<br />
beantwortet Herr<br />
Dipl.-Ing. Matthias Heyer<br />
unter E-Mail: heyer@iro-online.de<br />
… zum Thema Prüfungen<br />
nach DIN 19523 beantwortet<br />
Herr Dipl.-Ing. Bernd<br />
Niedringh<strong>aus</strong> unter<br />
E-Mail: niedringh<strong>aus</strong>@iro-online.de<br />
Um der immer größeren Nachfrage<br />
nach Prüfungen nach DIN<br />
19523 gerecht zu werden, wurde im<br />
Jahr 2009 eine Forschungshalle<br />
errichtet (Bild 1). Die Halle ist in<br />
ihrer Dimensionierung insbesondere<br />
auch auf diese Prüfungen <strong>aus</strong>gelegt<br />
und bietet somit einen<br />
geeigneten Raum für die Durchführungen<br />
der Prüfung. In 2010 wurde<br />
die Forschungshalle um eine Lagerhalle<br />
erweitert, die unter anderem<br />
auch die ordnungsgemäße Lagerung<br />
von Prüfmustern ermöglicht.<br />
Aktuell wird am iro mit dem Forschungsprojekt<br />
„Ausblasen von<br />
Geruchverschlüssen infolge Hochdruckreinigung“<br />
im Bereich der HD-<br />
Reinigung geforscht (Bild 2 und 3).<br />
Dieses Projekt – ursprünglich im<br />
Jahr 2001 durch die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
ins Leben gerufen – befindet<br />
sich derzeit in der nunmehr dritten<br />
Projektphase und ist durch die<br />
hanse<strong>Wasser</strong> Bremen GmbH, den<br />
Oldenburgisch-Ostfriesischen <strong>Wasser</strong>verband,<br />
die Stadtentwässerung<br />
Frankfurt sowie die Beteiligung von<br />
Herstellern von Reinigungsdüsen<br />
im Jahr 2008 erweitert worden.<br />
Nachdem zunächst der Hintergrund<br />
von Ausblasereignissen – also das<br />
Ausblasen oder Leersaugen von<br />
Geruchverschlüssen in den angeschlossenen<br />
häuslichen Entwässerungsgegenständen<br />
durch Reinigungsmaßnahmen<br />
im Hauptkanal<br />
– untersucht wurde, ist die aktuelle<br />
und auch finale Zielsetzung des Projekts<br />
die Ermittlung einer Reinigungsdüse<br />
oder Düsenkonfiguration,<br />
um eine effiziente Reinigung<br />
des öffentlichen Kanals mit einem<br />
geringen Ausblasrisiko zu kombinieren.<br />
Eine neue Versuchsreihe ist für<br />
die kommenden Wochen vorgesehen.<br />
Mit einem Ergebnis und somit<br />
Abschluss dieses Projekts ist im<br />
Frühjahr 2012 zu rechnen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Heyer<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18<br />
26121 Oldenburg<br />
E-Mail: heyer@iro-.online.de<br />
Internet: www.iro-online.de<br />
Bild 3. Ergebnisse der zweiten Projektphase:<br />
Maximal auftretende Über- und Unterdrücke an<br />
Anschlussleitungen infolge einer HD-Reinigung.<br />
Weitere Informationen<br />
Artikel „Hochdruckreinigung von<br />
<strong>Abwasser</strong> kanälen: Die neue Norm DIN 19523“<br />
(Februar 2008, bi-Umweltbau)<br />
Artikel zu den Ergebnissen des<br />
Forschungsprojekts „Ausblasen von<br />
Geruchverschlüssen infolge Hochdruckreinigung“<br />
in der Projektphase 2<br />
(bi-Umweltbau-Ausgabe 01-2011)<br />
jeweils als Download unter: http://www.iro-online.de/?id=32-<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1159
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Forschungsschwerpunkt<br />
„<strong>Abwasser</strong>wärmerückgewinnung“<br />
Die relativ jungen Technologien um die „Wärmerückgewinnung <strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong>“ bieten dem Institut für Rohrleitungsbau<br />
(iro) ein breites Forschungsspektrum. Angefangen mit der Entwicklung eines Wärmet<strong>aus</strong>chers für<br />
kleine Kanäle reichen die Aktivitäten mittlerweile von der Durchführung praxisorientierter Effizienztests über<br />
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bis hin zu der Entwicklung ganzheitlicher Konzepte für den Einsatz von<br />
Wärmet<strong>aus</strong>chern in <strong>Abwasser</strong>kanälen.<br />
Ein aktuelles Forschungsprojekt<br />
des iro, das in Kooperation mit<br />
dem Leed-Partner Jade Hochschule<br />
in Oldenburg durchgeführt wird,<br />
behandelt die Entwicklung von<br />
neuen Methoden, Konzepten und<br />
Werkzeugen für eine nachhaltige<br />
Energieplanung in Kommunen. Das<br />
Projekt wurde von Akteuren <strong>aus</strong><br />
den unterschiedlichsten Bereichen<br />
ins Leben gerufen: Vertretern der<br />
„Grünen Industrie“, Regionalplanern<br />
und Akteuren der regionalen und<br />
gemeindlichen Entwicklung. Das<br />
Projekt wird seitens der EU im Programm<br />
Interreg IVB gefördert und<br />
hat eine Laufzeit von September<br />
2009 bis August 2012.<br />
Am Beispiel der Kleinstadt Osterholz-Scharmbeck<br />
bei Bremen wird<br />
hier unter anderem der Einsatz<br />
eines <strong>Abwasser</strong>wärmet<strong>aus</strong>cherprototyps<br />
in der Praxis geprüft, der in<br />
Kombination mit einem Sanierungsverfahren<br />
in nicht begehbare<br />
Kanäle eingebracht werden kann.<br />
Bild 1. Versuchsaufbau der Wärmet<strong>aus</strong>cher-<br />
Prüfstrecke in der iro-Forschungshalle.<br />
Bild 2. Grafische Darstellung der Erstprüfung zur Erfassung von<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzungspotenzialen in Osterholz-Scharmbeck.<br />
Um die Anforderungen für einen<br />
sinnvollen Einsatz zu definieren und<br />
ggf. die Wirksamkeit des neuen Wärmet<strong>aus</strong>chers<br />
optimieren zu können,<br />
werden in der Forschungshalle des<br />
iro verschiedene Prüfstrecken entwickelt<br />
und installiert. Differenzierte<br />
Überströmungsversuche geben<br />
Aufschluss darüber, wie der Prototyp<br />
in Abhängigkeit von dem vorher<br />
am Beispielstandort Osterholz-<br />
Scharmbeck erfassten Kanalbetriebsbedingungen<br />
reagiert (siehe<br />
Bild 1).<br />
Die Analyse der Ergebnisse wird<br />
als Muster der Entscheidungsfindung<br />
für eine Pilotanwendung dienen.<br />
Für eine systemspezifische<br />
Standortsuche wird eine Verschneidung<br />
der Leitungsinformationen<br />
mit denen <strong>aus</strong> der Bestandsdatenbank<br />
öffentlicher Liegenschaften<br />
durchgeführt. Dieses schafft eine<br />
Identifizierung von möglichen Einsatzorten<br />
und dient als Basis für<br />
eine langfristige Umsetzung des<br />
Nutzungspotenzials (siehe Bild 2).<br />
In einem nächsten Schritt wird<br />
ein regelbasiertes Entscheidungsunterstützungsmodell<br />
entwickelt,<br />
welches als Grundlage für den<br />
abgestimmten Einsatz unterschiedlicher<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmet<strong>aus</strong>cher-<br />
Technologien dient.<br />
Auf Basis des Regelwerkes kann<br />
so ein Diskurs zwischen den Akteuren<br />
(Investor, Eigentümer, Betreiber<br />
des Kanalnetzes und der Klärwerke<br />
sowie der Kommune) stattfinden,<br />
um ein nachhaltig tragfähiges Konzept<br />
für die Nutzung von Wärme<br />
<strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong> zu erarbeiten.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Mike Böge<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18, 26121 Oldenburg<br />
E-Mail: boege@iro-online.de<br />
Internet: www.iro-online.de<br />
Dezember 2011<br />
1160 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Aktuell NETZWERK WISSEN<br />
Hoch aufgelöste Messdaten in der<br />
Schmutzfrachtmodellierung von Kanalsystemen<br />
Kurzfassung der Dissertation<br />
Von DI Dr. techn. Valentin Gamerith<br />
Technische Universität Graz, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau<br />
Begutachter: Univ.-Prof. DDipl.-Ing. Dr. techn. Dr.h.c. Harald Kainz, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Wolfgang Rauch<br />
Einleitung<br />
Die Modellierung von Kanalsystemen<br />
ist seit mehreren Jahrzehnten<br />
Gegenstand der Forschung und findet<br />
seit längerem auch Anwendung<br />
in der Praxis. Neuentwicklungen in<br />
der Messtechnologie erlauben mittlerweile<br />
die zeitlich hoch aufgelöste<br />
Erfassung von Abfluss und Schmutzstoffkonzentrationen<br />
direkt im<br />
Kanalsystem. Die großen Datenmengen<br />
stellen dabei eine Her<strong>aus</strong>forderung<br />
sowohl an das Datenmanagement<br />
als auch an die sinnvolle<br />
Anwendung der Daten in der<br />
Modellierung dar.<br />
Diese Arbeit behandelt die<br />
Anwendbarkeit hoch aufgelöster<br />
Langzeitmessreihen in der Schmutzfrachtmodellierung<br />
von Kanalnetzen.<br />
Dabei wurde eine Vorgehensweise<br />
entwickelt, die den Weg von<br />
Daten zu validierten Modellergebnissen<br />
erleichtern soll. Dazu wurden<br />
Methoden zur Datenanalyse, Datenvalidierung<br />
und Sensorkalibrierung<br />
entwickelt und umgesetzt. Methoden<br />
zur globalen Sensitivitätsanalyse<br />
wurden in das bestehende<br />
Optimierungsframework BlueM.<br />
OPT integriert, welches auch einen<br />
Optimierungsalgorithmus basierend<br />
auf evolutionären Strategien<br />
zur Modelloptimierung beinhaltet.<br />
Die entwickelten Methoden wurden<br />
in der Fallstudie Graz West R05<br />
angewendet, wo seit mehreren<br />
Jahren kontinuierlich hoch aufgelöste<br />
Messreihen zu Abfluss und<br />
Schmutzstoffkonzentrationen aufgezeichnet<br />
werden.<br />
Fallstudie Graz West R05:<br />
Messungen, Daten und<br />
Modell<br />
Im Einzugsgebiet Graz West R05 in<br />
Graz (Österreich) werden seit 2002<br />
durchgehend hoch aufgelöste<br />
Daten zu Niederschlag, Hydraulik<br />
und Schmutzstoffkonzentrationen<br />
aufgezeichnet. Das Einzugsgebiet<br />
mit einer Gesamtfläche von 460 ha<br />
wird im Mischsystem entwässert.<br />
Schmutzstoffkonzentrationen (ab-<br />
filtrierbare Stoffe, chemischer Sauerstoffbedarf<br />
und andere) werden<br />
direkt an einem Mischwasserüberlauf<br />
am Auslass des Einzugsgebiets<br />
in-situ von einem UV-VIS Spektrometer<br />
mit einer zeitlichen Auflösung<br />
von 1 bzw. 3 Minuten (Regenund<br />
Trockenwetterabfluss) gemessen.<br />
Alle verfügbaren Daten wurden<br />
visuell auf Fehler und Lücken analysiert.<br />
Die Periode 2009 wurde im<br />
Detail betrachtet. Auf Basis der<br />
Beobachtungen wurden in der Software<br />
R Scripts zur (halb)automatisierten<br />
Datenvalidierung entwickelt,<br />
welche über mehrere Tests die<br />
Daten in gültig, nicht gültig oder<br />
zweifelhaft klassifizieren.<br />
Anschließend wurde ein Modell<br />
des Einzugsgebiets in der Software<br />
SMUSI 5 erstellt. SMUSI ist ein<br />
k onzeptionelles deterministisches<br />
Niederschlags-Abfluss-Transportund<br />
Schmutzfrachtmodell. Das Einzugsgebiet<br />
wurde dabei zu 57 Teileinzugsgebieten<br />
und 56 Haupthaltungen<br />
aggregiert. Für das<br />
Schmutzfrachtmodell kamen drei<br />
Modellansätze zur Anwendung: ein<br />
Ansatz mit konstanter Regenwasserkonzentration<br />
und zwei Oberflächen<br />
Akkumulations- und<br />
Abtragsmodellansätze.<br />
UV-VIS Sondenkalibrierung<br />
Für die Kalibrierung der UV-VIS<br />
Sonde standen 36 Samples von 6<br />
Regenereignissen zur Verfügung.<br />
Zwei Methoden – die Anwendung<br />
einer linearen Regression und eine<br />
Kopplung an einen Optimierungsalgorithmus<br />
– wurden verglichen. Mit<br />
der vorhandenen, vom Hersteller<br />
zur Verfügung gestellten „globalen<br />
Kalibrierung“ wurden systematische<br />
Fehler von bis zu 50 % ermittelt.<br />
Durch die lokale Kalibrierung<br />
auf Basis der linearen Regression<br />
konnten die Fehler auf eine Größenordnung<br />
von 25 bis 30 % reduziert<br />
werden. Die Kopplung an den Optimierungsalgorithmus<br />
brachte keine<br />
signifikant besseren Resultate als<br />
die Regressionsmethode. Besondere<br />
Vorsicht wird bei der lokalen<br />
Sondenkalibrierung empfohlen,<br />
wenn nur wenige Samples zur Verfügung<br />
stehen, da mögliche Änderungen<br />
in der <strong>Abwasser</strong>matrix<br />
dabei nicht berücksichtigt werden:<br />
Wenn in der Kalibrierung nur Samples<br />
von einem Ereignis herangezogen<br />
wurden, führte dies zu Fehlern<br />
von bis zu 100 % für die Validierungsereignisse.<br />
Globale Sensitivitätsanalyse<br />
und Multikriterielle<br />
Optimierung<br />
Zwei Methoden der globalen Sensitivitätsanalyse<br />
– die Screening<br />
Methode nach Morris und die<br />
Methode der Standardisierten Re -<br />
gres sionskoeffizienten (SRCs) – wurden<br />
in das BlueM.OPT Framework<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1161
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
implementiert und anschließend<br />
verglichen. Ziel dabei war die Identifikation<br />
und Reihung der maßgebenden<br />
Modellparameter. Im Allgemeinen<br />
führten beide Methoden zu<br />
gleichen Ergebnissen, sofern ein<br />
annähernd lineares Verhaltens für<br />
die SRCs vor<strong>aus</strong>gesetzt werden<br />
kann. In diesem Fall kann mit Hilfe<br />
der SRCs die Varianz in der Zielgröße<br />
auf Grund der Variation der einzelnen<br />
Parameter bestimmt werden.<br />
Das Morris Screening wiederum<br />
erlaubt die Identifikation von Parameterinteraktion<br />
oder Nichtlinearitäten<br />
bei geringerem Rechenaufwand.<br />
Weiters wurde gezeigt, wie<br />
sich Sensitivitäten der Parameter<br />
mit der Wahl des Niederschlagsereignisses<br />
und der gewählten Zielgröße<br />
ändern. Dies erlaubt eine<br />
sinnvolle Wahl von Niederschlagsereignissen<br />
und Zielgrößen für die<br />
anschließende Modellkalibrierung.<br />
Die Modellkalibrierung erfolgte<br />
über die Kopplung des Modells an<br />
einen evolutionären Algorithmus,<br />
der die gleichzeitige Optimierung<br />
mehrerer Zielfunktionen (multikriterielle<br />
Optimierung) erlaubt. Ein<br />
Vergleich der Optimierung wurde<br />
mit einem und mit mehreren<br />
Regen ereignissen sowohl für das<br />
hy draulische Modell als auch für die<br />
drei Schmutzfrachtansätze durchgeführt.<br />
Im Allgemeinen führte die<br />
gleichzeitige Optimierung auf mehrere<br />
Ereignisse zu den besten Resultaten<br />
für die Validierungsereignisse.<br />
Ein Vergleich der Schmutzfrachtmodelle<br />
zeigte, dass das einfachere<br />
Oberflächen-Akkumulations- und<br />
Abtragsmodell zu den besten und<br />
stabilsten Resultaten führte.<br />
Zusammenfassung<br />
Durch die entwickelten Methoden<br />
für die Datenanalyse und Datenvalidierung<br />
konnten die vorhandenen<br />
hoch aufgelösten Messdaten sinnvoll<br />
geprüft und deren Qualität für<br />
die weitere Verwendung in der<br />
Modellierung abgesichert werden.<br />
Eine Auswertung der Messergebnisse<br />
der installierten UV-VIS Spektrometersonde<br />
zeigte die Notwendigkeit<br />
einer lokalen Sondenkalibrierung<br />
und diskutiert deren<br />
Grenzen. Zwei Methoden zur globalen<br />
Sensitivitätsanalyse wurden<br />
implementiert, verglichen und ihre<br />
Anwendbarkeit diskutiert. Im Allgemeinen<br />
wurden dabei dieselben<br />
Modellparameter als einflussreich<br />
identifiziert. Ein erster Ansatz zur<br />
Bewertung der Sensitivität von<br />
Modellparametern bei Berücksichtigung<br />
von Kombinationen von<br />
Regenereignissen und/oder Zielfunktionen<br />
wurde entwickelt. Ein<br />
Vergleich der automatisierten<br />
Modellkalibrierung bei Optimierung<br />
auf eine Zielfunktion und<br />
zweier Ansätze der multikriteriellen<br />
Optimierung zeigte, dass mit multikriterieller<br />
Optimierung eine höhere<br />
Qualität der Ergebnisse in der<br />
Modellvalidierung erreicht werden<br />
kann. Dabei führten beide Ansätze<br />
der multikriteriellen Optimierung<br />
zu gleich guten Ergebnissen. Drei<br />
Schmutzfrachtmodelle wurden verglichen<br />
und deren Anwendbarkeit<br />
für die Fallstudie diskutiert.<br />
Zusammenfassend liefert die<br />
vorgeschlagene Methodik wertvolle<br />
neue Einsichten und zufrieden stellende<br />
Ergebnisse für die Fallstudie<br />
und kann auch einfach auf andere<br />
Fallbeispiele übertragen und angewendet<br />
werden. Auch die praxisbezogene<br />
Anwendung der vorgestellten<br />
Methoden kann nur empfohlen<br />
werden. Nichtsdestotrotz wird<br />
angeraten, die Methoden mit<br />
Bedacht anzuwenden und die<br />
Ergebnisse kritisch zu hinterfragen.<br />
Gerade die Anwendung von komplexen<br />
Methoden verleitet zu übermäßigem<br />
Vertrauen in die Ergebnisse,<br />
auch wenn sie dem Ingenieursverständnis<br />
widersprechen.<br />
Ausgewählte Veröffentlichungen<br />
Gamerith, V.: High resolution online data in<br />
sewer water quality modelling.<br />
Schriftenreihe zur <strong>Wasser</strong>wirtschaft ,<br />
Technische Universität Graz, Band 64<br />
(2011). Verlag der Technischen Universität<br />
Graz, Graz, Österreich.<br />
Gamerith, V., Gruber, G. and Muschalla, D.:<br />
Single and Multievent Optimization<br />
in Combined Sewer Flow and Water<br />
Quality Model Calibration. Journal of<br />
Environmental Engineering 137<br />
(2011) 7, S. 551–558.<br />
Gamerith, V., Muschalla, D., Veit, J. and<br />
Gruber, G.: Online Monitoring of<br />
Combined Sewer Systems: Experiences<br />
and Application in Modeling. –<br />
in: Cognitive Modeling of Urban<br />
Water Systems, Monograph 19<br />
(2011), S. 167–183.<br />
Gamerith, V., Muschalla, D., Gruber, G. und<br />
Kainz, H.: Schmutzfrachtmodellierung<br />
auf Basis zeitlich hochaufgelöster<br />
Messdaten. – in: Schriftenreihe<br />
zur <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Technische<br />
Universität Graz, Band 62: Aqua<br />
Urbanica 2011 – Niederschlags und<br />
Mischwasserbewirtschaftung im<br />
urbanen Bereich. (2011), S. K1–K25.<br />
Gamerith, V., Neumann, M. B. and Muschalla,<br />
D.: Applied Global Sensitivity Analysis<br />
in Sewer Flow and Water Quality<br />
Modelling. 12th International Conference<br />
on Urban Drainage Proceedings<br />
(2011).<br />
Gamerith, V., Steger, B., Hochedlinger, M. and<br />
Gruber, G.: Assessment of UV/VISspectrometry<br />
performance in combined<br />
sewer monitoring under wet<br />
weather conditions. 12th International<br />
Conference on Urban Drainage<br />
Proceedings (2011).<br />
Gamerith, V., Muschalla, D., Könemann, P.<br />
and Gruber, G.: Pollution load modelling<br />
in sewer systems: an approach<br />
of combining long term online sensor<br />
data with multi-objective autocalibration<br />
schemes. Water Science<br />
& Technology 59 (2009) 1, S. 73–79.<br />
Dezember 2011<br />
1162 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Recht und Regelwerk<br />
Ankündigung eines neuen Projektkreises<br />
und „Call for experts“<br />
Auf Beschluss des Technischen Komitees 3.6 entsteht zurzeit ein neuer Projektkreis<br />
W-PK-3-6-9 „Dicht-, Hilfs- und Betriebsstoffe“<br />
Die Hauptaufgabe des PK wird<br />
sein, hygienische Aspekte der<br />
genannten Stoffe zu klären und<br />
festzulegen.<br />
Im Fokus der Arbeiten werden<br />
zunächst die Regelwerke DVGW<br />
W 521 „Gewindeschneidstoffe für<br />
die Trinkwasserinstallation – Anforderungen<br />
und Prüfung“ (1995),<br />
DVGW VP 402 „Dichtmittel für<br />
metallene Gewindeverbindungen<br />
der Gas- und <strong>Wasser</strong>installation“<br />
(1999) sowie DIN 30660 „Dichtmittel<br />
für die Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
sowie für <strong>Wasser</strong>heizungsanlagen“<br />
(1999) stehen. Sie werden<br />
auf Aktualität hin überprüft und<br />
überarbeitet. Im Hinblick auf Dichtheitsprüfungen<br />
von Trinkwasserinstallationen<br />
mit Luft wird das<br />
Gremium sich mit der DIN EN<br />
14291:2004 „Schaumbildende<br />
Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen“<br />
befassen und deren<br />
Anwendbarkeit im Trinkwasserbereich<br />
prüfen und diskutieren.<br />
Der DVGW möchte Experten <strong>aus</strong><br />
dem beschriebenen Fachgebiet<br />
sowie Hersteller dazu aufrufen, sich<br />
an der Arbeit in diesem Projektkreis<br />
zu beteiligen. Interessenten sind<br />
herzlich eingeladen.<br />
Rückmeldungen an<br />
Frau Stoppel,<br />
E-Mail: stoppel@dvgw.de<br />
Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
W 1001-B1: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Risikomanagement<br />
im Normalbetrieb – Beiblatt 1: Umsetzung für <strong>Wasser</strong>verteilungsanlagen, 11/2011<br />
Mit dem Hinweis W 1001 „Sicherheit<br />
in der Trinkwasserversorgung<br />
– Risikomanagement im Normalbetrieb“<br />
vom August 2008 hat<br />
der DVGW Neuland betreten. Bis<br />
dahin hatte man sich weitestgehend<br />
darauf beschränkt, technisch verantwortliches<br />
Handeln möglichst handfest<br />
zu beschreiben – genau diese<br />
und jene Anforderungen muss das<br />
Bauteil, das Bauwerk, die Bauweise,<br />
das Baupersonal etc. erfüllen. Selbstverständlich<br />
sind diese vertrauten<br />
technischen Regeln nach wie vor die<br />
Grundlage, um Risiken zu beherrschen<br />
– die meisten Anforderungen<br />
dienen ganz oder teilweise der<br />
Abwehr oder Vermeidung bestimmter<br />
Risiken (z. B. in Bezug auf<br />
Beeinträch tigungen der Trinkwasserqualität,<br />
sonstige Schäden oder<br />
Störungen, Arbeitsunfälle).<br />
In diesem Sinne enthält W 1001<br />
im Abschnitt 5.4.2 folgende Feststellung:<br />
„Fragen nach der grundsätzlichen<br />
Eignung von technischen<br />
Verfahren oder Festlegungen zur<br />
Beherrschung identifizierter Risiken<br />
werden größtenteils im DVGW-<br />
Regelwerk behandelt. Dort werden<br />
die Vorgehensweise und Ausführung<br />
von technischen Verfahren,<br />
Abläufen und Prozessen in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung beschrieben und<br />
Maßnahmen zur Minimierung von<br />
Risiken empfohlen. Ferner sind<br />
Angaben zu Sollzuständen, Messverfahren<br />
und -häufigkeiten enthalten.<br />
Technische Maßnahmen, die in<br />
Technischen Regeln des DVGW<br />
erörtert werden, sind somit als prinzipiell<br />
geprüft (basisvalidiert) anzusehen.<br />
In diesen Fällen ist es <strong>aus</strong>reichend,<br />
wenn der <strong>Wasser</strong>versorger<br />
die Maßnahmen zur Risikobeherrschung<br />
gemäß den Technischen<br />
Regeln für das Versorgungssystem<br />
fachgerecht umsetzt und deren<br />
Wirksamkeit überwacht.“<br />
Wer also gemäß den jeweils<br />
aktuellen technischen Regeln des<br />
DVGW konsequent<br />
""<br />
Anforderungen (Formulierungen<br />
mit „muss“ etc.) einhält,<br />
""<br />
Empfehlungen (Formulierungen<br />
mit „sollte“ etc.) einhält,<br />
""<br />
Hinweise (Formulierungen mit<br />
„darf“, „kann“ etc.) beachtet,<br />
""<br />
zertifizierte Bauteile und<br />
Dienstleister einsetzt und<br />
""<br />
die Umsetzung der obigen<br />
Punkte durch Kontrollen<br />
sicherstellt,<br />
fährt auf sicherer Spur, sollte aber<br />
zusätzlich in Bezug auf folgende<br />
Aspekte aufmerksam bleiben:<br />
1. Es gibt immer Risiken, die man in<br />
der bisherigen Regelsetzung noch<br />
nicht bedacht hat oder die aufgrund<br />
ihrer Seltenheit bzw.<br />
besonderen Art keine Berücksichtigung<br />
gefunden haben. Regelsetzung<br />
bedeutet auch immer einen<br />
mehr oder weniger aufwendigen<br />
Prozess vom erstmaligen Erkennen<br />
eines be stimmten Risikos<br />
über die Diskussion und Bewertung<br />
in der Fachwelt bis hin zur<br />
<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1163
Recht und Regelwerk<br />
Entwicklung allgemein anerkannter<br />
Gegenmaßnahmen und deren<br />
Fest legung z. B. in neuen Arbeitsblättern.<br />
Insofern ist es empfehlenswert,<br />
zusätzlich zur Umsetzung<br />
des Regelwerkes die Entwicklung<br />
über<br />
DVGW-Rundschreiben und Fachpresse<br />
im Hinblick auf die eigenen<br />
Verhältnisse zu verfolgen.<br />
2. Eingriffe Dritter (Baumaßnahmen<br />
u. a.) sind immer möglich.<br />
Man nehme z. B. ein Gewerbegebiet,<br />
das über eine Anschlussleitung<br />
querfeldein versorgt wird.<br />
Nun wird auf dem betreffenden<br />
Feld ein Parkplatz mit Asphaltdecke<br />
(mit der Folge höherer<br />
Bodenerwärmung im Sommer)<br />
oder eine Umgehungstraße (mit<br />
dem Risiko von der Fahrspur<br />
abkommender Gefahrguttransporter)<br />
errichtet. Die gewissenhafte<br />
Einhaltung der technischen<br />
Regeln zum Zeitpunkt des<br />
Leitungsb<strong>aus</strong> und eine routinemäßige<br />
Betriebsüberwachung<br />
greifen für solche Veränderungen<br />
zu kurz.<br />
3. Nicht zuletzt eilt der technische<br />
Fortschritt der technischen<br />
Regelsetzung vor<strong>aus</strong> – die Industrie<br />
aber braucht Anwender, die<br />
bereit sind, Neues <strong>aus</strong>zuprobieren.<br />
In solchen Fällen sind mögliche<br />
Risiken durch den Anwender<br />
gesondert zu ermitteln und zu<br />
bewerten, ggf. sind notwendige<br />
Maßnahmen abzuleiten.<br />
Es bleibt also eine Lücke zwischen<br />
„konventioneller“ Regelsetzung<br />
H2.0<br />
News, Forum, Lexikon –<br />
das neue Portal rund ums <strong>Wasser</strong>:<br />
wasserwelt.com<br />
<strong>Wasser</strong>welt_M2_<strong>gwf</strong>_41x36_1012.indd 1 11.11.11 10:43<br />
und diversen „Restrisiken“. Und<br />
außerdem ist da noch die ganz<br />
banale Kluft zwischen Theorie und<br />
Praxis der Regeleinhaltung, z. B.<br />
infolge von Gewohnheit. Hier setzt<br />
W 1001 an. Allerdings deckt W 1001<br />
die gesamte Versorgungskette vom<br />
Trinkwasserschutz im Einzugsgebiet<br />
bis zur Zapfstelle ab und bleibt<br />
im Hinblick auf konkrete Handlungsansätze<br />
sehr vage. Für <strong>Wasser</strong>verteilungsanlagen<br />
wird deshalb<br />
das vorliegende Beiblatt nun konkreter<br />
und anschaulicher.<br />
Der Ausgangspunkt für das Risikomanagement<br />
nach W 1001 ist<br />
eine Beschreibung des Versorgungssystems<br />
– denn nur was ich<br />
kenne und verständlich beschreiben<br />
kann, kann ich auch sinnfällig in<br />
Bezug auf mögliche Gefährdungen<br />
und Schadens<strong>aus</strong>maße analysieren<br />
und bewerten. So zeigt das Beiblatt<br />
beispielhafte Inhalte zur Beschreibung<br />
eines <strong>Wasser</strong>verteilungssystems<br />
auf. Sodann enthält es eine<br />
beispielhafte Auflistung möglicher<br />
Gefährdungen und ein Beispiel für<br />
ein mögliches Vorgehen zur Umsetzung<br />
des Risikomanagements für<br />
<strong>Wasser</strong>verteilungsanlagen anhand<br />
folgender Schritte:<br />
""<br />
Gefährdungsanalyse –<br />
Gefährdungspotenzial,<br />
vorhandene Regelwerksbezüge,<br />
mögliche Auswirkungen,<br />
bestehende Maßnahmen<br />
""<br />
Risikoabschätzung –<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit,<br />
Schadens <strong>aus</strong>maß, Risikoklasse<br />
""<br />
Risikobeherrschung –<br />
Handlungsbedarf (zusätzliche<br />
Maßnahmen, Überwachung)<br />
Letztlich sollte die Umsetzung in<br />
einen ständigen Prozess münden,<br />
mit dem man auf der Höhe der Zeit<br />
bleibt.<br />
Preis:<br />
€ 15,97 für Mitglieder,<br />
€ 21,29 für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
wvgw Wirtschafts- und<br />
Verlagsgesellschaft Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3, D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9191-40, Fax (0228) 9191-499,<br />
www.wvgw.de<br />
Ankündigung zur Fortschreibung<br />
des DVGW-Regelwerks<br />
Ankündigung zur Erarbeitung von Regel werken gemäß GW 100<br />
""<br />
GW 337-B1: Beiblatt 1 zu<br />
DVGW-Prüfgrundlage GW 337 –<br />
Rohre, Formstücke und<br />
Zubehörteile <strong>aus</strong> duktilem<br />
Gusseisen für die Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung: Anforderungen<br />
und Prüfungen<br />
""<br />
W 573 VP: Steinfänger in der<br />
Trinkwasser-Installation – Anforderungen<br />
und Prüfungen<br />
""<br />
W 576 VP: Thermostatmischer in<br />
der Trinkwasser Installation –<br />
Anforderungen und Prüfungen<br />
Dezember 2011<br />
1164 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Recht und Regelwerk<br />
Ankündigung zur Überarbeitung von Regelwerken gemäß GW 100<br />
""<br />
W 521: Gewindeschneidstoffe<br />
für die Trinkwasserinstallation;<br />
Anforderungen und Prüfungen<br />
""<br />
VP 402: Dichtmittel für metallene<br />
Gewindeverbindungen der<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>installation<br />
Bei Interesse und Rückfragen:<br />
Deutscher Verein des Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>faches e.V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
Josef-Wirmer-Straße 1–3,<br />
D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 91 88-5,<br />
Fax (0228) 91 88-990,<br />
E-Mail: info(at)dvgw.de,<br />
www.dvgw.de<br />
Vorhabensbeschreibung<br />
Überarbeitung des Merkblattes DWA-M 149-2 „Zustandserfassung und -beurteilung<br />
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden; Teil 2: Kodiersystem<br />
für die optische Inspektion“<br />
Das Merkblatt DWA-M 149-2 soll<br />
– zur Abstimmung auf die<br />
DIN EN 13508 Teil 2 + A1 „Untersuchung<br />
und Beurteilung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von<br />
Gebäuden – Teil 2: Kodiersystem für<br />
die optische Inspektion; Deutsche<br />
Fassung EN 13508-2:2003+A1:2011“<br />
– durch die Arbeitsgruppe ES-8.1<br />
„Zustandserfassung und -bewertung<br />
von <strong>Abwasser</strong>leitungen und<br />
-kanälen außerhalb von Gebäuden“<br />
überarbeitet werden. Im Sinne eines<br />
durchgängigen Arbeitsablaufes bei<br />
der Zustandserfassung und -bewertung<br />
wird das Merkblatt auf die<br />
europäischen Normen zur Zustandserfassung<br />
abgestimmt und ist überwiegend<br />
als nationale Ergänzung zur<br />
DIN EN 13508-2 zu verstehen.<br />
Das Merkblatt wird von der<br />
Arbeitsgruppe ES 8.1 „Zustandserfassung<br />
und -bewertung von<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen und -kanälen<br />
außerhalb von Gebäuden“ (Sprecher:<br />
Dr.-Ing. Martin Keding) im<br />
Fach<strong>aus</strong>schuss ES-8 „Zustandserfassung<br />
und Sanierung“ (Obmann: Dr.-<br />
Ing. Chrisitan Falk) überarbeitet.<br />
Überarbeitung des Merkblattes DWA-M 143-9 „Sanierung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden; Teil 9: Renovierung von <strong>Abwasser</strong>leitungen und -kanälen<br />
durch Wickelrohrverfahren“<br />
Anlass zur Überarbeitung des<br />
Merkblattes DWA-M 143-9<br />
„Sanierung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden;<br />
Teil 9: Renovierung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen durch<br />
Wickelrohrverfahren“ bilden neue<br />
Entwicklungen, die sich gegenüber<br />
dem Stand der Technik bei der<br />
Erstellung des derzeit gültigen<br />
Merkblattes ergeben haben. Insbesondere<br />
sind dies Entwicklungen,<br />
die sich unter Verwendung von<br />
selbstfahrenden Wickelmaschinen<br />
im Rohr sowie der dabei zur Anwendung<br />
kommenden Werkstoffe und<br />
Profile, ergeben haben. Es liegen<br />
seit Veröffentlichung des Merkblattes<br />
zusätzliche, umfangreiche Erfahrungen<br />
in Deutschland sowie weltweit<br />
vor, welche sich in der Überarbeitung<br />
niederschlagen sollen.<br />
Ferner soll die Möglichkeit einer<br />
Sanierung unter Aufrechterhaltung<br />
Wissensdurst<br />
stillt man auf<br />
wasserwelt.com<br />
News, Forum, Lexikon – das<br />
neue Portal rund ums <strong>Wasser</strong>.<br />
<strong>Wasser</strong>welt_M3_<strong>gwf</strong>_41x36_1012.indd 1 11.11.11 10:43<br />
der Vorflut unter verfahrenstechnischen<br />
und Sicherheitsaspekten<br />
erörtert und ggf. aufgenommen<br />
werden.<br />
Die Überarbeitung des Merkblattes<br />
wird neben der Berücksichtigung<br />
neuer Entwicklungen sowie<br />
dem veränderten Stand der Europäischen<br />
Normung auch die neue<br />
Gliederung der Merkblätter der<br />
Merkblattreihe DWA-M 143 „Sanierung<br />
von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden“ berücksichtigen.<br />
Diese beinhaltet neben<br />
der einheitlichen Gliederung der<br />
Merkblätter auch die Integration<br />
weitergehender Angaben zur Qualitätssicherung.<br />
Das Merkblatt wird durch die<br />
Arbeitsgruppe ES-8.5 „Auskleidung<br />
von <strong>Abwasser</strong>leitungen und -kanälen<br />
mit örtlich hergestellten Rohren“<br />
im FA ES-8 „Zustandserfassung<br />
und Sanierung“ (Obmann: Dr.-Ing.<br />
Christian Falk) überarbeitet.<br />
Der Bearbeitungszeitraum ist<br />
von Anfang 2012 bis Ende 2013<br />
geplant.<br />
Hinweise für die Bearbeitung:<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle,<br />
Dipl.-Ing. Christian Berger,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-126, Fax (02242) 872-184,<br />
E-Mail: berger@dwa.de<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1165
FachberichtE ATT Symposium<br />
40 Jahre Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren<br />
Grußwort zum ATT Symposium<br />
Jürgen Alth<strong>aus</strong><br />
Herzlich willkommen im H<strong>aus</strong>e Patmos im Siegerland. Als erster stellvertretender Landrat des Kreises Siegen-<br />
Wittgenstein darf ich Sie ganz herzlich im Namen von Kreistag und Kreisverwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein<br />
begrüßen; ich tue dies auch im Namen von unserem Landrat, Paul Breuer, der ja Verbandsvorsteher<br />
unseres <strong>Wasser</strong>verbandes Siegen-Wittgenstein ist.<br />
Jürgen Alth<strong>aus</strong>.<br />
„40 Jahre Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren“<br />
ist sicherlich ein<br />
guter Anlass zur Veranstaltung<br />
eines Expertensymposiums. Ich<br />
freue mich sehr, dass Sie den Kreis<br />
Siegen-Wittgenstein als Tagungsort<br />
für diese Veranstaltung <strong>aus</strong>gewählt<br />
haben. Bei so viel versammeltem<br />
Fachwissen werde ich mich davor<br />
hüten, in die Tiefen der Trinkwasserversorgung<br />
<strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong> vorzustoßen.<br />
Da ist Ihre Kompetenz deutlich<br />
größer als meine. Stattdessen<br />
möchte ich Ihnen unseren Kreis<br />
Siegen-Wittgenstein und unsere<br />
Region Südwestfalen vorstellen und<br />
ein wenig schmackhaft machen.<br />
Wald, <strong>Wasser</strong>, Eisen und Stahl<br />
prägen unsere Ge schichte, aber auch die Gegenwart.<br />
Wir sind eine der ältesten Industrieregionen Europas.<br />
Die ersten Spuren des Bergb<strong>aus</strong> stammen <strong>aus</strong> der Zeit<br />
der Kelten. In Wilnsdorf-Obersdorf gibt es einen Ofen<br />
<strong>aus</strong> der Zeit um 500 vor Christus. Mit der Zeit hat sich<br />
der Bergbau verändert. Ab etwa dem 10. Jahrhundert<br />
wurde mit dem Stollenbau begonnen, der Schachtbau<br />
folgte erst im 15. Jahrhundert.<br />
Das in den Bergwerken geförderte Eisenerz wurde<br />
oft im selben Ort zu Stahl und Eisen verarbeitet. <strong>Wasser</strong><br />
war für uns hier in Siegen-Wittgenstein immer sehr<br />
wichtig, sowohl zur Versorgung der Menschen als auch<br />
für gewerbliche und industrielle Zwecke. Ob früher zum<br />
Betrieb der Hammerwerke oder zur Eisenverhüttung,<br />
<strong>Wasser</strong> wurde stets gebraucht. Ein alter Siegerländer<br />
Wahlspruch lautet: „Ha m`r <strong>Wasser</strong>, da drenke m`r Wing.<br />
Ha m`r kei <strong>Wasser</strong>, drenke m`r <strong>Wasser</strong>“.<br />
Im klassischen hochdeutsch heißt das: „Haben wir<br />
<strong>Wasser</strong>, trinken wir Wein. Haben wir kein <strong>Wasser</strong>, trinken<br />
wir <strong>Wasser</strong>.“ Sie zucken sicherlich zusammen, denn diese<br />
Aussage löst zunächst Verwunderung <strong>aus</strong>, aber es ist<br />
tatsächlich so, dass wenn genügend <strong>Wasser</strong> vorhanden<br />
war, die Mühlen und Hammerwerke laufen konnten,<br />
sodass Geld verdient wurde und die Menschen ihr Auskommen<br />
hatten. Bei fehlendem <strong>Wasser</strong> war das Gegenteil<br />
der Fall.<br />
Dieser Spruch zeigt auch, wie abhängig unsere Region<br />
vom jeweiligen Niederschlagsgeschehen war. Obwohl<br />
man das Siegerland mit über 1000 mm Niederschlag/<br />
Jahr wahrlich nicht als niederschlagsarm bezeichnen<br />
kann, haben die Jahreszeiten mit den stark unterschiedlichen<br />
Niederschlägen, die Morphologie mit relativ schnellen<br />
Abflüssen und die Geologie mit dem sehr geringen<br />
Speicherungsvermögen von <strong>Wasser</strong> im Untergrund<br />
immer wieder zu Zeiten mit <strong>Wasser</strong>mangel geführt.<br />
Aufgrund dieser Rahmenbedingung entstanden im<br />
Siegerland und auch in Wittgenstein unzählige, kleinere<br />
Gewinnungsanlagen für die Versorgung mit Trink- und<br />
Brauchwasser. Aber gerade viele dieser dezentralen<br />
Anlagen hatten oftmals gerade dann, wenn <strong>Wasser</strong> zu<br />
verknappen drohte, auch ihre Probleme. Daher blieb für<br />
eine sichere Versorgung des Kreisgebietes nur die Möglichkeit<br />
der Oberflächenwasserspeicherung.<br />
Diese Aufgabe wurde in die Hände des 1953 gegründeten<br />
<strong>Wasser</strong>verbandes Siegen-Wittgenstein (damals<br />
noch <strong>Wasser</strong>verband Siegerland) gelegt. Unser <strong>Wasser</strong>verband<br />
betreibt die Obernautalsperre mit einem Volumen<br />
von 14,8 Mio. m³ und die Breitenbachtalsperre mit<br />
7,8 Mio. m³; <strong>Talsperren</strong>, die für unsere Heimat existenzund<br />
lebenswichtig sind. Seine Mitglieder sind in Siegen-<br />
Wittgenstein Kommunen und der Kreis. Aber über den<br />
<strong>Wasser</strong>verband wird Ihnen unser Geschäftsführer, Herr<br />
Müller, Weiteres und Genaueres berichten. Bis heute ist<br />
Siegen-Wittgenstein eine der führenden Industrieregionen<br />
Deutschlands – vor allem im Maschinenbau und<br />
der Metallverarbeitung.<br />
Bei uns arbeiten heutzutage mehr Menschen im produzierenden<br />
Gewerbe als zum Beispiel im Ruhrgebiet.<br />
Dezember 2011<br />
1166 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Viele dieser mittelständischen Unternehmen sind Weltmarktführer<br />
in ihren Branchen. Zugleich sind wir aber<br />
auch der waldreichste Kreis Deutschlands, mit einem<br />
Waldanteil von über 70 Prozent. Neben dem Staatswald<br />
gibt es bei uns viel genossenschaftlichen Waldbesitz,<br />
aber auch große private Waldbesitzer. Der bedeutendste<br />
ist sicher das Fürstenh<strong>aus</strong> zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg<br />
in Bad Berleburg.<br />
In der Vergangenheit wurde der Rohstoff Holz bei<br />
uns zwar auch schon genutzt, die Wertschöpfung fand<br />
aber überwiegend außerhalb des Kreisgebietes statt.<br />
Jetzt ist es unser Ziel, eine höhere Wertschöpfung <strong>aus</strong><br />
unserem Holzreichtum in der Region zu generieren, vor<br />
allem im Bereich der CO 2 -neutralen Energieerzeugung.<br />
So hat RWE erst vor wenigen Monaten als Pilotanlage<br />
für Nordrhein-Westfalen ein Biomasseheizkraftwerk<br />
hier bei uns im Kreisgebiet in Betrieb genommen.<br />
Angeschlossen ist eine Pelletfabrik. Beide Anlagen<br />
stehen im Industriepark Wittgenstein. Wir sehen die<br />
Chance, dort mittelfristig weitere Bioenergieunternehmen<br />
anzusiedeln. Die Forstverantwortlichen sorgen für<br />
eine gesunde, nachhaltige Waldwirtschaft. Ohne diese<br />
funktionierende Partnerschaft wäre sicher die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
in unseren zu mehr als 90 % bewaldeten <strong>Talsperren</strong>einzugsgebieten<br />
erheblich beeinträchtigt.<br />
Mit diesem intakten, natürlichen Einzugsgebiet wird<br />
in den <strong>Wasser</strong>schutzgebieten die Vor<strong>aus</strong>setzung für<br />
gutes Rohwasser geschaffen. Getreu dem Motto „Was<br />
nicht rein kommt, muss man auch nicht mit aufwändiger<br />
Technik bzw. teurem Geld wieder her<strong>aus</strong> holen.“<br />
Eine Bewaldung des Einzugsgebietes ist sicher einer<br />
urbanen Nutzung vorzuziehen. Jegliche anthropogene<br />
Belastung kann kritisch sein.<br />
Wir setzen hier auf Nachhaltigkeit, sowohl in der<br />
<strong>Wasser</strong>- als auch der Forstwirtschaft.<br />
Unsere waldreiche Mittelgebirgslandschaft ist auch<br />
touristisch ein Pfund, mit dem wir wuchern können. So<br />
haben wir mit dem Rothaarsteig einen Premium-Fernwanderweg,<br />
der jedes Jahr über eine Million Wanderer<br />
in die Region bringt. Der Tourismus nimmt bei uns stetig<br />
an Bedeutung zu. Dabei setzen wir nicht auf einen<br />
Massentourismus.<br />
„Wandern und aktiv Natur erleben“ ist unsere touristische<br />
Kernkompetenz. Zurzeit macht Siegen-Wittgenstein<br />
mit einem einzigartigen Naturprojekt von sich<br />
reden: der Wiederansiedlung von frei lebenden Wisenten.<br />
Wisente sind die europäischen Verwandten des<br />
amerikanischen Bisons. Sie sind die größten Landsäugetiere<br />
in Europa. Anfang des letzten Jahrhunderts waren<br />
Wisente bis auf ganz wenige Tiere in einigen Zoos fast<br />
<strong>aus</strong>gestorben.<br />
Inzwischen gibt es in Ostpolen und Weißrussland<br />
wieder frei lebende Herden. Wir siedeln hier bei uns in<br />
Siegen-Wittgenstein erstmals wieder in Mittel- und<br />
Westeuropa frei lebende Wisente an. Die Tiere sind<br />
bereits hier und leben derzeit in einem Eingewöhnungsgehege.<br />
Mittelfristig wird die Herde dann freigesetzt<br />
und kann in einem etwa 4000 ha großen Projektgebiet<br />
frei leben.<br />
Dieses Projekt wird vom Bundesumweltministerium<br />
und vom Land NRW unterstützt und findet auch international<br />
große Beachtung. Mit einem Erlebnisschaugehege,<br />
ohne Gitter oder sonstige Barrieren, werden<br />
Besucher ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit<br />
haben, Wisente in ihrer natürlichen Umgebung zu<br />
beobachten. Es handelt sich dabei dann nicht um die<br />
frei lebende Herde. Diese Tiere sind so scheu, dass sie<br />
wohl kaum jemals ein Wanderer zu Gesicht bekommen<br />
wird.<br />
Deshalb bauen wir das Erlebnisschaugehege, quasi<br />
als Guckloch in die Wisent-Wildnis, um die beeindruckenden<br />
Tiere auch für Besucher erlebbar zu machen.<br />
Ich könnte noch vieles über unsere Region berichten:<br />
zum Beispiel, dass der Barockmaler Peter Paul<br />
Rubens in Siegen geboren wurde und einige seiner<br />
Gemälde im Oberen Schloss in Siegen zu sehen sind,<br />
oder dass Siegen-Wittgenstein mit der Philharmonie<br />
Südwestfalen über ein eigenes symphonisches Orchester<br />
verfügt, dass vor drei Jahren mit dem Apollo-Theater<br />
in Siegen erstmals in Deutschland überhaupt wieder ein<br />
neues Theater eröffnet worden ist oder dass wir mit<br />
KulturPur jedes Jahr über Pfingsten ein hochkarätiges<br />
internationales Kulturfestival in einer Zeltstadt mitten<br />
im Wald auf einem Berg veranstalten – und das nun<br />
schon seit 20 Jahren.<br />
Aber, ich will zum Schluss kommen und einfach nur<br />
sagen: Vielleicht haben Sie mal Lust, auch nach dieser<br />
Tagung mal wieder zu uns zu kommen. Es lohnt sich,<br />
sowohl für Wander- und Naturfreunde als auch für<br />
Kulturinteressierte oder Städtetouristen.<br />
An dieser Stelle möchte ich mich bei der Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren bedanken für den<br />
großen Nutzen, den unser <strong>Wasser</strong>verband <strong>aus</strong> der partnerschaftlichen<br />
Zusammenarbeit in den beständigen<br />
Arbeitskreisen und dem Fach<strong>aus</strong>schuss gezogen hat,<br />
sodass sicherlich die ATT viel dazu beigetragen hat, dass<br />
wir heute da stehen, wo wir jetzt sind. Und wir können<br />
sagen, dass wir auch in Zukunft unseren Bürgern qualitativ<br />
hochwertiges Trinkwasser in <strong>aus</strong>reichender<br />
Menge zur Verfügung stellen können.<br />
Autor<br />
Jürgen Alth<strong>aus</strong><br />
1. Stellvertretender Landrat<br />
Kreis Siegen-Wittgenstein |<br />
Koblenzer Straße 73 |<br />
D-57072 Siegen<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1167
FachberichtE ATT Symposium<br />
40 Jahre Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren<br />
<strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein beim ATT Symposium<br />
am Dienstag, dem 23. November 2010 in Siegen<br />
Dirk Müller<br />
Vor 40 Jahren, am 23. November 1970, wurde die Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren von Vertretern<br />
<strong>aus</strong> acht <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen in Siegburg gegründet. Der <strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein war<br />
eines dieser Gründungsunternehmen. Das <strong>Wasser</strong> <strong>aus</strong> unseren Trinkwassertalsperren hat einen erheblichen<br />
Stellenwert in unserer Region.<br />
Entwicklung des <strong>Wasser</strong>verbandes<br />
Siegen-Wittgenstein<br />
Am 09. September 1953 wurde der <strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein<br />
(WVS) – damals <strong>Wasser</strong>verband Siegerland<br />
– gegründet. Er erstreckte sich auf den Raum<br />
Bild 1. Versorgungsgebiet mit Kreisgrenzen. Lahn, Eder und Sieg bilden<br />
das Flusssystem rund um das Rothaargebirge.<br />
Hilchenbach – Kreuztal – Freudenberg. Mitglieder<br />
waren seinerzeit 51 Städte und Gemeinden sowie der<br />
Landkreis Siegen. Die erste Aufgabe des Verbandes<br />
war der Bau der Breitenbachtalsperre mit dem dazugehörenden<br />
Transportleitungsnetz. Am 05. September<br />
1956 lieferte die Aufbereitungsanlage der Breitenbachtalsperre<br />
bereits das erste Trinkwasser.<br />
Der steigende <strong>Wasser</strong>bedarf sowie die Trockenjahre<br />
1957 und 1959 machten deutlich, dass eine sichere<br />
Trinkwasserversorgung nur großräumig möglich ist.<br />
1961 traten die Städte Siegen, Weidenau und die<br />
Gemeinde Eiserfeld dem <strong>Wasser</strong>verband bei. Damit war<br />
die wirtschaftliche Grundlage für Planung und Bau der<br />
Obernautalsperre gegeben, die in der Zeit von 1967 bis<br />
1971 realisiert wurde. Bis zum Ende der 60er Jahre<br />
wurden auch die übrigen Kommunen des damaligen<br />
Kreises Siegen Verbandsmitglieder.<br />
1972/73 schlossen sich die Städte Bad Berleburg,<br />
Bad Laasphe und der <strong>Wasser</strong>beschaffungsverband<br />
Erndtebrück dem <strong>Wasser</strong>verband an und damit der<br />
größte Teil des damaligen Kreises Wittgenstein. Mit der<br />
Gebietsreform von 1975 wurde das Versorgungsgebiet<br />
des <strong>Wasser</strong>verbandes deckungsgleich mit dem Kreisgebiet<br />
des Kreises Siegen-Wittgenstein (Bild 1). Der Name<br />
des Verbandes wurde ab 2001 geändert in <strong>Wasser</strong>verband<br />
Siegen-Wittgenstein.<br />
Aufgaben des Verbandes<br />
Satzungsgemäß hat der Verband die Aufgaben, seinen<br />
Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu beschaffen<br />
und bereitzustellen, Gewinnungsanlagen für Oberflächen-<br />
und Grundwasser zu bauen, zu erwerben und<br />
zu betreiben, Niedrigwasser durch Zuschusswasser <strong>aus</strong><br />
den <strong>Talsperren</strong> zu erhöhen und den Grundwasserstrom<br />
anzureichern sowie zum Hochwasserschutz regelnd<br />
beizutragen.<br />
Dezember 2011<br />
1168 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Staatliche Aufsicht<br />
Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch die<br />
Aufsichtsbehörde. Aufsichtsbehörde und zugleich obere<br />
Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg.<br />
Oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Klimaschutz,<br />
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.<br />
Trinkwassergewinnung<br />
Jährlich wird im Siegerland und in Wittgenstein eine<br />
Trinkwassermenge von etwa 16 Mio. m 3 benötigt. Um<br />
diese Quantität bereitstellen zu können, stehen dem<br />
<strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein die Obernautalsperre,<br />
die Breitenbachtalsperre, das Grundwasserwerk<br />
Siegtal sowie weitere Grundwassergewinnungsanlagen<br />
zur Verfügung. Rund 85 % der benötigten Trinkwassermenge<br />
liefern die beiden <strong>Talsperren</strong>. In der Anlage<br />
Dreis-Tiefenbach (Obernautalsperre) werden jährlich<br />
zudem bis zu 2 Mio. m 3 <strong>Wasser</strong> <strong>aus</strong> dem Grundwasserwerk<br />
Siegtal aufbereitet (Bild 2).<br />
Neben diesen drei Hauptgewinnungsanlagen<br />
betreibt der <strong>Wasser</strong>verband weitere Gewinnungsanlagen<br />
in Bad Berleburg, Bad Laasphe, Siegen, Burbach,<br />
Erndtebrück und Wilnsdorf.<br />
Von der Quelle bis zum <strong>Wasser</strong>hahn<br />
Bis das saubere Trinkwasser <strong>aus</strong> dem <strong>Wasser</strong>hahn<br />
kommt, muss es mitunter einen weiten Weg mit vielen<br />
Stationen durchlaufen. Zur Verteilung des <strong>Wasser</strong>s<br />
betreibt der <strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein ein<br />
Transportleitungsnetz von rund 308 km Länge. 27 Hochbehälter<br />
mit einem Gesamtinhalt von 52 218 m 3 dienen<br />
als Speicher. Da wir in einer Mittelgebirgsregion leben,<br />
sind für die Beförderung des <strong>Wasser</strong>s zusätzlich<br />
27 Pumpwerke erforderlich (Bild 3).<br />
Bild 2. <strong>Talsperren</strong> des <strong>Wasser</strong>verbandes Siegen-Wittgenstein:<br />
Ober nautalsperre, AB Dreis-Tiefenbach, Breitenbachtalsperre<br />
mit AB, Veranstaltungsort/Nähe Hauptring im Langenbachtal<br />
TL 40/5.<br />
27 Druckerhöhungsstationen/PW<br />
Aufbereitungsanlage<br />
Breitenbach<br />
Obernau- und<br />
Breitenbachtalsperre<br />
Verwaltungsgebäude<br />
und<br />
Betriebshof<br />
70 Mitarbeiter<br />
16,0 Mio m 3<br />
161 Trinkwasserübergabestellen<br />
27 Verbandshochbehälter<br />
Die Obernautalsperre – größte<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnungsanlage des Verbandes<br />
Die Obernautalsperre ist der größere der beiden<br />
St<strong>aus</strong>een des <strong>Wasser</strong>verbandes Siegen-Wittgenstein<br />
und hat ein Fassungsvermögen von 14,9 Mio. m 3 . Das<br />
Dammbauwerk des Obern<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ees wurde von 1967<br />
bis 1972 nach Planungen von W. Ihssen und G. Salveter<br />
gebaut (Bild 4).<br />
Für den Bau der Talsperre mussten die Ortschaften<br />
Obernau und Nauholz ganz sowie Brauersdorf teilweise<br />
<strong>aus</strong>gesiedelt werden. Von dieser Maßnahme waren insgesamt<br />
365 Menschen betroffen. Die meisten von ihnen<br />
haben in der näheren Umgebung neue Häuser gebaut.<br />
Am wasserseitigen Dammfuß wurde ein 60 m hoher<br />
Entnahmeturm errichtet, der über einen 130 m langen<br />
Bedienungssteg von der linken Talflanke als auch durch<br />
den Grundablasskanal vom luftseitigen Dammfuß vom<br />
Schieberh<strong>aus</strong> zugänglich ist. Im Grundablasskanal verlaufen<br />
die Grundablassleitungen (2 x DN 700 mm) und<br />
die Entnahmeleitung (DN 800 mm). Die Inbetriebnahme<br />
Aufbereitungsanlage<br />
Dreis- Tiefenbach<br />
Bild 3. Betriebspunkte.<br />
Grundwasserwerk<br />
Siegtal<br />
Bild 4. Obernautalsperre.<br />
11 kleinere<br />
Gewinnungen/<br />
Aufbereitungen<br />
308 km<br />
Transportleitungsnetz<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1169
FachberichtE ATT Symposium<br />
Bild 5. Breitenbachtalsperre.<br />
Obernautalsperre<br />
Bewaldung<br />
Wiesenfläche<br />
Bebauung<br />
Breitenbachtalsperre<br />
Bild 6. Bewaldung, Wiesenfläche und Bebauung an Obernautalsperre<br />
und Breitenbachtalsperre.<br />
der Talsperre, die <strong>aus</strong> einem Steinschüttdamm mit<br />
Asphaltbeton-Außenhautdichtung besteht, erfolgte<br />
1972.<br />
In den Jahren 1982 bis 1984 wurden Beileitungsstollen<br />
angelegt, um das Einzugsgebiet der Talsperre von<br />
11,3 km² um 10,2 km² auf insgesamt 21,5 km² zu vergrößern.<br />
Die Beileitungen bestehen <strong>aus</strong> dem Siegstollen<br />
(2940 m, DN 2000 mm) und dem Sindernbachstollen<br />
(780 m, DN 1800 mm). Die Bau<strong>aus</strong>führung erfolgte mittels<br />
hydraulischen Rohrvortriebs anstelle der ursprünglich<br />
vorgesehenen bergmännischen Stollenbauweise.<br />
Erholungssuchende finden rund um die Obernautalsperre<br />
vielseitige Möglichkeiten. Auf einem rund 10 km<br />
langen und gut <strong>aus</strong>gebauten Rundweg können Wanderer,<br />
Spaziergänger, Inliner oder Radfahrer hier Natur<br />
pur genießen. Für wissensdurstige Wanderer sind<br />
Schautafeln zum Thema <strong>Wasser</strong>, Geschichte der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
sowie mit weiteren Details zur Talsperre<br />
aufgestellt (Bild 4).<br />
Die Breitenbachtalsperre –<br />
<strong>Wasser</strong>lieferant seit 1956<br />
1953, im Jahre der Gründung des <strong>Wasser</strong>verbandes,<br />
wurde mit dem Bau der Breitenbachtalsperre begonnen<br />
(Bild 5). Im 1. Bau abschnitt 1956 wurde ein Stauinhalt<br />
von 2,6 Mio. m 3 geschaffen. Im Entnahmebauwerk am<br />
wasserseitigen Dammfuß gab es nur eine Entnahmemöglichkeit,<br />
etwa 7,0 m über Grund. Dieses Bauwerk ist<br />
durch den Grundablasskanal mit dem auf der Luftseite<br />
des Dammes gelegenen Pumpwerk verbunden. Zwei<br />
Leitungen (DN 500 mm) liefern das Rohwasser für die<br />
Trinkwasseraufbereitungsanlage in das Pumpwerk und<br />
dienen außerdem als Grundablass. Zur Erhöhung der<br />
Leistungsfähigkeit der Talsperre wurden in den Jahren<br />
1963–1967 drei Beileitungsstollen <strong>aus</strong> dem Bereich der<br />
Oberen Ferndorf gebaut. Hierdurch wurde das Einzugsgebiet<br />
von 4,1 km² auf 11,6 km² vergrößert.<br />
Im zweiten Bauabschnitt 1980 wurde die Talsperre<br />
mit Vergrößerung des Stauinhaltes um 5,5 Mio. m³ auf<br />
8,1 Mio. m³ aufgestockt. Der Entnahmeturm ist mit vier<br />
höhenmäßig gestaffelten Rohwasserentnahmen <strong>aus</strong>gerüstet.<br />
Die Gründung und andere Arbeiten bei der<br />
Errichtung des Entnahmeturms mussten unter <strong>Wasser</strong><br />
<strong>aus</strong>geführt werden. Auf vier Großbohrpfählen (DN 1500<br />
mm) wurde ein auf einem schwimmenden Hubgerüst<br />
hergestellter Gründungskörper (250 t) abgesenkt und<br />
aufgelagert. Anschließend wurden zehn Schachtringe<br />
(DN 3000 mm, 50 t) mit einem Autokran von Land <strong>aus</strong><br />
versetzt. Nach dem Aufbau wurde der Turm in Achsrichtung<br />
vorgespannt und die Fugen zwischen den einzelnen<br />
Schachtringen verpresst. Die Verbindungslei tungen<br />
zwischen Entnahmeturm und altem Einlaufbauwerk<br />
wurden durch Taucher auf vorgefertigten Fundamenten<br />
verlegt.<br />
An dem rund 6 km langen Rundweg sind für wissensdurstige<br />
Wanderer Schautafeln zum Thema <strong>Wasser</strong>,<br />
Geschichte der <strong>Wasser</strong>versorgung sowie weitere Details<br />
zur Talsperre aufgestellt. Zusätzlich wurde 2011 als weiterer<br />
Wander-Höhepunkt der Kalorienpfad Hilchenbach<br />
„Fitnesswandern rund um die Breitenbachtalsperre“<br />
eröffnet.<br />
Die Aufbereitung des Trinkwassers<br />
Trinkwasser ist eines der am besten kontrollierten<br />
Lebensmittel. Der <strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein<br />
sorgt dafür, dass es heute und in Zukunft in hervorragender<br />
Qualität <strong>aus</strong>reichend zur Verfügung steht.<br />
Bereits das Rohwasser in unseren <strong>Talsperren</strong> besitzt<br />
eine hohe Qualität. Die Einzugsgebiete liegen in einem<br />
geschützten, überwiegend bewaldeten Gebiet. Pflanzenschutzmittel<br />
oder andere vom Menschen in die<br />
Umwelt gebrachte organische Spurenstoffe sind im <strong>Talsperren</strong>wasser<br />
nicht nachweisbar. Der Nitratgehalt liegt<br />
auf natürlich niedrigem Niveau. An unser Trinkwasser<br />
werden hohe Qualitätsanforderungen und hygienische<br />
Bedingungen gestellt. Deshalb ist jeder unserer Talsper-<br />
Dezember 2011<br />
1170 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
ren eine Aufbereitungsanlage nachgeschaltet, die in<br />
zwei Filterstufen Trübstoffe, Algen und Mikroorganismen<br />
sowie Eisen und Mangan eliminieren, natürliche,<br />
gelöste organische Verbindungen vermindern<br />
und überschüssige Kohlensäure entfernen. Damit es bei<br />
den teilweise langen Transportwegen nicht zu einer<br />
Verkeimung kommen kann, ist eine Desinfektion des<br />
aufbereiteten <strong>Talsperren</strong>wassers gesetzlich vorgeschrieben.<br />
Diese geschieht mithilfe von Chlordioxid, das aber<br />
nur in der nötigen Menge unterhalb der gültigen Grenzwerte<br />
zugesetzt wird. Hier ist das Minimierungsgebot<br />
gemäß Trinkwasserverordnung maßgeblich (Bilder 7<br />
und 8).<br />
Unsere kleineren Gewinnungsanlagen übernehmen<br />
die Versorgung in der Peripherie des Verbandsgebietes.<br />
Das „Reinigungsprinzip“ ähnelt dem der <strong>Talsperren</strong>,<br />
wobei hier meistens Chlorbleichlauge zur Desinfektion<br />
eingesetzt wird. Um die bestmögliche Trinkwasserqualität<br />
gemäß der Trinkwasserverordnung, die das zentrale<br />
Gesetzwerk zur Regelung der <strong>Wasser</strong>bereitstellung,<br />
Aufbereitung, Verteilung und Einhaltung der Qualitätsanforderungen<br />
darstellt, sicherzustellen, entnimmt<br />
und untersucht das Gesundheitsamt mit Hilfe unabhängiger<br />
bestellter Fachlabore regelmäßig <strong>Wasser</strong>proben –<br />
in den <strong>Wasser</strong>werken, Hochbehältern und auch beim<br />
Endverbraucher. Unser Ziel ist es, Ihnen beim Trinkwasser<br />
ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit und<br />
Produktgüte zu gewährleisten.<br />
Die Aufbereitungsanlagen<br />
unserer <strong>Talsperren</strong><br />
Um die hohen Qualitätsanforderungen und hygienischen<br />
Anforderungen, die an unser Trinkwasser<br />
gestellt werden, erfüllen zu können, ist jeder unserer<br />
<strong>Talsperren</strong> eine Aufbereitungsanlage nachgeschaltet.<br />
Dabei handelt es sich um zweistufige Schnellfiltersysteme,<br />
die nach dem Stand der Technik arbeiten. In der<br />
ersten Filterstufe, die mit Quarzkies bzw. Hydroanthrazitkörnern<br />
(thermisch behandelte Spezialkohle)<br />
bestückt ist, werden zunächst Trübstoffe, Algen und<br />
Mikroorganismen sowie Eisen und Mangan eliminiert<br />
und natürliche, gelöste organische Verbindungen (z. B.<br />
Huminstoffe) vermindert.<br />
Während an der Breitenbachtalsperre geschlossene<br />
Schnellfilter eingesetzt werden, sind an der Aufbereitungsanlage<br />
Dreis-Tiefenbach, die das <strong>Wasser</strong> der Obernau<br />
aufbereitet, offene Filterbecken gewählt worden.<br />
Das <strong>Wasser</strong> in unserer Region ist aufgrund der hier herrschenden<br />
geologischen Rahmenbedingungen sehr<br />
weich und wird im zweiten Filtrationsschritt „aufgehärtet“.<br />
Das bedeutet, dass überschüssige Kohlensäure<br />
entfernt wird, damit es in den <strong>Wasser</strong>leitungen und<br />
H<strong>aus</strong>anschlüssen mit Armaturen und angeschlossenen<br />
H<strong>aus</strong>haltsgeräten nicht zu einer unerwünschten Korrosion<br />
kommt. Natürliches Kalkgestein (Jurakalkkorn)<br />
übernimmt diese Aufgabe und überführt das <strong>Wasser</strong> in<br />
Nährstoffe<br />
Mikroorganismen<br />
das sogenannte Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Nur<br />
bei diesem Gleichgewicht wird wirkungsvoll sowohl die<br />
Korrosion als auch eine Ausfällung (Bildung von Ablagerungen/Inkrustationen<br />
im Rohrnetz) vermieden.<br />
Mehr Lebensqualität für unsere Region<br />
Unser Ziel ist es, der Bevölkerung im Kreisgebiet Siegen-<br />
Wittgenstein nicht nur Trinkwasser zur Verfügung zu<br />
stellen, welches den gesetzlichen Vorgaben entspricht,<br />
sondern darüber hin<strong>aus</strong> ein Höchstmaß an Güte und<br />
Reinheit aufweisen kann. Deshalb untersuchen wir –<br />
zusätzlich zu den zahlreichen, regelmäßigen und unangekündigten<br />
Kontrollen des Gesundheitsamtes – in<br />
unserem verbandseigenen Labor jährlich etwa 3000 bis<br />
3500 Proben.<br />
Metalle<br />
Schadstoffe<br />
Bild 7. <strong>Wasser</strong>inhaltstoffe, die in die <strong>Talsperren</strong> gelangen: geringe<br />
Mengen Nährstoffe (Phosphat, Nitrat, Sulfat), wenige Algen und<br />
Bakterien, hauptsächlich geogene Metalle wie Eisen und Mangan,<br />
aber keine industriellen oder sonstigen Schadstoffe (Antibiotika<br />
etc.), da das Einzugsgebiet sehr gut geschützt ist.<br />
Kieselalgen<br />
Kieselalgen<br />
Dinoflagellaten<br />
Bild 8. Die Algenbelastung ist im Vergleich zu anderen <strong>Talsperren</strong><br />
recht gering. Indiz für eine gute bis sehr gute <strong>Wasser</strong>qualität ist das<br />
vornehmliche Vorkommen von Kieselalgen (Kaltwasseralgen),<br />
Asterionella (Schwebesternchen), Tabellaria Synedra (Stabkieselalge)<br />
und Cyclotella (zylindrisch) mit sogenannten Blüten (Massenvermehrung)<br />
im Frühjahr und im Herbst. Grünalgen, die größere<br />
Nährstoffmengen benötigen, kommen kaum vor, ebenso wenig<br />
Cyanobakterien/Blaualgen, die Giftstoffe, Geruchs- oder<br />
Geschmacksstoffe freisetzen.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1171
FachberichtE ATT Symposium<br />
Ringversuche<br />
""<br />
chemisch<br />
""<br />
mikrobiologisch<br />
""<br />
limnologisch<br />
→ Unabhängiger<br />
Qualitätsnachweis<br />
Bild 9. Der WVS beteiligt sich zur Eigenüberwachung seit vielen Jahren<br />
an Trinkwasserringversuchen. Pro Jahr finden drei chemische und vier<br />
mikrobiologische Ringversuche statt. Im Bereich der Limnologie ist der<br />
neue ATT Ringversuch Phytoplankton maßgeblich.<br />
Zu den überprüften Qualitätsparametern zählen insbesondere<br />
mikrobiologische und chemisch-physikalische<br />
Kenngrößen (inklusive <strong>aus</strong>gewählter Schwermetalle)<br />
sowie die Betrachtung limnologischer Kriterien.<br />
Das heißt: Unser <strong>Talsperren</strong>wasser wird als Ökosystem<br />
insbesondere mit dem darin vorkommenden Plankton<br />
im Kontext zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung gesehen. Die<br />
Gewährleistung einer guten Rohwasserqualität in den<br />
St<strong>aus</strong>een ist uns deshalb ebenso wichtig wie die Kontrolle<br />
des „Produktes“ <strong>Wasser</strong> und die Bewertung des<br />
Aufbereitungsprozesses.<br />
Der WVS beteiligt sich zur Eigenüberwachung seit<br />
vielen Jahren an Trinkwasserringversuchen. In Deutschland<br />
gibt es vier Ringversuchs-Ausrichter. Das Niedersächsische<br />
Landesgesundheitsamt (NLGA - Außenstelle<br />
Aurich) ist davon das einzige, welches mikrobiologische<br />
Trinkwasserringversuche anbietet. Darüber hin<strong>aus</strong> stellt<br />
es physikalisch-chemische Ringversuchsproben zur<br />
Verfügung, die Parameter mit hygienischer Relevanz<br />
abdecken. Etwa 400 bis 500 Labore <strong>aus</strong> Deutschland<br />
und dem benachbarten Ausland nehmen regelmäßig<br />
daran teil (Bild 9).<br />
Das NLGA kooperiert mit dem LANUV NRW auf dem<br />
Gebiet der Ringversuche über eine „Lenkungsgruppe<br />
Trinkwasserringversuche NRW/Niedersachsen“ eng<br />
zusammen. Damit soll vermieden werden, dass es zu<br />
unnötigen Überschneidungen angebotener Parameter<br />
kommt und um die Vorbereitung, Versendung und<br />
Ergebnis<strong>aus</strong>wertung der Testproben auf eine entsprechend<br />
fachlich-wissenschaftliche Basis zu stellen. Die<br />
Zertifikate bescheinigen die erfolgreiche qualitätsorientierte<br />
Arbeit unseres Betriebslabors.<br />
Qualitätssicherung<br />
An dieser Stelle möchten wir alle Mitglieder ermuntern,<br />
die Arbeitskreise aktiv zu besetzen. Ein wesentlicher<br />
Bestandteil der erfolgreichen ATT-Geschichte basiert<br />
auf der engagierten Mitarbeit in den jeweiligen Gremien.<br />
Diese Stärke der ATT gilt es zu wahren. Daher sind<br />
hier alle Mitgliedsunternehmen gefordert! Ohne unsere<br />
<strong>Talsperren</strong> wäre die <strong>Wasser</strong>versorgung in der Region<br />
nicht zu erfüllen – daher wird die ATT sicherlich auch<br />
künftig beim <strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein eine<br />
wichtige Rolle spielen. Denn für die Zukunft gilt es,<br />
einige interessante Projekte umzusetzen:<br />
""<br />
Konsequente Weiterentwicklung des<br />
Multibarrierensystems<br />
""<br />
Energetische Nutzung –<br />
<strong>Wasser</strong>kraft an der Obernautalsperre<br />
""<br />
Erneuerung der Oberflächendichtung<br />
Obernautalsperre<br />
""<br />
Weitere Abschnitte der Betonsanierung an<br />
beiden <strong>Talsperren</strong><br />
""<br />
Mittelfristige Auswechslung des Grundablasses<br />
an der Breitenbachtalsperre<br />
""<br />
Einrichtung zusätzliche(r) Entnahmehöhe(n)<br />
an der Breitenbachtalsperre<br />
""<br />
Vertiefte Überprüfung beider <strong>Talsperren</strong> in 2012<br />
Autor<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Dipl.-Ing. Dirk Müller<br />
E-Mail: d.mueller@wvsw.de |<br />
<strong>Wasser</strong>verband Siegen-Wittgenstein |<br />
Einheitsstraße 23 |<br />
D-57076 Siegen<br />
Dezember 2011<br />
1172 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
FachberichtE ATT Symposium<br />
Zusammenwachsen West und Ost<br />
in der ATT<br />
Kl<strong>aus</strong> Pütz<br />
Mitteldeutschland, das betrifft im Wesentlichen die heutigen<br />
Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,<br />
hat eine lange Tradition im <strong>Talsperren</strong>bau.<br />
Beginnend im 15. Jahrhundert entstanden bis in das<br />
18. Jahrhundert im Harz und im Erzgebirge zahlreiche<br />
sogenannte Kunstteiche, die dem Bergbau das für den<br />
Antrieb der Fördereinrichtungen und der sogenannten<br />
Pochwerke sowie für die Erzwäsche benötigte <strong>Wasser</strong><br />
lieferten. Es handelt sich dabei in technischer Hinsicht<br />
um kleinere <strong>Talsperren</strong>.<br />
Mit der rasanten Entwicklung der Industrie Ende des<br />
19. Jahrhunderts begann in Mitteleuropa, also auch in<br />
Deutschland, die Geschichte des modernen <strong>Talsperren</strong>baues.<br />
Dabei stand zunächst die <strong>Wasser</strong>mengenbewirtschaftung<br />
im Vordergrund. Diese verfolgte das Ziel,<br />
einen Ausgleich der räumlich und zeitlich ungleich<br />
verteilten <strong>Wasser</strong>dargebote zu schaffen. Bedingt durch<br />
regionale Besonderheiten einer Reihe deutscher Mittelgebirge<br />
(insbesondere geologische und hydrologische<br />
Verhältnisse) sind die Hauptnutzungsziele der meisten<br />
<strong>Talsperren</strong> die öffentliche Trinkwasserversorgung und<br />
der Hochwasserschutz. Die erste moderne Talsperre in<br />
Deutschland war die Trinkwassertalsperre Eschbach der<br />
Stadt Remscheid, die im Jahr 1891 in Betrieb genommen<br />
wurde. Im Jahr 1894 folgte die Inbetriebnahme<br />
der ersten Trinkwassertalsperre Mitteldeutschlands, der<br />
sächsischen Talsperre Einsiedel (Bild 1) für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
der Stadt Chemnitz.<br />
Bild 1. Trinkwassertalsperre Einsiedel (1894), Trinkwasser für Chemnitz.<br />
In den Jahren bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges<br />
kamen im Erzgebirge, im Vogtland, im Thüringer<br />
Wald und im (Ost-)Harz weitere Trinkwassertalsperren<br />
dazu. Eine davon ist die Talsperre Klingenberg für die<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung der Stadt Dresden (Bild 2).<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg mit Beginn der fünfziger<br />
Jahre setzte ein Anstieg des Trinkwasserbedarfs<br />
ein. Zu seiner Deckung wurden in der inzwischen<br />
gegründeten DDR etliche <strong>Talsperren</strong> errichtet, darunter<br />
15 Trinkwassertalsperren, sodass hier die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
über zahlreiche <strong>Talsperren</strong> verfügte, davon insgesamt<br />
mehr als 30 Trinkwassertalsperren. Diese <strong>Talsperren</strong><br />
befanden sich im Eigentum des Staates und<br />
wurden von den <strong>Wasser</strong>wirtschaftsdirektionen betrieben.<br />
Das Rohwasser der Trinkwassertalsperren wurde<br />
den VEB <strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
geliefert. Diese bereiteten es in ihren <strong>Wasser</strong>werken zu<br />
Trinkwasser auf und belieferten die Bevölkerung in den<br />
Städten und Gemeinden (Bild 3).<br />
Von der Seite der Wissenschaft und Forschung<br />
befassten sich insbesondere die Technische Universität<br />
Dresden und das Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft in Ostberlin<br />
mit dem Thema <strong>Talsperren</strong>. Fanden in der DDR<br />
Tagungen zu Fragen der <strong>Wasser</strong>gütebewirtschaftung<br />
von Trinkwassertalsperren statt, so war in der Regel Prof.<br />
Bernhardt vom Wahnbachtalsperrenverband unter den<br />
Teilnehmern, meist auch als Referent. Da er <strong>aus</strong> Dresden<br />
stammte, hatte er natürlich einen besonderen Bezug zu<br />
uns.<br />
Nach der politischen Wende in der DDR nahm er<br />
sofort Verbindung mit uns auf. Im Januar 1990 rief er<br />
mich an und sagte in seiner Art, sodass man keine<br />
Chance hatte, zu widersprechen: „Pütz, Sie kommen zur<br />
Festveranstaltung 20 Jahre ATT nach Siegburg und halten<br />
dort einen Vortrag über die Trinkwassertalsperren in<br />
der DDR. Sie bringen auch noch einige Fachleute mit.“<br />
Ich hatte u. a. Herrn Glasebach sowie zwei weitere<br />
Kollegen <strong>aus</strong> Dresden, Herrn Beuschold <strong>aus</strong> dem Ostharz,<br />
Herrn Reiß <strong>aus</strong> Chemnitz, Herrn Dr. von Tümpling<br />
<strong>aus</strong> Erfurt und Herrn Dr. Klapper <strong>aus</strong> Magdeburg angesprochen,<br />
die ebenfalls sehr gern nach Siegburg fuhren.<br />
Jürgen Benndorf war von Prof. Bernhardt ebenso eingeladen<br />
worden. Wir vier Dresdener fuhren mit einem<br />
Dacia, ein rumänischer Renault, Herr Glasebach, der<br />
spätere Geschäftsführer der 1991 gebildeten Landestal-<br />
Dezember 2011<br />
1174 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
sperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, chauffierte.<br />
Da wir noch nicht über DM verfügten, hatten wir zwei<br />
gefüllte 20-Literkanister Benzin und dazu natürlich<br />
unser Gepäck im Kofferraum. Wir kamen uns fast wie ein<br />
Selbstmordkommando vor. Mein Vortrag über die ostdeutschen<br />
Trinkwassertalsperren kam gut an, ebenso<br />
der Vortrag von Jürgen Benndorf zur Steuerung der<br />
Planktonsukzession durch Biomanipulation. Eine kleine<br />
Begebenheit am Rande während meines Vortrages<br />
möchte ich erwähnen. Die Fernbedienung für den DIA-<br />
Projektor versagte plötzlich ihren Dienst. Darauf ertönte<br />
eine Stimme <strong>aus</strong> dem Auditorium: „Herr Pütz, Sie sehen,<br />
auch im Westen kann die Technik plötzlich versagen.“<br />
Allgemeine Heiterkeit war das Ergebnis. Nach Abschluss<br />
der Vorträge wurden wir Ostdeutsche gebeten, die<br />
nächste Fach<strong>aus</strong>schuss-Sitzung der ATT bei uns zu organisieren.<br />
Am Abend fand eine Festveranstaltung statt. Dort<br />
ergaben sich zahlreiche Gespräche zwischen den westund<br />
ostdeutschen Fachkollegen. Ich stellte fest, dass<br />
dieses auf Augenhöhe geschah. Es war wohltuend, zu<br />
erleben, dass es auf der Ebene der Fachleute keine Vorurteile<br />
gab. Beim anschließenden Abendessen saß ich<br />
mit dem ehemaligen langjährigen Direktor des Wahnbachtalsperrenverbandes,<br />
Herrn Hötter am Tisch. Wir<br />
unterhielten uns bestens.<br />
Die erste gemeinsame Fach<strong>aus</strong>schuss-Sitzung fand<br />
am 25./26. Oktober 1990, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung<br />
an der Trinkwassertalsperre Eibenstock<br />
in Sachsen statt, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Hier<br />
war schon zu erkennen, dass es unter den Fachleuten<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft <strong>aus</strong> Ost und West keine Vorbehalte<br />
gab. Alle waren sich darüber im Klaren, dass wir schließlich<br />
mehrere Jahrzehnte zwangsläufig verschiedene<br />
Wege gehen mussten, die sich auch in unterschiedlichen<br />
Strukturen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft zeigten, dass<br />
jedoch die Naturgesetze, von denen das Verhalten des<br />
<strong>Wasser</strong>s bestimmt wird, unabhängig von politischen<br />
Systemen wirken. Es waren die „alten Hasen“ der ATT, ich<br />
möchte hier nur nennen Prof. Bernhardt, Herrn Such und<br />
Herrn Dr. Clasen vom Wahnbachtalsperrenverband,<br />
Herrn Dr. Strack <strong>aus</strong> Wuppertal, damals Vorsitzender der<br />
ATT, Herrn Katz von der Perlenbachtalsperre, Herrn<br />
Porten vom <strong>Wasser</strong>verband Oleftal, Herrn Rapp von der<br />
Kleinen Kinzig im Schwarzwald, Herrn Dr. Renner vom<br />
Wupperverband, Herrn Fischer <strong>aus</strong> Opladen, Herrn<br />
Klingebiel <strong>aus</strong> dem Siegerland, Herrn Dr. Oskam vom<br />
Biesbosch/Niederlande, Herrn Hansen <strong>aus</strong> Luxemburg,<br />
Herrn Gronwald <strong>aus</strong> Remscheid, Herrn Döhmen <strong>aus</strong><br />
Gevelsberg und Herrn Zach <strong>aus</strong> Düren, die uns vom<br />
Moment der Begrüßung an die Gewissheit gaben, wir<br />
sind anerkannt.<br />
Die ostdeutschen Betreiber von Trinkwassertalsperren<br />
und von <strong>Wasser</strong>werken, die Rohwasser <strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong><br />
zu Trinkwasser aufbereiten, sowie das Institut<br />
für Hydrobiologie der Technischen Universität Dresden<br />
Bild 2. Trinkwassertalsperre Klingenberg (1914), Trinkwasser<br />
für Dresden.<br />
Talsperre<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsdirektion<br />
<strong>Wasser</strong>werk<br />
VEB <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Bild 3. Prinzip der Trinkwasserversorgung <strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong> in der DDR.<br />
Bild 4. Talsperre Eibenstock – Ort der ersten gemeinsamen<br />
Fach<strong>aus</strong>schuss-Sitzung 25./26. Oktober 1990.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1175
FachberichtE ATT Symposium<br />
wurden dann 1991/92 weitgehend Mitglieder der<br />
Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT).<br />
Von da an waren wir, die <strong>aus</strong> den sogenannten<br />
Neuen Bundesländern Hinzugekommenen, fest integriert<br />
und zahlreiche Fachkolleginnen und -kollegen wirken<br />
seitdem aktiv, mit hohem Engagement im Fach<strong>aus</strong>schuss<br />
sowie in den Arbeitskreisen und Projektgruppen<br />
der ATT mit. Ich kann heute feststellen, es war und ist ein<br />
gegenseitiges Geben und Nehmen. Ausdruck der<br />
Gemeinsamkeiten sind u. a. gemeinsame Arbeiten an<br />
einem umfangreichen Regelwerk, an zahlreichen Technischen<br />
Informationen der ATT sowie an einer Reihe von<br />
Publikationen.<br />
Sicher gibt es umfangreiche weitere Ergebnisse der<br />
Arbeitskreise der ATT bzw. einzelner Mitglieder, u. a.<br />
auch die Bearbeitung einer Reihe von Forschungsthemen.<br />
Insbesondere im Fach<strong>aus</strong>schuss spiegelt sich das<br />
gemeinsame Anliegen der ATT-Mitglieder – Erfahrungs<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch<br />
und Erkenntnisgewinn – wider. Blicken wir<br />
zurück auf 40 Jahre ATT, das heißt für die Fachleute <strong>aus</strong><br />
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt auf 20 Jahre<br />
gemeinsamer Arbeit für die Sicherung der Trinkwasserversorgung<br />
<strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong>, so können wir feststellen,<br />
die Wiedervereinigung Deutschlands vor nunmehr<br />
diesen 20 Jahren war für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft ein Segen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Kl<strong>aus</strong> Pütz<br />
p-k-puetz@web.de |<br />
Ringstraße 35 |<br />
D-01454 Wachau<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Zeitschrift KA – <strong>Abwasser</strong> · Abfall<br />
In der Ausgabe 12/2011 lesen Sie u.a. folgende Beiträge:<br />
Liebscher/Gillar/Bosseler<br />
Hillenbrand u. a.<br />
Stahl<br />
Irmer u. a.<br />
Hansinger u. a.<br />
Sanierung von <strong>Abwasser</strong>schächten – Untersuchung von Materialien und Systemen<br />
zur Abdichtung und Beschichtung – Teil 4: Planungshinweise und Empfehlungen<br />
zur Qualitätssicherung<br />
demografischer Wandel: Auswirkungen und Lösungsansätze für die<br />
abwasserinfrastruktur<br />
Betriebsstabilität bei der Deammonifikation am Beispiel der Kläranlage Balingen<br />
(Baden-Württemberg)<br />
die neue Oberflächengewässerverordnung (OGewV) – Strategien und<br />
normative Anforderungen<br />
planung der Trinkwasserversorgung für ein Dorf im ecuadorianischen Regenwald<br />
Dezember 2011<br />
1176 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Fachmedien<br />
jetzt als Buch<br />
oder digital als<br />
eBook<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung: Umweltrechtliche<br />
und verfahrenstechnische Betrachtung<br />
Praxishilfen zur Anwendung wasserrechtlicher<br />
Vorschriften und zur verfahrenstechnischen<br />
Optimierung einer Kaskadendenitrifikation<br />
In diesem Buch für <strong>Abwasser</strong>profis werden wichtige wasser -<br />
recht liche Vorschriften durch deren konkrete Anwendung<br />
an einer exemplarischen Anlage verdeutlicht.<br />
Die Optimierung einer Belebungsstufe und die Ableitung von<br />
Optimierungsmaßnahmen für eine Kläranlage mit einer Ausbaugröße<br />
von rund 20.000 Einwohnerwerten sind anschaulich aufbereitet.<br />
Dieses Fachbuch gibt Experten wie auch Einsteigern<br />
wichtige Handlungsanweisungen für die Behandlung von <strong>Abwasser</strong><br />
an die Hand.<br />
A. Hamann<br />
1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Erhältlich als Buch oder als Buch mit Bonusmaterial<br />
und vollständigem eBook auf Datenträger oder als<br />
digitales eBook.<br />
Alle Produktvarianten und Angebotsoptionen (inkl. eBook)<br />
finden Sie im Buchshop unter www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle auf Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Ex. <strong>Abwasser</strong>reinigung: Umweltrechtliche und<br />
verfahrenstechnische Betrachtung<br />
als Buch (ISBN: 978-3-8356-3248-6)<br />
zum Preis von € 64,90 zzgl. Versand<br />
als Buch + eBook auf Datenträger (ISBN: 978-3-8356-3250-9)<br />
zum Preis von € 74,90 zzgl. Versand<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAAUVB2011<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FachberichtE ATT Symposium<br />
Gründung der ATT und<br />
ihre Entwicklung<br />
Wolfram Such<br />
Liebe Freunde und Gäste der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V.,<br />
meine sehr geehrten Damen und Herren!<br />
Bild 1.<br />
Aufnahme<br />
vom Wahnbachst<strong>aus</strong>ee<br />
im Bereich des<br />
Absperrbauwerkes<br />
im<br />
Frühjahr 1969<br />
während der<br />
Massenentwicklung<br />
der<br />
Blaualge<br />
Oscillatoria<br />
rubescens als<br />
Zeichen<br />
starker<br />
Eutrophierung.<br />
1. Einleitung<br />
Zusammen mit Herrn Kl<strong>aus</strong> Pütz freue ich mich, heute<br />
<strong>aus</strong> Anlass des 40-jährigen Bestehens der Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren e. V. zu Ihnen über<br />
die Gründung und weitere Entwicklung dieser<br />
Fachverei nigung der <strong>Wasser</strong>wirtschaft sprechen zu<br />
können!<br />
Herr Pütz und ich haben seit der Wiedervereinigung<br />
Deutschlands vor nunmehr 20 Jahren in den Gremien<br />
der ATT zusammengearbeitet.<br />
Wir nutzen die uns gebotene Möglichkeit, den früheren<br />
Gefährten für das gemeinsame erfolgreiche<br />
Wirken zu danken und den heute tätigen Kolleginnen<br />
und Kollegen für ihren Einsatz im Sinne der Aufgaben<br />
und Ziele der ATT die besten Wünsche für die Zukunft<br />
zu übermitteln!<br />
Einen Höhepunkt in der Entwicklung der ATT bildete<br />
der Eintritt der Unternehmen, die <strong>Talsperren</strong> betreiben<br />
und <strong>aus</strong> diesen gewonnenes <strong>Wasser</strong> zu Trinkwasser aufbereiten,<br />
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen <strong>aus</strong><br />
Anlass der Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands.<br />
Hierüber wird Kl<strong>aus</strong> Pütz im Anschluss an meine<br />
Ausführungen besonders berichten.<br />
Nun aber zunächst zur Gründung der ATT:<br />
Unter dem Eindruck der vom DVGW-Fach<strong>aus</strong>schuss<br />
„Eutrophierung und <strong>Talsperren</strong>“ im Jahr 1969 im Limnologischen<br />
Institut Falkau der Universität Freiburg veranstalteten<br />
Aussprachetagung kamen die technischen<br />
Geschäftsführer des <strong>Wasser</strong>werkes des Landkreises<br />
Aachen GmbH, Bauassessor Ebeling, und der Harzwasserwerke<br />
in Hildesheim, Dr. Maeckelburg, mit dem Leiter<br />
des technischen Betriebes beim Wahnbachtalsperrenverband<br />
in Siegburg, Dr. Heinz Bernhardt, gemeinsam zu<br />
der Überzeugung, dass eine engere Zusammenarbeit<br />
zwischen den Betreibern von Trinkwassertalsperren und<br />
Beziehern von <strong>Talsperren</strong>wasser zur Trinkwasseraufbereitung<br />
die Lösung ihrer brennenden Probleme erleichtern<br />
und beschleunigen könnte.<br />
Sie fanden Parallelen, zum Beispiel bei den schwerwiegenden<br />
Fragen der Eutrophierung der von ihnen<br />
betriebenen <strong>Talsperren</strong> (Bilder 1 und 2).<br />
Ähnliche alarmierende Qualitätsänderungen wurden<br />
u. a. in der Sösetalsperre im Westharz beobachtet.<br />
Große Schwierigkeiten traten infolge der hohen<br />
Manganbelastung in der Dreilägerbachtalsperre in der<br />
Eifel und bei anderen Trinkwassertalsperren auf.<br />
In weiteren Sitzungen, u. a. in Siegburg, bei denen<br />
der Geschäftsführer des Wahnbachtalsperrenverbandes,<br />
Direktor Franz-Gerd Hötter, hinzukam, wurden Aufgaben<br />
und Ziele einer angestrebten Arbeitsgemeinschaft formuliert<br />
und mit weiteren Betreibern von Trinkwassertalsperren<br />
in der Eifel und dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen<br />
erörtert. Zum gemeinsamen Arbeitskonzept<br />
und dem Entwurf einer Satzung lieferte die bereits<br />
zur Sicherung der <strong>Wasser</strong>versorgung <strong>aus</strong> uferfiltriertem<br />
und angereichertem Flusswasser gegründete Arbeitsgemeinschaft<br />
der Rheinwasserwerke e. V. Anregungen.<br />
Dezember 2011<br />
1178 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Gründungsversammlung<br />
Die Einladung zur Gründungsversammlung am 23. No -<br />
vember 1970, also heute exakt vor 40 Jahren, erging an<br />
die acht Gründungsunternehmen gemäß Bild 3.<br />
Mit der Beschlussfassung über die Satzung wurde<br />
die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren“ in Siegburg vollzogen.<br />
Die seinerzeit verabschiedete Ursprungsfassung der<br />
ATT-Satzung wurde zwar inzwischen mindestens achtmal<br />
geändert und an die jeweiligen Gegebenheiten<br />
sowie Erfordernisse angepasst. Am Ziel und der Zweckbestimmung,<br />
die prägnant in Präambel und § 2 der geltenden<br />
Satzung gemäß Bild 4 (1) und (2) festgelegt<br />
sind, hat sich allerdings seither nichts geändert.<br />
Bild 2.<br />
Aufnahme in<br />
einer Bucht<br />
des Wahnbachst<strong>aus</strong>ees<br />
im Frühjahr<br />
1969 während<br />
der Massenentwicklung<br />
der Blaualge<br />
Oscillatoria<br />
rubescens.<br />
Wahl Vorstand und wissenschaftlicher Leiter<br />
Auf der Gründungsversammlung wurden jeweils einstimmig<br />
gewählt:<br />
""<br />
zum geschäftsführenden, ehrenamtlich tätigen Vorsitzenden<br />
Direktor Bauassessor Mathias Ebeling,<br />
Geschäftsführer der <strong>Wasser</strong>werke des Landkreises<br />
Aachen GmbH,<br />
""<br />
zu seinem Vertreter im Vorstand Direktor Dr.-Ing.<br />
Martin Schmidt, Harzwasserwerke Hildesheim.<br />
""<br />
Zum wissenschaftlichen Leiter, der den gemäß<br />
Satzung zu bildenden Fach<strong>aus</strong>schuss, das Arbeitsgremium<br />
der Vereinigung, einzuberufen und zu<br />
leiten hat, die Mitgliederversammlung, das Lenkungsorgan<br />
des Vereins, sowie den Vorstand berät<br />
und informiert sowie im Einvernehmen mit dem<br />
Vorstand die ATT in technisch-wissenschaftlichen<br />
Belangen nach außen vertritt, wurde Dr. phil. Heinz<br />
Bild 3. Gründungsunternehmen der ATT.<br />
Bild 4 (1).<br />
Auszug <strong>aus</strong> der Satzung.<br />
Bild 4 (2).<br />
Auszug <strong>aus</strong> der Satzung.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1179
FachberichtE ATT Symposium<br />
Bild 5. Erstbesetzung des<br />
ATT-Fach<strong>aus</strong>schusses.<br />
Bernhardt, Leiter des technischen Betriebes beim<br />
Wahnbachtalsperrenverband, gewählt.<br />
Rahmenarbeitsprogramm<br />
Verabschiedet wurde auf der Gründungssitzung das<br />
Rahmenarbeitsprogramm der ATT. Es enthält als Vorgaben<br />
für die künftige Arbeit umfassende und längerzeitige<br />
Mess-, Untersuchungs- und Auswertungsprogramme<br />
in den <strong>Talsperren</strong> und Aufbereitungsanlagen<br />
der Mitglieder. Dazu kommen Vorschläge für Forschungs-<br />
und Entwicklungsprogramme zur Gewinnung,<br />
Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser<br />
<strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong>.<br />
Die im seinerzeit beschlossenen Rahmenarbeitsprogramm<br />
bereits verankerten zukunftsorientierten Grundsätze<br />
ziehen sich mit wechselnden Schwerpunkten entsprechend<br />
den jeweiligen Prioritäten wie ein roter<br />
Faden bis heute durch die Arbeit im Fach<strong>aus</strong>schuss der<br />
ATT. Seine Eckpfeiler sind ständiger, intensiver Erfahrungs<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch<br />
und gegenseitige Abstimmung über<br />
das jeweilige Vorgehen unter den Mitgliedern und auch<br />
in anderen technisch-wissenschaftlichen Fachgremien.<br />
Anschließend wurden die Vertreter der Gründungsmitglieder<br />
gewählt, von denen im Fach<strong>aus</strong>schuss und in<br />
Arbeitskreisen unter dem wissenschaftlichen Leiter<br />
die ersten, <strong>aus</strong> dem Rahmenprogramm entwickelten<br />
Jahresarbeitsprogramme umgesetzt wurden (Bild 5).<br />
Forschungsprojekt<br />
„Vorsperrenuntersuchungen“<br />
Als erstes gemeinsames Forschungsprojekt der ATT<br />
wurde ein umfangreiches Untersuchungsprogramm in<br />
vier Vorsperren und kleinen <strong>Talsperren</strong> der Mitglieder<br />
mit unterschiedlichen <strong>Abwasser</strong>- und Nährstoffbelastungen,<br />
besonders Phosphorverbindungen, <strong>aus</strong> den<br />
Einzugsgebieten beschlossen. Ausgewählt wurden<br />
Obersee (Rur), Perlenbachtalsperre, Genkel- und Wahnbachvorsperre.<br />
Ziel der an den Diplom-Biologen Wilhelmus vom<br />
Lehrstuhl für Physiologische Ökologie am Zoologischen<br />
Institut der Universität Köln übertragenen Doktorarbeit<br />
war die Erforschung der in den vier <strong>aus</strong>gewählten<br />
Staubecken ablaufenden physikalisch-chemisch-biologischen<br />
Prozesse, insbesondere zur biologischen<br />
Phosphoreliminierung.<br />
Damit sollten zugleich die von den Professoren<br />
Uhlmann und Benndorf an der Technischen Hochschule<br />
Dresden unter Mitwirkung von Kl<strong>aus</strong> Pütz in der damaligen<br />
DDR aufgrund von Laboruntersuchungen entwickelten<br />
Modellvorstellungen und Berechnungsverfahren<br />
zur Ermittlung der optimalen Größe von Vorsperren<br />
überprüft werden.<br />
Die endgültige Beantwortung einer solchen zentralen<br />
Frage, nämlich der Wirksamkeit der Vorsperren von<br />
Trinkwassertalsperren, konnte bis zur Abgabe der Dissertation<br />
im Jahr 1976 natürlich nicht gelingen. Sie hat<br />
danach den ATT-Fach<strong>aus</strong>schuss mehrmals und intensiv<br />
weiter beschäftigt. Erst etliche Jahre später konnte diese<br />
Frage mit Fertigstellung des gemeinsam von ATT und<br />
ATV-DVWK unter Leitung von Kl<strong>aus</strong> Pütz erarbeiteten<br />
Merkblattes W 605 „Bedeutung von Vorsperren für die<br />
<strong>Wasser</strong>gütebewirtschaftung von <strong>Talsperren</strong>“ im Zusammenhang<br />
mit der Her<strong>aus</strong>gabe der neuen DIN 19700<br />
weitgehend beantwortet werden.<br />
Vereinbarung zwischen ATT und<br />
RWTH Aachen<br />
Im Mai 1973 wurde zwischen der ATT und dem Rektor<br />
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule<br />
Aachen für den Lehrstuhl und das Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
eine Vereinbarung über wissenschaftliche<br />
Zusammenarbeit geschlossen. Gegenstand<br />
dieser Vereinbarung war zugleich der Aufbau und<br />
Betrieb eines gemeinsamen Untersuchungs- und Forschungslaboratoriums<br />
im ehemaligen Revierforstgebäude<br />
in Roetgen an der Dreilägerbachtalsperre in<br />
der Eifel.<br />
Die seinerzeit vereinbarte, für beide Partner damals<br />
bedeutsame Zusammenarbeit diente einmal zur Unterstützung<br />
der Forschung und Entwicklung auf den<br />
Gebieten der <strong>Wasser</strong>güte, <strong>Wasser</strong>aufbereitung und<br />
<strong>Wasser</strong>analytik, besonders der organischen Spurenstoffe,<br />
wie Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel.<br />
Sie stand im Zusammenhang mit<br />
der Bewirtschaftung von <strong>Talsperren</strong> sowie den Untersuchungen<br />
nach den Arbeitsprogrammen des Fach<strong>aus</strong>schusses<br />
und der ATT-Mitgliedsunternehmen. Sie<br />
verfügten zu dieser Zeit noch nicht alle über entsprechend<br />
<strong>aus</strong>gestattete und leistungsfähige eigene<br />
Laboreinrichtungen.<br />
Dezember 2011<br />
1180 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Weiterhin waren die gemeinsam aufgebauten<br />
<strong>Wasser</strong>laboratorien Roetgen auf eine damals durch<strong>aus</strong><br />
noch nicht übliche interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
von Chemikern, Biologen und Umweltingenieuren zur<br />
praxisnahen Ausbildung in der Siedlungswasserwirtschaft<br />
<strong>aus</strong>gerichtet. Die Einrichtung war auch im Zusammenhang<br />
mit den Lehraufträgen von Prof. Dr. Bernhardt<br />
über „Ausgewählte Kapitel der <strong>Wasser</strong>gütewirtschaft“<br />
und des Leiters der Laboratorien, Prof. Dr. Reichert, über<br />
„Chemie der <strong>Wasser</strong>gewinnung und des Gewässerschutzes“<br />
zu sehen.<br />
Mitgliederentwicklung<br />
Das Diagramm (Bild 6) zeigt die Entwicklung der Zahl<br />
der ATT-Mitglieder seit der Gründung. Sie ist bis zur<br />
Mitte der 1990er Jahre etwa auf das Fünffache gewachsen.<br />
Von der ursprünglichen regionalen Konzentration<br />
auf die Eifel und das Bergische Land in dem einen Bundesland<br />
Nordrhein-Westfalen, mit Ausnahme der Harzwasserwerke<br />
in Niedersachsen, hat die ATT sich nunmehr<br />
auf weitere sieben Bundesländer, Baden-Württemberg,<br />
Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,<br />
Sachsen-Anhalt und Thüringen, mit Standorten von<br />
Trinkwassertalsperren <strong>aus</strong>gedehnt. In Bild 7 sind die<br />
nach dem Stand von 1994 in den nunmehr neun<br />
Bundesländern tätigen 34 Mitgliedsunternehmen der<br />
ATT mit Angabe der von ihnen betriebenen insgesamt<br />
63 Trinkwassertalsperren (T) und <strong>aus</strong> diesen zur Trinkwasserversorgung<br />
abgegebenen <strong>Wasser</strong>mengen (insgesamt<br />
rund 550 Mio. m³), aufgeteilt und im Verhältnis<br />
zur Gesamtförderung <strong>aus</strong> Trinkwassertalsperren im<br />
jeweiligen Bundesland (zwischen mehr als 90 bis 100 %),<br />
dargestellt.<br />
Damit haben sich die Aktivitäten der ATT <strong>aus</strong> dem<br />
Westen immer mehr in Richtung Osten der Bundesrepublik<br />
Deutschland <strong>aus</strong>geweitet.<br />
Parallel zu dieser Entwicklung wurden von ATT-Mitgliedsunternehmen<br />
im Zuge der Intensivierung der<br />
Überwachung der Roh- und Trinkwassergüte weitere<br />
eigene leistungsfähige und einheitlich nach hohem<br />
Standard <strong>aus</strong>gerüstete Labore geschaffen. So kam es<br />
nach nahezu 25-jähriger Zusammenarbeit – zugleich<br />
begünstigt durch Entwicklungen auf dem öffentlichen<br />
und privaten Angebotssektor für Laborserviceleis tungen<br />
– zu einer wirtschaftlichen Trennung der ATT von den<br />
<strong>Wasser</strong>laboratorien Roetgen zum Ende des Jahres 1997.<br />
Ich möchte nunmehr auf die weitere Arbeit des ATT-<br />
Fach<strong>aus</strong>schusses und seine Ergebnisse eingehen.<br />
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.<br />
Heinz Bernhardt entfaltete der Fach<strong>aus</strong>schuss eine<br />
außerordentlich fruchtbare und innovative Tätigkeit mit<br />
und zur gegenseitigen Unterstützung seiner Mitglieder.<br />
Innerhalb des bereits bei der Gründung bestimmten<br />
Rahmens wurden seither die jeweils von der Mitgliederversammlung<br />
beschlossenen Arbeitsprogramme im<br />
Fach<strong>aus</strong>schuss auf jährlich zwei bis drei Sitzungen<br />
Bild 6. Entwicklung der Zahl der ATT-Mitglieder.<br />
Bild 7. Mitgliedsunternehmen der Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwasser talsperren e. V. in den Bundesländern<br />
(MU = insgesamt 34 in neun Bundesländern, Stand: 1994),<br />
von ihnen betriebene Trinkwasser talsperren (T = insgesamt 63)<br />
und <strong>aus</strong> diesen im Jahr 1994 zur Trink wasserversorgung<br />
abgegebene <strong>Wasser</strong>mengen (insgesamt rund 550 Mio. m³),<br />
aufgeteilt und ins Verhältnis zur Gesamtförderung <strong>aus</strong><br />
Trinkwassertalsperren im jeweiligen Bundesland<br />
(zwischen > 90 % bis 100 %) gesetzt.<br />
behandelt und bei Bedarf in bestehenden bzw. speziell<br />
gebildeten Arbeitskreisen und Projektkreisen weiter<br />
bearbeitet.<br />
Auf diese Weise ist es jeweils gelungen, die für die<br />
Mitglieder der ATT relevanten Fragen des Schutzes und<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1181
FachberichtE ATT Symposium<br />
der Sicherung, Untersuchung, Gewinnung, Aufbereitung,<br />
Speicherung und Verteilung von <strong>Wasser</strong> <strong>aus</strong> Trinkwassertalsperren<br />
einschließlich des Baues, Betriebes,<br />
der Sanierung und Unterhaltung der dazu dienenden<br />
Anlagen soweit möglich einer Lösung zuzuführen.<br />
Zunächst stand die Erforschung der Ursachen und<br />
Folgen der Eutrophierung von Seen und Staugewässern,<br />
dar<strong>aus</strong> abgeleitet die Entwicklung und Umsetzung<br />
von Strategien zu ihrer wirksamen Bekämpfung, im Mittelpunkt<br />
der gemeinsamen Arbeit.<br />
Bild 8 (1). ATT Technische Informationen.<br />
Bild 8 (2). ATT Technische Informationen.<br />
Dazu das Beispiel Wahnbachtalsperre<br />
Auf eigenen Untersuchungen und Forschungsprojekten<br />
des Wahnbachtalsperrenverbandes aufbauend und<br />
unterstützt durch Anregungen und ergänzende Untersuchungen<br />
der ATT sowie ihrer Mitglieder konnten am<br />
Ende der 1970er Jahre die weitere Eutrophierung der<br />
Wahnbachtalsperre durch die Errichtung und Inbetriebnahme<br />
einer zentralen Phosphor-Eliminierungsanlage<br />
am Vorbecken, flankiert von Maßnahmen im <strong>Wasser</strong>schutzgebiet,<br />
gestoppt und deren Oligotrophierung<br />
eingeleitet werden.<br />
Aufgrund der Anregungen und Vorgaben von Mitgliederversammlung,<br />
Beirat und Vorstand war und ist<br />
der Fach<strong>aus</strong>schuss der ATT im Einzelnen befasst<br />
""<br />
mit Berichten, Stellungnahmen, Durchführung von<br />
Untersuchungen über aktuelle und gemeinsam interessierende<br />
Fragen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung<br />
<strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong>, die federführend von<br />
ihm selbst oder nach Vorbereitung bzw. mit Unterstützung<br />
von Arbeitskreisen oder Projektgruppen<br />
behandelt werden.<br />
Der Fach<strong>aus</strong>schuss der ATT<br />
""<br />
erarbeitet Technische Informationen, die als Erfahrungsberichte,<br />
Anleitungen, Merkblätter und Hinweise<br />
zur Umsetzung durch die ATT-Mitglieder sowie<br />
zur Unterrichtung der Behörden, der übrigen Fachwelt<br />
und der interessierten Öffentlichkeit dienen. Sie<br />
sind in den Bildern 8 (1), 8 (2) und 8 (3) zusammenfassend<br />
wiedergegeben.<br />
Bild 8 (3). ATT Technische Informationen.<br />
Bild 9 (1).<br />
Untersuchungen, Forschungsund<br />
Entwicklungsvorhaben der<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Trinkwassertalsperren e.V.<br />
(Auswahl) (1).<br />
Dezember 2011<br />
1182 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Der Fach<strong>aus</strong>schuss<br />
""<br />
initiiert eigene, unterstützt, fördert und begleitet im<br />
Auftrag der ATT durch Dritte <strong>aus</strong>geführte Untersuchungen,<br />
Forschungs- und Entwicklungsvor haben<br />
(Beispiele siehe Bilder 9 (1), 9 (2) und 10).<br />
Die ATT gibt eine Schriftenreihe her<strong>aus</strong>, deren bisher<br />
erschienene sieben Ausgaben in den Bildern 11 (1) und<br />
11 (2) mit ihren Titeln vorgestellt sind.<br />
Den Anfang der Buchreihe bildete die Veröffentlichung<br />
„Trinkwasser <strong>aus</strong> <strong>Talsperren</strong>“ mit den Beiträgen<br />
der Vortragsveranstaltung anlässlich des 20-jährigen<br />
Bestehens der ATT im Jahr 1990 in Siegburg. Auf dieser<br />
Tagung konnten nach der Wiedervereinigung beider<br />
Teile Deutschlands erstmalig auch die der ATT beigetretenen<br />
Betreiber von Trinkwassertalsperren in den östlichen<br />
Bundesländern über ihre Erfahrungen und<br />
Erkenntnisse berichten.<br />
Mit Band 1 der ATT-Schriftenreihe beginnend wurden<br />
die auf den weiteren veranstalteten Tagungen der<br />
ATT gehaltenen Vorträge veröffentlicht (Auswahl siehe<br />
Bild 11 (3) und 11 (4)), soweit sie nicht in mehreren<br />
Sonder<strong>aus</strong>gaben der Fachzeitschrift <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<br />
<strong>Abwasser</strong> unter dem Titel „Special <strong>Talsperren</strong>“ publiziert<br />
worden sind.<br />
In den folgenden Bänden wurden auch die Vorträge<br />
auf anderen, von der ATT allein oder zusammen mit<br />
anderen technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen<br />
veranstalteten Symposien und Seminaren sowie<br />
Berichte über einzelne abgeschlossene Forschungsprojekte<br />
der ATT veröffentlicht (Bände 4 und 6).<br />
Persönlichkeiten im Vorstand und<br />
als wissenschaftliche Leiter der ATT<br />
Im letzten Teil des Rückblickes auf 40 Jahre ATT möchte<br />
ich die Erinnerung wachrufen an einige Kollegen, die<br />
sich im Vorstand und als wissenschaftliche Leiter für die<br />
Belange der ATT eingesetzt haben (Bild 12).<br />
Zum Nachfolger des 1976 <strong>aus</strong> dem Vorstand <strong>aus</strong>geschiedenen<br />
Vorsitzenden Direktor Mathias Ebeling<br />
wurde Josef Fischer <strong>aus</strong> dem gleichen Mitgliedsunternehmen<br />
gewählt und der bisherige stellvertretende<br />
Bild 9 (2).<br />
Untersuchungen, Forschungsund<br />
Entwicklungs vorhaben<br />
der ATT (Auswahl) (2).<br />
Bild 10.<br />
Forschungsprojekt Parasiten<br />
in Trinkwassertalsperren<br />
(Auswahl) (3).<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1183
FachberichtE ATT Symposium<br />
Bild 11 (1). ATT-Schriftenreihe.<br />
Bild 11 (2). ATT-Schriftenreihe.<br />
Bild 11 (3).<br />
Veröffentlichungen der ATT<br />
(Auswahl).<br />
Vorsitzende Gerhard Katz in seinem Amt erneut bestätigt.<br />
Im Jahr 1978 wechselte mit der Wahl von Dr.-Ing. Berthold<br />
Strack zum Vorsitzenden die Geschäftsführung der<br />
ATT vom <strong>Wasser</strong>werk des Landkreises Aachen zu den<br />
Stadtwerken Wuppertal AG. Dipl.-Ing. Gerhard Katz,<br />
Werkleiter des <strong>Wasser</strong>versorgungszweckverbandes Perlenbach,<br />
Monschau-Imgenbroich, wurde erneut zum<br />
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Dieses Team hat<br />
15 Jahre lang die Geschäfte der ATT erfolgreich geführt,<br />
bis mit der Neuwahl des Vorsitzenden 1993 die Geschäftsführung<br />
an den Wahnbachtalsperrenverband überging.<br />
Herr Gerhard Katz hat weiterhin und damit über 22 Jahre<br />
als stellvertretender Vorstand der ATT gewirkt.<br />
Dezember 2011<br />
1184 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Bild 11 (4).<br />
ATT-Schriftenreihe (Auswahl).<br />
Bild 11 (5).<br />
ATT-Schriftenreihe (Auswahl).<br />
Bild 12. Vorstände, wissenschaftliche Leiter und Geschäftsführung der ATT.<br />
Prof. Dr. Heinz Bernhardt hat als wissenschaftlicher<br />
Leiter von seiner Wahl bei Gründung im Jahr 1970<br />
mehr als 25 Jahre bis zu seinem unerwarteten, allzu<br />
frühen Tod am 12. Januar 1996 noch vor Vollendung<br />
des 67. Lebensjahres wie kein anderer die technischwissenschaftliche<br />
Entwicklung der ATT entscheidend<br />
geprägt. Ohne seine Ideen und sein unermüdliches,<br />
aufopferungsvolles Wirken ist die ATT nicht vorstell -<br />
bar.<br />
Im Juni 1995 wurde ihm auf Beschluss des Senats<br />
und der Fakultät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften<br />
der Technischen Universität in seiner Heimatstadt<br />
Dresden, für deren freiheitlich demokratische Erneuerung<br />
nach der politischen Wende er sich ebenfalls enga-<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1185
FachberichtE ATT Symposium<br />
Bild 13. Ehrenpromotion Prof. Dr. Heinz Bernhardt.<br />
Bild 14.<br />
BMBF-Statusseminar<br />
in memoriam Prof. Dr.<br />
Heinz Bernhardt.<br />
Bild 15.<br />
Dipl.-Biologe Dr. Jürgen Clasen (1939 – 2005)<br />
– Nachfolger von Prof. Dr. H. Bernhardt<br />
als wissenschaftlicher Leiter der ATT von<br />
1996-2004, für die ATT tätig seit ihrer Gründung<br />
im Jahr 1970, gestorben am 08. Februar 2005<br />
giert hat, mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde<br />
eine besondere Anerkennung seiner wissenschaftlichen<br />
Leistungen auf dem Gebiet der <strong>Wasser</strong>forschung und<br />
des Gewässerschutzes zuteil (Bild 13).<br />
Das gemeinsam von der ATT und der Deutschen<br />
Gesellschaft für Limnologie in Dresden veranstaltete<br />
BMBF-Statusseminar zum Abschluss des von ihm ganz<br />
wesentlich initiierten Forschungsverbundvorhabens<br />
„Stehende Gewässer“ in den neuen Bundesländern fand<br />
am 1./2. Oktober 1996 in memoriam Prof. Dr. Dr. h. c.<br />
Heinz Bernhardt statt (Bild 14).<br />
Zum Nachfolger von Professor Dr. Heinz Bernhardt als<br />
wissenschaftlicher Leiter der ATT wurde sein engster<br />
langjähriger Mitarbeiter beim Wahnbachtalsperrenverband,<br />
der Biologe Dr. Jürgen Clasen, gewählt, der die ATT<br />
seit ihrer Gründung auf technisch-wissenschaftlichem<br />
Gebiet maßgeblich mit gestaltet hat. Dr. Clasen hat sich<br />
bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2004 für die<br />
Belange der ATT ebenso erfolgreich wie sein Vorgänger<br />
eingesetzt (Bild 15).<br />
Für uns immer noch unfassbar, ist Dr. Clasen bereits<br />
ein knappes halbes Jahr nach Übertragung der wissenschaftlichen<br />
Leitung der ATT an seinen Nachfolger,<br />
Herrn Dipl.-Biologe Hartmut Willmitzer, Thüringer Fernwasserversorgung,<br />
Erfurt, am 8. Februar 2005 an den<br />
Folgen eines Herzinfarktes gestorben.<br />
Mit dem Ausscheiden des Geschäftsführers beim<br />
Wahnbachtalsperrenverband <strong>aus</strong> dem aktiven Dienst im<br />
Jahr 2001 wurden zu seinem Nachfolger als Vorsitzender<br />
der ATT der bisherige 1. Stellvertreter, Dr.-Ing. Lothar<br />
Scheuer, stellvertretender Vorstand des ATT-Mitgliedsunternehmens<br />
Aggerverband in Gummersbach, zu dessen<br />
Stellvertretern Dipl.-Ing. Jens Peters, Hauptgeschäftsführer<br />
des ATT-Mitgliedsunternehmens Thüringer <strong>Talsperren</strong>verwaltung,<br />
Tambach-Dietharz/Thüringer Fernwasserversorgung,<br />
Erfurt, und Assessor jur. Renke Droste,<br />
Geschäftsführer des ATT-Mitgliedes Harzwasserwerke<br />
GmbH, Hildesheim, gewählt. Gleichzeitig wurde erstmalig<br />
bei der ATT eine Geschäftsführung bestellt, die bis zu<br />
ihrer Übertragung auf den DVGW ab 2007 vom bisherigen<br />
Vorsitzenden <strong>aus</strong>geübt worden ist (Bild 12).<br />
Ich möchte meine Ausführungen beenden mit dem<br />
Aufruf an uns alle, den genannten und ungenannten<br />
Kollegen, die für unsere Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren<br />
gewirkt haben, ein ehrendes Andenken zu<br />
bewahren.<br />
Ich danke Ihnen!<br />
Autor<br />
Bauassessor Dipl.-Ing. Wolfram Such<br />
E-Mail: wolfram.such@t-online.de |<br />
Thüringer Allee 57 |<br />
D-53757 Sankt Augustin<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Dezember 2011<br />
1186 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Jetzt<br />
doppelt sparen:<br />
Edition<br />
15% Rabatt<br />
<strong>gwf</strong> Praxiswissen<br />
im Fortsetzungsbezug<br />
20% Rabatt<br />
für <strong>gwf</strong>-Abonnenten<br />
Diese Buchreihe präsentiert kompakt aufbereitete Fokusthemen <strong>aus</strong> der <strong>Wasser</strong>branche und Fachberichte<br />
von anerkannten Experten zum aktuellen Stand der Technik. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen individuelle<br />
Lösungen und vermitteln praktisches Know-how für ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Konzepte.<br />
Band I – Regenwasserbewirtschaftung<br />
Ausführliche Informationen für die Planung und Ausführung von Anlagen zur Regenwasserbwirtschaftung<br />
mit gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Anwendungsbeispielen <strong>aus</strong> der Praxis.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, 184 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Band II – Messen • Steuern • Regeln<br />
Grundlageninformationen über Automatisierungstechnologien, die dabei helfen, <strong>Wasser</strong> effizienter<br />
zu nutzen, <strong>Abwasser</strong> nachhaltiger zu behandeln und Sicherheitsrisiken besser zu kontrollieren.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Band III – Energie <strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
Abwärme <strong>aus</strong> dem Kanal und Strom <strong>aus</strong> der Kläranlage: Wie <strong>aus</strong> großen Energieverbrauchern<br />
Energieerzeuger werden. Methoden und Technologien zur nachhaltigen <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Band IV – Trinkwasserbehälter<br />
Grundlagen zu Planung, Bau<strong>aus</strong>führung, Instandhaltung und Reinigung sowie Sanierung von<br />
Trinkwasserbehältern. Materialien, Beschichtungssysteme und technische Ausrüstung.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
VORTEILSANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle die Fachbuchreihe <strong>gwf</strong> Praxiswissen im günstigen Fortsetzungsbezug,<br />
verpasse keinen Band und spare 15%. Ich wünsche die<br />
Lieferung beginnend ab Band<br />
als Buch + Bonusmaterial für € 46,70 (<strong>gwf</strong>-Abonnenten: € 37,30)<br />
als Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 59,40<br />
(<strong>gwf</strong>-Abonnenten: € 47,50)<br />
Wir beziehen <strong>gwf</strong> im Abonnement nicht im Abonnement<br />
Jeder aktuelle Band wird zum Erscheinungstermin <strong>aus</strong>geliefert und<br />
separat berechnet. Die Anforderung gilt bis zum schriftlichen Widerruf.<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAGWFP2011<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FachberichtE ATT Symposium<br />
Integrale <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung –<br />
ein ganzheitlicher Ansatz<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, <strong>Talsperren</strong>, Einzugsgebiet, integrale Bewirtschaftung,<br />
<strong>Wasser</strong>gütewirtschaft, Landwirtschaft<br />
Wilfried Scharf<br />
Der ganzheitliche Ansatz einer „Integralen <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung“<br />
betrachtet Einzugsgebiet und<br />
Ge wässersystem als eine räumlich-funktionale Einheit,<br />
in der <strong>Wasser</strong>- und Stoffh<strong>aus</strong>halt eng miteinander<br />
verwoben sind. Entsprechend sind <strong>Wasser</strong>mengen-<br />
und -gütewirtschaft nicht als getrennte Aufgaben<br />
anzugehen. Ziel der integralen <strong>Talsperren</strong> -<br />
bewirtschaftung ist die effiziente Sicherung eines<br />
quantitativ und qualitativ hochwertigen <strong>Wasser</strong>dargebots.<br />
Der Weg hierhin führt über eine Optimierung<br />
der Bewirtschaftung der Systemkomponenten (Wald,<br />
Grünland, Acker, Gewässer) und deren Zusammenspiel.<br />
In der Hierarchie der Bewirtschaftungsinstrumente<br />
ist eine angepasste Eintragsbewirtschaftung<br />
aufgrund von Sättigungseffekten prioritär und unabdingbar.<br />
Flankierend hierzu bietet die Gestaltung der<br />
Ökosystemstruktur sowohl der terrestrischen wie<br />
auch der aquatischen Systemkomponenten die Möglichkeit<br />
der Optimierung der Aufnahmekapazität des<br />
Gesamtsystems für unvermeidbare stoffliche Restbelastungen<br />
(integrierter Ansatz). Basierend auf einer<br />
vergleichenden Betrachtung des <strong>Wasser</strong>- und Stoffh<strong>aus</strong>halts<br />
der Systemkomponenten wird eine Vereinheitlichung<br />
und Rückführung der Vielfalt der dort<br />
ablaufenden Prozesse auf grundlegende Mechanismen<br />
angestrebt. Dabei erweist sich die Verlängerung<br />
der Aufenthaltszeit des <strong>Wasser</strong>s und damit der<br />
vom <strong>Wasser</strong> transportierten Stoffströme im System<br />
als eine Schlüsselkomponente der strategischen<br />
Ausrichtung des integrierten Ansatzes.<br />
Da die notwendigen Verwaltungsstrukturen für eine<br />
erfolgreiche Umsetzung eines ganzheitlichen An -<br />
satzes der Gewässerbewirtschaftung nur ansatzweise<br />
entwickelt sind, kommt den auf freiwilliger Basis<br />
beruhenden gemeinsamen Bemühungen von <strong>Wasser</strong>-,<br />
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft eine Schlüsselposition<br />
für die Gestaltung dieses Prozesses zu.<br />
The Holistic Reservoir Watershed-Scale Approach<br />
The holistic watershed-scale approach („Integrale<br />
<strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung”) considers the transport<br />
and fate of water, sediments, chemicals, nutrients<br />
and bacteria in the terrestrial and aquatic compartments<br />
to be tidily interlinked. Therefore, the reservoirs<br />
water quality and water quantity can not be<br />
managed disparately. If the reservoirs management is<br />
to be efficient not only the multiple environmental<br />
compartments (grassland, agricultural land, forest;<br />
streams, reservoir) but also their interplay has to be<br />
managed appropriately. Due to saturation effects<br />
input management is of major importance for reducing<br />
the input of sediments, nutrients and chemicals<br />
into the aquatic environment. In order to improve the<br />
nutrient management at the source e.g. farmer cooperations<br />
(“Landwirtschaftliche Kooperationen”) have<br />
been built. Additionally however, the ecosystem<br />
structure of each compartment needs a proper management<br />
in order to increase the natural retention<br />
capacity not only of the landscape but also of the<br />
aquatic ecosystems (ecotechnological approach).<br />
Accordingly, the processes that remove transform<br />
and store water and substances have to be considered.<br />
The particularities for each environmental compartment<br />
as well as its proper management are discussed.<br />
In general, increasing water retention reveals<br />
of major importance for increasing sediment, nutrient<br />
and chemical retention capacity in the environmental<br />
compartments.<br />
1. Einleitung<br />
Als Rohwasserquellen unterliegen Oberflächengewässer,<br />
zu denen unsere Trinkwasser-<strong>Talsperren</strong> zählen,<br />
anderen Rahmenbedingungen und Gesetzmäßigkeiten<br />
als Grundwasserspeicher. Nicht nur die gegenüber<br />
Grundwasserspeichern meist deutlich geringere Aufenthaltszeit<br />
des <strong>Wasser</strong>s im System Einzugsgebiet –<br />
Talsperre, sondern auch die unmittelbare Prägung des<br />
Abflussgeschehens und der stofflichen Belastungen<br />
resultierend <strong>aus</strong> der Flächennutzung (Struktur) und<br />
Dezember 2011<br />
1188 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Bewirtschaftung des Einzugsgebiets zwingen einer<br />
adäquaten <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung ihre eigenen<br />
Gesetzmäßigkeiten auf. Die effiziente Sicherung einer<br />
qualitativ und quantitativ guten Rohwassermenge in<br />
der Talsperre verlangt nach einem ganzheitlichen<br />
Ansatz, der über den <strong>Talsperren</strong>rand hin<strong>aus</strong>geht. Diesen<br />
Gedanken verfolgen die Mitglieder der ATT bereits seit<br />
Jahren, indem sie die Bewirtschaftung ihrer <strong>Talsperren</strong><br />
am Konzept des Multi-Barrieren-Prinzips orientieren [1].<br />
Die Einbindung der im Einzugsgebiet agierenden<br />
Akteure ist zwingend, um diesen Prozess erfolgreich<br />
umzusetzen. Beispielhaft hierfür sind die zahlreichen<br />
auf freiwilliger Basis beruhenden Kooperationen von<br />
<strong>Wasser</strong>- und Landwirtschaft.<br />
Grundlegendes Ziel einer ganzheitlichen <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung<br />
ist die Minimierung der Stoffeinträge<br />
in die aquatischen Systemkomponenten und die Erhöhung<br />
der Aufnahmekapazität dieser für unvermeidbare<br />
stoffliche Restbelastungen <strong>aus</strong> dem Einzugsgebiet.<br />
Damit wird die Schließung der Stoffkreisläufe im Einzugsgebiet<br />
zum strategischen Ziel einer integralen <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung.<br />
Nachfolgende Betrachtungen<br />
widmen sich zunächst einer Analyse des <strong>Wasser</strong>- und<br />
Stoffh<strong>aus</strong>halts der terrestrischen Systemkomponenten<br />
(Wald, Grünland, Acker). Basierend auf den sich <strong>aus</strong> den<br />
Einzelfallanalysen ableitenden Erkenntnissen rücken<br />
somit zunächst Überlegungen zu einer optimierten<br />
Bewirtschaftung der terrestrischen Systemkomponenten<br />
und der Gestaltung des Zusammenspiels dieser<br />
unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten in den<br />
Blickpunkt. Nachfolgend findet die Analyse der Struktur<br />
und Funktionsfähigkeit der aquatischen Systemkomponenten<br />
(Fließgewässer, <strong>Talsperren</strong>system) Eingang in<br />
die Betrachtungen. Hier steht die Diskussion um die<br />
Gestaltung gewässerinterner Retentionsmechanismen<br />
im Vordergrund. Bei all diesen Betrachtungen erfolgt<br />
der Versuch, über die Rückführung der Vielfalt der den<br />
Stoffrückhalt der Systemkomponenten steuernden<br />
Prozesse auf grundlegende Mechanismen eine Vereinheitlichung<br />
der Gesetzmäßigkeiten (Theoriebildung)<br />
anzustreben. Damit sollen die Grundlagen für eine<br />
strategische Ausrichtung des integrierten Bewirtschaftungsansatzes<br />
gelegt werden.<br />
2. Das Einzugsgebiet<br />
Bevor das mit dem Niederschlag ins Einzugsgebiet<br />
eingetragene <strong>Wasser</strong> die <strong>Talsperren</strong>zuläufe erreicht,<br />
durchläuft und wechselwirkt es mit den terrestrischen<br />
Systemkomponenten. Bei diesem Prozess erfährt das<br />
<strong>Wasser</strong> sowohl eine Veränderung in seiner stofflichen<br />
Zusammensetzung als auch in den abflusswirksamen<br />
Anteilen. Entsprechend sind <strong>Wasser</strong>- und Stoffh<strong>aus</strong>halt<br />
und damit auch <strong>Wasser</strong>mengen- und -gütewirtschaft<br />
im Einzugsgebiet einer Talsperre eng miteinander<br />
verwoben. Bewirtschaftungsziel des Einzugsgebiets ist<br />
die weitestgehende Minimierung der Stoff<strong>aus</strong>träge <strong>aus</strong><br />
dem terrestrischen System, d. h. die Schließung von<br />
Stoffkreisläufen. Soll die Höhe des Stoff<strong>aus</strong>trags <strong>aus</strong><br />
einem Einzugsgebiet in die Gewässersysteme reduziert<br />
werden, so gebührt grundsätzlich dem Instrument der<br />
Eintragsbewirtschaftung Priorität. Die Verringerung des<br />
Eintragssignals in ein gegebenes System wird sich mit<br />
einer gewissen zeitlichen Verzögerung im Austragssignal<br />
wieder finden. Diese Reaktionszeit ist in oberflächenwassergeprägten<br />
<strong>Talsperren</strong>systemen in der<br />
Regel deutlich kürzer als in Grundwassersystemen.<br />
Damit werden die Erfolge von Maßnahmen zeitnah<br />
erlebbar. Flankierend zur Eintragsbewirtschaftung eröffnet<br />
sich die Möglichkeit, durch eine gezielte Bewirtschaftung<br />
der Ökosystemstruktur – beispielsweise den<br />
Einsatz von Untersaaten im Maisanbau – dessen Funktionsfähigkeit<br />
zu verbessern, indem ein erhöhter<br />
system(integrierter) Stoffrückhalt das Austragssignal<br />
verringert. Naturgemäß bestehen zwischen den einzelnen<br />
terrestrischen Ökosystemtypen, beispielsweise<br />
Wald und Acker, deutliche Funktionsunterschiede mit<br />
Blick auf den <strong>Wasser</strong>- und Stoffh<strong>aus</strong>halt, die es bei der<br />
Gestaltung der Flächennutzung im Gesamtsystem zu<br />
berücksichtigen und zur Gestaltung der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
zu nutzen gilt – eine gesamtgesellschaftliche<br />
Aufgabe, die nur im Zusammenspiel mit den im System<br />
tätigen Akteuren gelöst werden kann.<br />
Beginnen wir die Betrachtungen mit einer Analyse<br />
des <strong>Wasser</strong>h<strong>aus</strong>halts. Bekannterweise ist der <strong>Wasser</strong>h<strong>aus</strong>halt<br />
eines naturnahen Waldsystems <strong>aus</strong>gegli chener<br />
Abfluss<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0 2 4 6 8 10 12 14 16<br />
Bild 1. Gleiche Niederschlagshöhen (Eingangssignale) führen<br />
in Abhängigkeit von der Einzugsgebiets- und Fließgewässerstruktur<br />
zu unterschiedlichen Abflüssen (Ausgangssignale).<br />
Zeit<br />
Wald<br />
Grünland<br />
Acker<br />
Siedlung<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1189
FachberichtE ATT Symposium<br />
dt / Jahr<br />
DIN [mg/l]<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
0<br />
Response: DIP [µg/L]<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
Phosphor-Konzentrationen<br />
GervershB GrDhünn Lingese<br />
1999 2003 2006<br />
Jahr<br />
1992<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Jahr<br />
Wald<br />
Grünland<br />
Acker<br />
Siedlung<br />
Bild 2. Die Höhe der Stoff<strong>aus</strong>träge von Fließgewässern (DIP gelöster<br />
Phosphor) reflektiert die Flächennutzungen im Einzugsgebiet dieser.<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Bild 3. Reduzierte Eintragsraten mineralischer Stickstoffdünger.<br />
A: Umsatz einer Genossenschaft im bergischen Land (gelb: Kalkammonsalpeter,<br />
rot: Mineralischer Stickstoff) – führen aufgrund der<br />
geringen Aufenthaltszeiten des <strong>Wasser</strong>s im Einzugsgebiet bergischer<br />
<strong>Talsperren</strong> zu einer unmittelbaren Reaktion bei den anorganischen<br />
Stickstoff-Konzentrationen (DIN) in den <strong>Talsperren</strong>zuläufen (B).<br />
Für die Bereitstellung von Bild A bedankt sich der Autor bei<br />
Herrn Spitz, Landwirtschaftskammer Rheinland.<br />
als jener von Produktivsystemen (Grünland, Acker) oder<br />
gar urbanen Systemen. So ist der <strong>Wasser</strong>abfluss als<br />
Reaktion auf ein gegebenes Niederschlagsereignis in<br />
einem waldreichen Einzugsgebiet niedriger und der<br />
Hochwasserscheitel ist aufgrund erhöhter Aufenthaltszeiten<br />
entsprechend gedämpft (Bild 1). Zudem ist der<br />
Gesamtabfluss verringert [2].<br />
Somit wird ein Eingangssignal vergleichbarer Intensität<br />
von den betreffenden Systemkomponenten des<br />
Einzugsgebiets in unterschiedlicher Weise verarbeitet,<br />
sodass sich die Ausgangssignale bei gleichem Eintrag<br />
unterscheiden. Die Optimierung und gezielte Nutzung<br />
der unterschiedlichen Signalverarbeitung in den Systemkomponenten<br />
fällt bei der <strong>Wasser</strong>mengenbewirtschaftung<br />
unter den Begriff „(system)“integrierter Hochwasserschutz.<br />
Jedoch hat jeder Systemrückhalt und<br />
damit auch der integrierte Hochwasserschutz seine<br />
natürlichen Grenzen. Lang andauernde intensive Niederschläge<br />
führen zu Sättigungseffekten und einer<br />
nachfolgend deutlichen Abnahme des Systemrückhalts<br />
[2]. Allerdings schmälert diese Erkenntnis den sich hier<strong>aus</strong><br />
ergebenden Nutzen nicht, da auch technische<br />
Schutzmaßnahmen ihre Bemessungsgrenzen haben<br />
und damit eine nur endliche Sicherheit bieten.<br />
Nicht nur wegen der abflussdämpfenden Wirkung,<br />
sondern auch wegen der im Vergleich zu anderen<br />
Flächennutzungen geringeren Höhe der Nähr-,<br />
Schadstoff- und Keim<strong>aus</strong>träge sind waldreiche Einzugsgebiete<br />
die von <strong>Wasser</strong>wirtschaftlern bevorzugten<br />
Flächennutzungssysteme im Einzugsgebiet von Ge -<br />
wässern (Bild 2). Während wir mit Blick auf den <strong>Wasser</strong>h<strong>aus</strong>halt<br />
die <strong>aus</strong>gleichende Wirkung des Waldes bis zur<br />
Erreichung der Sättigung aufgrund des Vergleichs mit<br />
anderen Landnutzungssystemen bei vergleichbarer<br />
Niederschlagsbeaufschlagung unzweifelhaft auf Unterschiede<br />
in der systeminternen Verarbeitung des Niederschlags-<br />
und damit Eingangssignals rückführen können,<br />
ist die Rückführung der geringen Stoff- und Keim<strong>aus</strong>träge<br />
<strong>aus</strong> Waldflächen nicht so offensichtlich den besseren<br />
systeminternen Verarbeitungsmechanismen<br />
zuzuordnen. Da waldreiche Einzugsgebiete deutlich<br />
geringer mit Nähr- und Schadstoffen beaufschlagt<br />
werden als andere Landnutzungssysteme, ist „a priori“<br />
zu erwarten, dass sich diese Unterschiede selbstverständlich<br />
auch in unterschiedlichen Austragsraten<br />
spiegeln.<br />
Da sich im Gegensatz zur Niederschlagsintensität die<br />
Höhe der Stoffeinträge in das System bewirtschaften<br />
lässt, eröffnet die angepasste Eintragsbewirtschaftung<br />
der terrestrischen Systemkomponenten (Input-Management)<br />
ein unverzichtbares Grundinstrument zur Reduktion<br />
diffuser Stoffeinträge in die Gewässer. Wie die<br />
Erfahrungen der letzten Jahre in <strong>Talsperren</strong>einzugsgebieten<br />
des Bergischen Landes überzeugend zeigen,<br />
führen beispielsweise Verringerungen landwirtschaftlicher<br />
Stickstoff-Eintragsmengen aufgrund der geringen<br />
Dezember 2011<br />
1190 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Bild 4. Jahresdynamik der anorganischen Stickstoff-Konzentra tionen (DIN)<br />
im Zulauf zur Großen Dhünn Talsperre während der Jahre 2000–2007.<br />
Aufenthaltszeit des <strong>Wasser</strong>s im Einzugsgebiet zu einer<br />
zeitnahen Abnahme der N-Konzentrationen in einigen<br />
<strong>Talsperren</strong>zuläufen (Bild 3). Zudem verbessern die<br />
Landwirte aufgrund verringerter Betriebskosten ihre<br />
Bilanzen. Unzweifelhaft ist dieser Erfolg nur unter Einbeziehung<br />
der Akteure – hier der Landwirte über die<br />
„Landwirtschaftlichen Kooperationen“ – schlussendlich<br />
für beide Seiten erfolgreich.<br />
Da parallel zur Reduzierung der Eintragsmengen<br />
auch Bemühungen zu einer Verbesserung der Methodik<br />
(Schleppschuh) und des Zeitpunkts der Ausbringung<br />
(Lagerkapazität) sowie der Systemstruktur (Uferrandstreifen,<br />
Auszäunungen, Viehtränken, Maisuntersaaten,<br />
etc.) in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft („Landwirtschaftliche<br />
Kooperationen“) erfolgten, ist <strong>aus</strong> der<br />
beobachteten Stickstoff-Konzentrationsabnahme in<br />
den Fließgewässern leider nicht abzuleiten, ob und<br />
inwieweit diese Maßnahmen zum Erfolg beigetragen<br />
haben.<br />
Wie eine Betrachtung des Stoffh<strong>aus</strong>halts und der<br />
Stoffbilanzen landwirtschaftlicher Flächen zeigt, unterliegt<br />
das Nährstoffeingangssignal einer unübersehbaren<br />
Veränderung im System [3]. So ist beispielsweise<br />
der Stickstoff-Flächen<strong>aus</strong>trag auf Grünland mit etwa<br />
20 kg N/ha gegenüber einem Eintragssignal von<br />
200 kg N/ha nicht nur deutlich verringert (Bild 6), auch<br />
das N:P Verhältnis von etwa 500–1000 : 1 im Gewässer<br />
gegenüber etwa 5 : 1 in Gülle hat sich deutlich verändert.<br />
Diese Veränderungen im Eintrags-/Austragsverhältnis<br />
sind unzweifelhaft das Ergebnis systeminterner<br />
Umsetzungsprozesse im terrestrischen System und bilden<br />
dessen Funktionsfähigkeit ab, die wiederum an die<br />
Struktur gebunden ist. Die Analyse der saisonalen Dynamik<br />
der Stickstoffkonzentrationen und Tages frachten in<br />
den <strong>Talsperren</strong>zuläufen mit Minima in den Sommermonaten<br />
(Bild 4) – bei hohen Temperaturen und langen<br />
Aufenthaltszeiten im terrestrischen System – weist<br />
unzweifelhaft biogen gesteuerte Umsetzungs- und<br />
Rückhaltprozesse als Ursache saisonal verringerter<br />
Stickstoff-Austräge <strong>aus</strong> dem terrestrischen System <strong>aus</strong>.<br />
Erhöhte Stickstoff-Aufnahmen der Vegetation in Verbindung<br />
mit erhöhten Denitrifikationsraten, welche den<br />
Stickstoff – meist als Klima wirksames Treibh<strong>aus</strong>gas<br />
N 2 O – in die Atmosphäre überführen sind hier die<br />
grundlegenden Prozesse, welche zwanglos die N-Jahresdynamik<br />
im Gewässer erklären können. Diese Jahresdynamik<br />
verdeutlicht aber auch, dass die Wirkung einer<br />
Herbstdüngung bei kurzen <strong>Wasser</strong>aufenthaltszeiten<br />
während der winterlichen Vegetationsp<strong>aus</strong>e sehr<br />
begrenzt ist und die Investition in Lagerkapazität ein<br />
wichtiger Beitrag sowohl zur Belastungsreduktion der<br />
Gewässer als auch zur Düngungseffizienz darstellt.<br />
Im Gegensatz zum Stickstoff wird der Phosphorh<strong>aus</strong>halt<br />
terrestrischer Systeme vornehmlich durch physikalisch-chemische<br />
Adsorptionsprozesse des Bodens<br />
geprägt. Vom Phosphor ist bekannt, dass dieser insbesondere<br />
an Tonmineralen und Eisenoxiden der bergischen<br />
Lehmböden adsorbiert und somit im Gegensatz<br />
zum leicht beweglichen anorganischen Stickstoff ganzjährig<br />
im System Boden zurückgehalten wird. Allerdings,<br />
wie Untersuchungen zeigen, ist die Aufnahmekapazität<br />
der Böden für den P-Rückhalt nicht unbegrenzt<br />
(Sättigungseffekte!). Allein <strong>aus</strong> diesem Grund ist eine<br />
Eintragsbewirtschaftung, welche die Höhe der Gülle<strong>aus</strong>bringung<br />
nur am Stickstoff orientiert, langfristig<br />
problematisch, da sie zu einer unerwünschten Anreicherung<br />
des Phosphors im Boden führt [4].<br />
Im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Produktivsystemen<br />
sind naturnahe Waldflächen ungedüngt.<br />
Dennoch zeigen Untersuchungen, dass auch hier<br />
deutliche Unterschiede der Signalverarbeitung in<br />
Abhängigkeit von der struktur- und betriebsbedingten<br />
Waldbewirtschaftung bestehen, die es unter wasserwirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten zu gestalten und zu<br />
nutzen gilt. Hinweise für eine optimierte Bewirtschaftung<br />
von Wald im Einzugsgebiet von <strong>Talsperren</strong> finden<br />
sich in dem von Mitgliedern der ATT erarbeiteten Merkblatt<br />
M 605 [5]. So zeigen Untersuchungen zum Konzentrationsverlauf<br />
des Stickstoffs im Sickerwasser unter<br />
einem Buchenwald und einem Fichtenforst auf benachbarten<br />
Standorten im Solling [2], dass die Stickstoff-<br />
Konzentrationen im Sickerwasser eines Fichtenforsts bei<br />
vergleichbaren Eintragsbelastungen gegenüber naturnahen<br />
Buchenwäldern deutlich erhöht sind (Bild 5).<br />
Die erhöhten jährlichen N-Eintragsraten im Fichtenforst<br />
aufgrund der erhöhten atmosphärischen Stickstoff-Auswaschungen<br />
des Fichtenforsts in Verbindung<br />
mit verminderten Aufnahmeraten durch die Fichtenwurzeln<br />
erklären diese Unterschiede. Somit koppelt hier<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1191
FachberichtE ATT Symposium<br />
Bild 5. Konzentrationsverläufe von Nitrat-Stickstoff im Sickerwasser<br />
auf einem Buchen- und Fichtenbestand auf vergleichbaren benachbarten<br />
Standorten im Solling (verändert nach [2]).<br />
<strong>Wasser</strong>s. Ob diese ihre Funktion als Senken für <strong>aus</strong>getragene<br />
Nähr-, Schadstoffe und Keime wahrnehmen<br />
können, ist eine Frage der Gewässerstruktur. Eine laterale<br />
und vertikale Anbindung der Gewässer in und an<br />
das Einzugsgebiet über Uferrandstreifen und eine<br />
intakte Gewässersohle wirken nicht nur dämpfend auf<br />
das Abflussgeschehen (Bild 1) – auch der Stoffrückhalt<br />
im Gewässersystem verbessert sich.<br />
Die vertikale Anbindung und damit der Aust<strong>aus</strong>ch<br />
zwischen <strong>Wasser</strong>körper und Gewässersohle trägt zur<br />
Dämpfung von Konzentrationsspitzen des gelösten<br />
Phosphors aufgrund der Gleichgewichtsadsorption mit<br />
den Feinsedimenten bei – solange diese nicht mit Phosphor<br />
gesättigt sind. Zwar findet adsorptiv gebundener<br />
Phosphor – wenn auch zeitlich verzögert – letztendlich<br />
den Weg zur Talsperre, steht beim Eintrag in diese aber<br />
nicht unmittelbar dem Algenwachstum zur Verfügung<br />
und unterliegt bereits beim Eintritt des <strong>Wasser</strong>s in die<br />
Vorsperren einer schnellen Sedimentation.<br />
Die Ausgestaltung entsprechend dimensionierter<br />
Uferrandstreifen verringert die Stoffeinträge in Abhängigkeit<br />
von der Struktur und Breite (=Aufenthaltszeit)<br />
(Bild 7). Dabei lässt sich der Wirkungsgrad für den<br />
Stoffrückhalt mathematisch grundsätzlich wie folgt<br />
beschreiben:<br />
C Ausgang = C Eingang · exp (–k · Breite).<br />
Bild 6. Einfluss steigender Stickstoffeinträge auf die Höhe der<br />
Stickstoff<strong>aus</strong>waschungen bei Ackerland, Dauergrünland und Wald<br />
(verändert nach [3]).<br />
die Ökosystemstruktur (Forst via Wald) unmittelbar auf<br />
die Eintragsrate (Input-Management) wie auch den<br />
Systemrückhalt des Systems (Aufnahmekapazität) für<br />
Stickstoff zurück [2]. Vergleiche mit anderen Landnutzungsformen<br />
zeigen allerdings, dass das Wald-Forst-<br />
System, insbesondere mit Blick auf den Stickstoff, schon<br />
bei geringen Eintragsraten den Sättigungsbereich<br />
erreicht [3] und der N-Austrag – wenn auch auf einem<br />
deutlich niedrigeren Niveau als in der Landwirtschaft –<br />
ungehindert in die Gewässer durchbricht. Nach diesen<br />
Untersuchungen zeigt Wald den geringsten und Grünland<br />
den höchsten Rückhalt und damit die höchste<br />
Aufnahmekapazität für Stickstoffeinträge (Bild 6).<br />
3. Die <strong>Talsperren</strong>zuläufe<br />
Als Fließgewässer sind die <strong>Talsperren</strong>zuläufe das<br />
System element mit der geringsten Aufenthaltszeit des<br />
Die optimale Gestaltung der Struktur des Uferrandstreifens<br />
orientiert sich dabei an dem in Bild 7 (A) dargestellten<br />
Aufbau [6]. Hiernach sichert vom Gewässer <strong>aus</strong><br />
kommend zunächst ein standortgerechter Baumbestand,<br />
vielfach die Erle, die Uferböschung (Zone 1) und<br />
damit die gewässerinterne Erosion, eine verbuschte<br />
Zone 2 übernimmt den Rückhalt abgetragener Bodenpartikel,<br />
also der Produkte der Flächenerosion, während<br />
ein ungedüngter Grünlandstreifen (Zone 3) als Infil trationszone<br />
gelöste Nährstoffe (vgl. Bild 6) zurückhält.<br />
Die bisherigen Ausführungen zum System Einzugsgebiet/Fließgewässer<br />
machen deutlich, dass einerseits<br />
unterschiedliche Systemkomponenten (z. B. Wald/<br />
Acker) und andererseits vergleichbare Komponenten<br />
(z. B. Forst/Wald) vergleichbare Eingangssignale an <strong>Wasser</strong>,<br />
Nähr- und Schadstoffen in Abhängigkeit von den<br />
Systemstrukturen unterschiedlich verarbeiten: Die Ökosystemstruktur<br />
bestimmt die Funktionsfähigkeit. Da der<br />
systeminterne Rückhalt einer Sättigungsfunktion folgt,<br />
ist und bleibt eine angepasste Eintragsbewirtschaftung<br />
unverzichtbares Grundinstrument einer integralen <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung:<br />
Ein noch so gut <strong>aus</strong>gestalteter<br />
Uferrandstreifen vermag Bewirtschaftungsfehler des<br />
Einzugsgebiets nicht zu kompensieren! Dennoch vermag<br />
das Wissen um die Abhängigkeit des Stoffrückhalts<br />
von der Systemstruktur die Grundlagen für ein optimiertes<br />
Zusammenspiel unterschiedlicher Flächennutzungen<br />
und somit die strategische Ausrichtung der<br />
Dezember 2011<br />
1192 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Gestaltung des Einzugsgebiets bereitzustellen. So sind<br />
dem „Konzept der differenzierten Flächen nutzung“ folgend<br />
mit zunehmender Gewässernähe extensiven Nutzungsformen<br />
Vorrang einzuräumen. Einem Übergangsstreifen<br />
Grünland – „Wald“ zur Abgrenzung einer im<br />
Einzugsgebiet erfolgenden Ackernutzung zum Gewässer<br />
hin, ist Vorrang einzuräumen gegenüber der Ausweisung<br />
eines alleinigen „Wald“übergangs streifens vergleichbarer<br />
Ausdehnung (Bild 6 und 7).<br />
4. Das <strong>Talsperren</strong>system<br />
<strong>Talsperren</strong>systeme bestehen <strong>aus</strong> einer oder mehreren<br />
Vorsperren und dem <strong>Wasser</strong>körper der Talsperre. Im<br />
Stoffh<strong>aus</strong>halt unserer Landschaft wirken <strong>Talsperren</strong>systeme<br />
als Stoffsenken. Sedimentation, speziell mit<br />
Blick auf den eutrophierungswirksamen Phosphor und<br />
partikulär gebundene Schadstoffe, ist hier der zentrale<br />
Prozess, welcher die Aufnahmekapazität des <strong>Wasser</strong>körpers<br />
für unvermeidbare stoffliche Restbelastungen<br />
darstellt. Dabei müssen gelöste Nährstoffe zunächst im<br />
<strong>Talsperren</strong>system partikularisiert werden, bevor sie<br />
sedimentieren können. Dies geschieht meist durch<br />
biogene Prozesse, welche bereits in den Vorsperren<br />
beginnen.<br />
Bedingt durch die Abnahme der Schleppkraft des<br />
<strong>Wasser</strong>s sedimentieren in den Vorsperren zunächst die<br />
von der fließenden Welle mitgeführten, bereits in partikulärer<br />
Form vorliegenden, also an Feinsedimente und<br />
Schwebstoffe gebunden Nähr- und Schadstoffe. Darüber<br />
hin<strong>aus</strong> setzt aber bereits in den Vorsperren zusätzlich<br />
die Partikularisierung gelöster Stoffe durch biogene<br />
Prozesse und deren nachfolgende Sedimentation ein.<br />
Diese Prozesse können durch Auslegung und Betrieb<br />
der Vorsperren gefördert werden [8]. Dabei kommt der<br />
Aufenthaltszeit des <strong>Wasser</strong>s für den Nährstoff- und<br />
Keimrückhalt eine Schlüsselposition zu. Zudem bietet<br />
sich in Vorsperren der gezielte Rückhalt von Schwimmstoffen,<br />
wie z. B. Öl als Folgewirkung von Unfällen im<br />
Einzugsgebiet, an.<br />
Wie uns die OECD Modelle der 70er-Jahre zeigen [9],<br />
ist die sich im See einstellende Phosphor-Konzentration<br />
proportional zur Phosphor-Zulaufkonzentration, aber<br />
umgekehrt proportional zur <strong>Wasser</strong>aufenthaltszeit. Entsprechend<br />
zeichnen sich tiefe <strong>Talsperren</strong> mit langen<br />
Aufenthaltszeiten aufgrund der erhöhten Phosphor-<br />
Sedimentation durch eine erhöhte Aufnahmekapazität<br />
für Phosphoreinträge <strong>aus</strong> (Bild 8).<br />
Da sich die Aufenthaltszeit in einer Talsperre nach<br />
deren Errichtung nicht mehr beeinflussen lässt, bleibt<br />
die Eintragsminderung des Phosphors über die Zuläufe<br />
das Hauptinstrument der Gewässergütebewirtschaftung<br />
von <strong>Talsperren</strong> („bottom-up“ Ansatz). Aber, wie<br />
sich <strong>aus</strong> der Strenge der Beziehung zwischen Algenentwicklung<br />
und Phosphoreintragssignal (Bild 8) ersehen<br />
lässt, finden sich selbst bei vergleichbaren Phosphor-<br />
Zulaufkonzentrationen und Aufenthaltszeiten nicht<br />
C Austrag<br />
= C Eintrag<br />
· exp(–k · L)<br />
Bild 7. Bei optimaler Struktur eines Uferrandstreifens (A) ist der<br />
Stoffrückhalt abhängig von der Breite (L) des Uferrandstreifens (B)<br />
und damit der <strong>Wasser</strong>-/Stoffaufenthaltszeit in diesem (verändert nach<br />
[6, 7]).<br />
Bild 8. Die Algenentwicklung (Chl Chlorophyllkonzentration) in<br />
einer Talsperre ist proportional zur Phosphoreintragsrate (Pi) und<br />
umgekehrt porportional zur Aufenthaltszeit (ζw) des <strong>Wasser</strong>s. Allerdings<br />
finden sich auch bei vergleichbaren Phosphoreintragsraten<br />
erhebliche Schwankungsbreiten beim Antwortsignal (Pfeil), die es in<br />
der <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung zu nutzen gilt (verändert nach [9]).<br />
A<br />
B<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1193
FachberichtE ATT Symposium<br />
ohne Daphnia<br />
mit Daphnia<br />
Gesamt-Phosphor (Frühjahr)<br />
15 25 35 45 55<br />
Gesamt-P [µg/l]<br />
Relative Häufigkeit<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
ohne Daphnia<br />
mit Daphnia<br />
Sommerliche Sichttiefen<br />
Variables<br />
0,2<br />
ohne Daphnia<br />
mit Daphnia<br />
0<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
Sichttiefen [m]<br />
Gesamt-P (Sommer)<br />
10 20 30 40<br />
Gesamt-P [µg/l]<br />
Bild 9. Seit dem Auftreten der Großfiltrierer (Daphnia hyalina) klart<br />
die Wupper-Talsperre in den Sommermonaten auf und das sommerliche<br />
epilimnische Phosphorangebot für die Algenentwicklung ist<br />
bei gleicher frühjährlicher Phosphor-Startkonzentration gegenüber<br />
früheren Jahren gesunken.<br />
Bild 10. Die Nahrungsnetzbewirtschaftung zielt auf die Förderung<br />
von Großfiltrierern (Rechteck: z. B. Daphnia hyalina), um die<br />
kleinen nicht sedimentierenden Schwebstoffe (Kreis) <strong>aus</strong> dem<br />
<strong>Wasser</strong> zu entfernen (verändert nach [13]), vgl. Bild 11.<br />
übersehbare Schwankungen bei den sich in der Talsperre<br />
einstellenden Phosphor- und letztlich auch Chlorophyll-Konzentrationen:<br />
Bei gleichem Eingangssignal<br />
ist das Antwortsignal – also die Reaktion der Talsperre<br />
auf ein gegebenes Phosphorangebot – unterschiedlich.<br />
Verantwortlich hierfür sind u. a. Nahrungsketteneffekte,<br />
deren Bewirtschaftung über das „top-down“ Instrument<br />
der Nahrungsnetzbewirtschaftung erfolgt [10]. Die<br />
Reaktion der Talsperre auf eine erfolgreiche Nahrungsnetzbewirtschaftung<br />
zeigt sich durch erhöhte Sichttiefen<br />
und verringerte Chlorophyll- und Phosphor-<br />
Konzentrationen [11] (Bild 9). Allerdings ist auch dieses<br />
Instrument in seiner Wirkung auf niedrige bis mittlere<br />
Phosphorbelastungen beschränkt und ersetzt keinesfalls<br />
eine <strong>aus</strong>reichende Absenkung der Phosphor belastung<br />
[12].<br />
Grundlegendes Instrument einer Nahrungsnetzbewirtschaftung<br />
ist eine angepasste fischereiliche Bewirtschaftung<br />
von <strong>Talsperren</strong>, welche zunächst darauf zielt,<br />
den Bestand an Zooplankton (Daphnia) fressenden<br />
Kleinfischen zu begrenzen, um die Entwicklung möglichst<br />
großer Daphnien zu ermöglichen (Bild 10). Dies<br />
geschieht meist über eine Förderung der Raubfischbestände<br />
durch entsprechende Besatzmaßnahmen mit<br />
dem Ziel, den Fraßdruck der das Zooplankton fressenden<br />
Kleinfische soweit zu verringern, dass sich Großfiltrierer<br />
in der Talsperre entwickeln können [10]. Die<br />
Erfolgskontrolle der eingeleiteten Maßnahmen lässt<br />
sich dabei wirkungsvoll über den CommunitySizeIndex<br />
[13] begleiten.<br />
Das bevorzugte Nahrungsgrößenspektrum des filtrierenden<br />
Zooplanktons der Gattung Daphnia sind, wie<br />
bereits erwähnt, kleine und nahezu nicht sedimentierende<br />
Partikel (< 50 µm) (Bild 10 und 11). Da die Sedimentationsrate<br />
bei gegebener Partikel(Plankton)konzentration<br />
ebenso wie das Ausmaß der Lichtstreuung<br />
nicht nur von der Partikelkonzentration, sondern<br />
ebenso von der Partikelgrößenverteilung abhängig ist,<br />
führt die Entwicklung der Großfiltrierer sowohl zu einem<br />
Auf klaren des <strong>Wasser</strong>s der Talsperre als auch einer<br />
Abnahme der Phosphorverfügbarkeit für das Algenwachstum<br />
bei gleicher Phosphorbelastung aufgrund<br />
erhöhter Phosphorsedimentationsraten (Bild 9): Die<br />
Aufnahme kapazität der Talsperre für die Verarbeitung<br />
des <strong>aus</strong> unvermeidbaren stofflichen Restbelastungen<br />
stammenden Eintragssignals hat sich erhöht.<br />
Nicht genug des Guten. Insbesondere die Vorliebe<br />
der Großfiltrierer (Daphnia) für Algen der Größenklasse<br />
< 40 µm und damit für bewegliche und sich der Sedimentation<br />
entziehende Cryptomonaden, welche<br />
sowohl bei der Sandfiltration als auch Mikrosiebung im<br />
<strong>Wasser</strong>werk nur schwer zu entfernen sind, unterstreicht<br />
die Bedeutung einer Bewirtschaftung der Ökosystemstruktur<br />
des <strong>Wasser</strong>körpers der Talsperre über eine<br />
gezielte fischereiliche Bewirtschaftung [10] mit Blick auf<br />
die Sicherung und Unterstützung der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
(Bild 11).<br />
5. Der Unterlauf<br />
Unzweifelhaft stellt die Errichtung einer Talsperre eine<br />
tief greifende Veränderung des betroffenen Fließgewässersystems<br />
dar. Damit wird die weitestgehend ökologisch<br />
verträgliche Einbindung der Talsperre in das<br />
Dezember 2011<br />
1194 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Fließgewässersystem Ziel einer integralen <strong>Talsperren</strong>bewirtschaftung.<br />
Nicht nur die Durchgängigkeit des<br />
Fließgewässers wird durch die Errichtung einer Talsperre<br />
unterbrochen. Da jede Talsperre als Stoffsenke wirkt, ist<br />
auch der Transport von Nähr- und Feststoffen (Geschiebetrieb)<br />
unterbrochen. Darüber hin<strong>aus</strong> kommt es unterhalb<br />
tiefer Trinkwassertalsperren, bedingt durch die<br />
Abgabe kalten Tiefenwassers, zu einer Veränderung des<br />
Temperaturregimes, welche sich un<strong>aus</strong>weichlich auf die<br />
Struktur der meist wechselwarmen aquatischen Biozönose<br />
<strong>aus</strong>wirkt. In der Summe führen diese Veränderungen<br />
zu einer Rhithralisierung der unterhalb gelegenen<br />
Gewässerabschnitte – also zu einer Beeinträchtigung<br />
der gewässertypspezifischen Biozönose mit<br />
entsprechender Abwertung nach den Bewertungsregeln<br />
der WRRL. Dies gilt insbesondere für <strong>Talsperren</strong>,<br />
welche die Äschenregion mit ihrem Ablauf bedienen.<br />
Ein an das natürliche Abflussgeschehen angepasster<br />
wassermengenwirtschaftlich neutraler Betrieb, welcher<br />
die natürliche saisonale Abfluss- und Temperaturdynamik<br />
in ihren Grundzügen abbildet, bietet dabei<br />
eine Möglichkeit der Verringerung negativer Auswirkungen<br />
des <strong>Talsperren</strong>betriebs auf den Unterlauf [1].<br />
Literatur<br />
[1] Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT): Integrale<br />
Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren gemäß DIN<br />
19700. ATT-Schriftenreihe Bd. 7, München: Oldenbourg<br />
Verlag, 2009.<br />
[2] Bredemeier, M.: Der Beitrag von Wald- und Forstwirtschaft<br />
zum Management des <strong>Wasser</strong>h<strong>aus</strong>halts. <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
150 (2009) Nr. 11, S. 904–909.<br />
[3] Kolbe, H.: Einfluss der Landnutzung auf Kriterien des <strong>Wasser</strong>schutzes.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 151 (2010) Nr. 5, S. 42–44.<br />
[4] Lehmann, J., Lan, Z., Hyland, C., Sato, S., Solomon, D. and Ketterings<br />
,Q. M.: Long-term dynamics of phosphorus forms and<br />
retention in manure-amended soils. Environmental Science<br />
and Technology 39 (2005), p. 6672–6680.<br />
[5] DVGW: Behandlung des Waldes in <strong>Wasser</strong>schutzgebieten für<br />
Trinkwassertalsperren. Merkblatt W 105 (2002).<br />
[6] Gunkel, G.: Renaturierung kleiner Fließgewässer. Stuttgart:<br />
G. Fischer, 1996.<br />
[7] Mander, Ü.: Efficiency of Riparian Buffer Zones, 2006. www.<br />
ruoko.fi/uploads/pdf/UloMander1.pdf.<br />
[8] DWA: Wirkung, Bemessung und Betrieb von Vorsperren zur<br />
Verminderung von Stoffeinträgen in <strong>Talsperren</strong>. Merkblatt<br />
M 605, 2005.<br />
[9] OECD: Eutrophication of Waters. Organization of Economic<br />
Cooperation and Developement, Paris, 1982.<br />
[10] Willmitzer, H., Werner, M. G. and Scharf, W.: Fischerei und<br />
fischereiliches Management von Trinkwassertalsperren.<br />
ATT Technische Information Nr. 11, München: Oldenbourg<br />
Verlag, 2000.<br />
[11] Scharf, W.: The use of nutrient reduction and food-web<br />
management to improve water quality in the deep stratifying<br />
Wupper Reservoir, Germany. Hydrobiologia 603 (2008),<br />
p. 105–115.<br />
Bild 11. Schematische Gegenüberstellung zweier großtechnischer<br />
Filtersysteme (a Schnellsandfilter, b Mikrosiebfilter) mit der Feinstruktur<br />
der Filterkämme des <strong>Wasser</strong>flohs Daphnia hyalina (c: rot). Während<br />
die Geißelalge Rhodomonas die technischen Filtersysteme passiert wird<br />
sie von <strong>Wasser</strong>flöhen erfolgreich <strong>aus</strong>gefiltert (verändert nach [14]).<br />
[12] Benndorf, J.: Food-web control without nutrient control:<br />
useful strategy in lake restoration? Schweizer Zeitschrift für<br />
Hydrologie 49 (1987), p. 237–248.<br />
[13] Willmitzer, H., Große, N., Mehling, A., Nienhüser, A., Scharf, W.<br />
und Stich, B. H.: Bewertung und Bedeutung der Biofiltration<br />
des Zooplanktons zur Verbesserung der <strong>Wasser</strong>qualität in<br />
<strong>Talsperren</strong>. <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 151 (2010) Nr. 11, S. 1070–<br />
1075.<br />
[14] Röske, I. und Uhlmann, D.: Biologie der <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Stuttgart: Ulmer, 2005.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Korrektur: 21.10.2011<br />
Dr. rer. nat. Wilfried Scharf<br />
E-Mail: scha@wupperverband.de |<br />
Wupperverband |<br />
Untere Lichtenplatzer Straße 100 |<br />
D-42289 Wuppertal<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1195
FachberichtE ATT Symposium<br />
Modernisierung/Neubau der<br />
SEBES Trinkwasseraufbereitungsanlage<br />
Esch/Sauer<br />
Praxis-Bericht von Pilotuntersuchungen mit Keramikmembranen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Trinkwasseraufbereitung, Trinkwassertalsperre, keramische Membranen,<br />
Verfahrenstechnik<br />
Stefan Panglisch, André Tatzel, Georges Kr<strong>aus</strong>, Isabelle Kolber, Christian Schroeder und Jean-Paul Lickes<br />
Pilotuntersuchungen zur Modernisierung einer <strong>Talsperren</strong>wasseraufbereitung<br />
haben gezeigt, dass mit<br />
keramischen Membranen sehr hohe Ausbeuten und<br />
Membranflüsse bei gleichzeitig nur geringem Chemikalienverbrauch<br />
erreichbar sind. Unter der Vor<strong>aus</strong>setzung<br />
einer etwa doppelten Lebenserwartung im<br />
Vergleich zu polymeren Membranen, könnten die<br />
erzielten Werte durch<strong>aus</strong> die höheren spezifischen<br />
Kosten der Keramikmembranen <strong>aus</strong>gleichen.<br />
Refurbishment/New Construction of the SEBES<br />
Drinking Water Treatment Plant Esch/Sauer<br />
Pilot investigations for the modernization of a reservoir<br />
water treatment have shown that with ceramic<br />
membranes extraordinary performance can be<br />
achieved. Very high recovery and flux could be<br />
attained with only small chemical consumption. Provided<br />
that ceramic membranes have double the lifetime<br />
compared to polymeric membranes these high<br />
performance characteristics could thoroughly balance<br />
the higher specific costs of ceramic membranes.<br />
1. Einleitung<br />
Das Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (<strong>Wasser</strong>verband<br />
der Talsperre Esch/Sauer: SEBES) ist als größter<br />
<strong>Wasser</strong>versorger in Luxemburg für die Lieferung der<br />
Bild 1. Mehrzwecktalsperre Esch/Sauer mit<br />
Trinkwasseraufbereitungsanlage.<br />
Hälfte des Trinkwasserbedarfs des Landes verantwortlich.<br />
Seit 1969 betreibt die SEBES in Esch-sur-Sûre<br />
ein <strong>Wasser</strong>werk zur <strong>Talsperren</strong>wasseraufbereitung der<br />
Sauer-Talsperre mit den Verfahrensstufen Ozonung,<br />
Flockung und Filtration, Aufhärtung und Desinfektion<br />
(Bild 1).<br />
Das <strong>Wasser</strong>werk hat augenblicklich eine Kapazität<br />
von maximal 70 000 m 3 /d. Nach 40 Betriebsjahren<br />
besteht der Bedarf, den Aufbereitungsprozess einerseits<br />
zu modernisieren und an zukünftige Anforderungen<br />
anzupassen sowie andererseits die Produktionskapazität<br />
auf mindestens 100 000 m 3 /d zu erhöhen. Für die<br />
Modernisierung der Trinkwasseraufbereitungsanlage<br />
(TWA) lassen sich die zukünftigen Aufbereitungsziele<br />
wie in Tabelle 1 dargestellt zusammenfassen.<br />
Die umfangreiche Modernisierung der TWA erfordert<br />
detaillierte und konkrete Vorplanungen einschließlich<br />
technischer Langzeit-Pilotversuche mit verschiedenen<br />
Membranprozessen und Membranmaterialien.<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> wurde von der SEBES mit der Planung,<br />
Durchführung und Bewertung der Pilotversuche<br />
be auf tragt. Hauptaufgabe war es, verschiedene<br />
Verfahrens varianten im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit<br />
sowie verfahrenstechnische Eignung im halbtechnischen<br />
Maßstab in der SEBES Trinkwasseranlage<br />
Dezember 2011<br />
1196 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Tabelle 1. Zusammenfassung der erweiterten<br />
Aufbereitungsziele.<br />
Aufbereitungsziele<br />
Sicherstellung der Partikelentfernung auch<br />
bei extremer Schwankung der Rohwasserqualität<br />
(z. B. starke Regenfälle, Entnahme von Flusswasser,<br />
Algenblüte) sowie<br />
bei Ausfall einzelner Aggregate oder<br />
Verfahrensstufen (Redundanz)<br />
Reduktion der Konzentration organischer<br />
<strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe in Bezug auf<br />
organische Spurenstoffe, bspw. POP (persistente<br />
organische Spurenstoffe), Pestizide<br />
bioverfügbare organische <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe<br />
THM-Vorläufersubstanzen<br />
Färbung, Geruch und Geschmack<br />
Elimination von Viren<br />
Entfernung von Ammonium<br />
Entmanganung<br />
Aufhärtung und Stabilisierung<br />
(Verbesserung der Korrosionschemie)<br />
Desinfektion<br />
Möglichkeit zur direkten Flusswasseraufbereitung<br />
(bei Revision der Talsperre)<br />
eingehend zu untersuchen. Die Ergebnisse <strong>aus</strong> den<br />
Pilotversuchen dienten als Datenbasis für die Bewertung<br />
der einzelnen Verfahren <strong>aus</strong> verfahrenstechnischer,<br />
wirtschaftlicher und ökologischer Sicht.<br />
2. Stand des Wissens<br />
Derzeit werden zur Trinkwasseraufbereitung weltweit<br />
keine Membrananlagen mit keramischen Membranen<br />
im groß-technischen Maßstab außerhalb Japans betrieben.<br />
Mit Stand Juli 2011 sind hier etwa 104 Anlagen mit<br />
einer Gesamtproduktionskapazität von etwa 500 000 m³<br />
pro Tag in Betrieb bzw. befinden sich im Bau (Bild 2). Die<br />
in Japan betriebenen Anlagen werden maßgeblich zur<br />
Aufbereitung von Flusswasser eingesetzt. Eine <strong>Talsperren</strong>wasseraufbereitung<br />
existiert nicht.<br />
Abgesehen von Beschreibungen von Kurzzeit- oder<br />
Laborversuchen [1–11], ist Literatur zu großtechnischen<br />
Langzeit-Pilotversuchen mit keramischen Membranen<br />
an europäischen <strong>Talsperren</strong> nur sehr selten zu finden.<br />
Aufgrund der besonderen Eigenschaften keramischer<br />
Membranen [9] sind solche Ergebnisse jedoch von<br />
besonderem Interesse und werden daher hier schwerpunktmäßig<br />
beschrieben.<br />
3. Versuchsdurchführung<br />
Die Pilotversuche starteten im Juni 2008 für einen Zeitraum<br />
von 11 Monaten. Verschiedene innovative und<br />
konventionelle Aufbereitungsprozesse in Kombination<br />
mit Membranverfahren wurden getestet, um die optimale<br />
Lösung hinsichtlich Leistungsfähigkeit und verfahrenstechnischer<br />
Eignung zu bestimmen. Die einzelnen<br />
Wadashima (10.500 m 3 /d)<br />
Anzahl der Anlagen<br />
Gesamtproduktionskapazität<br />
Aufbereitungslinien unterschieden sich durch verschiedene<br />
Vor- und Nachbehandlungen (Ozonung, Pulverkohle<br />
(PAK)) sowie Membranprozesse und Membranmaterialien<br />
(Bild 3). Die zu bewertenden unterschiedlichen<br />
Ultra- und Mikrofiltrationsstufen (UF/MF)<br />
umfassten Druck- und Saugbetrieb, das In/Out- und<br />
Out/In-Verfahren sowie verschiedene Membranmaterialien<br />
wie Keramik und die Polymerwerkstoffe Polyvinylidenfluorid<br />
(PVDF) und Polyethersulfon (PES). Die entsprechenden<br />
Anlagen wurden mit Membranen der<br />
Firmen Zenon, Pall, Inge und Metawater betrieben. Weiterhin<br />
wurde der Einsatz von Nanofiltrations- und<br />
Umkehrosmosemembranen (NF und RO) mit Produkten<br />
der Fa. Dow getestet.<br />
In der Tabelle 2 sind die untersuchten Aufbereitungsvarianten<br />
zusammengefasst und die betrachteten<br />
< 1.000 m 3 /d<br />
< 10.000 m 3 /d<br />
< 100.000 m 3 /d<br />
> 100.000 m 3 /d<br />
Trinkwasseraufbereitung<br />
Aufbereitung gereinigten<br />
<strong>Abwasser</strong>s zur Wiederverwendung<br />
Gesamt<br />
104<br />
505.200 m 3 /d<br />
Stand Juli 2011<br />
Bild 2. Standort und Kapazität von betriebenen und in Bau<br />
befindlichen Trinkwasseraufbereitungsanlagen mit keramischen<br />
Membranen in Japan (Stand Juli 2011; Abbildung mit Erlaubnis<br />
von Metawater).<br />
Biologische<br />
Filtration<br />
Sand<br />
Vorozonung<br />
Soda<br />
ggf. Pulverkohle<br />
pH pH pH<br />
Flockung Flockung Flockung<br />
MF<br />
Out/In<br />
PVDF<br />
Pall<br />
UF<br />
Out/In<br />
PVDF<br />
Zenon<br />
Biologische<br />
Filtration<br />
Blähton<br />
MF<br />
In/Out<br />
Keramik<br />
Metawater<br />
Rohwasser<br />
ggf. Pulverkohle<br />
pH<br />
Flockung<br />
MF<br />
In/Out<br />
Keramik<br />
Metawater<br />
Soda<br />
pH<br />
Flockung<br />
Ozon oder<br />
Ozon/H 2 O 2<br />
Biologische<br />
Filtration<br />
Aktivkohle<br />
UF<br />
In/Out<br />
PES<br />
Inge<br />
Biologische<br />
Filtration<br />
Aktivkohle<br />
Bild 3. Schematische Darstellung der Verfahrensvarianten.<br />
pH<br />
Antiscalant<br />
NF/RO<br />
pH<br />
Mehr-<br />
schicht-<br />
Filtration<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1197
FachberichtE ATT Symposium<br />
Tabelle 2. Übersicht Aufbereitungsverfahren und Fragestellungen.<br />
Aufbereitungsverfahren<br />
Fragestellungen<br />
Ultra- oder Mikrofiltration<br />
Druck- oder Saugbetrieb<br />
Membranmaterial: PES, PVDF, Keramik<br />
Out/In oder In/Out-Modus<br />
Umkehrosmose oder Nanofiltration Vorbehandlung mit Mehrschicht- oder<br />
Ultrafiltration<br />
Oxidation<br />
Vor oder nach einer Membranfiltration<br />
Ozon oder Peroxon-Prozess (Ozon +<br />
<strong>Wasser</strong>stoffperoxid)<br />
Sorption<br />
Pulverkohle oder granulierte Aktivkohle<br />
Biologische Filtration<br />
Blähton, Sand oder granulierte<br />
Aktivkohle<br />
Tabelle 3. Übersicht der zeitlichen Entwicklung der Rohwasserqualität über<br />
den Pilotierungszeitraum.<br />
Parameter 1.06.08–<br />
31.08.08<br />
1.09.08–<br />
30.11.08<br />
1.12.08–<br />
28.02.2009<br />
1.03.09–<br />
30.04.09<br />
Temperatur [C°] 7,1–9 9–14 8,4–3 3,1–5,1<br />
Trübung [NTU] 0,5–1,9 0,5–4 0,9–6,8 0,2–5,4<br />
SAK 436 [1/m] 0,29–0,47 0,26–0,63 0,31–0,59 0,27–0,43<br />
SAK 254 [1/m] 3,2–5,5 4,1–9,0 5,2–8,5 4,2–6,1<br />
TOC [mg/L] 1,4–3,7 1,7–4,2 1,9–4,0 1,6–4,0<br />
Ca 2+ [mg/L] 10–10,6 10,2–11,6 10,1–11,8 9,9–10,7<br />
Mg 2+ [mg/L] 4,4–4,8 4,5–5,1 4,5–5,2 4,4–4,9<br />
O 2 [mg/L] 6,9–11,2 3,3–10,9 9,7–12,8 11,1–12,9<br />
NO<br />
– 3 [mg/L] 19,8–23,0 12,7–21,5 15,6–22,1 19,2–22,2<br />
Al tot [µg/L] 7–73 4–67 15–375 20–268<br />
Fe tot [µg/L] 12–41 13–252 60–252 43–184<br />
Mn tot [µg/L] 7–81 13–165 14–50 21–49<br />
Coliforme [1/100mL] 6–41 14–1.046 5–1.733 4–435<br />
E. coli [1/100mL] 0 0–113 4–580 0–186<br />
KBE 22 °C [1/mL] 60–350 140–1.350 190–2.950 80–1.870<br />
KBE 36 °C [1/mL] 10–110 20–380 20–470 60–420<br />
1 . Generation<br />
L=1.000mm 0,4 m 2<br />
3. Generation<br />
L=1.500mm 25m 2<br />
Bild 4. Keramikmodule verschiedener Generationen.<br />
2 . Generation<br />
L=1.000mm 15m 2<br />
Fragestellungen beschrieben. Jeder Aufbereitungsprozess<br />
wurde hinsichtlich Produktionsleistung, Betriebssicherheit<br />
und -stabilität, Filtratqualität und Entfernungsleistung<br />
(z. B. Mikroorganismen, organische<br />
Inhaltsstoffe), Wartungsaufwand sowie Energie- und<br />
Chemikalienbedarf bewertet.<br />
4. Material und Methoden<br />
Als Rohwasser für alle Varianten diente wie für die TWA<br />
das <strong>Talsperren</strong>wasser der Sauer-Talsperre (Tabelle 3).<br />
Zur Versorgung der Pilotanlagen wurde der Zuleitung<br />
vom Rohwasserbecken zur großtechnischen TWA ein<br />
Teilstrom entnommen. Eine Druckerhöhungspumpe<br />
förderte das Rohwasser (rund 20 m 3 /h) über einen<br />
au tomatisch rückspülbaren Vorfilter (300 µm) bedarfsgerecht<br />
auf die verschiedenen Verfahrensvarianten.<br />
In die Pilotanlage der Firma Metawater wurden keramische<br />
Membranen der ersten Generation (Bild 4) eingesetzt,<br />
die in dieser Bauart nur noch in Versuchsanlagen<br />
verwendet werden. Für die Umsetzung einer<br />
großtechnischen Anlage werden dahingegen Module<br />
der 3. Generation verwendet. Aufgrund der Bauart der<br />
Membranen lassen sich jedoch die mit Membranen der<br />
1. Generation ermittelten Daten auch auf die größeren<br />
Module übertragen. Dies wurde in einem weiteren Pilotierungsprojekt,<br />
bei dem ein keramisches Modul der<br />
1. Generation parallel zu einem der 3. Generation betrieben<br />
wurde, bestätigt. Hierbei konnte gezeigt werden,<br />
dass die Leistungsfähigkeit des großtechnischen<br />
Moduls dem des kleineren Moduls mindestens gleichwertig<br />
ist.<br />
Die Membran besteht bei allen Generationen <strong>aus</strong><br />
Al 2 O 3 . Die aktive Membranschicht besitzt eine nominale<br />
Porengröße von 0,1 µm. Das Versuchsmodul wies bei<br />
einer Gesamtfläche von 0,4 m² eine Länge von 1 m auf.<br />
Der äußere Durchmesser betrug 30 mm, wobei das<br />
Modul 55 Feed-Kanäle enthielt. Der innere Durchmesser<br />
der Kanäle beträgt bei allen Generationen 2,5 mm. Der<br />
Betrieb der Membranmodule erfolgte im Dead-End In/<br />
Out Modus.<br />
Die Versuchsanlage war in einem Überseecontainer<br />
(Bild 5) untergebracht und bestand <strong>aus</strong> drei identisch<br />
aufgebauten Linien, jeweils mit zwei Membranelementen<br />
der 1. Generation <strong>aus</strong>gerüstet. Die Linien konnten<br />
unabhängig voneinander betrieben werden, bspw. hinsichtlich<br />
des Filtratflusses, der Reinigungsprozedur oder<br />
der vorhergehenden Flockung (Flockungsmittel Polyaluminiumchlorid<br />
(PACl)).<br />
Das Zulaufwasser für die drei Linien gelangte direkt<br />
von den Verteilungen in jeweils einen Feedtank. In diesem<br />
Behälter wurde der pH-Wert auf einen vorher definierten<br />
Wert zur Flockung eingestellt (Ziel pH-Wert für<br />
die Flockung etwa 6,5). Dazu befanden sich in den<br />
Feedtanks pH-Messsonden sowie regelbare Rührer zur<br />
besseren Einmischung der Säure. Das so behandelte<br />
<strong>Wasser</strong> wurde daraufhin mittels einer Kreiselpumpe zur<br />
Dezember 2011<br />
1198 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Membran gepumpt. Direkt vor dem Einlauf in die Druckerhöhungspumpe<br />
wurde das Flockungsmittel kontinuierlich<br />
zudosiert. Die Kreiselpumpe sorgte dabei für den<br />
notwendigen hohen Energieeintrag zur augenblicklichen<br />
Vermischung. Zwischen Kreiselpumpe und Membranmodul<br />
befand sich die Flockungsstrecke in Form<br />
einer Schlauchleitung. Der Durchmesser der Schlauchleitung<br />
wurde dabei so gewählt, dass sich je nach Flux<br />
die für die Ausbildung von Mikroflocken notwendigen<br />
G-Werte zwischen 200 und 500 1/s einstellten. Anschließend<br />
wurde das <strong>Wasser</strong> durch die keramische Membran<br />
filtriert.<br />
Aufgrund der hohen mechanischen Stabilität erlaubt<br />
die Membranfiltration mit Keramikmembranen die<br />
Durchführung effektiver Spülungen bei hohen Drücken<br />
(5 bar), sowohl mit <strong>Wasser</strong> als auch mit Luft. Dadurch<br />
werden sowohl Membranbeläge entfernt als auch das<br />
Verblocken der Membranporen vermindert (Bild 6). Der<br />
zeitliche Abstand der Spülungen richtet sich nach der<br />
Rohwasserqualität und dem eingestellten Flux. Bei den<br />
Pilotuntersuchungen konnte er bis auf 2 Stunden <strong>aus</strong>gedehnt<br />
werden.<br />
Etwa jedes 10. Mal wurde zur Unterstützung der<br />
Rückspülung zusätzlich Schwefelsäure in den Rückspülbehälter<br />
dosiert, bis sich ein pH-Wert von etwa 2 einstellte.<br />
Das angesäuerte Filtrat wurde dann mit geringem<br />
Rückspüldruck in die Membran eingebracht (so<br />
genannte CEB = Chemikalien-unterstützte Rückspülung).<br />
Dann folgte eine Einwirkzeit von 10 min. Im<br />
Anschluss wurde eine normale Rückspülung durchgeführt,<br />
um die Chemikalienlösung <strong>aus</strong>zuwaschen.<br />
Allerdings kann es bei der Durchführung von Pilot-<br />
Versuchen an der Leistungsgrenze, bei langen Betriebszeiten<br />
oder bei sehr ungünstiger Rohwasserqualität<br />
trotz regelmäßiger Durchführung einer CEB, zu einem<br />
signifikanten Absinken der Permeabilität kommen. In<br />
diesem Fall wird eine Intensivreinigung bzw. eine CIP<br />
(Cleaning in Place) notwendig. Dazu muss die Anlage<br />
für mehrere Stunden außer Betrieb genommen und<br />
eine hochkonzentrierte Chemikalienlösung zirkuliert<br />
werden. Zielsetzung der CIP ist eine 100%ige und nachhaltige<br />
Wiederherstellung der Permeabilität. Das heißt,<br />
die mit einer CIP gereinigte Membran sollte sich so verhalten<br />
wie eine neu eingesetzte.<br />
Kam es durch die hohe Beanspruchung durch die<br />
Pilotierung zu einem irreversiblen Einbruch der Permeabilität<br />
oder sollte die Ausgangspermeabilität für die<br />
Durchführung von vergleichbaren Versuchen wieder<br />
hergestellt werden, wurde mit der keramischen Membran<br />
eine CIP durchgeführt. Hierbei werden in einem<br />
Standardprozess 3000 ppm freies Chlor gefolgt von<br />
1%iger Zitronensäure verwendet. Durch diese Reinigungsprozedur<br />
konnte die Ausgangspermeabilität<br />
jederzeit nachhaltig wiederhergestellt werden.<br />
Filtrat<br />
Bild 5.<br />
Überseecontainer<br />
mit<br />
der Keramik-<br />
Membran-<br />
Pilotanlage<br />
(links) und<br />
Voroxidation<br />
(rechts).<br />
Filtration<br />
Feed<br />
Dead-End Filtration<br />
In-Out<br />
Filtrat<br />
Rückspülwasser<br />
Rückspülung<br />
Spülwasser<br />
Rückspülwasser<br />
Rückspüldruck: 5bar<br />
Dauer: 2 - 20 s<br />
Rückspülwasser<br />
Air Flush<br />
Druckluft<br />
Spülwasser<br />
Druck: 2 bar<br />
Dauer: 2 - 3 s<br />
Bild 6. Durchführung der Rückspülung mit der keramischen<br />
Membran.<br />
Rückspülwasser<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1199
FachberichtE ATT Symposium<br />
Filtrationszeit:<br />
120 95 87 76<br />
min<br />
Ausbeute: 99<br />
%<br />
CEB H 2SO 4/NaOH:<br />
2<br />
#/Tag<br />
CIP<br />
x<br />
PACl:<br />
2,4 1,3<br />
mg Al/L<br />
PAK:<br />
-<br />
mg/L<br />
Ozon:<br />
-<br />
mg/L<br />
Bild 7. Exemplarisches Pilotierungsergebnis mit den keramischen<br />
Membranen.<br />
Flux in L/m h<br />
5. Zusammenfassung<br />
der Untersuchungs ergebnisse<br />
Die Pilotversuche haben gezeigt, dass grundsätzlich mit<br />
allen getesteten Membrankonzepten und den jeweiligen<br />
Vorbehandlungen die Aufbereitungsziele erreicht<br />
werden können. Die Trübung konnte zuverlässig unabhängig<br />
von der Rohwasserqualität dauerhaft auf Werte<br />
< 0,1 NTU reduziert werden. Bakterien und Coliphagen<br />
(als Indikator für Viren) konnten ebenso von allen getesteten<br />
Membranen sicher zurückgehalten werden. Die<br />
Filtratqualität hinsichtlich organischer, anorganischer<br />
und mikrobiologischer Parameter unterschied sich je<br />
nach Membran, Anlagenkonzept und Vorbehandlung<br />
nur marginal. Etwas größere Abweichungen zwischen<br />
den einzelnen Membranprozessen waren jedoch im<br />
Energie- und Chemikalienverbrauch, Spülwasser- und<br />
Konzentratanfall, der Membranleistung sowie im<br />
Betriebsverhalten festzustellen.<br />
Der Einsatz von höheren Ozon-Konzentrationen<br />
(> 2 mg O 3 /L) in der Vorozonung hatte positive Auswirkungen<br />
auf das Filtrationsverhalten sowohl der keramischen<br />
als auch der polymeren druckgetriebenen Membran<br />
(PVDF). Der Vorteil eines günstigeren Filtrationsverhaltens<br />
bei höheren Ozonkonzentrationen kann sich<br />
aber auch negativ <strong>aus</strong>wirken, wenn oxidierte organische<br />
<strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe durch eine ggf. geringere<br />
Größe und eine höhere Polarität durch die kombinierte<br />
Flockung/Membran nicht zurückgehalten werden<br />
könnten. Bei hohen DOC-Konzentrationen im Zulauf<br />
kann die Konzentration der auf diese Weise entstehenden<br />
biologisch verwertbaren organischen Materie sehr<br />
hoch werden. Dies bedeutet für den nachfolgenden<br />
Biofilter notwendigerweise höhere Aufenthaltszeiten,<br />
um die Wiederverkeimungsneigung im Leitungsnetz<br />
unterhalb der Toleranzgrenze zu halten. Somit ist der<br />
Einsatz von hohen Ozonkonzentrationen <strong>aus</strong>schließlich<br />
zur Verbesserung der Filtrationsleistung der Membran<br />
bei höheren organischem Hintergrund des Rohwassers<br />
nicht zu empfehlen. Bei niedrigeren Ozon-Konzentrationen<br />
waren nur minimale oder keine direkten Auswirkungen<br />
auf das Betriebsverhalten je nach Rohwasserqualität<br />
zu verzeichnen. Versuche zum Einsatz von Pulveraktivkohle<br />
(PAK) hinsichtlich einer Verbesserung der<br />
Filtratqualität und des Betriebsverhaltens zeigten, dass<br />
eine solche Verbesserung nur bei höheren Dosierungen<br />
(> 15 mg PAK/L) erreicht wird.<br />
Insgesamt gesehen, hat sich die keramische Membran<br />
als sehr geeignet für die Zielsetzung gezeigt. Es<br />
wurden Ausbeuten und Verfügbarkeiten von jeweils<br />
rund 99 % erreicht. Ein kontinuierlicher stabiler Betrieb<br />
war für die eher ungünstige <strong>Wasser</strong>qualität im Spätsommer,<br />
Herbst und Winter mit einem Flux von 160 L/(m²h)<br />
möglich sowie bei der günstigen <strong>Wasser</strong>qualität im<br />
Frühjahr und Sommer mit 250 L/(m²h) (Bild 7).<br />
Weiterhin konnte bei günstigen <strong>Wasser</strong>qualitäten für<br />
einige Tage ein Flux von 400 L/(m²h) realisiert werden,<br />
ohne dass es zu starken Permeabilitätsabfällen kam. Der<br />
erreichbare Flux war mit den eingesetzten keramischen<br />
Membranen um etwa den Faktor 3 höher als der Flux<br />
der polymeren PES-Membran, die immerhin einen<br />
maximalen Flux von rund 120–140 L/(m²h) realisieren<br />
konnte. Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit der<br />
Membranmodule war eine effektive Spülung mit hohem<br />
Druck möglich und es konnte im Regelbetrieb auf den<br />
Einsatz oxida tiver Chemikalien verzichtet werden. Für<br />
die regel mäßige CEB war lediglich Säure bei pH 2 notwendig.<br />
Dies musste aufgrund der langen Filtrationszeiten<br />
vergleichsweise selten durchgeführt werden. Auch<br />
konnte bei irreversiblen Permeabilitätseinbrüchen<br />
infolge von gezielt herbeigeführten zu hohen Belastungen<br />
der Membran die Permeabilität durch eine Standard-CIP<br />
mit Chlor und Zitronensäure nachhaltig wiederhergestellt<br />
werden. Im Regelbetrieb würde diese<br />
Standard-CIP aller Vor<strong>aus</strong>sicht nach maximal ein- bis<br />
zweimal pro Jahr notwendig sein, um irreversible Verblockungen<br />
der Membran zu entfernen.<br />
Ein wesentliches Ergebnis der Pilotuntersuchungen<br />
war zusammenfassend, dass mit keramischen Membranen<br />
vergleichsweise hohe Ausbeuten und Membranflüsse<br />
bei gleichzeitig nur geringem Chemikalienverbrauch<br />
erreichbar sind. Unter der Vor<strong>aus</strong>setzung einer<br />
etwa doppelten Lebenserwartung im Vergleich zu polymeren<br />
Membranen könnten die erzielten Werte durch<strong>aus</strong><br />
die höheren spezifischen Kosten der Keramikmembranen<br />
<strong>aus</strong>gleichen.<br />
Derzeit werden basierend auf den Ergebnissen der<br />
Pilotierung die betrieblichen Randbedingungen für<br />
einen wirtschaftlichen Einsatz der Membransysteme<br />
näher untersucht. Wesentliche Gesichtspunkte sind eine<br />
hohe Ausbeute von 99 %, (die bei Einsatz der keramischen<br />
Membran eine zweite Membranstufe zur Aufbereitung<br />
des schlammhaltigen Spülwassers entbehrlich<br />
macht), eine hohe Flexibilität in Bezug auf einen maximal<br />
erreichbaren Membranfluss, geringe Betriebs kosten<br />
für Energie- und Chemikalienbedarf sowie die garantierte<br />
Standzeit der eingesetzten Membranen.<br />
Dezember 2011<br />
1200 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Literatur<br />
[1] Bottino, A., Capannelli, C., Del Borghi, A., Colombino, M. and<br />
Conio, O.: Water treatment for drinking purpose: ceramic<br />
microfiltration application. Desalination Volume (141) Issue<br />
1, 1 December 2001, p. 75–79.<br />
[2] Hagen K., Meusel, Ch. and Gerstenberg, S.: Ceramic membrane<br />
filtration for drinking water treatment. Workshop on Ceramic<br />
Membranes, Kiwa Water Research, Groningenhaven 7,<br />
Nieuwegein, The Netherlands, 24 September 2007.<br />
[3] Lee, S. and Cho, J.: Comparison of ceramic and polymeric<br />
membranes for natural organic matter (NOM) removal. Desalination,<br />
Volume (160), Issue 3, 30 January 2004, p. 223–232.<br />
[4] Lerch A., Panglisch, S., Buchta P., Tomita, Y., Yonekawa, H.,<br />
Hattori, K. and Gimbel, R.: Direct river water treatment using<br />
coagulation/ceramic membrane microfiltration. Desalination<br />
(2005), 179, p. 41–50.<br />
[5] Loi-Brügger, A., Panglisch, S., Buchta, P., Hattori, K., Yonekawa,<br />
H., Tomita, Y. und Gimbel, R.: Flusswasseraufbereitung durch<br />
Flockung und Mikrofiltration mit Keramikmembranen: In T.<br />
Melin, J. Pinnekamp, M. Dohmann, editors, Membrantechnik<br />
in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung und <strong>Abwasser</strong>behandlung: Perspektiven,<br />
Neuentwicklungen und Betriebserfahrungen im<br />
In- und Ausland/6. Aachener Tagung Siedlungswasserwirtschaft<br />
und Verfahrenstechnik, 2005.<br />
[6] Loi-Brügger A., Buchta P.S., Gimbel R., Hattori K., Yonekawa H.<br />
and Tomita Y.: One year pilot study on economical surface<br />
water treatment with new ceramic membranes. In: Dechema<br />
e. V. (Hrsg.), Industrial Water 2006. European Conference on<br />
Efficient Use of Water Resources in Industry, February<br />
6-8,2006, Frankfurt am Main/Germany. Tagungsband, Frankfurt<br />
am Main:, 2006a, p. 90–97.<br />
[7] Loi-Brügger A., Panglisch S., Buchta P., Hattori K., Tomita Y.H.<br />
and Gimbel R.: Ceramic membranes for direct river water<br />
treatment applying coagulation and microfiltration. Water<br />
Science & Technology: Water Supply 6 (4), 2006b, p. 89–98.<br />
[8] Meyn, T. and Leiknes, T.: Comparison of optional process configurations<br />
and operating conditions for ceramic membrane<br />
MF coupled with coagulation/flocculation pre-treatment for<br />
the removal of NOM in drinking water production. Journal of<br />
Water Supply: Research and Technology – AQUA 59 (2008)<br />
No 2–3, p. 81–91.<br />
[9] Panglisch, S.: Einsatz von keramischen Membranen in der<br />
Trinkwasseraufbereitung. In: T. Melin, J. Pinnekamp, M. Dohmann<br />
(Hrsg.), Membrantechnik in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung: Perspektiven, Neuentwicklungen<br />
und Betriebserfahrungen im In- und Ausland. 8. Aachener<br />
Tagung Siedlungswasserwirtschaft und Verfahrenstechnik<br />
(27-28. Oktober 2009), Aachen:, Die Deutsche Bibliothek<br />
– CIP-Einheitsaufnahme, 2009, ISBN 3-8107-0064-9,<br />
S. Ü3-1-Ü3-18.<br />
[10] Panglisch, S., Kr<strong>aus</strong>, G., Tatzel, A. and Lickes, J.-P.: Membrane<br />
performance in combined processes including ozonation or<br />
advanced oxidation, powdered activated carbon and coagulation<br />
– Investigations in pilot scale. Desalination Volume<br />
250, Issue 2, 15 January 2010, p. 819–823.<br />
[11] Schippers, E., Bakker, S.H., Brummel, D. and Heijman, S.G.J.:<br />
Particle removal from surface water with ceramic microfiltration.<br />
In s.n. (Ed.), Particle separation 2007 – from particle<br />
characterisation to separation processes (pp. 1–8). Toulouse:<br />
IWA, 2007.<br />
Autoren<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Korrektur: 11.11.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Dr.-Ing. Stefan Panglisch (Korrespondenz-Autor)<br />
E-Mail: s.panglisch@iww-online.de |<br />
André Tatzel<br />
E-Mail: a.tatzel@iww-online.de |<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> |<br />
Moritzstraße 26 |<br />
D-45476 Mülheim an der Ruhr<br />
Georges Kr<strong>aus</strong><br />
E-Mail: georges.kr<strong>aus</strong>@sebes.lu |<br />
Dr. Isabelle Kolber<br />
E-Mail: isabelle.kolber@sebes.lu |<br />
Christian Schroeder<br />
E-Mail: christian.schroeder@sebes.lu |<br />
Syndicat des Eaux du Barrage d‘Esch-sur-Sûre - SEBES |<br />
Rue de Lultzh<strong>aus</strong>en |<br />
L-9650 Esch-sur-Sûre (Esch-Sauer) |<br />
Luxembourg<br />
Dr. Jean-Paul Lickes<br />
E-Mail: jean-paul.lickes@eau.etat.lu |<br />
Ministère de l‘Intérieur et de Aménagement du Territoire |<br />
Administration de la Gestion |<br />
1A, rue August Lumière |<br />
L-1950 Luxembourg |<br />
Luxembourg<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1201
FachberichtE ATT Symposium<br />
Der Weg zum <strong>Talsperren</strong>-Benchmarking<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Benchmarking, <strong>Talsperren</strong>, Prozessmodelle, Kennzahlen<br />
Eberhard Jüngel<br />
Nachdem sich in der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft bei<br />
der <strong>Abwasser</strong>behandlung und der Trinkwasserversorgung<br />
Benchmarking als wichtiges Instrument der<br />
Selbstüberprüfung und Effizienzsteigerung der<br />
Unternehmen etabliert hat, ergriff eine Projektgruppe<br />
die Initiative, auch für den Betrieb von <strong>Talsperren</strong><br />
Benchmarkingmodelle zu entwickeln. Gemeinsam<br />
mit der Firma aquabench GmbH und dem IWW Zentrum<br />
<strong>Wasser</strong> wurde zuerst ein Prozessmodell zum<br />
Personaleinsatzbenchmarking erfolgreich erprobt.<br />
Erste positive Ergebnisse veranlasste die Projektgruppe<br />
dieses Prozessmodell zum Vollkostenbenchmarking<br />
weiter zu entwickeln. Der Weg dahin wird<br />
beschrieben.<br />
The Way to the Dam-Benchmarking<br />
After the benchmarking process was established<br />
within the German water economy both in wasterwater<br />
treatment and water supply as an important<br />
instrument for hard check and efficiency increase of<br />
companies, a task force took the initiative to develop<br />
a benchmarking version to run barrages. Together<br />
with the company aquabench GmbH and the IWW<br />
Water Centre in a first step a process pattern for<br />
deployment benchmarking was proved. The task<br />
force was motivated by successful results to advance<br />
the process pattern to benchmark absorbed cost. The<br />
outworking is described below.<br />
1. Einleitung<br />
Benchmarking ist in der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
eine weit verbreitete Initiative. Mit ihr werden Maßstäbe<br />
(Benchmark = Maßstab) ermittelt, an denen sich die<br />
betei ligten Unternehmen hinsichtlich ihrer eigenen<br />
Wirtschaftlichkeit und Effizienz messen bzw. vergleichen<br />
können. Am Benchmarking beteiligen sich Unternehmen,<br />
Aufga benträger und Einrichtungen, die gleiche<br />
oder ähnliche Aufgaben wahrnehmen, mit dem Ziel, die<br />
eigene Betriebsblindheit zu überwinden und Hinweise<br />
zu erhalten, wo hinsichtlich der Betriebsabläufe Handlungs-<br />
bzw. Verbesserungsbedarf besteht. Mit Hilfe des<br />
Benchmarking können innerbetriebliche Abläufe und<br />
Methoden optimiert und Einsparpotenziale erschlossen<br />
werden, was letztendlich zu einer Stärkung am Markt,<br />
zur Verbesserung und zum Nachweis der eigenen Wirtschaftlichkeit<br />
führt. Letzteres ist auch eine Frage, die<br />
immer wieder von den Aufsichtsgremien gestellt wird<br />
[1–5].<br />
2. Allgemeine Grundsätze des Benchmarking<br />
Die Teilnahme an einem Benchmarkingprojekt erfolgt<br />
auf freiwilliger Basis. Vor<strong>aus</strong> setzung für den Erfolg ist<br />
eine offene und ehrliche Bereitstellung der relevanten<br />
Da ten, wobei dies unter der Bedingung einer absoluten<br />
Vertraulichkeit erfolgen muss.<br />
Gewöhnlich sieht der Ablauf eines Benchmarkingprojektes<br />
vor, dass zuerst das ei gentliche Objekt, also<br />
die Abläufe, die Technologien usw., die einem Vergleich<br />
unter zogen werden sollen, klar definiert und beschrieben<br />
werden muss.<br />
Dazu gehört auch die Vorgabe von Kennzahlen, die<br />
dann einen Vergleich zulassen.<br />
Auf der Grundlage der sich dann anschließenden<br />
Datenermittlung erfolgt mittels der definierten Kennzahlen<br />
die Bestimmung des Maßstabs, des Benchmarks.<br />
In der abschließenden Analyse, die gemeinsam<br />
durch alle am Benchmarkingprojekt Beteiligten erfolgt,<br />
werden Ursachen und Gründe erörtert, warum bei den<br />
Teilneh mern möglicherweise Abweichungen (im Positiven<br />
wie im Negativen) vom ermittelten Maßstab festgestellt<br />
wurden. Diese Ursachenanalyse ist für jeden<br />
Einzelnen Ent scheidungsgrundlage, ob in den Betriebsabläufen<br />
und Organisationsstrukturen Ver änderungen<br />
eingeleitet werden müssen.<br />
Nach Umsetzung dieser ggf. erforderlichen Änderungen<br />
in den Betriebsabläufen kann dieser Benchmarkingprozess<br />
– beginnend bei der Datenerfassung –<br />
wiederholt werden, um den Erfolg der eingeleiteten<br />
Maßnahmen zu prüfen.<br />
3. Erste Schritte zum<br />
<strong>Talsperren</strong>-Benchmarking<br />
In der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft wurden bis zum Jahr<br />
2006 mehr als 50 Bench markingprojekte initiiert. Diese<br />
Projekte wurden <strong>aus</strong>schließlich bei <strong>Wasser</strong>ver- und<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgungsunternehmen für die dort zu<br />
sichernden Abläufe und Techno logien durchgeführt.<br />
Dezember 2011<br />
1202 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Der Arbeitskreis „Bau und Betrieb von Stauanlagen“<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trink wassertalsperren e. V.<br />
(ATT) stellte sich die Aufgabe, nunmehr auch für den<br />
Talsper renbetrieb eine Benchmarkingmethode zu<br />
entwickeln [6].<br />
Im Mittelpunkt dieser Methode bzw. eines solchen<br />
Benchmarkingprojektes sollen das Absperrbauwerk<br />
und der St<strong>aus</strong>ee selbst stehen.<br />
Die Absperrbauwerke von <strong>Talsperren</strong> sind außerordentlich<br />
differenziert: Sie unter scheiden sich erheblich<br />
in der Höhe, in der Länge und insbesondere in der<br />
Bau weise.<br />
Auch die St<strong>aus</strong>een selbst sind sehr unterschiedlich<br />
hinsichtlich Fläche, Uferlänge und Stauvolumen. In -<br />
sofern bestanden anfänglich erhebliche Zweifel diese<br />
Objekte überhaupt „vergleichbar“ machen zu können,<br />
da jede Talsperre für sich ein Unikat ist.<br />
Zur Lösung dieses Problems bildeten sich innerhalb<br />
des ATT-Arbeitskreises zwei Projektgruppen. Eine<br />
Projektgruppe, in welcher der Ruhrverband, der<br />
<strong>Wasser</strong>ver band Eifel-Rur, der <strong>Talsperren</strong>betrieb Sachsen-Anhalt<br />
und die Landestalsperrenver waltung des<br />
Freistaates Sachsen mitwirken, konzentrierten sich auf<br />
das sogenannte aufgabenorientierte Prozessmodell.<br />
Eine zweite Projektgruppe, in welcher der Wupperverband<br />
und der Aggerverband mitwirken, konzentrierte<br />
sich auf das sogenannte bauwerksorientierte Prozessmodell.<br />
Im Weiteren wird über die Entwicklung des aufgabenorientierten<br />
Prozessmodells be richtet.<br />
4. Das aufgabenorientierte Prozessmodell<br />
4.1 Vergleichbarkeit der <strong>Talsperren</strong><br />
Wie im Punkt 3 bereits geschrieben, unterscheiden sich<br />
die <strong>Talsperren</strong> hinsichtlich ihrer Absperrbauwerke und<br />
der St<strong>aus</strong>een zum Teil erheblich. Dabei gibt es aber<br />
Merkmale, im Weiteren als „Randbedingungen“ bezeichnet,<br />
die beeinflusst, also ver ändert werden können und<br />
solche, die nicht beeinflusst werden können.<br />
Beeinflussbare Randbedingungen sind z. B. die technische<br />
Ausstattung und deren Automatisierungsgrad<br />
des Absperrbauwerkes, die Nebennutzungen und die<br />
Be triebspläne.<br />
Nicht beeinflussbare Randbedingungen sind z. B. die<br />
Morphologie der Sperrstelle und des Stauraumes, die<br />
Bauweise und die Geometrie des Absperrbauwerkes<br />
sowie dessen Alter, wor<strong>aus</strong> sich ein Instandsetzungsaufwand<br />
ableiten lässt. Außerdem können das Einzugsgebiet,<br />
die hydrologischen Merkmale und in der Regel<br />
auch die Hauptnutzungen nicht verändert werden.<br />
Diese Randbedingungen machen deutlich, wo<br />
tatsächlich Veränderungen möglich werden, um die<br />
eigene Wirtschaftlichkeit zu verbessern bzw. wo tatsächlich<br />
belast bare Kennzahlen bzw. ein belastbarer<br />
Kennzahlenvergleich zu einem sinnvollen Er gebnis<br />
führen können.<br />
4.2 Vergleichbarkeit der zu erledigenden Aufgaben<br />
Die am Benchmarkingprojekt beteiligten Unternehmen,<br />
Einrichtungen und Verbände hatten teilweise unterschiedliche<br />
Vor<strong>aus</strong>setzungen, die vorläufig nicht verändert<br />
wer den sollten, die aber erheblichen Einfluss auf<br />
die zu ermittelnden Kennzahlen haben können. Das<br />
waren z. B. die Rechtsformen (Verband, Staatsbetrieb,<br />
öffentlich-recht liche Anstalt), das Aufgabenprofil (<strong>aus</strong>schließlich<br />
<strong>Talsperren</strong>betrieb bis einschließlich Gewässerunterhaltung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung), Betriebsvorschriften<br />
auf der Grundlage der Länder-<strong>Wasser</strong>gesetze,<br />
Kostenstellenstrukturen und Tarifsysteme.<br />
Um trotz dieser recht unterschiedlichen Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
bei der Erledigung der an stehenden Aufgaben<br />
vergleichbare Aufwendungen zu haben, wurde festgelegt,<br />
in einem ersten Schritt den Zeitaufwand des unmittelbar<br />
mit dem <strong>Talsperren</strong>betrieb befassten Personals,<br />
die Personaleinsatzzeiten zu erfassen und als Grundlage<br />
für das Benchmarking zu nehmen.<br />
Dazu ist anzumerken, dass der Aufwand, der beim<br />
<strong>Talsperren</strong>betrieb durch eigenes Personal anfällt, relativ<br />
hoch ist. Die Personalkosten betragen etwa 30 bis 40 %<br />
des gesamten monetären Aufwandes. Insofern besteht<br />
hier grundsätzlich ein erhebliches Einsparungspo tenzial.<br />
Dar<strong>aus</strong> abgeleitet wurde das Personaleinsatzbenchmarking<br />
für das aufgabenori entierte Prozessmodell<br />
entwickelt.<br />
4.3 Entwicklung des Prozessmodells zum<br />
Personaleinsatzbenchmar king<br />
Unter Berücksichtigung der im Punkt 4.2 getroffenen<br />
Festlegungen zur Erfassung der Personaleinsatzzeiten,<br />
also des Zeitaufwandes des Personals für die anfallenden<br />
Arbeiten, waren zuerst die Aufgaben zu definieren,<br />
die vollständig den <strong>Talsperren</strong>be trieb widerspiegeln.<br />
Gemeinsam mit zwei zwischenzeitlich vertraglich<br />
gebundenen Unternehmen zur feder führenden Begleitung<br />
dieses Projektes wurde dazu das Prozessmodell<br />
gemäß Bild 1 entwickelt.<br />
Die durch das Personal wahrzunehmenden Aufgaben<br />
wurden in 60 Teilaufgaben, die sich in 13 Hauptaufgaben<br />
zusammenfassen lassen, dargestellt. Die Hauptaufgaben<br />
wiederum lassen sich in fünf Aufgabenbereiche<br />
zusammenfassen.<br />
Dazu wurde weiter festgelegt, dass die Erfassung der<br />
Personaleinsatzzeit für jede Teilaufgabe mit einer<br />
Genauigkeit von rund 0,5 Stunden zu erfolgen hat.<br />
Gegebenenfalls kann die Einsatzzeit auch geschätzt<br />
werden. Um zu einem Vergleich zwischen den beteiligten<br />
Unternehmen zu kommen, musste diese Erfassung<br />
in genau einem Wirtschaftsjahr vorgenommen werden.<br />
Nach Abschluss der Erfassung erfolgte die Zu sam menfas<br />
sung der ermittelten Einsatzzeiten in Form von Tagewerken.<br />
Im Nachgang hat sich her<strong>aus</strong>gestellt, dass diese<br />
Genauigkeit vollkommen <strong>aus</strong>reichend ist, um belastbare<br />
Ergebnisse zu erzielen.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1203
FachberichtE ATT Symposium<br />
4.4 Datenerfassung und Kennzahlenbildung<br />
Für die Datenerfassung wurde das Wirtschaftsjahr 2005<br />
festgelegt. Neben den Per sonaleinsatzzeiten gemäß<br />
dem Prozessmodell (Bild 1) mussten auch umfangreiche<br />
Informationen zur Talsperre erfasst werden. Das<br />
waren insbesondere technische Parameter und hydrologische<br />
und geografische Informationen, aber auch<br />
Aussagen zum Ausstattungsgrad und zur Gesamtzahl<br />
der eingesetzten Beschäftigten. Auch der Anteil der zu<br />
erledigenden Aufgaben, die an Dritte vergeben werden,<br />
musste beson ders für eine spätere Ursachenanalyse<br />
erfasst werden.<br />
Mit der Erfassung der Personaleinsatzzeiten und der<br />
technischen Parameter waren nunmehr Grundlagen<br />
geschaffen, um belastbare Kennzahlen zu bilden. Die<br />
Kenn zahlen stellen das Verhältnis zwischen Einsatzzeit<br />
für eine bestimmte Teil- oder Hauptaufgabe (siehe Prozessmodell)<br />
zu einem technischen Parameter dar.<br />
Beispiel:<br />
Einsatzzeit für Funktionsprüfungen<br />
Anzahl der Armaturen<br />
Bild 1. Prozessmodell zum<br />
Personaleinsatzbenchmar king.<br />
Bild 2. Auswertung der Kennzahl hinsichtlich der Einsatzzeiten für<br />
Funktionsprüfungen je Armaturengruppe.<br />
Auf diese Art und Weise wurden 60 Kennzahlen gebildet<br />
und <strong>aus</strong>probiert. Davon ha ben sich im Ergebnis insbesondere<br />
der Ursachenanalyse etwa 15 Kennzahlen als<br />
„belastbar“ her<strong>aus</strong>gestellt.<br />
4.5 Auswertung und erste Ergebnisse<br />
Nach Abschluss der Erfassung der Personaleinsatzzeiten<br />
konnten zuerst bisherige Erfahrungen beim <strong>Talsperren</strong>betrieb<br />
bestätigt werden.<br />
Übereinstimmend zwischen den am Projekt Beteiligten<br />
wurde festgestellt, dass die Sicherung des <strong>Talsperren</strong>betriebes<br />
– das sind insbesondere die Gewährleistung<br />
der Betriebs- und Standsicherheit sowie die<br />
erforderlichen <strong>Wasser</strong>güte- und <strong>Wasser</strong> mengen steuerungen<br />
– 60 bis 70 % der Einsatzzeiten in Anspruch<br />
nimmt.<br />
Weitere rund 20 bis 25 % der Einsatzzeiten sind für<br />
die Instandhaltung und Instand setzung der Bauwerke<br />
in der technischen Ausrüstung erforderlich.<br />
Die verbleibenden Einsatzzeiten dienen administrativen<br />
und sonstigen Aufgaben.<br />
Bei der folgenden Auswertung der belastbaren<br />
Kennzahlen wurden teilweise sehr unterschiedliche<br />
Ergebnisse festgestellt.<br />
Als Beispiel dazu ist in Bild 2 die Kennzahl hinsichtlich<br />
der Einsatzzeiten für Funktionsprüfungen je Armaturengruppe<br />
dargestellt. Die hier ersichtlichen erheblichen<br />
Differenzen wurden unter Beisein aller am Projekt<br />
Beteiligten einer Ursachen analyse unterzogen. Dabei<br />
musste festgestellt werden, dass ein Großteil der Gründe<br />
für diese Abweichung in den oftmals nicht beeinflussbaren<br />
Randbedingungen (siehe Punkt 4.2) zu suchen<br />
sind.<br />
Im Rahmen der Analyse anderer Kennzahlen wurden<br />
jedoch auch abweichende Technologien, Abläufe und<br />
Strategien zwischen den <strong>Talsperren</strong>betreibern festgestellt,<br />
die letztendlich für jeden Einzelnen Ansätze für<br />
die Überprüfung der eigenen Effizienz darstellen und<br />
damit dem Ziel des Benchmarking Rechnung tragen.<br />
Die mit diesem Personaleinsatzbenchmarking, hier<br />
insbesondere mit der Ursachen analyse, erzielten Ergebnisse<br />
führten bei den beteiligten Unternehmen zu der<br />
Über zeugung, dass ein brauchbares Instrument zur<br />
Kontrolle der eigenen Wirtschaftlich keit gefunden und<br />
entwickelt wurde. Insofern waren die Beteiligten davon<br />
überzeugt, dass eine Weiterentwicklung dieses Prozessmodells<br />
sinnvoll ist.<br />
Anpassungen der Technologien, Abläufe und Strategien,<br />
die letztendlich zu einer größeren Wirtschaftlichkeit<br />
führen können, konnten bisher nur begrenzt abgeleitet<br />
und umgesetzt werden. Nachhaltigere Ergebnisse<br />
werden auf der Grundlage eines Vollkostenbenchmarking<br />
erwartet (siehe 5.).<br />
Die Methoden und Erfahrungen zum aufgabenorientierten<br />
und auch zum bauwerks orientierten<br />
Prozessmodell wurden in der Schriftenreihe der ATT-<br />
Dezember 2011<br />
1204 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
Technische Infor mationen Nr. 13 als „Leitfaden Benchmarking<br />
<strong>Talsperren</strong>betrieb“ zusammengefasst.<br />
Bild 3. Prozessmodell zum Vollkostenbenchmarking.<br />
5. Weitere Entwicklung des Prozessmodells<br />
zum Vollkosten benchmarking<br />
Zwischen den am Personaleinsatzbenchmarking<br />
be teiligten Unternehmen wurde vereinbart, dass das<br />
Prozessmodell für ein Vollkostenbenchmarking weiter<br />
zu entwi ckeln ist.<br />
Beim Vollkostenbenchmarking wird der monetäre<br />
Aufwand für Personal, Material einschließlich Fremdleistungen<br />
sowie für die Instandhaltung und Instandsetzung<br />
der baulichen Anlagen und der technischen<br />
Ausrüstung einschließlich Kapitaldienst er mittelt und<br />
bei der Kennzahlenbildung im Verhältnis zu einer<br />
bestimmten technischen oder naturräumlichen Gegebenheit<br />
der Talsperre betrachtet.<br />
Eine Entwicklung des Vollkostenbenchmarking zum<br />
Untenehmensbereichsbench marking wurde vorläufig<br />
zurückgestellt.<br />
Grundlage für das Vollkostenbenchmarking ist das<br />
Prozessmodell für das Personal einsatzbenchmarking<br />
(Bild 1).<br />
Dabei erfolgt nur noch eine Betrachtung auf der<br />
Ebene der Hauptaufgaben (Bild 3), d. h. der Aggregationsgrad<br />
der Kennzahlen wird vergrößert, womit allerdings<br />
der Er kenntnisgewinn automatisch verringert<br />
wird. Diese zusammengefasste Betrachtung dient vorrangig<br />
der Verbesserung des optimierten Betriebes<br />
jeder ein zelnen Tal sperre im Gegensatz zum Personaleinsatzbenchmarking,<br />
wo tatsächlich eine detaillierte<br />
Analyse bis in die Teilaufgaben hinein möglich ist.<br />
Die Ermittlung des monetären Aufwandes für die<br />
13 Hauptaufgaben muss der voll ständige Betrieb s-<br />
aufwand sein. Die Ermittlung des Aufwandes für die<br />
Instandhaltung der baulichen Anlagen und der technischen<br />
Ausrüstung, für den Kapitalaufwand und für<br />
außerordentliche Aufwendungen ergänzen den<br />
Betriebsauf wand zum Gesamtaufwand für jede<br />
Talsperre.<br />
Da die beteiligten Unternehmen – neben den im<br />
Punkt 3/Aufgabenorientiertes Pro zessmodell genannten<br />
Unternehmen beteiligen sich nunmehr auch die<br />
Harzwasser werke am Vollkostenbenchmarking – unterschiedliche<br />
Kostenstellenstrukturen ha ben, wurde<br />
vereinbart im Rahmen des Vollkostenbenchmarkingprojektes<br />
eine ge meinsame Kostenstellenstruktur<br />
außerhalb der jeweiligen kaufmännischen Systeme zu<br />
verwenden, die der der 13 Hauptaufgaben entspricht.<br />
Mit der Entwicklung des Prozessmodells – die Entwicklung<br />
ist zum Zeitpunkt der Er stellung dieses Aufsatzes<br />
(Ende 2010) noch nicht abgeschlossen – wurden<br />
vorläufig erste Kennziffern erstellt, die nach Vorliegen<br />
der erfassten Daten einer Belastung unterzogen werden.<br />
Danach erfolgt eine endgültige Festlegung der<br />
tatsächlich an wendbaren Kennziffern.<br />
Die Daten werden für das Wirtschaftsjahr 2010<br />
erfasst. Eine Auswertung und erste Ergebnisse werden<br />
im 1. Halbjahr 2012 erwartet.<br />
Literatur<br />
[1] DWA-Arbeitsblatt-AB WI-00.1, Benchmarking – Februar<br />
2001.<br />
[2] DWA-Arbeitsblatt-AB WI-001, Benchmarking in der deutschen<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft – Anforderungen, Rolle und Gestaltung<br />
– November 2003.<br />
[3] DWA-Themen-TH WI-001, Leitfaden Benchmarking für <strong>Wasser</strong>versorgungs-<br />
und <strong>Abwasser</strong>beseitigungsunternehmen –<br />
November 2005.<br />
[4] DWA-Merkblatt-M 1100, Benchmarking in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>beseitigung – März 2008.<br />
[5] DWA-Themen-TH WI-00.1, Unternehmensbenchmarking als<br />
Bestandteil der Modernisierungsstrategie – Kennzahlen und<br />
Auswertungsgrundsätze – April 2008.<br />
[6] Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT),<br />
Technische Informationen Nr. 13 – Leitfaden Benchmarking<br />
<strong>Talsperren</strong>betrieb.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Korrektur: 01.11.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Dipl.-Ing. Eberhard Jüngel<br />
E-Mail: Eberhard.Juengel.@ltv.sachsen.de |<br />
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen |<br />
Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster |<br />
Muldenstraße |<br />
D-08309 Eibenstock<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1205
FachberichtE ATT Symposium<br />
Organische Spurenstoffe in Gewässern<br />
Vorkommen und Bewertung<br />
Spurenstoffe, <strong>Abwasser</strong>reinigung, Trinkwasseraufbereitung, <strong>Wasser</strong>versorgung, Bewertungskonzepte<br />
Heinz-Jürgen Brauch<br />
Organische Spurenstoffe werden aufgrund der erheblichen<br />
Fortschritte in der chemisch-analytischen Messtechnik<br />
in immer höherer Anzahl und immer geringeren<br />
Konzentrationen in <strong>Wasser</strong>- und Umweltproben<br />
gefunden. Ihr Vorkommen zeigt den weit verbreiteten<br />
Einsatz von chemischen Stoffen (Chemi kalien) in<br />
unterschiedlichsten Produkten an, bedeutet aber nicht<br />
unmittelbar eine Gefährdung für die Umwelt und<br />
die Trinkwasserversorgung. Um mögliche Risiken einschätzen<br />
zu können, bedarf es transparenter und<br />
nachvollziehbarer Bewertungskonzepte, denen die<br />
Verbraucher Vertrauen entgegen bringen können. Dies<br />
kann nur durch eine offene Kommunikation und ein<br />
gemeinsames Handeln zwischen allen Interessensgruppen<br />
erfolgreich umgesetzt werden.<br />
Organic Trace Pollutants in Aquatic Systems<br />
Due to the enormous progress in analytical techniques<br />
organic micropollutants are found in increasing<br />
numbers and ever lower concentrations in water<br />
as well as in the environment. Their occurrence in<br />
very low concentration levels gives an indication of<br />
the widespread use of chemicals in our society but it<br />
doesn’t necessarily mean a hazard for the environment<br />
or for drinking water supply. In order to assess<br />
possible risks, concepts are needed which will have<br />
the trust of consumers and the public. An open communication<br />
as well as common activities of all stakeholders<br />
must be key elements of such a strategy.<br />
1. Einführung<br />
Vorkommen, Verhalten, Verbleib und Bewertung von<br />
organischen Spurenstoffen in Gewässern und in der<br />
Umwelt sind derzeit nicht nur ein aktuelles wissenschaftliches<br />
Forschungsgebiet, sondern auch in der<br />
Öffentlichkeit und in den Medien wird eine intensive<br />
Diskussion über diese Thematik geführt, welche immer<br />
wieder zu negativen Schlagzeilen auch bezüglich der<br />
Sicherheit und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von<br />
Trinkwasser beitragen kann. Da allein mit sachlichen<br />
und technisch-fundierten Aussagen und Fakten eine<br />
Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung bei den<br />
Verbrauchern nicht zu erwarten ist, sind u. a. von<br />
den <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen (WVU) entsprechende<br />
Informations- und Kommunikationsstrategien<br />
erforderlich.<br />
Vom wissenschaftlichen Standpunkt sind organische<br />
Spurenstoffe in der Regel anthropogene naturfremde<br />
Stoffe, die in geringen bis sehr geringen Konzentrationen<br />
in Gewässern (<strong>Abwasser</strong>, Oberflächenwasser und<br />
Grundwasser) vorkommen können [1–7]. Sie sind Indikatoren<br />
für den weit verbreiteten Einsatz von chemischen<br />
Stoffen (Chemikalien) in Industrieprodukten,<br />
Medikamenten, Lebensmitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln,<br />
Kosmetika etc., die auch im H<strong>aus</strong>halt verwendet<br />
werden und deren Rückstände in die Umwelt und in die<br />
Gewässer gelangen können und dort verbleiben. Da<br />
heute mit modernsten und leistungsfähigsten Analysensystemen<br />
auch extrem niedrige Konzentrationen<br />
gemessen werden können, wird vielfach vermutet, dass<br />
schon der Nachweis einer Verbindung z. B. in einer <strong>Wasser</strong>probe,<br />
unabhängig von der festgestellten Konzentration,<br />
eine erhebliche Gefährdung für Mensch und<br />
Umwelt bedeutet und dass jede nachgewiesene chemische<br />
Verbindung selbst hochtoxisch ist. Dass dies nicht<br />
zutrifft, hat bereits im 16. Jahrhundert Paracelsus<br />
erkannt (Zitat):<br />
„Alle Ding’ sind Gift, und nichts ist ohne Gift.<br />
Allein die Dosis macht, dass ein Ding’ kein Gift ist.“<br />
Erforderlich sind für die aktuellen Diskussionen nicht<br />
nur Konzentrationsangaben, sondern transparente und<br />
nachvollziehbare Kriterien, wie ein solcher Stoff in der<br />
gemessenen Konzentration zu bewerten ist.<br />
Unabhängig davon sind generell ökonomisch und<br />
ökologisch sinnvolle Maßnahmen angezeigt, die zu<br />
einer Verminderung oder Vermeidung der Einträge von<br />
organischen Spurenstoffen in die Gewässer führen. Da<br />
inzwischen weltweit mehr als 50 Millionen Stoffe erfasst<br />
und registriert und in Europa derzeit mehr als 100 000<br />
Chemikalien im Vertrieb bzw. am Markt vorhanden sind,<br />
erübrigt sich die Frage, wie viele organische Spuren-<br />
Dezember 2011<br />
1206 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
stoffe wurden bislang nachgewiesen und wie viele<br />
werden zukünftig noch in unseren Gewässern zu finden<br />
sein? Es steht außer Frage, dass uns <strong>aus</strong> wissenschaftlicher<br />
und <strong>aus</strong> gesellschaftspolitischer Sicht die Thematik<br />
Spurenstoffe auch noch in Jahrzehnten beschäftigen<br />
wird. Dabei muss unsere hoch technisierte Gesellschaft<br />
entscheiden, welchen Nutzen der Einsatz von chemischen<br />
Stoffen z. B. für Gesundheit, Nahrungsmittelproduktion<br />
und Lebensqualität erbringt und wie hoch<br />
mögliche Gefährdungen und Schäden an Umwelt und<br />
Natur zu bewerten sind.<br />
2. Bewertungskonzepte für organische<br />
Spurenstoffe<br />
Bei der Zulassung von Chemikalien wird heute nach<br />
REACH (Registration, Evaluation and Assessment of<br />
Chemicals) eine umfangreiche Risikobewertung gefordert,<br />
bevor die entsprechenden Stoffe auf den Markt<br />
kommen [8]. Ausgenommen von den REACH-Vorgaben<br />
sind Pharmaka-Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel<br />
(PSM), für die eigene Zulassungskriterien EU-weit festgesetzt<br />
sind. Für die meisten der seit Jahrzehnten<br />
produzierten, auf dem Markt befindlichen und verwendeten<br />
Chemikalien (sogenannte Altstoffe) waren in der<br />
Vergangenheit keine so strengen Zulassungsanforderungen<br />
vorhanden, sodass hochtoxische Stoffe (wie z. B.<br />
prioritäre gefährliche Stoffe der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie)<br />
erst nach langwierigen Diskussionen verboten<br />
wurden. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden<br />
und werden auch heute noch z. T. toxische organische<br />
Spurenstoffe gefunden, obwohl sie schon seit Jahren<br />
nicht mehr hergestellt werden (z. B. verschiedene Pestizidwirkstoffe,<br />
chlorierte Kohlenwasserstoffe etc.).<br />
Eine umfassende Risikobewertung, die alle toxikologischen<br />
und gesundheitlichen Aspekte beinhaltet,<br />
liegt nur für wenige t<strong>aus</strong>end Chemikalien weltweit vor.<br />
Für die meisten Stoffe sind nur unzureichende toxikologische<br />
Daten vorhanden, sodass für diese Verbindungen<br />
eine Bewertung nach dem TTC-Konzept (threshold<br />
of toxicological concern) vorgenommen wird [9]. Das<br />
TTC-Konzept will für eine bestimmte chemische Verbindung,<br />
deren Struktur bekannt ist, eine unbedenkliche<br />
Exposition für den Menschen angeben. Bei einem<br />
Schwellenwert von < 1,5 µg pro Tag und Person liegt<br />
danach keine Gesundheitsgefährdung vor. Bei gentoxischen<br />
Substanzen wird ein Schwellenwert um den<br />
Faktor 10 niedriger angegeben. Das vom Umweltbundesamt<br />
entwickelte GOW-Konzept (Gesundheitliche<br />
Orientierungswerte) ist mit dem TTC-Konzept insofern<br />
vergleichbar, da dieselben toxikologischen Quellen und<br />
Literaturangaben verwendet werden [10–11]. Das GOW-<br />
Konzept berücksichtigt aber nur den Trinkwasserpfad,<br />
d. h. die Aufnahme eines Stoffes über das Trinkwasser<br />
wird mit GOW-Werten geregelt. Nach diesem Konzept<br />
liegt generell eine gesundheitliche Sicherheit vor, wenn<br />
ein Vorsorgewert von 0,1 µg/L ˆ= 0,2 µg pro Tag und<br />
Person dauerhaft unterschritten wird. Für gentoxische<br />
Verbindungen gilt ein um den Faktor 10 niedrigerer<br />
Wert. Da nach dem TTC-Konzept etwa 10 % der Exposition<br />
von Chemikalien über die Aufnahme von Trinkwasser<br />
erfolgt, sind die Zahlenwerte gemäß TTC- und<br />
GOW-Konzept in den meisten Fällen direkt vergleichbar.<br />
Grundsätzlich gilt, dass je größer und zuverlässiger die<br />
toxikologische Datenbasis ist, dann auch deutlich<br />
höhere TTC- bzw. GOW-Zahlenwerte festgelegt werden<br />
können.<br />
Für einen umfassenden vorsorgenden Gewässerschutz<br />
zur Sicherung der Rohwasserressourcen setzen<br />
sich die Verbände der <strong>Wasser</strong>versorgung (ARW –<br />
Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke, AWBR –<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein,<br />
ATT – Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren,<br />
AWWR – Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der<br />
Ruhr, DVGW – Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches)<br />
ein. Im Donau-, Maas- und Rhein-Memorandum<br />
(DMR) 2008 sowie im Oberflächenwasser-Memorandum<br />
von DVGW und ATT sind für organische Spurenstoffe<br />
spezifische Zielwerte bzw. Qualitätsanforderungen<br />
festgelegt, die beispielhaft in Tabelle 1 aufgeführt sind.<br />
Die Zielwerte wurden als zulässige Maximalwerte<br />
definiert, bei deren Überschreitung Handlungsbedarf<br />
bezüglich geeigneter Maßnahmen zur Verminderung<br />
der Stoffeinträge in die Gewässer besteht. Die Zielwerte<br />
sind <strong>aus</strong> Vorsorgegründen in der Regel niedriger als<br />
entsprechende Grenzwerte der Trinkwasserverordnung<br />
oder gesundheitliche Orientierungswerte (GOW), die<br />
meist nach humantoxikologischen Kriterien abgeleitet<br />
wurden. Grundsätzlich sind nach Ansicht der <strong>Wasser</strong>verbände<br />
die Einträge von organischen Spurenstoffen in<br />
die Gewässer bzw. Rohwasserressourcen soweit wie<br />
möglich zu minimieren.<br />
Ein verfahrenstechnisches Konzept zur Bewertung<br />
von organischen Spurenstoffen ist das sogenannte<br />
TZW-Konzept, welches physikalisch-chemische und biologische<br />
Stoffeigenschaften mit verfahrenstechnischen<br />
Aspekten der Trinkwasseraufbereitung kombiniert.<br />
Anhand der Ergebnisse von Laboruntersuchungen zum<br />
Verhalten organischer Spurenstoffe bei verschiedenen<br />
Tabelle 1. Zielwerte (Maximalwerte) für organische Spurenstoffe<br />
bzw. Stoffgruppen.<br />
Konzentrationen in µg/L DMR DVGW/ATT<br />
Pestizide und Metabolite 0,1 0,1<br />
Biozide 0,1 0,1<br />
Endokrin wirksame Substanzen 0,1 0,1<br />
Pharmakarückstände 0,1 0,1<br />
Perfluorierte/Polyfluorierte Verbindungen (PFC) und<br />
übrige Halogenverbindungen (HKW)<br />
0,1 0,1<br />
Mikrobiell schwer abbaubare Stoffe 1,0 1,0<br />
Synthetische Komplexbildner 5,0 5,0<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1207
FachberichtE ATT Symposium<br />
Vorratsbehälter<br />
Schlauchpumpe<br />
Pulsationsdämpfer<br />
Überströmventil<br />
Durchflussmesser<br />
Druckmesser<br />
Aktivkohlefilter<br />
Druckmesser<br />
Aufbereitungsverfahren (Bodenpassage, biologischer<br />
Abbau, Oxidation, Adsorption an Aktivkohle etc.) werden<br />
unter realitätsnahen Bedingungen spezifische<br />
Kenndaten wie z. B. Abbaubarkeit, Oxidierbarkeit und<br />
Adsorbierbarkeit ermittelt, die konkrete Angaben zum<br />
Verhalten bei der Trinkwasseraufbereitung erlauben.<br />
Insbesondere die Ergebnisse des Aktivkohle-Kleinfiltertests<br />
(Bild 1) ergeben vergleichende Informationen<br />
zum Durchbruchsverhalten der verschiedenen Spurenstoffe<br />
bei der Aktivkohlefiltration (Bild 2). Während die<br />
Stoffe Clofibrinsäure, Diclofenac, Bezafibrat und Carbamazepin<br />
gut bis sehr gut entfernt werden können, ist<br />
ein Rückhalt von Amidotrizoesäure mit Aktivkohle kaum<br />
möglich.<br />
Bild 1. Aufbau des Aktivkohle-Kleinfiltertests.<br />
c/c 0<br />
Konzentration in ng/L<br />
1,0<br />
0,9<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Clofibrinsäure<br />
Diclofenac<br />
Bezafibrat<br />
Carbamazepin<br />
Amidotrizoesäure<br />
Probennahme<br />
0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000<br />
Bild 2. Durchbruchskurven von <strong>aus</strong>gewählten<br />
Arzneimittelwirk stoffen bzw-metaboliten (Clofibrinsäure).<br />
Rohwasser<br />
(Uferfiltrat)<br />
nach Ozonung<br />
BVT<br />
nach Aktivkohle<br />
N,N-Dimethylsulfamid<br />
NDMA<br />
Bild 3. Verhalten von DMS und NDMA bei der<br />
Trinkwasseraufbereitung.<br />
9 ng/L NDMA<br />
Ausgang WW<br />
n = 3<br />
3. Aktuelle organische Spurenstoffe<br />
Neben Pflanzenschutzmitteln (PSM) und Arzneimittelwirkstoffen,<br />
über deren „Relevanz“ für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
schon seit Jahren diskutiert wird, sind weitere<br />
Spurenstoffe wie PSM-Metaboliten (N,N-Dimethylsulfamid<br />
(DMS), Desphenylchloridazon und andere),<br />
perfluorierte Verbindungen (PFC), Benzotriazole, künstliche<br />
Süßstoffe und viele andere mehr in den Mittelpunkt<br />
des Interesses gerückt. Während früher nur<br />
wenige PSM-Metaboliten (Desethyl-Verbindungen von<br />
Atrazin, Simazin und Terbutylazin sowie 2,6-Dichlorbenzamid)<br />
in Roh- und Trinkwässern gemessen wurden,<br />
haben zumindest in der Bundesrepublik Deutschland<br />
die Fallbeispiele DMS und Chloridazon-Metaboliten B<br />
und B1 die Diskussion wieder neu entfacht. Grundsätzlich<br />
werden die aktuellen PSM-Metaboliten vom<br />
Umweltbundesamt als nicht-relevant bewertet und sind<br />
dort in einer Liste mit gesundheitlichen Orientierungswerten<br />
(GOW) geführt (Tabelle 2).<br />
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) wurde erstmals im Jahr<br />
2006 als unbekannter Metabolit des Fungizids Tolylfluanid<br />
identifiziert [13,14]. DMS weist eine hohe Mobilität<br />
im Boden und Grundwasser auf, ist sehr persistent<br />
und wird als toxikologisch unkritisch eingestuft. Vom<br />
Umweltbundesamt wurde ein GOW von 1,0 µg/L im<br />
Trinkwasser festgelegt. Bei der Ozonung in <strong>Wasser</strong>-<br />
Tabelle 2. Bewertung von PSM-Metaboliten.<br />
Bewertung<br />
Relevante PSM-Metaboliten weisen ein pestizides,<br />
ökotoxikologisches oder humantoxikologisches<br />
Restwirkungspotential auf.<br />
→ es gilt der PSM-Grenzwert<br />
Nicht relevante PSM-Metaboliten (nrM) sollten <strong>aus</strong><br />
„trinkwasserhygienischer“ Sicht ebenfalls begrenzt<br />
werden.<br />
→ UBA-Empfehlung: dauerhaft hinnehmbare<br />
gesundheitliche Orientierungswerte<br />
(GOW) von 1,0 µg/L bzw. 3,0 µg/L<br />
http://www.umweltdaten.de/wasser/themen/<br />
trinkwassertoxikologie/tabelle_gow_nrm.pdf [12]<br />
Dezember 2011<br />
1208 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
werken kann aber <strong>aus</strong> DMS das kanzerogene und gentoxische<br />
NDMA (N-Nitrosodimethylamin) entstehen, für<br />
welches ein GOW von 0,01 µg/L = 10 ng/L gilt (Bild 3).<br />
Der Wirkstoff Tolylfluanid wurde bereits im Frühjahr<br />
2007 von der Herstellerfirma zurückgezogen und ist<br />
inzwischen EU-weit nicht mehr zugelassen.<br />
Umfangreiche Untersuchungen zum Vorkommen<br />
von DMS in verschiedenen Gewässern ergaben zum Teil<br />
sehr hohe Gehalte, vor allem in Grundwasserproben<br />
(Bild 4).<br />
Die höchsten DMS-Konzentrationen wurden im<br />
Grundwasser, insbesondere im Abstrom von Sonderkulturen<br />
und Obstanbau gefunden. Auch in kleineren<br />
Fließgewässern wurden zum Teil erhöhte DMS-Konzentrationen<br />
> 1 µg/L gemessen. Inzwischen sind von<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen und Behörden systematische<br />
Untersuchungen zum Vorkommen von DMS<br />
in Oberflächen-, Grund- und Trinkwässern durchgeführt<br />
worden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse bestätigen die<br />
vergleichsweise hohen DMS-Konzentrationen in der<br />
aquatischen Umwelt. Während im Grundwasserbereich<br />
derzeit noch keine Anzeichen für einen Rückgang der<br />
DMS-Gehalte zu erkennen ist, zeigen aktuelle DMS-<br />
Befunde in Oberflächengewässern inzwischen rückläufige<br />
Konzentrationen, die auf den freiwilligen<br />
Anwendungsverzicht zurückzuführen sind.<br />
Eine noch größere Vielfalt von Stoffen (mehr als<br />
900 Wirkstoffe ohne Metaboliten) werden unter dem<br />
Begriff „Arzneimittelrückstände“ diskutiert, wobei in der<br />
Regel eine Einteilung nach Indikationsklassen vorgenommen<br />
wird, die jedoch für chemisch-analytische<br />
Aspekte ohne Bedeutung ist (Bild 5).<br />
N,N-Dimethylsulfamid [ng/L]<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
MAX 18 000 ng/L<br />
n = 684 800 n = 354<br />
1800<br />
n = 255<br />
1600<br />
Grundwasser<br />
Median 150 ng/L<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
MAX 2500 ng/L<br />
Oberflächenwasser<br />
Median 67 ng/L<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
MAX 5500 ng/L<br />
Trinkwasser<br />
Median 60 ng/L<br />
Bild 4. Vorkommen von N,N-Dimethylsulfamid in Grund-, Oberflächen<br />
und Trinkwasser.<br />
Bild 5. Indikationsklassen von Arzneimitteln.<br />
Konzentration in ng/L<br />
Clofibrinsäure<br />
Bezafribat<br />
Gemfibrozil<br />
Fenofibrinsäure<br />
Diclofenac<br />
Ibuprofen<br />
Indometacin<br />
Naproxen<br />
Carbamazepin<br />
Azithromycin<br />
Clarithromycin<br />
Dehydrato-Erythromycin<br />
Roxithromycin<br />
Sulfamethoxazol<br />
Clindamycin<br />
Trimethoprim<br />
Ciprofloxacin<br />
Ofloxacin<br />
Atenolol<br />
Bisoprolol<br />
Metaprolol<br />
Sotalol<br />
1 10 100 1000 10 000<br />
KA-Zulauf<br />
KA-Ablauf<br />
Bild 6.<br />
Zu- und Ablaufkonzentrationen<br />
verschiedener<br />
Arzneimittelwirkstoffe<br />
in<br />
Kläranlagen.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1209
FachberichtE ATT Symposium<br />
Bild 7. Verwendung von künstlichen Süßstoffen.<br />
Bild 8. Verhalten von künstlichen Süßstoffen bei der<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung.<br />
Konzentrataion in ng/L<br />
1000<br />
100<br />
10<br />
1<br />
Acesulfam Saccharin Cyclamat Sucralose<br />
Scheurer M., Lange F.T., Brauch H.-J. (2009) Anal Bioanal Chem 394 (6): 1585–1594<br />
Bild 9. Konzentrationsbereiche von künstlichen Süßstoffen<br />
in Oberflächengewässern.<br />
Sehr viel <strong>aus</strong>sagekräftiger für Verhalten und Bewertung<br />
von Arzneimittelwirkstoffen in Gewässern sind<br />
Monitoring-Daten und Resultate von systematischen<br />
Untersuchungen. In Bild 6 sind die Zu- und Ablaufkonzentrationen<br />
(Mittelwerte) verschiedener Arzneimittelwirkstoffe<br />
in <strong>aus</strong>gewählten Kläranlagen vergleichend<br />
gegenübergestellt.<br />
Aus den Messdaten ist ersichtlich, dass ein Großteil<br />
der untersuchten Wirkstoffe nur zum Teil biologisch<br />
abgebaut und eliminiert werden kann, sodass noch<br />
einige bekannte Verbindungen wie Carbamazepin,<br />
Diclofenac, Atenolol, Metoprolol und Sotanol auch in<br />
höheren Konzentrationen in Vorflutern und Oberflächengewässern<br />
gefunden werden. Daneben werden<br />
auch vergleichsweise hohe Konzentrationen von iodierten<br />
Röntgenkontrastmitteln in den Fließgewässern<br />
gemessen, wobei die Zahlenwerte relativ gut mit den<br />
entsprechenden Anteilen an gereinigtem <strong>Abwasser</strong> korrelieren.<br />
In Rohwässern, die zur Trinkwassergewinnung<br />
genutzt werden, finden sich dagegen nur wenige polare<br />
und persistente Verbindungen wie Carbamazepin, Amidotrizoat<br />
und Sulfamethoxazol, die weder durch biologischen<br />
Abbau im Untergrund noch durch Sorptionsprozesse<br />
zurückgehalten werden. Grundsätzlich eignet<br />
sich die Adsorption an Aktivkohle gut zur Entfernung<br />
von Arzneimittelwirkstoffen, auch wenn die Laufzeiten<br />
der Aktivkohlefilter im Einzelfall unterschiedlich sein<br />
können. Allerdings gilt auch im Fall der Arzneimittelrückstände<br />
die Forderung eines vorsorgenden Gewässerschutzes:<br />
Die Einträge sind vor Ort, d. h. direkt an der<br />
Quelle, zu minimieren. Eine Aufbereitung im <strong>Wasser</strong>werk<br />
(als end-of-pipe-Lösung) kann nur dann akzeptabel<br />
sein, wenn längerfristig die entsprechenden<br />
gesundheitlichen Orientierungswerte (GOW) überschritten<br />
werden.<br />
Weitere aktuelle Spurenstoffe sind die künstlichen<br />
Süßstoffe (Bild 7).<br />
Von den vier in Abwässern vorkommenden Verbindungen<br />
werden Acesulfam und Sucralose in Kläranlagen<br />
biologisch kaum abgebaut und eliminiert,<br />
sodass vergleichbar hohe Ablaufkonzentrationen (wie<br />
im Zulauf) resultieren (Bild 8).<br />
In Oberflächengewässern tritt vor allem Acesulfam<br />
in höheren Konzentrationen (> 1 µg/L) auf (Bild 9).<br />
Aufgrund seiner hohen Persistenz, <strong>Wasser</strong>löslichkeit<br />
und Mobilität wird Acesulfam häufig in oberflächenwasserbeeinflussten<br />
Rohwässern gefunden. Da Acesulfam<br />
als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen und daher nicht<br />
toxisch ist, sollte ein GOW im Trinkwasser bei 10 µg/L<br />
liegen.<br />
4. Folgerungen<br />
Das Vorkommen von organischen Spurenstoffen in sehr<br />
niedrigen Konzentrationen in der aquatischen Umwelt<br />
ist eine Tatsache, die nicht mehr wegzudiskutieren ist.<br />
„Null“-Konzentrationen wird es bei zunehmend sensi-<br />
Dezember 2011<br />
1210 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ATT Symposium<br />
Fachberichte<br />
tiveren Analysenmethoden nicht mehr geben. Erforderlich<br />
sind abgestimmte, transparente und nachvollziehbare<br />
Bewertungskonzepte und -methoden, denen der<br />
Verbraucher und die Öffentlichkeit Vertrauen entgegen<br />
bringen können. Dies kann nur durch gemeinsames<br />
Handeln von Politik und Behörden, Industrie, <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und Verbrauchern erfolgreich umgesetzt<br />
werden.<br />
Literatur<br />
[1] Brauch, H.-J., Sacher, F. und Schmidt, C.: Anthropogene Spurenstoffe<br />
in Gewässern – Relevanz für die <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
gwa 88 (2008) Nr. 1, S. 17–25.<br />
[2] Sacher, F., Ehmann, M., Gabriel, S., Graf, C. and Brauch H.-J.:<br />
Pharmaceutical residues in the river Rhine – results of a onedecade<br />
monitoring programme. J. Environ. Monit. (2008)<br />
No. 10, p. 664–670.<br />
[3] Scheurer, M., Brauch, H.-J. and Lange, F. T.: Analysis and occurrence<br />
of seven artificial sweeteners in German waste water<br />
and in soil aquifer treatment (SAT). Anal. Bioanal. Chem. 394<br />
(2009) No. 6, p. 1585–1594.<br />
[4] Scheurer, M., Sacher, F. and Brauch, H.-J.: Occurrence of the<br />
antidiabetic drug metformin in sewage and surface waters<br />
in Germany. J. Environ. Monit. (2009) No. 11, p. 1608–1613.<br />
[5] Lange, F. T., Wenz, M., Schmidt, C. K. and Brauch, H.-J.: Occurrence<br />
of perfluoroalkyl sulfonates and carboxylates in German<br />
drinking water sources compared to other countries.<br />
Water Science & Technology 56 (2007) No. 11, p. 151–158.<br />
[6] Schmidt, C. K. and Brauch, H.-J.: Occurrence, fate and relevance<br />
of aminopolycarboxylate chelating agents in the<br />
Rhine basin. The Handbook of Environmental Chemistry Vol.<br />
5L, Springer-Verlag, 2006, p. 211–234.<br />
[7] Lange, F. T. and Brauch, H.-J.: Analysis, Occurrence, and Fate of<br />
Aromatic Sulfonates in the Rhine and its Tributaries. In:<br />
Handbook of Environmental Chemistry, O. Hutzinger (ed.),<br />
Vol. 5 Water Pollution, Part L, Springer, 2006, p. 185–210.<br />
[8] Umweltbundesamt (2011): www.umweltbundesamt.de/<br />
chemikalien/index.htm<br />
[9] Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (2011):<br />
www.efsa.europa.eu<br />
[10] Umweltbundesamt (2011): www.umweltbundesamt.de/<br />
wasser/themen<br />
[11] Bayerisches Landesamt für Umwelt (2011): lfu.bayern.de/<br />
analytik_stoffe/psm_metaboliten/doc/uba-empfehlung.pdf<br />
[12] Umweltbundesamt: http://www.umweltdaten.de/wasser/<br />
themen/trinkwassertoxikologie/tabelle_gow_nrm.pdf<br />
[13] Schmidt, C. K. and Brauch, H.-J.: N,N-Dimethylsulfamide as<br />
precursor for N-nitroso dimethylamine (NDMA) formation<br />
upon ozonation and its fate during drinking water treatment.<br />
Environmental Science & Technology 42 (2008), p.<br />
6340–6346.<br />
[14] Schmidt, C. K. und Brauch, H.-J.: Zur Bedeutung von NDMA,<br />
anderen Nitrosaminen und N,N-Dimethylsulfamid (DMS) für<br />
die Trinkwasserversorgung. ARW-Jahresbericht 2007 (2008),<br />
S. 39–59.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Korrektur: 11.11.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Brauch<br />
E-Mail: heinz-juergen.brauch@tzw.de |<br />
DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TWZ) |<br />
Karlsruher Straße 84 |<br />
D-76139 Karlsruhe<br />
Parallelheft <strong>gwf</strong>-Gas | Erdgas<br />
Rohrleitungsbau<br />
Sie lesen u. a. fol gende Bei träge:<br />
Hartmann/Kocks/Maier<br />
Drees/Vengels<br />
Gawantka<br />
Günther u. a.<br />
Hoffmann<br />
Umhüllungen <strong>aus</strong> Polyamid für nicht konventionelle Bauweisen<br />
nachumhüllungsmaterialien für hohe mechanische<br />
und thermische Beanspruchungen<br />
Zielnetzplanung am Beispiel eines regionalen Gashochdrucknetzes<br />
BCM-Biogastechnik vereinigt Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz<br />
durch Gesamtbetrachtung – Was muss sich ändern?<br />
konformitätsprüfung von Smart-Meter-Schnittstellen<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1211
Praxis<br />
Glasfaserliner <strong>aus</strong> dem H<strong>aus</strong>e Insituform<br />
DIBt-Zulassung Z-42.3-475 am 30. September 2011 erteilt<br />
Wie bei jedem langjährig<br />
erfolgreichen Unternehmen<br />
basieren auch bei Insituform die<br />
Entscheidungen auf soliden Marktund<br />
Wettbewerbsanalysen, internen<br />
Auswertungen, konstruktivem<br />
Kundenfeedback und natürlich den<br />
Anforderungen, die sich <strong>aus</strong> der<br />
Unternehmens<strong>aus</strong>richtung und<br />
-philosophie begründen.<br />
Die letzten prägenden Entwicklungen<br />
waren die Integration der<br />
Schacht- und Großprofilsanierungsverfahren<br />
sowie die Aufnahme des<br />
UV-härtenden Glasfaserliners von<br />
iMPREG in das Angebotsportfolio<br />
der IRT.<br />
Die Nachfrage nach Glasfaserlinern<br />
ist in den letzten Jahren enorm<br />
gestiegen. Dabei hat sich vielerorts<br />
eine „Aufgabenteilung“ zwischen<br />
Produktion und Installation entwickelt,<br />
indem sich einzelne Unternehmen<br />
auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen<br />
konzentrieren. Das<br />
heißt, Produkte werden industriell<br />
Trier: Insituform-Glasfaserliner mittels Winde auf<br />
dem Weg durch den Kanal.<br />
Trier: Einziehen des Insituform-<br />
Glasfaserliners in den<br />
Startschacht.<br />
gefertigt und an verschiedene <strong>aus</strong>führende<br />
Unternehmen verkauft<br />
und durch diese eingebaut.<br />
Insituform, als Vorreiter der grabenlosen<br />
Sanierung mittels Synthesefaser-Schlauchlining,<br />
hat seit seiner<br />
Gründung 1989 einen anderen<br />
Weg beschritten. Der Insituform-<br />
Liner, in eigenen Produktionsstätten<br />
hergestellt und imprägniert,<br />
wird von eigenem Personal mit<br />
eigenem Equipment installiert.<br />
„Alles <strong>aus</strong> einer Hand“ bringt viele<br />
Vorteile, nicht nur für dem Dienstleister,<br />
sondern insbesondere dem<br />
Kunden – dem Auftraggeber:<br />
""<br />
Sicherheit,<br />
dass das angebotene und beauftragte<br />
Produkt/Verfahren tatsächlich<br />
zum Einsatz kommt.<br />
""<br />
Vertrauen,<br />
dass Produzent, Kalkulator und<br />
Einbaukolonne qualifiziert auf<br />
das Produkt geschult sind.<br />
""<br />
Zuverlässigkeit,<br />
da Produktion und Installation<br />
von vornherein optimal aufeinander<br />
abgestimmt sind und<br />
ein lückenloser Informationskreislauf<br />
zeitnahe Reaktionen<br />
ermöglicht.<br />
Trier: Einschieben der UV-Lichterkette<br />
vor dem Einbau des Packers.<br />
""<br />
Schnelligkeit,<br />
da zwischen Produktion und Installation<br />
nur geringe Abhängigkeit<br />
von externen Partnern und<br />
deren Prioritäten besteht.<br />
""<br />
Innovationen,<br />
die auf der Produktkenntnis in<br />
jeder Phase – von der Wareneingangskontrolle<br />
der Ausgangsmaterialien<br />
bis zur Kontrolle<br />
des fertigen Endproduktes<br />
– beruhen.<br />
Heidenau: Einziehen der<br />
Gleitfolie mittels Insituform-<br />
Einbaufahrzeug.<br />
Dezember 2011<br />
1212 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
Erfahrungen <strong>aus</strong> t<strong>aus</strong>enden realisierten<br />
B<strong>aus</strong>tellen, die die Netzbetreiber<br />
überzeugt und Insituform<br />
so zum Marktführer der Branche<br />
gemacht haben. Der Mix <strong>aus</strong><br />
Bewährtem und dem Öffnen<br />
gegenüber neuen Ansprüchen<br />
erwies sich schon in der Vergangenheit<br />
als Erfolgsrezept.<br />
Daher war die Entscheidung,<br />
einen UV-härtenden Glasfaserliner<br />
– selbstverständlich mit DIBt-Zulassung<br />
– in die eigene Produktion aufzunehmen,<br />
nur logisch und folgerichtig.<br />
Die effiziente und partnerschaftliche<br />
Zusammenarbeit mit iMPREG<br />
endet mit dieser Entscheidung aber<br />
nicht, da für beide Unternehmen<br />
die Kooperation äußerst erfolgreich<br />
ist.<br />
Durch die Produkterweiterung<br />
in eigener Herstellung ist IRT nun<br />
außerdem in der Lage, gezielt Synergien<br />
zu nutzen, welche weiteren<br />
direkten Kundennutzen bringen:<br />
""<br />
Flexibilität,<br />
wenn kurzfristig nicht vorhersehbare<br />
Randbedingungen auf<br />
der B<strong>aus</strong>telle einen Produktwechsel<br />
notwendig machen.<br />
""<br />
Objektivität,<br />
da für jede projektbezogene<br />
Aufgabenstellung das technisch,<br />
wirtschaftlich und ökologisch<br />
optimale Produkt angeboten<br />
werden kann.<br />
""<br />
Wirtschaftlichkeit,<br />
wenn eine Maßnahme den kombinierten<br />
Einsatz verschiedener<br />
Materialien bzw. Aushärtemethoden<br />
erfordert.<br />
""<br />
Neutralität,<br />
da keinerlei Firmeninteresse<br />
besteht, ein bestimmtes Produkt<br />
zu favorisieren.<br />
Der Insituform-Glasfaserliner wurde<br />
hinsichtlich seiner Gebrauchstauglichkeit<br />
und aller relevanten Kenndaten<br />
umfassend geprüft und<br />
erhielt am 30.09.2011 die DIBt-<br />
Zulassung des Deutschen Instituts<br />
für Bautechnik.<br />
Die DIBt-Zulassung für den<br />
Insituform-Glasliner – genau wie die<br />
Heidenau: Der Zugkopf wird für<br />
den Einzugsvorgang vorbereitet.<br />
Zulassung für den Insituform-Synthesefaserliner<br />
und alle anderen<br />
Zertifikate – können von der Seite<br />
www.insituform.de/unternehmen/<br />
qualitaetssicherung heruntergeladen<br />
werden.<br />
Unabhängig davon steht ein<br />
Team von Spezialisten deutschlandweit<br />
für alle Fragen allgemeiner<br />
Natur, aber auch konkrete Sanierungsprojekte<br />
betreffend bereit.<br />
Den zuständigen Ansprechpartner<br />
findet man unter: www.insituform.<br />
de/niederlassungen<br />
Blick hinter die „Kulissen“<br />
Mitte September – mit der serienreifen<br />
Produktion des eigenen GF-<br />
Liners – öffnete IRT nach dem produktionsbedingten<br />
Umbau der<br />
Halle seine Tore zur ersten Werksbesichtigung.<br />
25 Ingenieure folgten<br />
der Einladung der Niederlassung<br />
Köln/Bonn nach Geschwenda in<br />
Thüringen. Als erste externe Besucher<br />
konnten sie die neue Imprägnieranlage<br />
für Glasfaserliner besichtigen,<br />
welche parallel zur Synthesefaserliner-Imprägnierung<br />
errichtet<br />
wurde.<br />
Analog zum Aufbau der Anlage<br />
erfolgte auch die Umstrukturierung<br />
des Lager- und Logistikbereichs.<br />
Zielsetzung: Die 23 000 m² Lagerfläche<br />
– für rund 30 000 m Trockenschläuche,<br />
etwa 200 000 kg ver-<br />
Heidenau: Materialschonendes<br />
Einziehen des Insituform-<br />
Glasfaserliners.<br />
schiedene Polyestertypen, rund 70 t<br />
Zuschlagstoffe für Polyester sowie<br />
verschiedenes Equipment für die<br />
B<strong>aus</strong>tellenbelieferung – den Bedürfnissen<br />
der Produkterweiterung<br />
anzupassen. Die Anpassung<br />
erstreckte sich auch auf alle an -<br />
deren Abläufe, wie z. B. Disposition<br />
oder Fakturierung.<br />
In den ersten Wochen der GFL-<br />
Produktion empfing das Werk nicht<br />
nur Kunden, sondern auch Kalkulatoren,<br />
Vertriebsmitarbeiter und<br />
Bauleiter der einzelnen IRT-Niederlassungen.<br />
Die Schulungen waren<br />
Teil der Produkteinführung. Denn<br />
nur wenn jeder Mitarbeiter mit dem<br />
neuen Produkt vertraut ist, kann<br />
langfristig eine gleich bleibend<br />
hohe Qualität gesichert werden.<br />
<br />
Heidenau: Der fertig installierte Insituform<br />
Glasfaserliner.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1213
Praxis<br />
Technische Daten<br />
Kurzzeit-E-Modul (DIN EN 1228)<br />
13 .000 N/mm 2<br />
Kurzzeit-E-Modul (DIN EN ISO 178)<br />
11 700 N/mm 2<br />
Abminderungsfaktor A1 1,43<br />
Langzeit-E-Modul (DIN EN 1228) 9090 N/mm 2<br />
Kurzzeit-Biegezugspannung (DIN EN ISO 178)<br />
185 N/mm 2<br />
Langzeit-Biegezugspannung 129 N/mm 2<br />
Standardharzsysteme nach DIN EN 13121,<br />
Gruppe 4<br />
„Feuertaufe“ in der Praxis<br />
bestanden<br />
Gestützt auf den reichen Erfahrungsschatz<br />
bei der Installation von<br />
Schlauchlinern im Allgemeinen und<br />
das über dreijährige Know-how<br />
beim Einbau von Glasfaser linern im<br />
Speziellen, verlief die Montage der<br />
ersten Insituform-Glasfaserliner<br />
erwartungsgemäß ohne Komplikationen.<br />
Vorbereitung und Durchführung<br />
der ersten Maßnahmen – wie<br />
beispielsweise in Trier DN 300, 4 mm<br />
oder Heidenau Eiprofil 800/1200,<br />
9 mm – wichen weder für die Bauleitung<br />
noch für die eingespielte<br />
Kolonne von der Routine ab.<br />
Größer war da natürlich die<br />
Anspannung im Werk selbst. Galt es<br />
doch nun, die Erkenntnisse <strong>aus</strong> den<br />
umfangreichen Testläufen umzusetzen,<br />
denn der Anspruch an die Qualität<br />
des Liners war bei Auftraggeber<br />
und -nehmer gleichermaßen hoch.<br />
Aber auch hier profitierte Insituform<br />
wieder von seiner harmonisch<br />
gewachsenen und schlanken Struktur,<br />
die eine enge Abstimmung zwischen<br />
Technik & Entwicklung, Produktion<br />
und der erfahrenen<br />
Kolonne der Testb<strong>aus</strong>tellen gewährleistete.<br />
Weiteres Plus: Alle am<br />
Kompetenzzentrum Geschwenda<br />
vorhandenen technischen Einrichtungen<br />
– von den modernen Laboratorien<br />
bis hin zum Testgelände –<br />
konnten und können zeitlich unbegrenzt<br />
genutzt werden.<br />
Kontakt:<br />
Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH,<br />
Sulzbacher Straße 47,<br />
D-90552 Röthenbach/Pegnitz,<br />
Tel. (0911) 95773-0, Fax (0911) 95773-33,<br />
E-Mail: info@insituform.de,<br />
www.insituform.de<br />
Mit Torpedo in die Tiefe<br />
ARGE Pfaffinger/Streicher verlegt erstmals eine Stahlleitung DN 300 mit<br />
ZM-Auskleidung im Raketenpflugverfahren<br />
STREICHER Gruppe<br />
Der niederbayerische Gäuboden blühte, auf den Feldern begann die Aussaatzeit. Ausgerechnet in diesen für<br />
die Landwirtschaft sensiblen Zeitraum fiel die Verlegung einer Stahlleitung zur Optimierung der Trinkwasserversorgung<br />
im Raum Wallersdorf. Die Arbeiten, die Anfang April begannen, haben jedoch kaum Spuren in der<br />
Landschaft hinterlassen. Denn im Auftrag der <strong>Wasser</strong>versorgung Bayerischer Wald (WBW) wurde von den<br />
niederbayerischen Firmen Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH und MAX STREICHER GmbH & Co. KG<br />
aA erstmals ein Verfahren durchgeführt, das die baulichen Eingriffe und somit Auswirkungen auf Flora,<br />
Fauna und Landwirtschaft auf ein Minimum reduziert.<br />
Lediglich eine schmale Schneise<br />
zieht sich durch die Mitte des<br />
Feldwegs am Rande eines Ackers<br />
bei Wallersdorf. Zuvor fuhr hier ein<br />
Mit ihrer 100-jährigen Geschichte vereint die<br />
STREICHER Gruppe Qualität und Fachkenntnis<br />
mit langjähriger Erfahrung in den Kompetenzfeldern<br />
Rohrleitungs- und Anlagenbau, Maschinenbau,<br />
Tief- und Ingenieurbau und Roh- und<br />
B<strong>aus</strong>toffe. Unter dem Dach der Muttergesellschaft<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA mit Hauptsitz<br />
in Deggendorf beschäftigt das Unternehmen<br />
im In- und Ausland über 3000 Mitarbeiter.<br />
nach außen hin gewöhnlicher Pflug<br />
entlang. Alles andere als gewöhnlich<br />
ist die Ausstattung der 18 Tonnen<br />
schweren Baumaschine. Am<br />
Ende des Pflugschwertes sitzt ein<br />
Aufweitkopf, der sogenannte Torpedo.<br />
Er hat einen Durchmesser<br />
von 419 mm und kann bis in<br />
eine Tiefe von 2,50 m eingesetzt<br />
werden. Dabei verdrängt und verdichtet<br />
der Torpedo das Erdreich.<br />
Die einzuziehenden, bis zu 800<br />
Meter langen Rohrstücke werden<br />
am Ende des Torpedos montiert<br />
und während dem Pflügen in den<br />
entstehenden Hohlraum eingezogen.<br />
Schnell und schonend<br />
Die Leitungsabschnitte der Pflugtrasse<br />
werden auf Rollenböcken<br />
vorbereitet, damit der Rohrmantel<br />
beim Einzug nicht beschädigt wird.<br />
Dies ist aber schon das Augenfälligste<br />
an dieser B<strong>aus</strong>telle. „Die Erdbewegung<br />
beschränkt sich auf die<br />
Einzieh- und Verbindungsgruben,<br />
wobei der Humusabtrag um 70 Prozent<br />
verringert wird“, merkt Bauleiter<br />
Andreas Freisinger von Pfaffinger<br />
an. Hinter dem Pflug schließt<br />
sich der Boden nahezu vollständig.<br />
Bautransporte entfallen in Teilen<br />
und die Belästigung durch Lärm<br />
oder Staubentwicklung reduziert<br />
Dezember 2011<br />
1214 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
sich auf ein Minimum. Doch das<br />
Verfahren schont nicht nur Umwelt<br />
und Anwohner, sondern auch die<br />
Kassen. Laut dem planenden Ingenieur<br />
Dionys Stelzenberger verkürzt<br />
sich die Bauzeit dank Raketenpflugverfahren<br />
um ein Drittel gegenüber<br />
konventionellen Baumethoden.<br />
Bewährtes Verfahren an<br />
neuem Material<br />
Neu ist das Raketenpflugverfahren<br />
nicht. Es bewährt sich bereits seit<br />
dem Jahr 2000. Grundlage für seine<br />
Entwicklung bildete das Rohrpflugverfahren,<br />
das im Kabel- und Rohrleitungsbau<br />
eingesetzt wird. Die<br />
Erweiterung des Pflugs um die<br />
Raketenkonstruktion mit Verdrängerteil<br />
ermöglicht das Verlegen von<br />
Rohren auch mit größerem Durchmesser.<br />
Waren zu Beginn Hohlräume<br />
von 250 mm möglich, so<br />
schafft der Aufweitkopf heute Hohlräume<br />
von bis zu 500 mm Durchmesser.<br />
Die Leitung, die bei Wallersdorf<br />
verlegt wird, hat einen Außendurchmesser<br />
von 330 mm.<br />
Eine Neuheit ist dagegen, dass<br />
das Raketenpflugverfahren bei<br />
einer Stahlleitung angewandt wird.<br />
Gewöhnlich kommt das grabenlose<br />
Verfahren aufgrund der eingeschränkten<br />
Biegeradien von Stahl<br />
bislang nur bei PE- oder Gussrohren<br />
zum Einsatz.<br />
Das Pflugschwert mit dem<br />
Torpedo im Sohlbereich, der<br />
Hohlräume von bis zu 500 mm<br />
Durchmesser aufweiten kann.<br />
© STREICHER<br />
Erfolgreicher Erstversuch<br />
In den ersten zwei Stunden der<br />
Verlegearbeiten wurden 160 Meter<br />
Rohrleitung eingezogen. „Das Verfahren<br />
funktioniert besser als an -<br />
genommen“, sagt Bauleiter Markus<br />
Lallinger von STREICHER. Der Boden<br />
in der Region sei steinfrei und sehr<br />
bindig, weshalb sich die Stahlleitung<br />
besonders leicht einziehen ließ.<br />
„Beim Erstversuch waren maximale<br />
Zugkräfte von zehn Tonnen erforderlich.<br />
Die zulässige Zugkraft würde<br />
bei 100 Tonnen liegen, wobei der<br />
Biegeradius von 190 Metern nicht<br />
unterschritten werden darf. Bei Einziehlängen<br />
von 150 bis 760 Metern<br />
lagen die Zugkräfte nie über 60 Tonnen.<br />
Da gibt es also noch genügend<br />
Spielraum“, sagt Markus Lallinger.<br />
Premiere für neuen Pflug<br />
Um die Zugkräfte und den Biegeradius<br />
genau überprüfen zu können,<br />
wurde für die Verlegung der<br />
Stahlleitung der WBW im Auftrag<br />
der ARGE ein Spezialpflug eingesetzt.<br />
Ein Sensor im Inneren des<br />
Aufweitkopfes überwacht die Zugkräfte.<br />
Ein Tachymeter, der im Be -<br />
reich der Trasse aufgestellt wird,<br />
misst ständig Lage und Gefälle des<br />
Pflugs und übermittelt die Signale<br />
direkt an den Pflugführer. Gezogen<br />
wird der Pflug von einer 480 PS<br />
starken Zugmaschine, die bis zu<br />
200 Tonnen Zugkraft aufbringen<br />
kann. Sie fährt die Verlegestrecke in<br />
einer Durchschnittsgeschwindigkeit<br />
von 2 bis 4 m/min ab. Pflugund<br />
Zugmaschinenführer stehen<br />
über Funk per manent in Kontakt.<br />
Für eine sichere<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Auf diese Weise verlegte die ARGE<br />
insgesamt 9,3 Kilometer Stahlleitung<br />
DN 300, davon 8 km im Raketenpflugverfahren<br />
in nur 4,5 Monaten,<br />
durch die nun waldwasser®<br />
(EU-geschützte Marke der WBW)<br />
<strong>aus</strong> dem Grundwasserpumpwerk<br />
Moos bei Plattling bis nach Reißing<br />
fließt. Die Strecke gliederte sich in<br />
21 Pflugabschnitte von 150 bis<br />
760 m Länge. Bereits Mitte Juni<br />
Wenig Eingriff in die Natur: Der Humusabtrag<br />
reduziert sich auf die Einzieh- und einige<br />
Verbindungsgruben. Das Verfahren ist besonders<br />
schonend für die Umwelt und spart außerdem<br />
Kosten. © STREICHER<br />
waren die Pflugarbeiten abgeschlossen.<br />
Auch der Bau eines<br />
2000 m³ fassenden Hochbehälters<br />
bei Reißing sowie eines Pumpwerks<br />
bei Arndorf sind Bestandteil des<br />
Ausb<strong>aus</strong> des WBW-Netzes. Neben<br />
der Optimierung und Sicherung der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung in Ostbayern<br />
trägt die neue Stahlleitung auch zur<br />
Stabilisierung des <strong>Wasser</strong>drucks in<br />
der Region bei.<br />
Kontakt:<br />
Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH,<br />
Wiener Straße 35, D-94032 Passau,<br />
Tel. (0851) 390-0, Fax (0851) 390-29,<br />
www.pfaffinger.com<br />
Pfaffinger Unternehmensgruppe<br />
Die Unternehmensgruppe Pfaffinger mit Hauptsitz<br />
in Passau blickt auf eine über 150-jährige Firmengeschichte.<br />
Inzwischen auf sechs in Deutschland<br />
ansässige Standorte gewachsen (Passau,<br />
Leipzig, Berlin, Leuna, Stuttgart und Essen), realisiert<br />
das Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern<br />
regionale wie auch überregionale Projekte.<br />
Pfaf finger sieht sich als Kompetenzzentrum in<br />
den Bereichen Hochbau, Ingenieur- und Rohrleitungsbau,<br />
in der Rohrnetz- und Sanierungstechnik<br />
sowie bei Tiefbaumaßnahmen.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1215
Produkte und Verfahren<br />
Neue Aktivkohle-Serie von Siemens<br />
AquaCarb-CX auf Basis von Kokosnussschalen ergänzt Angebot<br />
zur Behandlung von Oberflächenwasser<br />
Siemens Water Technologies erweitert mit der Reihe AquaCarb-CX sein Angebot an Aktivkohlen. Die neuen<br />
Produkte werden <strong>aus</strong> Kokosnussschalen gewonnen und stellen eine Alternative zu Filtern auf Basis von<br />
Steinkohle dar. Mit AquaCarb-CX lassen sich Geschmacks- und Geruchsstoffe, Desinfektionsnebenprodukte<br />
und deren Vorläufer sowie organische Kohlenstoffe (Total Organic Carbon, TOC) <strong>aus</strong> Oberflächenwasser<br />
entfernen. Auch zur Behandlung von Grundwasser ist die AquaCarb-CX-Serie geeignet. Sie ist ebenso wie die<br />
Siemens-Produktline Westates auf dem nordamerikanischen Markt erhältlich.<br />
Die Produkte der AquaCarb-CX-<br />
Serie verbinden zwei Eigenschaften:<br />
Sie weisen die <strong>aus</strong>gedehnte<br />
mikroporöse Struktur von<br />
Aktivkohle auf Basis von Kokosnussschalen<br />
auf, zeigen aber zugleich<br />
das bessere kinetische Verhalten<br />
von Aktivkohle <strong>aus</strong> Steinkohle. So<br />
Mit der AquaCarb-CX-Serie führt Siemens neue<br />
Aktivkohlen auf der Basis von Kokosnussschalen<br />
für die Aufbereitung von Oberflächen wasser ein.<br />
© Siemens AG<br />
lassen sich mit AquaCarb-CX flüchtige<br />
organische Verbindungen<br />
effektiv beseitigen. Darüber hin<strong>aus</strong><br />
ist die Aktivkohle in Anwendungen<br />
einsetzbar, für welche bislang<br />
bevorzugt Filter auf Steinkohlebasis<br />
verwendet wurden.<br />
Von Siemens durchgeführte<br />
Tests haben gezeigt, dass die Aktivkohlen<br />
der AquaCarb-CX-Serie nicht<br />
nur eine höhere Adsorptionsfähigkeit<br />
als Aktivkohle auf Steinkohlebasis<br />
besitzen, sondern bis zum Durchbruch<br />
des Filters zudem einen<br />
höheren Durchsatz bewältigen können.<br />
Für den Kunden ergeben sich<br />
dar<strong>aus</strong> Kosteneinsparungen beim<br />
Lebenszyklus der Anlage sowie für<br />
die Einhaltung der geforderten<br />
<strong>Wasser</strong>qualität.<br />
Siemens Water Technologies ist<br />
mit der Westates-Reihe für Aktivkohlen<br />
und zugehöriger Ausstattung<br />
ein führender Anbieter von<br />
Adsorptionstechnologien. Zusätzlich<br />
bietet das Unternehmen technische<br />
und anlagenspezifische<br />
Dienstleistungen wie Analysen,<br />
Aus- und Einbau, Reaktivierung und<br />
Recycling verbrauchter Kohlemedien.<br />
Auf diese Weise unterstützt es<br />
Kunden dabei, einen dauerhaft<br />
effizienten Betrieb ihrer Adsorbersysteme<br />
sicherzustellen und Ausfallzeiten<br />
zu minimieren.<br />
AquaCarb und Westates sind<br />
Marken von Siemens und/oder verbundenen<br />
Konzerngesellschaften<br />
in bestimmten Ländern.<br />
Mehr Details zu AquaCarb unter:<br />
http://www.water.siemens.com/en/<br />
products/activated_carbon/granular_<br />
activated_carbon_gac/Pages/<br />
aquacarb-1230cx-enhanced-coconut.aspx<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.siemens.com/water<br />
Geführtes Radar revolutioniert<br />
die Trennschichtmessung<br />
Das erste einheitliche Zweileiter-Konzept für Durchfluss und Füllstand erhöht die<br />
Sicherheit und senkt die Kosten<br />
Der Wunsch nach Einheitlichkeit<br />
und Durchgängigkeit in der<br />
Feldinstrumentierung seitens der<br />
Betreiber wird immer lauter. Die<br />
damit verbundene Reduktion von<br />
Komplexität und Kosten steht im<br />
Vordergrund.<br />
Endress+H<strong>aus</strong>er setzt diese Forderung<br />
in einem neuen, auf der<br />
Zweileiter-Technik basierenden Konzept<br />
für die Messparameter Durchfluss<br />
und Füllstand nach und nach<br />
um. Insgesamt sieben Messverfahren<br />
werden in diesem einheitlichen<br />
Gerätekonzept integriert und stehen<br />
für „Unified Instrumentation –<br />
Efficiency by Endress+ H<strong>aus</strong>er“.<br />
Geführtes Radar Levelflex<br />
FMP50…57<br />
Alle acht Gerätevarianten der neuen<br />
Gerätegeneration zur Füllstandmessung<br />
für Flüssigkeiten und Schütt-<br />
Dezember 2011<br />
1216 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Produkte und Verfahren<br />
güter erfüllen folgende Kundenanforderungen:<br />
""<br />
Entwicklung nach DIN/<br />
EN 61508: 2010 – SIL2/SIL3<br />
bei homogener Redundanz,<br />
wiederkehrende Prüfung ohne<br />
Füllstandsänderung möglich<br />
""<br />
Geräte- und Prozessdiagnose<br />
nach NE 107 verkürzt oder<br />
vermeidet Anlagenstillstände<br />
""<br />
Im Gehäuse integrierter<br />
Datenspeicher HistoROM<br />
ermöglicht Elektronikt<strong>aus</strong>ch<br />
ohne Neuabgleich<br />
Doppelt sichere<br />
Trennschichtmessung mit<br />
Levelflex FMP55<br />
Die neue Füllstandsonde Levelflex<br />
Typ FMP55 ist der weltweit erste<br />
Multiparameter-Transmitter zur<br />
Trennschichtmessung. Die Besonderheit<br />
dabei ist, dass der Levelflex<br />
FMP55 zwei Messverfahren kombiniert<br />
und zwar das geführte Radarverfahren<br />
mit dem kapazitiven Messprinzip.<br />
Damit vereint dieses Messgerät<br />
alle Vorteile der beiden<br />
bisherigen Trennschicht-Messsysteme.<br />
Das Ergebnis ist eine her<strong>aus</strong>ragende<br />
Zuverlässigkeit bei der<br />
Messwerterfassung von Trennschichten,<br />
die häufig in Chemischen<br />
bzw. Petrochemischen Prozessen<br />
vorkommen. Durch die Ausgabe<br />
von zwei normierten 4 … 20 mA<br />
Signalen erfüllt der Levelflex FMP55<br />
den Wunsch der Nutzer nach einer<br />
zuverlässigen Erfassung vom<br />
Gesamtfüllstand und der Trennschicht.<br />
Das Messgerät entscheidet<br />
ohne weitere Einstellungen des<br />
Betreibers selbst, welches Messverfahren<br />
– geführtes Radar bei klaren<br />
Trennschichten oder Kapazitiv beim<br />
Auftreten von Emulsionsschichten<br />
– zum Einsatz kommt. Selbst wechselnde<br />
obere Dk-Werte beeinflussen<br />
die Messsicherheit nicht.<br />
Mit dem Levelflex FMP55 entfallen<br />
Entscheidungen in einer frühen<br />
Planungsphase, welches Messverfahren<br />
– geführtes Radar oder Kapazitiv<br />
– besser geeignet ist: Levelflex<br />
FMP55: immer die richtige Wahl für<br />
alle Trennschichtmessaufgaben!<br />
Kontakt:<br />
Endress+H<strong>aus</strong>er Messtechnik<br />
GmbH+Co. KG,<br />
Colmarer Straße 6,<br />
D-79576 Weil am Rhein,<br />
www.de.endress.com<br />
Die neue Füllstandsonde<br />
Levelflex<br />
FMP55<br />
kombiniert<br />
zwei Messverfahren,<br />
nämlich das<br />
geführte<br />
Radarverfahren<br />
mit dem<br />
kapazitiven<br />
Messprinzip in<br />
einem Sensor.<br />
Mit NOVAIR und NOVAQUA besserer Wirkungsgrad<br />
Viele SBR-Anlagenhersteller integrierten in den letzten Jahren Tauchmotorbelüfter auf Basis der DAB<br />
Tauchmotorpumpen NOVA und NOVA SV in ihre Kleinkläranlagen. Ebenso setzten die Hersteller Tauchmotorpumpen<br />
von DAB Deutschland dort ein. Diese im Markt anerkannte Qualität der NOVA SV wurde jetzt mit der<br />
Markteinführung von NOVAIR 200 und NOVAIR 600 (Belüfter) und NOVAQUA 180 (Pumpe) weiter optimiert.<br />
NOVAIR ist der erste von DAB entwickelte Belüfter und seine Eigenschaften lassen aufhorchen. „Sowohl der<br />
Lufteintrag als auch die Wartungsfreundlichkeit und Energieeffizienz konnten bei Testreihen immer Spitzenplätze<br />
erreichen“, fasst Achim Zinner, Technischer Leiter DAB, die Vorteile der drei neuen Produkte zusammen.<br />
Der Wirkungsgrad von Kleinkläranlagen<br />
mit SBR-Technik<br />
(Sequential Batch Reactor) hängt<br />
nicht zuletzt von dem hohen Sauerstoffeintrag<br />
ab, den die Belüfter<br />
bewirken. Je mehr ultrafeine Luftblasen<br />
dem Belebungsbecken<br />
zugeführt werden, desto besser<br />
können die Mikroorganismen ihre<br />
Dienste zur Klärung verrichten.<br />
Das neue spezielle Design der<br />
Propeller und des Belüftergehäuses<br />
leisten hier ganze Arbeit. Mit dem<br />
ebenfalls neuen Oberteil mit lösbarer<br />
Kabelverbindung werden zudem<br />
die Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht.<br />
Das Kabel ist zudem längswasserdicht<br />
und erhöht somit die<br />
elektrische Sicherheit.<br />
Auch die Motoren der NOVAIR<br />
und NOVAQUA wurden auf noch<br />
längere Laufzeiten hin optimiert.<br />
Die Edelstahlwelle besitzt jetzt eine<br />
Keramikummantelung, die für hohe<br />
Verschleißfestigkeit steht.<br />
Mit speziellen V-Ringen wird der<br />
Verzopfung wirksam entgegengewirkt.<br />
Ein hochwertiger Konden sator<br />
<br />
DAB Tauchmotorbelüfter NOVAIR<br />
mit neuem Propellerdesign.<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1217
Produkte und Verfahren<br />
DAB Tauchmotorbelüfter<br />
NOVAIR 600<br />
und NOVAIR<br />
200.<br />
gehört ebenfalls mit zum neuen DAB-<br />
Qualitätskonzept. Auch die Energieeffizienz<br />
konnte weiter gesteigert werden,<br />
lässt sich doch ein höherer Lufteintrag<br />
in kürzerer Zeit realisieren.<br />
„Mit den beiden neuen Tauchmotorbelüftern<br />
NOVAIR 200 und<br />
NOVAIR 600 und der dazugehörigen<br />
Tauchmotorpumpe NOVAQUA<br />
180 wird der gute Ruf der Serie<br />
NOVA SV konsequent fortgeschrieben.<br />
Diese neuen DAB-Produkte<br />
sind Komponenten, die die Effizienz<br />
der Kleinkläranlagen merkbar steigern<br />
und deren Herstellern deutliche<br />
Vorteile bieten“, ist sich Hans<br />
van Lieshout, Geschäftsführer DAB,<br />
sicher.<br />
Das Produkt-Trio kann auch bei<br />
der Teichbelüftung oder dem<br />
Mischen von feststofffreien Flüssigkeiten<br />
zum Einsatz kommen und<br />
dokumentiert mit einer Garantie<br />
von 30 Monaten seinen hohen<br />
Qualitätsanspruch.<br />
Kontakt:<br />
DAB<br />
Pumpen GmbH Deutschland,<br />
Tackweg 11, D-47918 Tönisvorst,<br />
Tel. (02151) 82136-0, Fax (02151) 82136-36,<br />
www.dwtgroup.com<br />
Pumpen mit „Allmind“ intelligent überwachen<br />
und regeln<br />
Die Allweiler AG, ein Unternehmen der Colfax Corp., hat mit „Allmind“ eine neue „Smart-Plattform“ für ihre<br />
Pumpen entwickelt. Alle Pumpen lassen sich damit intelligent überwachen und mit hohem Wirkungsgrad<br />
regeln. Die kontinuierliche Diagnose der Pumpe ergänzt die Fähigkeiten von „Allmind“. Das Ergebnis: eine<br />
drastische Reduzierung der Wartungs- und Energiekosten, erhöhte Sicherheit und eine optimale Regelung<br />
der Pumpe auf den gewünschten Betriebspunkt. Zur Regelung nutzt „Allmind“ übliche Frequenzumrichter.<br />
Diese benötigen keine Intelligenz, da die von Allweiler entwickelten „Allmind“-Algorithmen alle Regelungsinfor<br />
mationen bereitstellen.<br />
Das Mastermodul<br />
„AM 101“ ist<br />
das zentrale<br />
„Gehirn“ der<br />
neuen Pumpenüberwachung,<br />
-diagnose und<br />
-regelung der<br />
ALLWEILER AG.<br />
Sind mehrere<br />
Pumpen im<br />
Einsatz,<br />
kommen<br />
zusätzliche<br />
Satellitenmodule<br />
„AM 201“<br />
hinzu:<br />
Sie nehmen die<br />
Sensorsignale<br />
an jeder Pumpe<br />
auf und<br />
kommunizieren<br />
mit dem<br />
Mastermodul.<br />
llmind“ besteht <strong>aus</strong> Modu-<br />
die flexibel kombiniert<br />
„Alen,<br />
werden und damit auf die jeweiligen<br />
Prozesse individuell angepasst<br />
werden können. Das System bietet<br />
dabei erstmalig die Möglichkeit, mit<br />
einer Hardware-Plattform von der<br />
einfachen Zustandsüberwachung<br />
bis hin zu komplexen Überwachungs-<br />
und Regelungstätigkeiten<br />
an mehreren Pumpen alle Anforderungen<br />
zu realisieren. Dabei lassen<br />
sich Druck, Temperatur, Leckage,<br />
Vibration und Leistung überwachen<br />
sowie PID-Regler aktivieren. Somit<br />
kann jede Pumpe individuell mit<br />
einer Drehzahlregelung <strong>aus</strong>gerüstet<br />
werden. Der dafür notwendige Frequenzumrichter<br />
ist ebenfalls Teil<br />
der neuen Plattformstrategie. Je nach<br />
Konfiguration löst „Allmind“ pumpenindividuelle<br />
Reaktionen <strong>aus</strong>, z. B.<br />
ein drehzahlreduziertes Weiterfahren<br />
in einem sicheren Betriebspunkt.<br />
Mit „Allmind“ werden Wartung<br />
und Instandhaltung planbar, es gibt<br />
keine ungeplanten Produktions<strong>aus</strong>fälle<br />
und keine Folgeschäden.<br />
Das System speichert alle Sensorwerte<br />
und ermöglicht so vielfältige<br />
Auswertungen. Durch einen integrierten<br />
Assistenten erfordert es<br />
keine speziellen Kenntnisse bei der<br />
In betriebnahme. Kompakte Maße,<br />
die Schutzart IP 54 und individuelle<br />
Montagemöglichkeiten an der Wand<br />
oder auf DIN-Schiene ermöglichen<br />
es, „Allmind“ in jeder Industrieumgebung<br />
einzusetzen. Vorkonfigurierte<br />
Einstellungen auf den jeweiligen<br />
Prozess, die Möglichkeit zur<br />
individuellen Optimierung und eine<br />
einfache Nachrüstung vorhandener<br />
Anlagen sind ebenfalls möglich.<br />
„Allmind führt zu deutlich niedrigen<br />
Gesamtkosten (TCO), ist günstiger<br />
als ähnliche Systeme und<br />
rechnet sich daher schnell auch für<br />
kleinere Pumpen und Normpumpen“,<br />
fasst Stefan Kleinmann,<br />
Vice President Geschäftsbereich<br />
Industrie und Mitglied der<br />
Geschäftsleitung der Allweiler AG,<br />
zusammen. „Allmind“ lässt sich<br />
sowohl für Kreisel- als auch für<br />
Verdrängerpumpen einsetzen.<br />
Kontakt:<br />
Allweiler AG, Edwin Braun,<br />
Allweilerstraße 1,<br />
D-78315 Radolfzell,<br />
Tel. (07732) 86-343, Fax (07732) 86-99343,<br />
E-Mail: e.braun@allweiler.de,<br />
www.allweiler.de<br />
Dezember 2011<br />
1218 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Zur Sache<br />
Genau betrachtet<br />
Fachaufsätze für <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> werden vor Veröffentlichung<br />
im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Die Fachbeiträge in <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<br />
<strong>Abwasser</strong> sollen Themen <strong>aus</strong><br />
dem <strong>Wasser</strong>fach auf höchstem wissenschaftlichem<br />
Niveau behandeln.<br />
Deshalb werden eingereichte Manuskripte<br />
jeweils zwei Gutachtern<br />
(Referees) <strong>aus</strong> dem betreffenden<br />
Fachgebiet zur Prüfung vorgelegt.<br />
Die Redaktion bedankt sich an<br />
dieser Stelle ganz herzlich bei den<br />
Wissenschaftlern und Fachleuten,<br />
die sich ehrenamtlich dazu bereit<br />
erklären, Fachaufsätze zu begutachten.<br />
Denn ihre aktive Mitarbeit<br />
als Referees, aber auch ihre Mithilfe<br />
bei der Akquisition von interessanten<br />
Beiträgen und qualifizierten<br />
Fachautoren trägt wesentlich dazu<br />
bei, eine lebendige und spannende<br />
technisch-wissenschaftliche Fachzeitschrift<br />
zu gestalten.<br />
Wie jedes Jahr veröffentlichen<br />
wir auch in dieser Dezember<strong>aus</strong>gabe<br />
alle Referees namentlich in<br />
alphabetischer Reihenfolge – allerdings<br />
ohne jeglichen Bezug zu den<br />
Gutachten.<br />
© Niabot/Wikipedia<br />
Wissenschaftliche Beiträge zur<br />
Veröffentlichung in <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
senden Sie an:<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler,<br />
Schriftleitung <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>,<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
Rosenheimer Str. 145,<br />
D-81671 München,<br />
oder:<br />
Postfach 801360,<br />
D-81613 München,<br />
Tel. (089) 45051-318,<br />
Fax 45051-318-323,<br />
E-Mail: ziegler@oldenbourg.de<br />
Gutachter im <strong>gwf</strong>-Peer-Review-Verfahren 2011<br />
Dr. Jörg Bork, Universität Koblenz-Landau, Landau<br />
Dr. Martin Brockmann, Aquantis GmbH, Ratingen<br />
Dr. Norbert Burger, figawa, Köln<br />
Dr. Christoph Czekalla, Hamburg <strong>Wasser</strong>, Hamburg<br />
Prof. Dr. Frank Wolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg<br />
Prof. Dr. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart<br />
Dr. Kl<strong>aus</strong> Hagen, KrügerWABAG GmbH, Bayreuth<br />
Dr. Hans Jürgen Hahn, Universität Koblenz-Landau, Landau<br />
Prof. Dr. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW, Mülheim an der Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr. Rainer Helmig, Universität Stuttgart, Stuttgart<br />
Prof. Dr. Winfried Hoch, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Dr. Georg Houben, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover<br />
Prof. Dr. Martin Jekel, Technische Universität Berlin<br />
Prof. Dr. Wolfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1219
Zur Sache<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl. -Ing. Karl Morschhäuser, figawa, Köln<br />
Dr. Thomas Nelle, AWS GmbH, Gelsenkirchen<br />
Dr. Franz Otillinger, Stadtwerke Augsburg <strong>Wasser</strong> GmbH, Augsburg<br />
Dipl.-Geol. Ulrich Peterwitz, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Hermann Löhner, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Dipl.-Geol. Ulrich Peterwitz, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Prof. Dr. Johannes Pinnekamp, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH)<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Rosenwinkel, Leibniz Universität Hannover<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Prof. Dr. Theo G. Schmitt, Technische Universität Kaiserslautern<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doehring, Hannover<br />
Prof. Dr. Friedhelm Sieker, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker, Hoppegarten<br />
Frank Stefanski, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis, Bieske und Partner Ingenieure GmbH, Lohmar<br />
Prof. Dr. Wolfgang Uhl, Technische Universität Dresden<br />
Prof. Dr. Knut Wichmann, DVGW-Forschungsstelle TUHH, Hamburg<br />
Prof. Dr. Thomas Wintgens, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Life Sciences, Muttenz<br />
Dr. Rudi Winzenbacher, Zweckverband Landeswasserversorgung, Langenau<br />
<strong>gwf</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
INTERNATIONAL<br />
The leading specialist journal<br />
for water and wastewater<br />
S1 / 2011<br />
Volume 152<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Innovation from tomorrow’s world<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
The leading Knowledge Platform in<br />
Water and Wastewater Business<br />
MIS Universell.<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
9/2011<br />
Jahrgang 152<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Established in 1858, »<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>« is regarded<br />
as the leading publication for water and wastewater<br />
technology and science – including water production,<br />
water supply, pollution control, water purification and<br />
sewage engineering.<br />
It‘s more than just content: The journal is a publication<br />
of several federations and trade associations. It comprises<br />
scientific papers and contributions re viewed by experts, offers<br />
industrial news and reports, covers practical infor mation, and<br />
publishes subject laws and rules.<br />
In other words: »<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>« opens a direct way to<br />
your target audience.<br />
Boost your Advertising! Now!<br />
Das Schnellmontagesystem mit eingebauter Injektionsmembran.<br />
MIS ist die innovative H<strong>aus</strong>einführung, mit der Sie Bohrungen schnell gas- und wasserdicht machen:<br />
• Expansionsharz-Schnellabdichtsystem für Gas- und <strong>Wasser</strong>h<strong>aus</strong>einführungen.<br />
• Integrierter Außenflansch. Keine Nachbearbeitung der Außenabdichtung.<br />
• Gleichmäßige Harzverteilung in alle Hohlstellen/Ausbrüche – für alle Mauerwerke geeignet.<br />
• Besonders sicher in der Anwendung – ein Arbeitsgang, eine Kartuschenfüllung.<br />
Damit Wände dichter bleiben. Und Gebäude länger leben.<br />
Informieren Sie sich jetzt: Telefon: 0 73 24 96 00-0 · Internet: www.hauff-technik.de<br />
Mit dem Kopf durch die Wand.<br />
Knowledge for the Future<br />
Oldenbou<br />
Rosenheimer Straße 145<br />
D-81671 München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Media consultant:<br />
Inge Matos Feliz<br />
matos.feliz@oiv.de<br />
Phone: +49 (0)89/45051-228<br />
Fax: +49 (0)89/45051-207<br />
<strong>gwf</strong> international.indd 1 06.10.11 11:34<br />
Dezember 2011<br />
1220 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Impressum<br />
Information<br />
Das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Die technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>versorgung, Gewässerschutz,<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung und <strong>Abwasser</strong>technik.<br />
Organschaften:<br />
Zeitschrift des DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
des Bundesverbandes der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e. V. (BDEW),<br />
der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.<br />
(figawa),<br />
der DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
(ÖVGW),<br />
des Fachverbandes der Gas- und Wärme versorgungsunternehmen,<br />
Österreich,<br />
der Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein (AWBR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke e. V. (ARW),<br />
der Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr (AWWR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)<br />
Her<strong>aus</strong>geber:<br />
Dr.-Ing. Rolf Albus, Gaswärme Institut e.V., Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Ruhrverband, Essen<br />
Dipl.-Ing. Heiko Fastje, EWE Netz GmbH, Oldenburg<br />
Prof. Dr. Fritz Frimmel, Engler-Bunte-Institut, Universität (TH) Karlsruhe<br />
Prof. Dr. -Ing. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart (federführend <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>)<br />
Prof. Dr. Winfried Hoch, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Kl<strong>aus</strong> Homann (federführend Gas|Erdgas),<br />
Thyssengas GmbH, Dortmund<br />
Dipl.-Ing. Jost Körte, RMG Messtechnik GmbH, Butzbach<br />
Prof. Dr. Matthias Kr<strong>aus</strong>e, Stadtwerke Halle, Halle<br />
Dipl.-Ing. Kl<strong>aus</strong> Küsel, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau<br />
GmbH, Erkrath<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
Stuttgart<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert, EBI, Karlsruhe<br />
Dr. Karl Roth, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Hans Sailer, Wiener <strong>Wasser</strong>werke, Wien<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR<br />
BauAss. Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Aggerverband, Gummersbach<br />
Dr.-Ing. Walter Thielen, DVGW e. V., Bonn<br />
Dr. Anke Tuschek, BDEW e. V., Berlin<br />
Martin Weyand, BDEW e. V., Berlin<br />
Redaktion:<br />
Hauptschriftleitung (verantwortlich):<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München,<br />
Tel. (0 89) 4 50 51-3 18, Fax (0 89) 4 50 51-3 23,<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
Redaktionsbüro im Verlag:<br />
Sieglinde Balzereit, Tel. (0 89) 4 50 51-2 22,<br />
Fax (0 89) 4 50 51-3 23, e-mail: balzereit@oiv.de<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Jan-Ulrich Arnold, Technische Unternehmens -<br />
beratungs GmbH, Bergisch Gladbach<br />
Prof Dr. med. Konrad Botzenhart, Hygiene Institut der Uni Tübingen,<br />
Tübingen<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Wolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr<br />
München, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Abfall technik, Neubiberg<br />
Dr. rer. nat. Kl<strong>aus</strong> Hagen, Krüger WABAG GmbH, Bayreuth<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW GmbH, Mülheim/Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, TU Berlin, Berlin<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Reinhold Krumnack, DVGW, Bonn<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. Karl Morschhäuser, FIGAWA, Köln<br />
Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Bieske und Partner GmbH, Lohmar<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Universität Hannover<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doering, Hannover<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl, Techn. Universität Dresden, Dresden<br />
Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann, DVGW-Forschungsstelle TUHH,<br />
Hamburg<br />
Verlag:<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145,<br />
D-81671 München, Tel. (089) 450 51-0, Fax (089) 450 51-207,<br />
Internet: http://www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Carsten Augsburger, Jürgen Franke, Hans-Joachim Jauch<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Essen,<br />
Tel. (0201) 82002-35 e-mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Mediaberatung:<br />
Inge Matos Feliz, im Verlag,<br />
Tel. (089) 45051-228, Fax (089) 45051-207,<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Anzeigenverwaltung:<br />
Brigitte Krawzcyk, im Verlag,<br />
Tel. (089) 450 51-226, Fax (089) 450 51-300,<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 61.<br />
Bezugsbedingungen:<br />
„<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>“ erscheint monatlich<br />
(Doppel<strong>aus</strong>gabe Juli/August). Mit regelmäßiger Verlegerbeilage<br />
„R+S – Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach“ (jeden 2. Monat).<br />
Jahres-Inhaltsverzeichnis im Dezemberheft.<br />
Jahresabonnementpreis:<br />
Inland: € 360,– (€ 330,– + € 30,– Versandspesen)<br />
Ausland: € 365,– (€ 330,– + € 35,– Versandspesen)<br />
Einzelheft: € 37,– + Versandspesen<br />
ePaper als PDF € 330,–, Einzel<strong>aus</strong>gabe: € 37,–<br />
Heft und ePaper € 429,–<br />
(Versand Deutschland: € 30,–, Versand Ausland: € 35,–)<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Studentenpreis: 50 % Ermäßigung gegen Nachweis.<br />
Bestellungen über jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag.<br />
Abonnements-Kündigung 8 Wochen zum Ende des Kalenderjahres.<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen:<br />
Leserservice <strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Postfach 91 61<br />
D-97091 Würzburg<br />
Tel. +49 (0) 931 / 4170-1615, Fax +49 (0) 931 / 4170-492<br />
e-mail: leserservice@oldenbourg.de<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen<br />
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages<br />
strafbar. Mit Namen gezeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt<br />
der Meinung der Redaktion.<br />
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH<br />
Ostring 13, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
© 1858 Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München<br />
Printed in Germany<br />
Dezember 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1221
INFormation Termine<br />
2012<br />
""<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater 2012 – Lehrgang 1/2012<br />
09.01.2012, Essen<br />
Technische Akademie Hannover e.V., Dr.-Ing. Igor Borovsky, Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover, Tel. (0511) 3943330,<br />
Fax (0511) 3943340, E-Mail: info@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
""<br />
42. Internationales <strong>Wasser</strong>bau-Symposium und <strong>Wasser</strong>wirtschaft (IWW) der RWTH Aachen –<br />
Hochwasser, eine Daueraufgabe<br />
12.–13.01.2012, Aachen<br />
Institut für <strong>Wasser</strong>bau und <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 52056 Aachen,<br />
Dipl.-Hydrol. Sabine Jenning, Tel. (0241) 80 25923, E-Mail: jenning@iww.rwth-aachen.de, www.iww.rwth-aachen.de<br />
""<br />
Gebäude- und Grundstücksentwässerung – Gesicherte Qualität durch RAL-Gütezeichen<br />
16.–17.01.2012, Fulda<br />
Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef,<br />
Sarah Heimann, Tel. (02242) 872-192, E-Mail: heimann@dwa.de<br />
""<br />
Hochwassermanagement durch Geodaten – GIS und GDI in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
25.–26.01.2012, Kassel<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Sarah Heimann, Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
53773 Hennef, Tel. (02242) 872-192, E-Mail: heimann@dwa.de<br />
""<br />
Weibliche Führungskräfte in der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
07.–08.02.2012, Leipzig<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
E-world energy & water<br />
07.–09.02.2012, Essen<br />
www.e-world-2012.com<br />
""<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum – Rohrleitungen – in neuen Energieversorgungskonzepten<br />
09.–10.02.2012, Oldenburg<br />
Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg e.V., Ofener Straße 18, 26121 Oldenburg, Tel. (0441) 36 10 39-0,<br />
Fax (0441) 36 10 39-10, E-Mail: info@iro-online.de, www.iro-online.de<br />
""<br />
Dynamische Druckänderungen (Druckstöße) in <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen –<br />
Ursachen und Beherrschung<br />
28.–29.02.2012, Göttingen<br />
DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e.V., Katja Heythekker, Postfach 14 03 62, 53058 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9188-602, Fax (0228) 9188-92-602, E-Mail: heythekker@dvgw.de<br />
""<br />
12. Göttinger <strong>Abwasser</strong>tage: Her<strong>aus</strong>forderung und zukunftsweisende Konzepte<br />
28.–29.02.2012, Göttingen<br />
Technische Akademie Hannover e.V., Dr.-Ing. Igor Borovsky, Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover, Tel. (0511) 3943330,<br />
Fax (0511) 3943340, E-Mail: info@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
""<br />
GeoTHERM – expo & congress<br />
01.–02.03.2012, Offenburg<br />
Messe Offenburg-Ortenau GmbH, Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg, Tel. (0781) 9226-91,<br />
Fax (0781) 9226-77, E-Mail: info@messeoffenburg.de, www.messe-offenburg.de<br />
""<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater 2012 – Lehrgang 2/2012<br />
12.03.2012, Hannover<br />
Technische Akademie Hannover e.V., Dr.-Ing. Igor Borovsky, Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover, Tel. (0511) 3943330,<br />
Fax (0511) 3943340, E-Mail: info@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
Dezember 2011<br />
1222 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Einkaufsberater<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser.de/einkaufsberater<br />
Ansprechpartnerin für den<br />
Eintrag Ihres Unternehmens<br />
Inge Matos Feliz<br />
Telefon: 0 89/4 50 51-228<br />
Telefax: 0 89/4 50 51-207<br />
E-Mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Die technisch-wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung
Armaturen<br />
Brunnenservice<br />
Absperrarmaturen<br />
Automatisierung<br />
Prozessleitsysteme<br />
Energie <strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
Armaturen<br />
Be- und Entlüftungsrohre
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Schraubenverdichter<br />
Fernwirktechnik<br />
Kompressoren<br />
Drehkolbengebläse<br />
Korrosionsschutz<br />
Aktiver Korrosionsschutz<br />
Drehkolbenverdichter
Passiver Korrosionsschutz<br />
Regenwasser-Behandlung,<br />
-Versickerung, -Rückhaltung<br />
Kunststoffschweißtechnik<br />
Rohrhalterungen und<br />
Stützen<br />
Rohrhalterungen<br />
Leckortung<br />
Schachtabdeckungen<br />
Rohrleitungen<br />
Kunststoffrohrsysteme<br />
Messen – Steuern – Regeln<br />
Smart Metering
Umform- und<br />
Befestigungstechnik<br />
Filtermaterialien<br />
von Anthrazit bis Zeolith<br />
Rohrleitungs- und Kanalbau<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Biologische <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Sonderbauwerke<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung und<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
Rohrdurchführungen<br />
Chemische <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
Öffentliche Ausschreibungen
Beratende Ingenieure (für das <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>fach)<br />
Ing. Büro CJD Ihr Partner für <strong>Wasser</strong>wirtschaft und<br />
Denecken Heide 9 Prozesstechnik<br />
30900 Wedemark Beratung / Planung / Bauüberwachung /<br />
www.ibcjd.de Projektleitung<br />
+49 5130 6078 0 Prozessleitsysteme<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Grundwasserbehandlung<br />
Kanalsanierung<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Schmutz-/Regenwasserableitung<br />
<strong>Wasser</strong>gefährdende Stoffe<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />
Regenerative Energien<br />
Darmstadt l Freiburg l Homberg l Mainz<br />
Offenburg l Waldesch b. Koblenz<br />
Rockenh<strong>aus</strong>en<br />
Erfurt<br />
igr AG<br />
Luitpoldstraße 60 a<br />
67806 Rockenh<strong>aus</strong>en<br />
Tel.: +49 (0)6361 919-0<br />
Fax: +49 (0)6361 919-100<br />
Baden-Airpark<br />
Leipzig<br />
Berlin<br />
Lichtenstein<br />
Bitburg<br />
Zagreb<br />
E-Mail: info@igr.de<br />
Internet: www.igr.de<br />
Herzogenaurach<br />
Niederstetten<br />
• Beratung<br />
• Planung<br />
• Bauüberwachung<br />
• Betreuung<br />
• Projektmanagement<br />
Beratende Ingenieure für:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
Telefon 0511/284690<br />
Telefax 0511/813786<br />
30159 Hannover<br />
Kurt-Schumacher-Str. 32<br />
• Beratung<br />
• Gutachten<br />
• Planung<br />
• Bauleitung<br />
info@scheffel-planung.de<br />
www.scheffel-planung.de<br />
<strong>Wasser</strong> Abfall Energie Infrastruktur<br />
UNGER ingenieure l Julius-Reiber-Str. 19 l 64293 Darmstadt<br />
www.unger-ingenieure.de<br />
DVGW-zertifizierte Unternehmen<br />
Zertifizierung_<strong>gwf</strong>_20101110_.qxd 10.11.2010 08:33 Seite 1<br />
Die STREICHER Gruppe steht für Innovation und Qualität. Mit knapp 3.000 Mitarbeitern werden<br />
anspruchsvolle Projekte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene durchgeführt.<br />
Die Zertifizierungen der STREICHER Gruppe umfassen:<br />
DIN EN ISO 9001 GW 11 G 468-1 WHG § 19 I<br />
DIN EN ISO 14001 GW 301: G1: st, ge, pe G 493-1 AD 2000 HPO<br />
SCC** W1: st, ge, gfk, pe, az, ku G 493-2 DIN EN ISO 3834-2<br />
OHSAS 18001 GN2: B W 120 DIN 18800-7 Klasse E<br />
FW 601: FW 1: st, ku<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA, Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Schwaigerbreite 17 Tel.: +49(0)991 330-231 rlb@streicher.de<br />
94469 Deggendorf Fax: +49(0)991 330-266 www.streicher.de<br />
Das derzeit gültige Verzeichnis der Rohrleitungs-Bauunternehmen<br />
mit DVGW-Zertifikat kann im Internet unter<br />
www.dvgw.de in der Rubrik „Zertifizierung/Verzeichnisse“<br />
heruntergeladen werden.
Stellenanzeigen<br />
BGETEM_83x254_Layout 1 14.07.11 14:20 Seite 1<br />
Stadt Nürnberg<br />
www.nuernberg.de<br />
Energie Textil Elektro<br />
Medienerzeugnisse<br />
Die BG ETEM ist eine der größten gewerblichen Berufsgenoss<br />
enschaften in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung beraten und<br />
betreuen wir ca. 3,6 Mio. Versicherte in rund 237.000 Mitgliedsbetrieben<br />
bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und<br />
Berufskrankheiten.<br />
Unterstützen Sie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz!<br />
Für den Außendienst unserer Präventionsabteilung suchen wir für die<br />
Fachkompetenz Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
DIPLOM-INGENIEURE/INNEN<br />
der Fachrichtungen Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Elektrotechnik<br />
oder eines vergleichbaren Studienganges mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss.<br />
Ihre Aufgabe ist die Beratung und Unterstützung unserer Mitgliedsunternehmen<br />
in allen Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und<br />
des Gesundheitsschutzes. Bei Problemen und Fragen stehen Sie<br />
den Mitgliedsunternehmen partnerschaftlich zur Seite und erarbeiten<br />
gemeinsam Lösungen. Sie setzen sich für die Einhaltung der geforderten<br />
Sicherheitsstandards durch die von Ihnen betreuten Unternehmen<br />
ein. Darüber hin<strong>aus</strong> schulen Sie Unternehmer/innen und<br />
deren Mitarbeiter/innen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.<br />
Ihr Wohnort sollte in Ihrem zukünftigen Einsatzbereich in den Großräumen<br />
nördliches B erlin, B raunschweig /Hannover, Rheinland/Pfalz,<br />
oder Südbayern liegen.<br />
Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und waren im Anschluss<br />
mindestens drei Jahre bevorzugt in einem Unternehmen der<br />
Versorgungswirtschaft tätig. Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative und<br />
-verantwortung, gute Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit<br />
<strong>aus</strong>. Sie können komplexe Zusammenhänge verständlich und überzeugend<br />
darstellen und zeigen in der Zusammenarbeit mit Anderen<br />
Teamgeist und die richtige Balance zwischen Kooperations- und Konfliktfähigkeit.<br />
Sicheres und souveränes Auftreten runden Ihr Profil ab.<br />
Mit einer umfassenden zweijährigen Ausbildung zur Aufsichtsperson<br />
bereiten wir Sie auf Ihre zukünftige Tätigkeit vor.<br />
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsbereich mit einer<br />
qualifikations- und leistungsgerechten Vergütung nach den für<br />
Bundesbeamte geltenden Bestimmungen.<br />
Wir verfolgen das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen<br />
und freuen uns daher besonders über deren Bewerbungen.<br />
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung<br />
bevorzugt berücksichtigt.<br />
Fragen zu Ihrem künftigen Aufgabengebiet beantwortet Ihnen Dipl.-<br />
Ing. Thomas Gindler, Tel. 0211 9335-4257.<br />
Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.bgetem.de.<br />
Sie sind interessiert? Dann senden Sie uns schriftlich oder elektronisch<br />
Ihre <strong>aus</strong>sagekräftige Bewerbung.<br />
BG ETEM<br />
Dieter Wirges (Personalabteilung)<br />
Auf’m Hennekamp 74<br />
40225 Düsseldorf<br />
0211/9335-4371<br />
Wirges.Dieter@bgetem.de<br />
Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) übernimmt<br />
für die Stadt und ihr Umfeld mit über 500.000 Einwohnern die<br />
Aufgabe der <strong>Abwasser</strong>entsorgung sowie die Erhebung und Analyse der<br />
Umweltdaten. In dieser Funktion übernimmt sie einen wichtigen Beitrag<br />
zur Daseinsvorsorge und dem Erhalt der Balance zwischen wirtschaftlichem<br />
Wachstum, Umweltschutz und sozialen Belangen.<br />
Wir suchen für unseren Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik<br />
Nürnberg“, Werkbereich Umweltanalytik, eine/einen<br />
Abteilungsleiterin/<br />
Abteilungsleiter<br />
Ihre Aufgaben<br />
Als Leiter/in der Abteilung Umweltanalytik verantworten Sie den Erfolg<br />
des Unternehmensbereiches Umweltanalytik mit den Sachthemen Immissionsschutz,<br />
Bodenschutz, Gewässerschutz und Gebäudeuntersuchungen.<br />
Insbesondere sind Sie für folgende Aufgaben zuständig:<br />
• Führen der Abteilung Umweltanalytik<br />
• Organisieren und Steuern der Umweltuntersuchungen<br />
• Bewerten und Präsentieren der Messergebnisse von Schadstoffbelastungen<br />
• Vernetzung im Umfeld, Investitions- und Organisationsentwicklung,<br />
sowie Controlling innerhalb der Abteilung<br />
• Begleiten der städtebaulichen Entwicklungen und Planungen unter<br />
dem Gesichtspunkt des Immissionsschutzes<br />
• Mitwirken an der Entwicklung von kommunalen Umweltzielen<br />
• Beraten des Umweltreferenten sowie kommunaler und staatlicher<br />
Dienststellen<br />
• Vertreten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik nach außen<br />
• Durchführen der Öffentlichkeits- und Pressearbeit zu den bearbeiteten<br />
Umweltthemen und -zielen<br />
Wir erwarten<br />
eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit <strong>aus</strong>geprägter Fähigkeit<br />
für Führungsaufgaben und Leitungserfahrung. Vor<strong>aus</strong>gesetzt wird ein<br />
abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom) der Studienrichtung<br />
Chemie oder ein entsprechender Abschluss. Sie verfügen über<br />
Erfahrungen im Bereich der analytischen Chemie und Umwelttechnik,<br />
insbesondere im Immissionsschutzbereich, technisches Verständnis,<br />
schnelles und differenziertes Erfassen von komplexen technischen<br />
Sachverhalten, Entschlusskraft und Entscheidungsfreude, Fremdsprachenkenntnisse,<br />
Kostenbewusstsein, Teamfähigkeit und Flexibilität,<br />
hohes Organisationsund Verhandlungsgeschick sowie sicheres Auftreten.<br />
Wir bieten<br />
eine unbefristete Beschäftigung mit 35/39 Wochenarbeitsstunden nach<br />
dem TVöD und eine der Verantwortung angemessene Bezahlung. Bei<br />
Vorliegen der Vor<strong>aus</strong>setzungen ist eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis<br />
möglich.<br />
Ihre Bewerbung<br />
senden Sie bitte mit <strong>aus</strong>sagefähigen Bewerbungsunterlagen bis<br />
31.12.2011 an die Stadt Nürnberg, Personalamt, z.H. Frau Herold,<br />
Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil<br />
eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Telefonisch<br />
erreichen Sie uns unter (0911) 231-8548. Für fachliche Informationen<br />
steht Ihnen Herr Hagspiel, Telefon (0911) 231-4520 gerne zur Verfügung.<br />
Die Stadt Nürnberg fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter. Der Frauenförderplan ist Bestandteil unserer Personalarbeit.<br />
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden<br />
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.<br />
Wir freuen uns, wenn sich Bewerberinnen und Bewerber aller Nationalitäten<br />
angesprochen fühlen.<br />
Nürnberg
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
3R + <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
im Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
3R erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine 3R (12 Ausgaben) und<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> (12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug<br />
□ als Heft für 541,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) für 541,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ als Heft für 270,50 zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) für 270,50 pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr. Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift<br />
von € 20,- auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice 3R<br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice 3R, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten<br />
erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante, fachspezifische Medien- und Informationsangebote<br />
informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAGWFW1211
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
Seite<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 1121<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen Titelseite, 1117<br />
Aquadosil <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Essen 1137<br />
ecwatech 2012, Moskau, Rußland<br />
4. Umschlagseite<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 1129<br />
Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen 1125<br />
Geotherm, Messe Offenburg-Ortenau GmbH, Offenburg 1131<br />
Haase <strong>Abwasser</strong>technik GmbH & Co. KG, Troisdorf 1123<br />
HTI Hezel KG, Herrenberg<br />
Teilbeilage<br />
IST Anlagenbau GmbH, Kandern 1129<br />
IWRM Karlsruhe 2012, Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, Karlsruhe<br />
Beilage<br />
KRYSCHI <strong>Wasser</strong>hygiene, Kaarst 1136<br />
Siemens AG, Industry Sector, Nürnberg<br />
2. Umschlagseite<br />
Xylem Water Solutions Deutschland GmbH, 1164, 1165<br />
Einkaufsberater / Fachmarkt/Stellenmarkt 1123–1129<br />
Stellenmarkt<br />
BG ETEM, Energie Textil Elektro, Düsseldorf 1129<br />
Stadt Nürnberg, Nürnberg 1129<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
3-Monats-<strong>Vorschau</strong> 2012<br />
Ausgabe Januar 2012 Februar 2012 März 2012<br />
Erscheinungstermin:<br />
Anzeigenschluss:<br />
23.01.2011<br />
16.12.2011<br />
17.02.2012<br />
23.01.2012<br />
16.03.2012<br />
16.02.2012<br />
Themenschwerpunkt<br />
Vorbericht zum IRO „26. Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum: Rohrleitungen in<br />
neuen Energieversorgungskonzepten“<br />
• Energie <strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
• Trinkwasserspeichersysteme<br />
• Bau und Sanierung unterirdischer<br />
Infrastruktur<br />
• Strategien gegen Infiltration von<br />
Fremdwasser<br />
• Korrosionsschutz<br />
• Digitale Videoinspektion, Kanal-TV<br />
• Geoinformationssystems (GIS) in der<br />
Siedlungswasserwirtschaft<br />
Energie <strong>aus</strong> <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong><br />
Nachhaltig Wärme und Strom<br />
erzeugen, energieeffizient einsetzen<br />
• Wärme <strong>aus</strong> dem Kanal<br />
• Abwärmekataster<br />
• Co-Vergärung und Biogaserzeugung<br />
• Klärschlammbehandlung<br />
• Stromproduzent Kläranlage<br />
• Klärgas für Brennstoffzellen<br />
• Rohstoffe <strong>aus</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
• Geothermie<br />
• Stromerzeugung im <strong>Wasser</strong>werk<br />
Vorbericht zur IFAT Entsorga, München<br />
Filtration, Membrantechnik<br />
Neue Verfahren und Materialien<br />
• Ultrafiltration<br />
• Nanofiltration<br />
• Umkehrosmose<br />
• Entfernung von Krankheitserregern<br />
und Spurenstoffen<br />
Fachmessen/<br />
Fachtagungen/<br />
Veranstaltung<br />
(mit erhöhter Auflage<br />
und zusätzlicher<br />
Verbreitung)<br />
19. Tagung Rohrleitungsbau –<br />
Berlin, 24.01.–25.01.2012<br />
Symposium <strong>Wasser</strong>versorgung 2012 –<br />
Wien (A), 25.01.–26.01.2012<br />
E-world energy & water –<br />
Intern. Fachmesse und Kongress –<br />
Essen, 07.02.–09.02.2012<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum –<br />
Oldenburg, 09.02.–10.02.2012<br />
12. Göttinger <strong>Abwasser</strong>tage –<br />
Göttingen, 28.02.–29.02.2012<br />
GeoTHERM – expo & congress –<br />
Offenburg, 01.03.–02.03.2012<br />
AQUA Ukraine – Intern. <strong>Wasser</strong> Forum –<br />
Donezk (UA), März 2012<br />
SHK – Essen, 07.03.–10.03.2012<br />
45. Essener Tagung für <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft – Aachen, 14.03.–<br />
16.03.2012<br />
Water Sofia – Fachmesse für <strong>Wasser</strong>,<br />
<strong>Abwasser</strong> und Infrastruktur der<br />
Leitungsnetze – Sofia (BG), März 2012<br />
WFC-11 th World Filtration congress –<br />
Graz (A), 16.04.–20.04.2012<br />
Analytica – München, 17.04.–20.04.2012<br />
IFH/Intherm – Nürnberg, 18.04.–21.04.2012<br />
Änderungen vorbehalten
ECWATECH 10TH ANNIVERSARY<br />
ECWATECH<br />
5-8 June 2012<br />
IEC «Crocus Expo», Moscow, Russia<br />
The Best Water Event<br />
in Russia, CIS and<br />
Eastern Europe<br />
ECWATECH-2012<br />
For more information visit<br />
www.ecwatech.com<br />
Approved<br />
Event