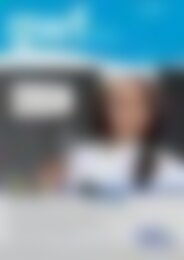gwf Wasser/Abwasser REHAU (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
7-8/2011<br />
Jahrgang 152<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Bau<br />
Automotive<br />
Industrie<br />
AWADUKT HPP –<br />
DAS NEUE HOCHLAST-KANALROHRSYSTEM DER ZUKUNFT FÜR 100 JAHRE UND MEHR<br />
Vorteile, die überzeugen:<br />
- Systemsteifigkeit SN16 für das gesamte Rohr- und Formteilprogramm<br />
- Aus füllstofffreiem Polypropylen nach DIN EN 1852-1<br />
- Durch RAUSISTO+ Technologie optimierte Punktlastbeständigkeit des<br />
Rohres, hochdruckspülbar bis 340 bar<br />
- Cool Colour-Technologie mit neuer und IR-reflektierender Farbgebung<br />
für schnelle, unkomplizierte Verlegung<br />
- Dank Safety-Lock-Dichtsystem kein Herausschieben der Dichtung<br />
beim Steckvorgang, Einsatz in <strong>Wasser</strong>schutzzone II und III möglich<br />
- Die Innensignierung sorgt für eindeutige Identifikation des Rohrsystems<br />
bei der Kanalbefahrung<br />
- 100 Jahre Lebensdauer, attestiert durch die LGA Nürnberg<br />
- 10 Jahre Herstellergarantie, inklusive Ein- und Ausbaukosten<br />
AWADUKT HPP besticht zudem durch hohe chemische und thermische<br />
Beständigkeit, ist fremdwasserdicht und fügt sich konsequent<br />
in die <strong>REHAU</strong> Kanalnetzlösung aus Polypropylen ein.<br />
QR-Code scannen und mehr erfahren:<br />
www.rehau.de/awadukt
Fachmedien<br />
jetzt als Buch<br />
oder digital als<br />
eBook<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung: Umweltrechtliche<br />
und verfahrenstechnische Betrachtung<br />
Praxishilfen zur Anwendung wasserrechtlicher<br />
Vorschriften und zur verfahrenstechnischen<br />
Optimierung einer Kaskadendenitrifikation<br />
In diesem Buch für <strong>Abwasser</strong>profis werden wichtige wasser -<br />
recht liche Vorschriften durch deren konkrete Anwendung<br />
an einer exemplarischen Anlage verdeutlicht.<br />
Die Optimierung einer Belebungsstufe und die Ableitung von<br />
Optimierungsmaßnahmen für eine Kläranlage mit einer Ausbaugröße<br />
von rund 20.000 Einwohnerwerten sind anschaulich aufbereitet.<br />
Dieses Fachbuch gibt Experten wie auch Einsteigern<br />
wichtige Handlungsanweisungen für die Behandlung von <strong>Abwasser</strong><br />
an die Hand.<br />
A. Hamann<br />
1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Erhältlich als Buch oder als Buch mit Bonusmaterial<br />
und vollständigem eBook auf Datenträger oder als<br />
digitales eBook.<br />
Alle Produktvarianten und Angebotsoptionen (inkl. eBook)<br />
finden Sie im Buchshop unter www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle auf Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Ex. <strong>Abwasser</strong>reinigung: Umweltrechtliche und<br />
verfahrenstechnische Betrachtung<br />
als Buch (ISBN: 978-3-8356-3248-6)<br />
zum Preis von € 64,90 zzgl. Versand<br />
als Buch + eBook auf Datenträger (ISBN: 978-3-8356-3250-9)<br />
zum Preis von € 74,90 zzgl. Versand<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAAUVB2011<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
STANDPUNKT<br />
Energie- und <strong>Wasser</strong>gewinnung – ein Gegensatz?<br />
Der tiefgreifende Umbruch im Energiesektor<br />
hat nicht zuletzt wegen der<br />
angestrebten Vorreiterrolle der Bundesrepublik<br />
deutliche Auswirkungen auf die<br />
Energiegewinnung. Mit dem Bestreben, die<br />
Klimaschutzziele der Europäischen Union zu<br />
erreichen und damit einen Schritt in Richtung<br />
Klimawende zu gehen, ist in den letzten Jahren<br />
eine Vielzahl von alternativen Energiegewinnungsformen<br />
etabliert worden. Diese<br />
Diversifizierung in der Energiegewinnung<br />
wird unweigerlich auch Auswirkungen auf die<br />
Gewässer haben.<br />
Zwischen der traditionellen Energiewirtschaft<br />
in unserem Lande, die zu einem großen<br />
Teil auf fossilen Energieträgern wie Stein- und<br />
Braunkohle basiert, und der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
herrscht seit jeher eine historische Abhängigkeit<br />
aber auch eine ständige Auseinandersetzung<br />
in puncto Ressourcenschutz. Erdgas aus<br />
konventionellen Lagerstätten stand und steht<br />
dabei weniger im Fokus. Doch insbesondere<br />
neue Verfahren zur Nutzung der in der Vergangenheit<br />
nicht gewinnbaren fossilen Energieträger<br />
(zum Beispiel die Erdgasgewinnung<br />
aus unkonventionellen Lagerstätten mittels<br />
Fracking) und die Dynamik des Ausbaus von<br />
regenerativen Energiequellen (insbesondere<br />
Biogas und Erdwärme) führen zu weiteren<br />
Spannungsfeldern mit der <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Der Bundesgesetzgeber verfolgt vorrangig<br />
die Ziele, mit dem Energieeinspeisegesetz<br />
(EEG) und den darin vorgegebenen Vergütungssätzen<br />
den Anteil regenerativer Energien<br />
an der Strom- und Gasversorgung kontinuierlich<br />
zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der erneuerbaren Energien zu verbessern.<br />
Die Produktion von Biogas, mit der<br />
an schließenden Aufbereitung auf Erdgasqualität<br />
und der Einspeisung ins Gasnetz, eignet<br />
sich in hervorragender Weise zur Steigerung<br />
des Anteils der erneuerbaren Energien<br />
bei gleichzeitiger Nutzung einer vorhandenen<br />
Infrastruktur. Deshalb ist die Produktion von<br />
Biogas zu unterstützen, jedoch sollte dieses<br />
umweltverträglich unter Beachtung aller<br />
Umwelt kompartimente geschehen. Die im<br />
Umfang gleich bleibende landwirtschaftliche<br />
Nutzfläche ge rät in eine Doppelfunktion,<br />
einerseits zur Nahrungsmittelproduktion und<br />
andererseits zur Erzeugung von Energiepflanzen.<br />
Dabei zusätzlich anfallende organische<br />
Reststoffe (Gärreste) sollen außerdem der<br />
pflanzen bedarfsgerechten Düngung dienen<br />
und er höhen somit den Nährstoffdruck auf die<br />
Fläche. In Abhängigkeit von der schon vorhandenen<br />
Nutzungsinten sität kann die aus<br />
der Biogas gewinnung resultierende landwirtschaftliche<br />
Intensitätsstei gerung die regionale<br />
Gewässergüte durch zusätzliche Nährstoffund<br />
Pflanzenschutzmitteleinträge nachteilig<br />
beeinflussen.<br />
Die Erdwärmenutzung hat in den vergangenen<br />
Jahren rasant zugenommen. Von diesen<br />
Anlagen kann eine Gefährdung des<br />
Grundwassers ausgehen, wenn die allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik bei deren<br />
Bau nicht beachtet werden oder der Ausbau<br />
in Problemgebieten stattfindet.<br />
Allein in Nordrhein-Westfalen sind auf der<br />
Hälfte der Landesfläche Erlaubnisfelder zur<br />
Aufsuchung von Erdgas ausgewiesen und<br />
genehmigt worden. Es geht um die Erdgasgewinnung<br />
aus unkonventionellen Lagerstätten,<br />
in denen das Gas in Schiefer-, Sandsteinoder<br />
Steinkohleschichten eingeschlossen ist<br />
und mit Hilfe eines Spezialverfahrens freigesetzt<br />
werden muss. Sowohl bei einigen Probebohrungen<br />
aber vor allem bei der Gewinnung<br />
wird das sogenannte „Fracking-Verfahren“<br />
eingesetzt. Hierbei wird ein mit unterschiedlichen<br />
Chemikalien versetztes Sand-<strong>Wasser</strong>-<br />
Gemisch mit hohem Druck in den Untergrund<br />
gepresst, um das Gestein aufzusprengen,<br />
damit das Gas freigesetzt werden kann. Bei<br />
jeder Bohrung werden dem Frackwasser, das<br />
nur teilweise wieder aus dem Untergrund<br />
zurückgepumpt werden kann, rund 50 Tonnen<br />
Chemikalien zugesetzt. Hier besteht<br />
be sonders in einem dicht besiedelten Land<br />
wie Deutschland dringender Bedarf, neue,<br />
weniger problematische Zusatzstoffe zu entwickeln.<br />
Andernfalls ist eine Gefährdung<br />
wich tiger Grundwasser-Ressourcen abzusehen.<br />
Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft wird sich jetzt und in<br />
der Zukunft mit diesen Einflussfaktoren auseinandersetzen<br />
müssen. Es gilt, gemeinsam<br />
Lösungen für die Energiewende zu entwickeln,<br />
die umweltverträglich sind und insbesondere<br />
die natürlichen <strong>Wasser</strong>ressourcen schonen.<br />
Dr.-Ing. Bernhard Hörsgen<br />
Vorstand der Gelsenwasser AG<br />
Gelsenkirchen<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 649
INHALT<br />
Wie sich die Branche angesichts der Kartellverfahren<br />
in Hessen zur <strong>Wasser</strong>preiskontrolle in Deutschland<br />
stellt, lesen Sie ab Seite 722<br />
Die Gewässerbelastung mit Pflanzenschutzmittelrückständen<br />
und deren Metaboliten ist nach wie vor<br />
ein drängendes Problem. Beitrag über neue<br />
Lösungsansätze ab Seite 728<br />
Fachberichte<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
722 G. Röstel<br />
<strong>Wasser</strong>preiskontrolle in<br />
Deutschland – Wie stellt sich<br />
die Branche dazu?<br />
Water Price Control in Germany – How does<br />
the Branch position itself in Addition?<br />
728 F. Haakh<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
und Gewässerschutz – neue<br />
Lösungsansätze<br />
Pesticide Residues and Water Protection –<br />
new Approaches<br />
736 U. Roth, H. Mikat und H. Wagner<br />
Der Einfluss moderner Haushaltsgeräte<br />
auf den Trinkwasserbedarf<br />
der Haushalte<br />
The Influence of Modern Household Appliances<br />
on the Drinking Water Demand in Households<br />
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
746 H. Bockhorn u. a.<br />
Fokus<br />
Engler-Bunte-Institut des Karlsruher<br />
Instituts für Technologie (KIT)<br />
und Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>,<br />
Karlsruhe (TZW) im Jahre 2010<br />
Report on the Activities of Engler-Bunte-Institut,<br />
Karlsruher Institut for Technology, in 2010<br />
Tiefbau<br />
654 Grabenlose Lösungen für den Leitungsbau<br />
in Megacities<br />
660 Schlauchliner-Sanierung am Heidelberger<br />
Schloss<br />
662 Grabenlos sanieren für den Naturschutz<br />
664 Langlebig und dicht geschweißt<br />
666 Stauraum für Reicholzrieds neue<br />
Kanalisation<br />
668 In allen Profilen gut gewickelt<br />
669 Einsatz in Ecuador<br />
671 Sauberes Niederschlagswasser in Bedburg<br />
674 Tiefbaulösungen maßgeschneidert<br />
Juli/August 2011<br />
650 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INHALT<br />
Tiefbau im Fokus: Projektberichte rund um den<br />
Neubau und die Sanierung unterirdischer Infrastrukturen.<br />
Ab Seite 654<br />
Grundwassertage in Dresden: Diskussion über die<br />
Auswirkungen steigenden Grundwassers.<br />
Ab Seite 689<br />
676 Baugrundkolloquium: Fachgerechte<br />
Erkundung vermeidet unnötige Baufolgekosten<br />
678 Fachkundelehrgang Grundstücksentwässerung<br />
(ZFKD-GE)<br />
679 Zertifizierung nach GN 3<br />
682 Systemkompetenz am SKZ für die<br />
Kunststoffrohr-Industrie<br />
Nachrichten<br />
Branche<br />
688 WVER beteiligt sich an europaweitem<br />
Hochwasserschutz<br />
689 <strong>Wasser</strong>-Experten diskutierten in Dresden<br />
die Wirkungen steigenden Grundwassers<br />
691 Kraftwerke einsparen statt ersetzen<br />
692 Erfahrungsaustausch über Kunststoffverarbeitung<br />
692 Verbesserte Technik macht Klärschlammverbrennung<br />
auch für kleinere Kläranlagen<br />
wirtschaftlich<br />
694 Kunden mit Leistungen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
sehr zufrieden<br />
694 Karl-Imhoff-Preis der DWA ausgeschrieben<br />
695 Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
gegründet<br />
696 Landgericht Bonn verneint Gleichwertigkeit<br />
der Angebote<br />
697 Nutzen für Umwelt und Gesellschaft<br />
698 Rückblick: wat + WASSER BERLIN<br />
INTERNATIONAL<br />
Veranstaltungen<br />
700 <strong>Wasser</strong>wirtschaft und Politik im Dialog<br />
701 6th IWA Specialist Conference on<br />
Membrane Technology for Water & Wastewater<br />
Treatment<br />
702 Aquatech Amsterdam 2011 legt Akzent auf<br />
industriellen <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
704 Fokus IFAT ENTSORGA 2012: Hochwassergefahr<br />
– auch und gerade für <strong>Abwasser</strong>behandlungsanlagen<br />
705 Energieeffizienz in der <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
706 MEORGA – Spezialmesse für Prozessleitsysteme,<br />
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik<br />
706 Effiziente Sanierungsplanung von<br />
Kanalnetzen<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 651
INHALT<br />
Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
gegründet. Ab Seite 695<br />
Ankündigung: Membran-Spezialisten treffen sich im<br />
Oktober in Aachen. Seite 701<br />
Forschung und Entwicklung<br />
707 HZI-Forscher zeigen, wie kleine<br />
Gen- Veränderungen den Darmkeim Yersinia<br />
gefährlicher machen<br />
708 Neues Frühwarnsystem erkennt drohende<br />
Trinkwasserverschmutzung<br />
709 Materialforscher wollen mit neuen Kupfer-<br />
Werkstoffen gefährliche Keime abtöten<br />
710 <strong>Wasser</strong>aufbereitung, Energieverbrauch und<br />
Umweltverträglichkeit in Einklang bringen<br />
Leute<br />
712 Prof. Dr.-Ing. Matthias Krause neuer<br />
DVGW-Präsident<br />
712 Henning R. Deters wird Vorstandsvorsitzender<br />
der GELSENWASSER AG<br />
713 Prof. Dr.-Ing. Klaus Homann mit Bunsen-<br />
Pettenkofer-Ehrentafel ausgezeichnet<br />
713 Frank Gröschl in den Vorstand der europäischen<br />
„Water Supply and Sanitation<br />
Technology Platform“gewählt<br />
714 figawa-Präsidium und Vorstand neu<br />
gewählt<br />
715 Dr. Matthias Maier wird Honorarprofessor<br />
an der Hochschule Karlsruhe<br />
716 Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Karl Heinz Hunken<br />
verstorben<br />
Vereine, Verbände, Organisationen<br />
717 Neue Regelungen zum Gewässerschutz –<br />
DVGW sieht Nachbesserungsbedarf<br />
717 Neue Hilfen zur effektiven und effizienten<br />
Instandhaltung von <strong>Wasser</strong>rohrnetzen<br />
Recht und Regelwerk<br />
718 DVGW-Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
719 DVGW-Regelwerk: Ankündigung der<br />
Fortschreibung<br />
720 DVGW-Regelwerk: zurückgezogene<br />
Regelwerke<br />
721 DWA: Neue Merkblätter erschienen<br />
Produkte und Verfahren<br />
762 Modulare Ventilgehäuse: multifunktionale<br />
Lösungen, die Platz und Kosten sparen<br />
763 Edelstahldruckerhöhungsanlagen für<br />
Prozesswässer<br />
764 Reproduzierbare Durchflusswerte<br />
764 Schutz vor Ablagerungen bei der<br />
Umkehrosmose durch Kohlendioxid<br />
Juli/August 2011<br />
652 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INHALT<br />
Neues Frühwarnsystem<br />
erkennt drohende<br />
Trinkwasserverschmutzung.<br />
Seite 708<br />
Information<br />
761 Buchbesprechungen<br />
765 Impressum<br />
766 Termine<br />
Recht und Steuern<br />
Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach, Ausgabe 7/8, 2011<br />
Dieses Heft enthält folgende Beilagen:<br />
– Siemens AG, Nürnberg<br />
– DWA<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> im September 2011<br />
u.a. mit diesen Fachbeiträgen:<br />
Die Bedeutung von Landnutzungsänderungen für ein Integriertes <strong>Wasser</strong>ressourcen-Management<br />
– eine Fallstudie im westlichen Zentral-Brasilien<br />
<strong>Wasser</strong>entnahmeentgelte zwischen <strong>Wasser</strong>sparen und <strong>Wasser</strong>dargebot – Ist<br />
Ressourcenschonung eine sinnvolle Zielsetzung für <strong>Wasser</strong>entnahme entgelte?<br />
Optimierung der geometrischen Parameter der walzenförmigen und kegelförmigen<br />
Wirbelkammer in Wirbeldrosselanlagen<br />
Erscheinungstermin: 15.9.2011<br />
Anzeigenschluss: 22.8.2011<br />
Flexibel!<br />
Leistungsstark!<br />
Anpassungsfähig!<br />
Ankerbohren<br />
Geothermiebohren<br />
Pfahlbohren<br />
Aufschlußbohren<br />
HDI-Bohren<br />
Soilmix-Bohren<br />
Rohrschirm-<br />
Komponenten<br />
EMDE Industrie-Technik GmbH<br />
Lahnstr. 32-34 D-56412 Nentershausen<br />
Telefon +49 (0) 64 85-187 04-0<br />
www.emde.de <br />
bohrtechnik@emde.de<br />
Ideen zum<br />
Bohren<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 653
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Grabenlose Lösungen<br />
für den Leitungsbau in Megacities<br />
von Dr. Hans-Joachim Bayer<br />
Die Megacity<br />
Paris.<br />
Megacities<br />
In Europa sieht man die Thematik<br />
der Megacities dieser Welt recht<br />
gelassen und vor allem als ein fernes,<br />
überwiegend asiatisches Problem<br />
an. Ungezügeltes urbanes<br />
Wachstum kennt man in Mitteleuropa<br />
wenig und die Probleme der<br />
Megacities muten einem befremdlich<br />
an. Megacities sind städtische<br />
Ballungsräume mit mehr als fünf<br />
Millionen Einwohnern.<br />
Die erste Megacity der Welt war<br />
sicherlich London. Dort hat man die<br />
Probleme heutiger, neuer Megacities<br />
schon vor beinahe 200 Jahren<br />
erlebt. Dabei hat Europa auch<br />
Boomtowns mit enormen Wachstumsproblemen,<br />
zum Beispiel Moskau,<br />
Istanbul, Athen oder Madrid.<br />
Die Städte Athen und Istanbul<br />
haben in den letzten 20 Jahren ihre<br />
Einwohnerzahl sogar verdoppelt.<br />
Der unter irdische Leitungsbau<br />
erlebt in diesen Städten eine Dynamik<br />
wie nie zuvor, weil die offene<br />
Bauweise in den meisten Fällen<br />
wegen des Verkehrs kaum noch<br />
möglich ist.<br />
Am schnellsten und heftigsten<br />
verlaufen jedoch die Verstädterungsprobleme<br />
in Asien, Südamerika und<br />
Weltweit entstehen immer mehr Megacities.<br />
Afrika. Viele chinesische und indische<br />
Städte wurden erst vor wenigen<br />
Jahren Megacities. Weitere Städte in<br />
diesen Staaten werden bis 2020<br />
hinzukommen. Da diese Megacities<br />
Wirtschaftszentren mit enormer Wirtschaftskraft<br />
darstellen, sind wir in<br />
Mitteleuropa mehr oder weniger<br />
auch betroffen. Es ist gut zu wissen,<br />
wo diese Megacities liegen oder entstehen<br />
werden, wie sie ihre oberirdischen<br />
und vor allem ihre unterirdischen<br />
Infrastrukturprobleme lösen.<br />
Welche Leitungen liegen<br />
im Untergrund?<br />
Nicht alle Leitungen in den Megacities<br />
liegen im Untergrund. In vielen<br />
Ländern, von Südosteuropa über<br />
Mittel- und Ostasien, sind Stromund<br />
Telefonleitungen kein unterirdisches<br />
Netzthema. In fast allen<br />
asiatischen Städten verlaufen die<br />
Leitungen oberirdisch, was zu einer<br />
hohen Belegung von Strom- bzw.<br />
Telekommasten führt.<br />
Selbst in einem High-Tech-In -<br />
dus trieland wie Japan ist das so und<br />
die Masten stehen zudem oft dicht<br />
vor Gebäudefassaden. Hier wird<br />
man Stromleitungen jedoch künftig<br />
vermehrt unter die Erde legen,<br />
schon um bei Erdbeben die Gefährdungen<br />
zu reduzieren.<br />
Die unterirdische Leitungsverlegung<br />
in allen großen Städten ist<br />
ein erhebliches Problem, ebenso<br />
der Umgang mit alten oder nicht<br />
mehr benötigten Leitungsnetzen.<br />
Die Folge dieses Problems sind<br />
neue Wege und beachtenswerte<br />
Lösungsansätze.<br />
Was sich in Megacities alles im<br />
Untergrund befindet, zeigen oft<br />
ungewollte und seltene Ereignisse,<br />
wie etwa Leitungsbrüche, Einstürze<br />
oder Vortriebs- und Verlegeunfälle.<br />
In Millionenstädten wie New York<br />
liegen auch nicht mehr benötigte<br />
Leitungen im Untergrund, eine Sortierung<br />
nach aktiven und inaktiven<br />
Leitungen muss vorgenommen<br />
werden. In anderen Megacities gibt<br />
es ebenso Leitungsnetze, die selten<br />
und sehr spezifisch sind, wie Rohrpostleitungen<br />
(Paris mit seiner „Diligence“<br />
verfügt über ein immens<br />
großes Rohrpostnetz zwischen den<br />
Postämtern), eigene Energieversorgungskabel<br />
und -netze für die<br />
Untergrundbahnen, eigene Kommunikations-<br />
und Steuernetze für<br />
wichtige Versorgungsleitungen,<br />
eigene Kommunikationsnetze für<br />
staatliche Dienste (Behördennetze)<br />
oder eigene Versorgungstunnel für<br />
Einrichtungen von übergeordneter<br />
Bedeutung.<br />
Juli/August 2011<br />
654 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Große Hohlraumbauten<br />
im Untergrund<br />
In Megacities muss jedoch beim Leitungsbau<br />
auf große Hohlraumbauten<br />
im Untergrund besonders Rücksicht<br />
genommen werden. Solche<br />
Hohlraumbauten sind zum Teil sehr<br />
alt (mittelalterliche Verteidigungsgänge,<br />
unterirdisch verbundene,<br />
mehrstöckige Keller, Speicher und<br />
Katakomben, zum Beispiel in Nürnberg,<br />
Köln, Wien oder Rom; unterirdische<br />
Steinbruchan lagen in Paris<br />
oder Neapel; alte Entwässerungsanlagen<br />
und unterirdische Transportkanäle<br />
in Karlsruhe; alte <strong>Wasser</strong>versorgungsstollen,<br />
beispielsweise in<br />
Freiburg und alte Bergwerksstollen<br />
direkt unter der Stadt, etwa in Freiberg,<br />
Zeitz, Clausthal, Goslar) gehören<br />
zum Gefüge und zum Wesen<br />
dieser Städte.<br />
Andere Städte, die vor über<br />
150 Jahren ein schnelles Bevölkerungswachstum<br />
erlebten, begannen<br />
früh mit dem Bau unterirdischer<br />
Transportsysteme (U-Bahnen). So<br />
sind die Untergrundbahnen von<br />
London, Berlin und Paris schon über<br />
100 Jahre alt. Dieser U-Bahn-Bau<br />
machte Umplanungen und Neuverlegungen<br />
der tiefen Leitungsnetze<br />
(insbesondere des <strong>Abwasser</strong>s) erforderlich.<br />
Die großen Hohlraumstrukturen<br />
unter den Metropolen bekamen<br />
oft Vorrang vor den kleineren<br />
Durchmessern. Manchmal wurden<br />
U-Bahnstrecken nicht aufgefahren,<br />
wo aufwändig in neue Kanalisationen<br />
investiert wurde. Die Trassen<br />
bestimmter U-Bahnstrecken, zum<br />
Beispiel in Berlin, erklären sich daraus.<br />
Unter den Straßen verhält es<br />
sich so, wie in der Schifffahrt oder<br />
Luftfahrt. Große Objekte haben Vorfahrt<br />
vor klei neren Objekten; denn<br />
Untergrund-Hohlräume sind komplex,<br />
haben zahlreiche Zugänge,<br />
Versorgungsstrecken, Lüftungsbauwerke<br />
und Rettungsgänge.<br />
Neben den großräumigen unterirdischen<br />
Verkehrsbauwerken entstehen<br />
auch immer unterirdische<br />
Verbindungspassagen und Shoppingzonen.<br />
Vor allem nordische<br />
Städte wie Helsinki, Stockholm,<br />
<br />
Hier könnte eine Leitung nur im Bohrverfahren verlegt werden.<br />
kanadische und russische Großstädte<br />
weisen solche unterirdischen<br />
Fußgängerzonen auf, die auch im<br />
Winter ein angenehmes Einkaufen<br />
ermöglichen. In Finnland sind<br />
zudem auch Hallenbäder und Sportstätten<br />
unterirdisch „aus dem Fels<br />
gehauen“ und stellen eine Lebensebene<br />
unter der Erdoberfläche dar.<br />
Vermeidung<br />
von Baustellenemissionen.<br />
Einsparpotenzial bei geschlossener Bauweise.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 655
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
HDD-Bohrungen in der City.<br />
Fernwasser<br />
für die Megacities<br />
Ohne <strong>Wasser</strong> kein Leben und ohne<br />
sauberes und frisches <strong>Wasser</strong> keine<br />
hohe Bevölkerungsdichte. <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
gehören zu den ältesten<br />
Leitungssystemen. Die Megacity<br />
Rom hatte schon vor 2000 Jahren<br />
eine Fernwasserversorgung mit langen<br />
Aquädukten, die die erste Millionenstadt<br />
der Welt mit frischem<br />
<strong>Wasser</strong> versorgte. Noch heute sind<br />
lange Bauwerksreste dieser <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
zu bewundern. Aber auch<br />
das römische Köln (Colonia) bekam<br />
Fernwasser aus der Eifel (80 km<br />
lange <strong>Wasser</strong>leitung, Leitungsstollen<br />
und Aquädukte).<br />
HDD-Spülbohrung vor dem Brandenburger<br />
Tor in Berlin.<br />
Verlegung eines Rohrbündels im<br />
HDD-Bohrverfahren.<br />
Sehr viele Megacities besitzen<br />
mit ihren Fernwasserversorgungssystemen<br />
Trinkwassertalsperren im<br />
Hinterland, die bis zu 200 km<br />
vom Abnehmergebiet entfernt sein<br />
können. Das Trinkwasser, meist von<br />
Talsperren gespeist, wird über<br />
Großrohre und Stollensysteme (Auffahrung<br />
mit Mikrotunnel- und Tunnelvortriebsmaschinen)<br />
in die Ballungszentren<br />
transportiert und verteilt.<br />
Das Trinkwasser unterliegt<br />
ständiger Kontrollen, auch die Fernleitungen<br />
werden permanent überwacht.<br />
In erdbebengefährdeten<br />
Gebieten kommen noch Fernwarnsysteme<br />
hinzu. In Japan wurden die<br />
Dämme der Talsperren in den letzten<br />
Jahren erheblich verstärkt.<br />
Dammbrüche sollen dadurch auch<br />
bei starken Beben ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Nur sehr wenige Großstädte, wie<br />
Berlin oder Hamburg, gewinnen im<br />
Stadtgebiet Grundwasser. Städte<br />
wie Shanghai, London, Houston,<br />
Los Angeles, Sao Paulo, Istanbul,<br />
und fast alle anderen Megacities<br />
verfügen über mächtige Trinkwassersperren<br />
im Hinterland. Fortwährend<br />
kommen weitere neue<br />
hinzu.<br />
Manche Megacities wachsen so<br />
schnell, dass die Trinkwasserversorgung<br />
in neuen Stadtvierteln, die<br />
zudem oft ein ungeordnetes Wachstum<br />
aufweisen, noch gar nicht aufgebaut<br />
werden kann. Das Trinkwasser<br />
wird daher mit Tankwagen<br />
an die Bevölkerung verteilt. Der Bau<br />
neuer Trinkwassernetze bedarf einiger<br />
Jahre. Bis dahin entstehen aber<br />
schon die nächsten Stadtviertel<br />
ohne Leitungsnetze.<br />
In schon bebauten, aber mit Leitungen<br />
noch unerschlossenen<br />
neuen Stadtvierteln lassen sich mit<br />
dem HDD-Verfahren nachträglich in<br />
kaum verkehrsstörender Weise<br />
komplett neue Leitungsnetze installieren.<br />
Grundodrill HDD-Bohranlagen<br />
der 150 bis 250 kN-Klasse mit<br />
Bohr reichweiten von 200 m bis 400<br />
m sind ideal für den Netzbau, während<br />
Grundopit-Bohranlagen das<br />
ge samte Spektrum an Hausanschlüssen<br />
bis 60 m Länge abdecken<br />
können.<br />
Nachträgliche Erneuerung<br />
von Leitungsnetzen<br />
Die Trinkwassernetze bedürfen der<br />
ständigen Erneuerung. Alte Megacities,<br />
wie London, erleiden <strong>Wasser</strong>verluste<br />
durch alte Leitungen, die<br />
mit hohem Aufwand durch neue<br />
ersetzt werden müssen. Neue Megacities<br />
haben Probleme mit den zu<br />
kleinen Leitungen, die entspre -<br />
chend dem Bevölkerungswachstum,<br />
durch größere Lei tungen<br />
ausgetauscht werden müssen.<br />
Grabenlose Leitungserneuerung ist<br />
ständig und gut gefragt.<br />
Juli/August 2011<br />
656 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Eine der häufigsten Formen der<br />
Leitungserneuerung ist der Einsatz<br />
mit Grundoburst-Geräten, wobei<br />
die überalterten Leitungen durch<br />
einen Rollenmesser aufgeschnitten<br />
und in der gleichen Lage neue<br />
Rohre gleicher oder größerer<br />
Dimension eingezogen werden. Auf<br />
diese Weise werden in alten oder<br />
sehr schnell gewachsenen neuen<br />
Megacities zu klein gewordene<br />
Leitungen erneuert.<br />
<strong>Abwasser</strong>systeme enormen<br />
Ausmaßes<br />
Auch <strong>Abwasser</strong>sammler waren in<br />
römischen Großstädten schon<br />
üb lich und sind zum Beispiel in Rom<br />
noch erkennbar. London hat aufgrund<br />
von Epidemien während des<br />
schnellen Bevölkerungswachstums<br />
zu umfassenden Maßnahmen<br />
gegriffen und vor über 150 Jahren<br />
enorme <strong>Abwasser</strong>sammler gebaut,<br />
die das <strong>Abwasser</strong> unterhalb der<br />
Stadt der Themse zuführen sollten.<br />
Diese Maßnahme war wegweisend<br />
für andere Großstädte und Londoner<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungsexperten<br />
haben in vielen anderen europäischen<br />
Großstädten übergeordnete<br />
Kanalisationssysteme entworfen, so<br />
etwa in Hamburg.<br />
Erstaunlich ist auch, dass schon<br />
im 19. Jhd. für die tiefliegenden<br />
<strong>Abwasser</strong>sammler in London und<br />
New York, Stützkonstruktionen mit<br />
mehreren Arbeits ebenen und Vorläufer<br />
von Vortriebsmaschinen, entwickelt<br />
wurden. Bis heute gelten die<br />
großen und tiefen <strong>Abwasser</strong>sammler<br />
von London, Paris und New York<br />
als Vorbilder für die <strong>Abwasser</strong>sammler<br />
in anderen Megacities. Im<br />
Nordwesten von Paris liegen die<br />
Hauptsammler teils über 100 Meter<br />
unter der Erde. Sie unterfahren alle<br />
anderen unterirdischen Hohlräume,<br />
auch die unterirdischen Steinbrüche<br />
von Paris.<br />
In vielen Megacities sind Regenwassersammler<br />
und Kanal getrennt.<br />
Die aufzubereitenden <strong>Abwasser</strong>mengen<br />
in den Kläranlagen reduzieren<br />
sich hierdurch.<br />
Die meisten <strong>Abwasser</strong>sammler<br />
werden heute in den Megacities mit<br />
Mikrotunnel- und Tunnelbohrmaschinen<br />
aufgefahren. Oft bekommen<br />
diese Sammler, nach Pariser<br />
Vorbild, die tiefste unterirdische<br />
Infrastrukturebene zugeteilt.<br />
Um die <strong>Abwasser</strong>kapazitäten<br />
aufzunehmen, werden in wachsenden<br />
Megacities nahezu permanent<br />
neue <strong>Abwasser</strong>sammler in neuen<br />
Trassen, wenn möglich tiefer und<br />
mit größerem Querschnitt, aufgefahren,<br />
an denen untergeordnete<br />
Systeme angeschlossen werden.<br />
Beispiel für die Rohrinfrastruktur in Städten; je nach Größe sind die<br />
Kanäle größer und die Leitungen liegen tiefer.<br />
Bildquellennachweis: Fotos/Skizzen, Quelle TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.KG, Lennestadt.<br />
Erneuerung einer Altleitung im Berstverfahren.<br />
Kleinere und oberflächennahe<br />
Leitungssysteme<br />
Sehr viele Leitungen und Kabel mit<br />
kleinerem Querschnitt liegen aber<br />
auch in geringer Tiefe unter der<br />
Oberfläche: Erdgasleitungen, Fernund<br />
Nahwärmesystem, Strom (wenn<br />
als Erdkabel), Glasfaserkabel, Telekommunikationsleitungen,<br />
oft mehrerer<br />
Anbieter und mit unterschiedlichen<br />
Leitungsmedien, Steuer- und<br />
Signalkabel für die Verkehrsanlagen<br />
und Verkehrsüberwachung, Straßenrandentwässerung<br />
und Spülungsleitungen<br />
(Reinigung).<br />
Die Dichte dieser oberflächennahen<br />
Leitungen ist enorm. In beinahe<br />
jeder Metropol-Region sind<br />
die Anordnung, Tiefenlage und der<br />
Abstand dieser Leitungen sehr<br />
unterschiedlich und unterliegen<br />
örtlichen klimatischen (Frost oder<br />
kein Frost), historischen, wirtschaftlichen<br />
und politischen Rahmenbedingungen.<br />
Die „Vermehrung“<br />
gerade dieser Leitungen, beispielsweise<br />
für Belange der Telekommunikation,<br />
ist enorm.<br />
Um Verletzungen oder Durchtrennungen<br />
bestehender Leitungen<br />
beim Einbau zusätzlicher Leitungen<br />
zu vermeiden, werden in vielen<br />
Metropolen streifenförmige Belegungsräume<br />
zugeteilt, die im Normalfall<br />
nicht überschritten werden<br />
dürfen. In etlichen Städten kommt<br />
noch eine definierte Tiefenbegrenzung<br />
hinzu, sodass die Leitungsnetze<br />
mit tieferen und größeren Leitungen<br />
keine Berührung bekommen.<br />
In Städten mit engen Straßen<br />
im Zentrum sind die unterirdischen<br />
Raumnutzungsverhältnisse äußerst<br />
knapp. Mehrstöckige Belegungen<br />
mit Seiten- und Tiefenbegrenzungen<br />
werden zugeteilt. Insbesondere<br />
in japanischen Metropolräumen<br />
werden diese dreidimensi-<br />
<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 657
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Tabelle. Übersicht über die nachträglichen Leitungseinbaumethoden in Megacities.<br />
Bohranlage Typ Längen [m];<br />
Durchmesser [mm];<br />
Rohrwerkstoff<br />
GRUNDOMAT<br />
GRUNDORAM<br />
GRUNDOPIT<br />
GRUNDOPIT<br />
GRUNDODRILL<br />
GROSSBOHR-<br />
ANLAGEN<br />
Erdrakete<br />
Bodenverdrängung<br />
ungesteuert<br />
Stahlrohrvortrieb<br />
Bodenentnahme<br />
ungesteuert<br />
Mini-<br />
Bohranlage<br />
Spülbohrung<br />
gesteuert<br />
Mini-<br />
Bohranlage<br />
Spülbohrung<br />
gesteuert<br />
HDD-<br />
Bohranlagen<br />
Spülbohrung<br />
gesteuert<br />
< 20;<br />
25 ≤ ID ≤ 160;<br />
PE-HD, PP-HM, PVC,<br />
Stahl<br />
< 100;<br />
180 ≤ ID ≤ 4.000;<br />
Stahl<br />
< 80;<br />
25 ≤ ID ≤ 200; PE-HD,<br />
PP-HM (Kurz-/Langrohr)<br />
< 80;<br />
25 ≤ ID ≤ 200; PE-HD,<br />
PP-HM<br />
(Kurz-/Langrohr)<br />
< 600;<br />
40 < OD ≤ 630; PE-HD,<br />
PP-HM, Guss, Stahl<br />
ca. 2000;<br />
630 < OD < 1500;<br />
PE-HD, PP-HM, Guss,<br />
Stahl<br />
GRUNDOBURST Erneuerung < 200;<br />
63 < ID < 1100;<br />
Kreisprofilrohre<br />
Kunststoff, Guss, Stahl<br />
Renovierung < 1.000;<br />
160 < ID < 1100;<br />
PE-HD, Stahl, Guss<br />
Medien<br />
Gas, <strong>Wasser</strong>,<br />
Strom,<br />
<strong>Abwasser</strong>,<br />
Kommunikation<br />
Gas, <strong>Wasser</strong>,<br />
Strom,<br />
<strong>Abwasser</strong>,<br />
Kommunikation<br />
Gas, <strong>Wasser</strong>,<br />
Strom,<br />
<strong>Abwasser</strong>,<br />
Kommunikation<br />
Gas, <strong>Wasser</strong>,<br />
Strom,<br />
<strong>Abwasser</strong>,<br />
Kommunikation<br />
Gas, <strong>Wasser</strong>,<br />
Strom,<br />
<strong>Abwasser</strong>,<br />
Fernwärme,<br />
Kommunikation<br />
Gas,<br />
<strong>Wasser</strong>,<br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Anwendungsgebiete<br />
Hausanschlüsse mit dichter Hauseinführung<br />
Unterquerung von Straßen, Plätzen, Bahndämme<br />
Stahlrohrvortrieb und Rohrerneuerung bis ID 300 (ab GRU 130)<br />
Sacklochbohrungen für Gründungen (Fundamente, Masten<br />
etc.)<br />
Unterquerung von Straßen, Plätzen, Bahndämme, Flüsse,<br />
Schutzrohrverlegung für die Aufnahme von Produktrohren,<br />
kleine Tunnelvortriebe, im Pipelinebau, Herstellung von<br />
Rohrschirmen, z. B. für Fußgängerunterführungen.<br />
Hausanschlüsse mit dichter Hauseinführung<br />
<strong>Abwasser</strong>hausanschlüsse aus Schacht (1000 mm)<br />
Unterquerung von Straßen, Plätzen Bahndämme,<br />
Felsbohrungen,Verlegung Schutz- und Produktrohre<br />
Hausanschlüsse mit dichter Hauseinführung<br />
<strong>Abwasser</strong>hausanschlüsse aus Schacht (1000 mm)<br />
Unterquerung von Straßen, Plätzen Bahndämme,<br />
Felsbohrungen,Verlegung Schutz- und Produktrohre<br />
Unterquerungen von Straßen, Autobahnen, Parkanlagen,<br />
Bach-, Fluss- und Kanaldüker<br />
Längsverlegungen (einzeln, im Bündel), Felsbohrungen<br />
Schutz-, Produktrohrverlegung, einzeln, im Bündel<br />
Sammler und Hausanschlüsse<br />
Altrohre: Steinzeug, Beton, AZ, GGG, Kunststoff<br />
Neurohrdurchmesser bis 2 Nennweiten größer als Altrohr<br />
Auch einsetzbar für Swagelining, Relining Tight in Pipe (TIP)<br />
onalen, unterirdischen Zuteilungen<br />
von Nut zungs raum streng gehandhabt<br />
und viele andere asiatische<br />
Mil lionenstädte folgen dem japanischen<br />
Muster. Ohne diese<br />
2-dimen sio nalen (streifenförmigen)<br />
oder 3-dimensionalen Raumeinteilungen<br />
herrscht oft ein heilloses<br />
Chaos in der unterirdischen Infrastruktur.<br />
Mit aufwändigen Handschachtungen<br />
müssen dann Wege<br />
für neue Lei tungen gesucht werden,<br />
dennoch e rgeben sich viele<br />
Leitungsschäden. Der Zeit- und Kostenaufwand<br />
für die Leitungsverlegungen<br />
ist immens. Viele Megacities<br />
haben daher neue Wege und<br />
neue Ordnungssysteme entwickelt,<br />
in denen wiederum kollisionsfrei<br />
nachträglich grabenlos, beispielsweise<br />
mit steuerbaren Bohrgeräten,<br />
weitere Leitungen installiert werden<br />
können.<br />
Unterirdische<br />
Belegungsräume<br />
Aufgrund der zu dichten und zu<br />
unübersichtlichen Leitungsbelegung<br />
an der Oberfläche haben<br />
manche wirtschaftsstarke oder ordnungsliebende<br />
Megacities unterirdische<br />
Leitungsgänge entwickelt,<br />
in denen zugeteilte Belegungsräume<br />
für definierte Medien gelten.<br />
Solche Leitungsgänge gibt es althergebracht<br />
im Stollenprofil oder<br />
als Neuauffahrung im Rundtunnelprofil<br />
(siehe Bespiel oben).<br />
Diese zwar sehr teuren Leitungsgänge<br />
haben den enormen Vorteil,<br />
dass entsprechend einem zusätzlichen<br />
oder veränderten Bedarf Leitungen<br />
eingehängt oder umgehängt<br />
werden können. Ihre Verbreitung<br />
und auch ihre Dimensionen<br />
werden daher weiter zunehmen.<br />
In Megacities, in denen keine<br />
Leitungsgänge, Leitungssammel-<br />
Juli/August 2011<br />
658 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
systeme oder Leerrohrsysteme für<br />
künftige Belegungen üblich oder<br />
aufgrund eines sehr geschichtsträchtigen<br />
Untergrundes keine solchen<br />
Systeme installierbar sind,<br />
werden häufig zumindest unterirdische<br />
streifenförmige oder rechteckig-profilartige<br />
Raumeinteilungen<br />
vorgenommen. Für diese<br />
Raumeinteilungen gibt es unterschiedliche<br />
Varianten:<br />
a) das Vorrangprinzip großer<br />
Hohlraumstrukturen. Kleinere<br />
Systeme müssen diese umgehen,<br />
sich ihnen begleitend oder<br />
versetzt seitlich nachordnen<br />
(Beispiele: Paris, London, Wien,<br />
u. a.)<br />
b) das Belegungsebenen-Prinzip.<br />
Unterirdische „Levels“ werden<br />
zugeteilt, in denen definierte<br />
und hierfür bewilligte Leitungen<br />
verlaufen dürfen (Beispiele:<br />
New York, Chicago, andere nordund<br />
südamerikanische Städte)<br />
c) das Leitungsgang- oder<br />
Leitungssammelprinzip<br />
d) das genaue unterirdische<br />
3-dimensionale Raumzuordnungsprinzip<br />
(z.B.: Kernzonen<br />
von Tokyo, Osaka, u. a.)<br />
e) das Verlege-Abfolge-Prinzip.<br />
Die ältesten Leitungssysteme<br />
hatten „freie“ Auswahl, nachfolgende<br />
Leitungen müssen sich<br />
nachordnen. Die jüngsten<br />
Systeme müssen den verbliebenen<br />
Platz nutzen.<br />
Die unterirdische Raumbelegung<br />
wird in allen Megacities dichter,<br />
auch in den „alten Megacities“<br />
ohne großen Bevölkerungszuwachs.<br />
Dies wird dazu führen, dass<br />
unterirdische Raumbelegungen<br />
immer weiter durchgeplant werden<br />
müssen und unterirdische Raumzuordnungssysteme<br />
immer mehr Verbreitung<br />
finden werden.<br />
Literatur<br />
Informationsschrift der Fa. Tracto-Technik<br />
GmbH & Co KG: Trenchless Pipe Installation<br />
in busy congested areas (2010).<br />
Bayer, H.-J.: Unterirdische Leitungsbelegungsräume<br />
in den Megacities der<br />
Welt. IRO Band 35: Rohrleitungen –<br />
was wird sein in den nächsten 25 Jahren?<br />
S. 31–45. Vulkan-Verlag, Essen,<br />
2011.<br />
Niederste-Hollenberg, J.: Infrastruktursysteme<br />
in urbanen Räumen – Risiken<br />
und Perspektiven. IRO Band 35: Rohrleitungen<br />
– was wird sein in den<br />
nächsten 25 Jahren? S. 18–26. Vulkan-<br />
Verlag Essen, 2011.<br />
Kontakt:<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG,<br />
Spezialmaschinen,<br />
Reiherstraße 2,<br />
D-57368 Lennestadt,<br />
Tel (0 2723) 808 - 0, Fax (02723) 808 - 1 80,<br />
E-Mail: marketing@tracto-technik.de,<br />
www.tracto-technik.de<br />
Alles zählt<br />
Bei Messung des <strong>Wasser</strong>verbrauchs zählt alles mit<br />
Wenn Fernauslesung einfach und sicher sein soll<br />
Wenn eine faire Abrechnung gefragt ist<br />
Wenn Leckagen frühzeitig erkannt werden sollen<br />
Wenn Kundenservice wichtig ist<br />
Wenn Umweltbewusstsein ernst genommen wird<br />
Wenn die Installation von <strong>Wasser</strong>zählern mühelos<br />
sein soll<br />
Wenn alles zählt – ultrapräzise und bis ins kleinste Detail – ist die Wahl<br />
einfach. MULTICAL ® 21 Ultraschallwasserzähler mit Fernauslesung.<br />
Mehr erfahren Sie auf www.multical21.de<br />
Film ab...<br />
<br />
Kamstrup A/S · Werderstraße 23-25 · D-68165 Mannheim · info@kamstrup.de · www.multical21.de
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Schlauchliner-Sanierung am Heidelberger Schloss<br />
In Heidelberg wurde von der Firma Erles Umweltservice GmbH aus Meckesheim (EUS) eine der beiden<br />
Hauptentwässerungsleitungen des historischen Heidelberger Schlosses per Schlauchliner saniert.<br />
„Über den Dächern von Heidelberg“<br />
wurde der Inliner mit dem von Erles gebauten<br />
Spezial-LKW etwa 30 Meter über die Balustrade<br />
in den Schacht abgelassen.<br />
In einer der bekanntesten „Idyllen“ Deutschlands, aber zugleich in<br />
bautechnischer Extremlage, fand die Sanierung einer der Hauptentwässerungsleitungen<br />
des Heidelberger Schlosses statt.<br />
Das Heidelberger Schloss gehört<br />
zu einem der berühmtesten<br />
historischen Gebäude Deutschlands<br />
und ist das Wahrzeichen der<br />
Stadt Heidelberg. Das erstmals 1225<br />
erwähnte Schloss und die dazu<br />
gehörige Schlossanlage ziehen jährlich<br />
über eine Million Besucher in<br />
ihren Bann. In herrlicher Lage über<br />
dem Schloss liegt das dazugehörige<br />
ehemalige Schlosshotel, das im<br />
Rahmen einer Umnutzung von der<br />
Firma HOCHTIEF Solution AG aufwendig<br />
saniert und zu einer exklusiven<br />
Wohnanlage umgebaut wurde.<br />
Diese stadtbildprägende Immobilie<br />
verzückte einst schon den<br />
berühmten Schriftsteller Mark Twain,<br />
der über das damalige Hotel sagte:<br />
„Noch niemals habe ich eine Aussicht<br />
genossen, die einen so stillen<br />
und beglückenden Zauber besessen<br />
hat wie diese“.<br />
Im Rahmen der behördlichen<br />
Auflagen wurde durch die EUS die<br />
227 m lange Entwässerungsleitung<br />
DN 400 bis hinunter in die Altstadt<br />
von Heidelberg untersucht. Dabei<br />
wurden auf der gesamten Strecke<br />
Undichtigkeiten, Korrosionen, Rissund<br />
Scherbenbildungen durch statische<br />
Überlastung festgestellt.<br />
Ebenfalls stark in Mitleidenschaft<br />
gezogen waren die einzelnen<br />
Schachtbauwerke.<br />
Problematisch war nicht nur die<br />
exponierte Lage der Baustelle hoch<br />
über den Dächern von Heidelberg –<br />
die Entwässerungssysteme waren<br />
auch sehr aufwändig und kompliziert<br />
aufgebaut. Speziell die hohen<br />
Gefällestrecken von bis zu 46 %<br />
stellten die hochmotivierten Techniker<br />
der EUS vor eine sehr<br />
anspruchsvolle und vor allem kraftintensive<br />
Aufgabe.<br />
Um den baubehördlichen und<br />
gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen,<br />
wurde gemeinsam mit der<br />
„Vermögen und Bau Baden-Württemberg“,<br />
dem Eigentümer des Heidelberger<br />
Schlosses, sowie der<br />
HOCHTIEF Solution AG und dem<br />
baubegleitenden Ingenieurbüro<br />
PGT aus Freiburg festgelegt, dass<br />
die komplette Entwässerungsleitung<br />
zur Gewährleistung einer<br />
weiteren dauerhaften Nutzung mittels<br />
In liner-Auskleidung renoviert<br />
werden soll. Nicht mehr benötigte<br />
Schachtbauwerke sollten mit dem<br />
Inliner durchfahren werden und<br />
danach verschlossen bleiben.<br />
Aufgrund der hohen Qualitätsanforderungen<br />
und der unzugänglichen<br />
Lage kam nur der Einbau<br />
eines GFK Inliners in Frage.<br />
Die EUS setzte hier auf den GL01,<br />
ein Produkt aus dem Hause iMPREG.<br />
Mit iMPREG arbeitet die EUS bereits<br />
seit 1999 erfolgreich zusammen<br />
und gehört dort zu den ersten und<br />
langjährigen Kunden. „Unabhängig<br />
davon ist der GL01 durch seine<br />
nahtlosen, überlappenden und in<br />
Längsrichtung verlaufenden Glasfaserbahnen<br />
hervor ragend für den<br />
Einzug in langen Strecken geeignet“,<br />
meint Jens Wohlrabe, Projektleiter<br />
der EUS. „Mit zunehmender<br />
Wandstärke steigt die Längskraftaufnahme<br />
des Materials praktisch<br />
ins Unendliche“, fügt er ergänzend<br />
hinzu.<br />
Bedingt durch die Lage und den<br />
schwierigen Zugang musste der<br />
GFK Inliner in der Dimension 400<br />
über die gesamte Strecke von<br />
226 an einem Stück eingebaut wer-<br />
Juli/August 2011<br />
660 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
den. Das größte Gefälle hier beträgt<br />
46 %! Erschwerend kam hinzu, dass<br />
die Leitung nicht gerade verlief und<br />
mit Abwinklungen von bis zu 20°<br />
ins Tal führte.<br />
Nach dem Aufbau der <strong>Wasser</strong>haltung<br />
und abschließender Reinigung<br />
unter TV-Beobachtung wurde<br />
eine massiver als sonst eingesetzte<br />
Gleitfolie eingezogen. Diese musste,<br />
anders als üblich, in allen verfügbaren<br />
Zwischenschächten zusätzlich<br />
gesichert werden. Für den folgenden<br />
Liner-Einzug wurden in den<br />
Zwischenschächten mit den extremen<br />
Abwinklungen noch Umlenkrollen<br />
installiert, um die Einzugsfolie<br />
nicht zu beschädigen.<br />
Beim folgenden Einbau des<br />
In liners wurde dieser unter Zuhilfenahme<br />
des Einbaufahrzeuges der<br />
EUS über die Balustrade der Schlossterrasse<br />
materialschonend in den<br />
Einzugsschacht eingelassen. Die<br />
Höhendifferenz von der Balustrade<br />
zum Einzugsschacht beträgt<br />
25 Meter! Für solche Extremsituationen<br />
verfügt die EUS über ein<br />
hochmodernes, größtenteils selbst<br />
entwickeltes Equipment. Unter<br />
Zuhilfenahme dieses Einbaufahrzeuges<br />
mit hydraulisch angetriebenen,<br />
profilierten Rollen konnte der<br />
Liner kontrolliert und ohne jedes<br />
Risiko jederzeit gezogen und bei<br />
Bedarf auch gestoppt werden.<br />
Nach dem Einziehen des Inliners<br />
musste dieser speziell in den<br />
Schächten fixiert werden, um ein<br />
Durchrutschen des Schlauches bei<br />
diesem extremen Gefälle zu verhindern.<br />
Hierbei mussten EUS-Projektleiter<br />
Wohlrabe und sein Team<br />
ebenfalls individuelle Lösungen<br />
suchen. Nach einigen Probeläufen<br />
entschied man sich für eigens in der<br />
Werkstatt der EUS angefertigte<br />
Ankerbefestigungen. Dank dieser<br />
und weiterer innovativer Individuallösungen<br />
war eine solch anspruchsvolle<br />
Installation möglich.<br />
Im Anschluss an die Fixierung<br />
des Inliners wurden die Packerschleusen<br />
angebunden und die Leitung<br />
auf gesamter Länge mit Luftdruck<br />
beaufschlagt. Nach dem Einsetzen<br />
der Lichtquelle und der<br />
folgenden Abnahmefahrt zum<br />
Startpunkt der Aushärtung konnte<br />
das Team der EUS erstmals an diesem<br />
anstrengenden Tag durchatmen.<br />
Die Aushärtung erfolgte vollständig<br />
automatisiert unter Steuerung<br />
und Beobachtung eines<br />
Technikers und konnte planmäßig<br />
nach fünf Stunden beendet werden.<br />
Im Anschluss an die Aushärtung<br />
wurden die Liner-Enden und die noch<br />
benötigten Zwischenschächte aufgeschnitten<br />
und mit PCC Mörtel eingebunden.<br />
Ein weiterer „Gewaltakt“ war<br />
die Sanierung der Schächte. Auch<br />
hier mussten alle benötigten Materialien<br />
zu Fuß zu der extremen Hanglage<br />
herbeigeschafft werden.<br />
Nach Fertigstellung wurde der<br />
sanierte Kanal befahren und vom<br />
Auftraggeber abgenommen. In der<br />
abschließenden Betrachtung wurden<br />
noch einmal der reibungslose Ablauf<br />
sowie die hohe Professionalität der<br />
EUS im Umgang mit dem Material<br />
Beengte Verhältnisse im Startschacht DN 700/700.<br />
und mit Extremsituationen hervorgehoben.<br />
Auch die ins Labor gegebenen<br />
Materialstücke bekamen am<br />
Ende Bestwerte bescheinigt.<br />
Dies gilt nicht zuletzt als Beweis<br />
dafür, dass sich eine langjährige<br />
Partnerschaft zwischen Anwender<br />
und Hersteller sowie der aufgebaute<br />
Erfahrungsschatz für Kunden<br />
und alle Beteiligten am Ende auszahlt.<br />
„Dort wo andere meinen, die<br />
Lichthärtung sei an ihre Grenze<br />
gelangt, fangen wir mit innovativen<br />
Lösungen an“, stellt der Geschäftsführer<br />
Andreas Erles nach Beendigung<br />
der Maßnahme beim<br />
abschließenden Gespräch mit allen<br />
Beteiligten auf der Baustelle fest.<br />
Kontakt:<br />
Erles Umweltservice GmbH, Andreas Erles,<br />
Dieselstraße 5, D-74909 Meckesheim,<br />
Tel. (06226) 4296-85,<br />
E-Mail: Andreas.Erles@erles.de,<br />
www.erles.de<br />
Inliner in einem der Zwischenschächte während des<br />
Aushärtevorgangs.<br />
Fertig eingebauter Inliner mit den Rohreinbindungen<br />
aus PCC Mörtel.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 661
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Grabenlos sanieren für den Naturschutz<br />
Mennicke Rohrbau saniert für <strong>Wasser</strong>gruppe Marktheidenfeld mit Close-Fit-Lining<br />
Über 8000 Gebiete stehen bundesweit unter Naturschutz. Viele übernehmen für unseren Alltag zentrale Funktionen.<br />
Allein in Bayern dienen mehr als zehn Naturparks zur Trinkwassergewinnung, so auch das Naturschutzgebiet<br />
Weihersgrund. Zur Erhaltung einer ausgezeichneten <strong>Wasser</strong>qualität rehabilitierte Mennicke im<br />
Gewinnungsgebiet bei Marktheidenfeld Brunnenleitungen im Close-Fit-Verfahren.<br />
Klar und unbelastet versorgen die<br />
Quellen im Naturschutzgebiet<br />
Weihersgrund über drei Tiefbrunnen<br />
rund 22 000 Einwohner mit<br />
Trinkwasser. Das sind 60 Liter pro<br />
Sekunde aus über 50 Metern Tiefe.<br />
In die Qualität der <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
investiert die <strong>Wasser</strong>gruppe<br />
So bleibt es innen sauber: Eine Verschlussblase<br />
schützt das PE-Rohr vor Verschmutzung.<br />
Bevor das gefaltete PE-Rohr wieder seine kreisrunde<br />
Form annehmen kann, muss das Rohrende verschlossen<br />
und gesichert werden. Unter Dampf und<br />
Druck wird es anschließend rückverformt<br />
Marktheidenfeld viel. Bis zum<br />
100-jährigen Verbandsjubiläum im<br />
kommenden Jahr sollen die Arbeiten<br />
zur Sanierung und Erweiterung<br />
der Verbandsanlagen abgeschlossen<br />
sein. Für die Erneuerung der<br />
Brunnenleitungen und der Zuleitung<br />
zum Maschinenhaus war das<br />
bayerische Rohrleitungsbauunternehmen<br />
Mennicke Rohrbau im Einsatz.<br />
Kleine Baustelle,<br />
große Wirkung<br />
Aufgelöste Dichtringe in den Muffen<br />
hatten dazu geführt, dass das<br />
<strong>Wasser</strong> aus den PVC-Leitungen in<br />
das Erdreich austrat. Auf einer<br />
Gesamtlänge von 1790 Metern<br />
wurden die maroden Leitungen<br />
(DN 150 und DN 175) des Kiesel-,<br />
Gold- und Forstratsbrunnens durch<br />
den Einzug von PE-Inlinern SDR 17<br />
grabenlos erneuert. „Eine offene<br />
Bauweise war von vornherein ausgeschlossen“,<br />
gibt Markus Warmuth-Baron,<br />
Niederlassungsleiter<br />
Nord, rückblickend an. „Dafür wäre<br />
die Flora und Fauna der Umgebung<br />
zu empfindlich.“ Eine raffiniertere<br />
Methode musste her. Nahezu ohne<br />
Baugruben einsetzbar, nahtlos<br />
anliegend und langlebig war das<br />
Faltrohrrelining durch Close-Fit<br />
optimal gewählt.<br />
Überzeugende<br />
Close-Fit-Technik<br />
Die thermomechanische Technologie<br />
erlaubt eine schnelle und<br />
umweltschonende Installation und<br />
garantiert zugleich ein dauerhaft<br />
dichtes, vor Innenkorrosion<br />
geschütztes Rohr. Letzteres war<br />
besonders wichtig, da das Grundwasser<br />
am Weihersgrund kohlensäureaggressiv<br />
ist. Durch den hohen<br />
Anteil an freier Kohlensäure bot sich<br />
für die Brunnenleitungen das diffusionsoffene<br />
Polyethylen als bestgeeigneter<br />
Baustoff an. Hohe Umweltauflagen<br />
machten zusätzliche Vorkehrungen<br />
nötig. Auffangwannen<br />
wurden unter die Baugeräte<br />
gestellt, Bioöl als Treibstoff eingesetzt.<br />
Zur Umgehung von Tabuzonen<br />
mussten mancherorts 150<br />
Meter von der Baugrube entfernt<br />
Winden postiert werden. Nicht minder<br />
aufwändig gestaltete sich die<br />
Bewältigung der Fliesssande. Häufig<br />
auftretende Quellen sind die Folge<br />
der artesischen Brunnen vor Ort<br />
und bilden nasse feinsandige Böden<br />
der Klasse zwei. „Unsere PE-Schweißer<br />
mussten hier unter erschwerten<br />
Bedingungen volle Leistung bringen“,<br />
unterstreicht Warmuth-Baron.<br />
Schweißtechnisch routiniert verbanden<br />
Mennicke’s Spezialisten die<br />
PE-Liner innerhalb kürzester Zeit.<br />
Mit dem modernen Close-Fit-<br />
Verfahren renovierte Mennicke die<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnungsanlage im Weihersgrund<br />
zügig und reibungslos.<br />
Die Brunnenleitungen in der Talaue<br />
bei Marktheidenfeld sind damit<br />
technisch wieder auf dem neuesten<br />
Stand.<br />
Kontakt:<br />
Marion Melzer,<br />
Mennicke Rohrbau GmbH,<br />
Rollnerstraße 180,<br />
D-90425 Nürnberg,<br />
Tel. (0911) 36 07- 284,<br />
Fax (0911) 36 07- 406,<br />
E-Mail: mmelzer@mennicke.de,<br />
www.mennicke.de<br />
Juli/August 2011<br />
662 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Epochale Novelle,<br />
epochaler Kommentar<br />
Inkl. Online-<br />
Datenbank zum<br />
<strong>Wasser</strong>recht!<br />
WHG<br />
<strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
Kommentar<br />
Herausgegeben von Dr. jur. Konrad Berendes,<br />
Minis terialrat a.D. im Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Prof. Dr. jur. Walter<br />
Frenz, Professor für Berg-, Umwelt- und Europarecht<br />
an der RWTH Aachen, und Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen<br />
Müggenborg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
in Aachen, Honorarprofessor der RWTH<br />
Aachen sowie Lehrbeauftragter der Universität Kassel<br />
2011, L, ca. 1.600 Seiten, fester Einband,<br />
ca. € (D) 150,–, ISBN 978-3-503-12666-8<br />
Berliner Kommentare<br />
Das 2010 in Kraft getretene <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
(WHG) ersetzt vollständig das vormals geltende<br />
Rahmen recht. Neben vielen inhaltlichen Änderungen<br />
hat es vor allem systematische, grundsätzliche Neuerungen<br />
gegeben. Doch bei der Anwendung des Rechts<br />
herrscht oftmals Unsicherheit.<br />
Um Ihnen die Praxis mit dieser komplizierten Materie zu<br />
erleichtern, wurde der neue Berliner Kommentar WHG<br />
entwickelt. Neben der ausführlichen, praxisorientierten<br />
Erläuterung des WHG 2010 berücksichtigt er auch die<br />
abweichenden bzw. ergänzenden landesrechtlichen<br />
Regelungen.<br />
Setzen auch Sie auf die Kompetenz von Herausgebern<br />
und Autoren aus Verwaltung, Anwaltschaft und Wissenschaft<br />
– jeder Einzelne ist bestens mit der Materie vertraut<br />
und durch zahlreiche Publikationen ausgewiesen.<br />
Bearbeitet von RA Dr. jur. Markus Appel, LL.M. | MinRat<br />
a.D. Dr. jur. Konrad Berendes | Dipl.-Biol. Martin Böhme |<br />
RA Prof. Dr. jur. Bernd Dammert | RA Dr. jur. Claus Esser |<br />
Prof. Dr. jur. Walter Frenz | RA Dr. jur. Ralf Gruneberg |<br />
Prof. Dr. jur. Sebastian Heselhaus, M.A. | Dr. rer. nat.<br />
Dipl.-Chem. Anne Janssen-Overath | Reg.-Rat Dr. jur.<br />
Moritz Maus | RA Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg |<br />
RA Frank Niesen | RA Dr. jur. Peter Nisipeanu | Prof. Dr. jur.<br />
Peter Reiff | RegDir Bernhard Schmid | Dr. jur. Joachim<br />
Schwind | RA Dr. jur. Martin Weber | MinDir Dr. jur. Helge<br />
Wendenburg | RA Bernd Zloch.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.ESV.info/978-3-503-12666-8<br />
erich schmidt verlag<br />
Auf Wissen vertrauen<br />
Bestellungen bitte an den Buchhandel oder: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin · Fax 030/25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV. info
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Langlebig und dicht geschweißt<br />
Neubau eines 5,4 km langen Transportsammlers aus PE-HD<br />
Der Aggerverband in Nordrhein-Westfalen ist der Garant für einwandfreies Trinkwasser und effiziente<br />
Reinigung des <strong>Abwasser</strong>s. Beim Bau eines neuen <strong>Abwasser</strong>transportsammlers hatten die Kriterien<br />
Langlebigkeit und Sicherheit höchste Priorität. Nur eine Lösung erfüllte die hohen Anforderungen:<br />
das <strong>Abwasser</strong>system FRIAFIT.<br />
Die<br />
Trinkwasseraufbereitung,<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung, Unterhaltung<br />
der Fließgewässer und des<br />
Talsperrenbetriebs sind die Hauptaufgaben<br />
des Aggerverbands.<br />
1100 km² umfasst das Verbandsgebiet.<br />
25 Mio. m 3 Trinkwasser bereitet<br />
der Verband im Jahr für die rund<br />
500 000 Einwohner auf. Darüber<br />
hinaus betreut das Unternehmen<br />
zurzeit 462 <strong>Abwasser</strong>anlagen. Hierzu<br />
zählen Klärwerke, Kanäle, Regenüberlauf-<br />
und Bodenfilter becken.<br />
Neu hinzugekommen sind jetzt<br />
5,4 km lange PE-HD Leitungen d355<br />
und d225. Der Bau des <strong>Abwasser</strong>transportsammlers<br />
wurde notwendig,<br />
als die Entscheidung fiel, den<br />
Betrieb der Kläranlage Marienhagen<br />
einzustellen. Aufgrund der Einwohnerentwicklung<br />
und der gesetzlichen<br />
Forderungen hätte man die<br />
Kläranlage um eine weitere Reinigungsstufe<br />
ausbauen müssen. Ein<br />
Vorhaben, das sich bei genauerer<br />
Betrachtung als unwirtschaftlich<br />
erwies. Der <strong>Abwasser</strong>transportsammler<br />
wurde von der Kläranlage<br />
Marienhagen bis zur Stadt Wiehl<br />
verlegt und bei Alperbrück an das<br />
dortige Kanalnetz angeschlossen.<br />
Die Aggertalsperre in Nordrhein-Westfalen.<br />
Gute Erfahrungen mit PE-HD<br />
Bei der Materialauswahl gaben die<br />
Kriterien Langlebigkeit und Dichtheit<br />
den Ausschlag. Der Projektleiter<br />
des Aggerverbandes, Friedrich-<br />
Wilhelm Noll, hatte bereits langjährige<br />
gute Erfahrungen mit Druckund<br />
Freispiegelleitungen aus PE-HD<br />
im Klärwerksbereich gesammelt.<br />
Daher entschied er sich für <strong>Abwasser</strong>rohre<br />
aus PE100, d355 × 21,1<br />
sowie d225 × 13,4 (SDR17). Die<br />
Rohre besitzen inspektionsfreundliche<br />
Innenflächen, die eine optimale<br />
Befahrung mit der Kamera ermöglichen.<br />
Dem Systemgedanken konsequent<br />
folgend kam für die Verantwortlichen<br />
als Ver bindungstechnik<br />
nur eine homogene Schweißung<br />
mit Heizwendelschweißmuffen in<br />
Frage. Das System wurde durch den<br />
Einsatz von Kontrollschächten aus<br />
PE-HD komplettiert.<br />
Maximale<br />
Verarbeitungssicherheit<br />
und Zuverlässigkeit<br />
„Die Verarbeitungssicherheit des<br />
FRIAFIT-<strong>Abwasser</strong>systems hat uns<br />
überzeugt“, berichtet Dietmar<br />
Aschemeier, der Bauleiter der Firma<br />
Gebrüder Schmidt GmbH. Die so<br />
genannte Temperaturkompensation<br />
bei den FRIAFIT-Muffen AM<br />
bietet entscheidende Vorteile: Bei<br />
dieser Technik wird die benötigte<br />
Schweißenergie in Abhängigkeit<br />
von der aktuellen Umgebungstemperatur<br />
automatisch korrigiert. Der<br />
im Kabel des Schweißgerätes FRIA-<br />
MAT integrierte Fühler erfasst die<br />
Temperatur in unmittelbarer Nähe<br />
der Schweißverbindung.<br />
Der eingelesene Barcode auf der<br />
Muffe übermittelt die entsprechenden<br />
Korrekturfaktoren. Anhand dieser<br />
Parameter berechnet der FRIA-<br />
Juli/August 2011<br />
664 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Schweißung einer FRIAFIT-Muffe<br />
AM mit dem FRIAMAT-Schweißgerät.<br />
MAT eine korrigierte Schweißzeit.<br />
Der angepasste Energieeintrag<br />
schafft ideale Schweißbedingungen<br />
in der Fügezone an der Rohroberseite<br />
und an der Muffeninnenseite.<br />
Damit ist eine optimale Schweißnahtgüte<br />
auch bei extremen Temperaturen<br />
von –10 °C bis +45 °C<br />
gewährleistet.<br />
In der Praxis hat dies den positiven<br />
Effekt, dass auf der Baustelle<br />
sowohl in den Wintermonaten wie<br />
auch im Hochsommer eine zuverlässige<br />
Verarbeitung gewährleistet<br />
ist. So kann zügig und ohne kostspielige<br />
Unterbrechungen ganzjährig<br />
durchgearbeitet werden. Neben<br />
diesem Temperaturausgleich sorgen<br />
die freiliegenden Heizwendeln,<br />
ein weiteres charakteristisches<br />
Merkmal, für zusätzliche Verarbeitungssicherheit.<br />
Durch ihre offene<br />
Lage ermöglichen sie eine direkte<br />
Wärmeübertragung auf die Rohroberfläche.<br />
Das Resultat: Der Fügespalt<br />
zwischen Rohr und Muffe wird<br />
exzellent geschlossen.<br />
Insgesamt wurden über 700<br />
FRIAFIT-Muffen AM in den Dimensionen<br />
d355 und d225 problemlos<br />
geschweißt. Auch beim Service<br />
überzeugte FRIATEC. FRIAFIT-Fachberater<br />
Torsten Wennmann be -<br />
treute die Baustelle und wies das<br />
Personal in die Anwendung aller<br />
Werkzeuge ein, die für die Verarbeitung<br />
notwendig waren.<br />
Mit dem FRIATOOLS-Sortiment<br />
steht dem Anwender darüber hinaus<br />
ein genau abgestimmtes Geräteprogramm<br />
zur Verfügung. Neben<br />
dem FRIAMAT-Schweißgerät kam<br />
das Schälgerät FWSG 710 L auf der<br />
Baustelle zum Einsatz. Mit diesem<br />
Gerät lässt sich die Oxidschicht an<br />
der Rohroberfläche dimensionsübergreifend<br />
von d225 bis d710<br />
sicher entfernen. Ein spezielles<br />
federgelagertes Schälmesser er -<br />
zeugt einen gleichmäßigen Spanabtrag.<br />
Die zuverlässige Belieferung<br />
der Baustelle mit FRIAFIT-Formteilen<br />
trug als zusätzlicher Erfolgsfaktor<br />
zum guten Gelingen der<br />
Baumaßnahme bei.<br />
Kontakt:<br />
FRIATEC AG,<br />
Division Technische Kunststoffe,<br />
Postfach 710261,<br />
D-68222 Mannheim,<br />
www.friatec.de<br />
Zuverlässige Verankerung im PE-Formstück:<br />
Die Einbettungstiefe beträgt circa zwei Drittel des<br />
Heizwendeldurchmessers.<br />
Auf das Innere kommt es an: die „offen“ liegende<br />
Heizwendel.<br />
Info<br />
Maßnahme:<br />
Neubau des <strong>Abwasser</strong>transportsammlers Alpetal<br />
von November 2008 bis Mai 2010.<br />
Bauort: Stadt Wiehl<br />
Bauherr: Aggerverband, Gummersbach<br />
Planungsbüro:<br />
Ingenieurbüro Klapp und Müller GmbH,<br />
Reichshof-Odenspiel<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 665
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Stauraum für Reicholzrieds neue Kanalisation<br />
AMITECH Germany liefert bislang schwerstes GFK-Bauteil nach Bayern<br />
Im Zuge der Umstrukturierung der <strong>Abwasser</strong>entsorgung von Reicholzried (Markt Dietmannsried) war der Bau<br />
eines hoch komplexen Staukanal-Bauwerkes erforderlich. Pumpenbauwerk, Staustrecke und Entlastungsbauwerk<br />
wurden von AMITECH Germany GmbH nach Vorgaben des Ingenieurbüros Klinger, Dietmannsried,<br />
konstruiert, gebaut und geliefert. Mit 37 Tonnen Gesamtgewicht war das Pumpenbauwerk die bislang<br />
schwerste GFK-Sonderkonstruktion, die das AMITECH-Werk, im sächsischen Mochau, seit seiner Gründung<br />
verlassen hat.<br />
25 Tonnen<br />
schwer war das<br />
Entlastungbauwerk<br />
für<br />
Reicholzried:<br />
Das schwerste<br />
Einzelbauteil,<br />
das je das Werk<br />
in Mochau<br />
verließ.<br />
Die Tage der Kläranlage des<br />
Örtchens Reicholzried (Markt<br />
Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu)<br />
sind gezählt. Nach 25 Jahren<br />
Betriebsdauer läuft nicht nur der<br />
wasserrechtliche Genehmigungsbescheid<br />
der Anlage aus; sie ist<br />
überdies überlastet und technisch<br />
veraltet. Eine Sanierung, die das<br />
Ing.-Büro Klinger im Zuge einer<br />
Machbarkeitsstudie prüfte, wäre<br />
mit 745 000 € so teuer gewesen wie<br />
ein Neubau – von jährlichen<br />
Betriebskosten von 92 000 € ganz<br />
abgesehen. So entschieden sich die<br />
Verantwortlichen der Gemeinde<br />
letztlich für eine andere Alternativoption,<br />
nämlich den An schluss des<br />
Reicholzrieder Netzes an das Kanalnetz<br />
der Kerngemeinde Dietmannsried<br />
über eine Pumpendruckleitung<br />
von rund 3200 Metern Länge. Von<br />
Dietmannsried geht es dann künf tig<br />
weiter ins Zentralklärwerk Kempten.<br />
Diese Konzeption hat allerdings<br />
eine Voraussetzung. Das vorhandene<br />
Netz in Dietmannsried kann<br />
nur mit begrenzten Mengen an<br />
<strong>Abwasser</strong> beliefert werden, ohne es<br />
zu überlasten. Es ist also eine exakte<br />
Regulierung des Zuflusses aus<br />
Reicholzried notwendig. Dieses war<br />
2010 Anlass und Rahmenbedingung<br />
für eine der aufwändigsten<br />
und größten Sonderkonstruktionen,<br />
die je das Werk des GFK-Rohr-<br />
Herstellers AMITECH Germany verlassen<br />
haben. Um den Mischwasserabfluss<br />
nach Dietmannsried auf<br />
rund 12 Liter pro Sekunde zu<br />
begrenzen, wurde am Ortsausgang<br />
Reicholzried aus GFK-Rohren und –<br />
Sonderbauteilen ein mächtiges<br />
Staukanalbauwerk mit oben liegender<br />
Entlastung gebaut. Dieses<br />
wurde mit AMITECH-Unterstützung<br />
Das Entlastungsbauwerk wird in die Baugrube<br />
abgesenkt.<br />
Millimeterarbeit mit schwersten Lasten: ankoppeln<br />
an das bereits liegende Bauwerk.<br />
Juli/August 2011<br />
666 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
konstruiert und in Mochau aus<br />
Elementen des GFK-Systems FLOW-<br />
TITE gebaut.<br />
Das Staukanalbauwerk setzt sich<br />
aus drei Elementen zusammen. Vier<br />
aneinander gekoppelte GFK-Rohre<br />
DN 2400 bilden die eigentliche<br />
Speicherkammer mit etwa 145<br />
Kubikmetern Volumen. Sie ist mit<br />
1 % Gefälle verlegt und durch die<br />
glatten Innenseiten der Rohre<br />
selbstreinigend. Die Kammer kann<br />
durch einen integrierten Dom DN<br />
1000 beiderseits zu Wartungszwecken<br />
betreten werden. Der Kammer<br />
in Fließrichtung vorgelagert ist als<br />
Entlastungsbauwerk ein 6 Meter<br />
langes GFK-Rohr DN 2800 mit längs<br />
installierter Überlaufschwelle. Diese<br />
wird aktiv, wenn sich im Starkregenfalle<br />
im gesamten System das <strong>Wasser</strong><br />
bis in Höhe der Schwelle zurückgestaut<br />
hat. Dann werden über eine<br />
abgehende Leitung DN 700 bis zu<br />
1950 Liter mechanisch vorbehandeltes<br />
Mischwasser pro Sekunde<br />
abgeführt. Um diese mechanische<br />
Rei nigungswirkung zu optimieren,<br />
wurde im Reicholzrieder Überlaufbauwerk<br />
die Option für den nachträglichen<br />
Einbau eines so genannten<br />
GiWa-Grobstoffrechens konstruktiv<br />
vorbereitet. Hierbei handelt<br />
es sich um einen Stahl-/Kunststoff-<br />
Rechen, der auf der Überfall-Wand<br />
zwischen Bauwerkszulauf und Entlastungskanal<br />
installiert wird. Ein<br />
verschleißarmes, integriertes Reinigungssystem<br />
sorgt dafür, dass sich<br />
der sehr effektive Rechen auch bei<br />
starker Belastung nicht zusetzen<br />
kann. Zudem funktioniert der<br />
Rechen rein mechanisch ohne<br />
Fremdenergieeintrag. Auch das Entlastungbauwerk<br />
ist von oben her<br />
durch zwei Domeinstiege DN 1000<br />
zugänglich. Mit 25 Tonnen Gesamtgewicht<br />
ist das Entlastungbauwerk<br />
Reicholzried das schwerste homogene<br />
Bauteil, das je das Werk in<br />
Mochau verlassen hat.<br />
Das 7,22 Meter lange Pumpwerk<br />
als Abschluss des Staukanals ist<br />
zwar mit 37 Tonnen noch deutlich<br />
schwerer, wurde jedoch in drei Einzelteilen<br />
angeliefert und in situ<br />
zusammengebaut. Die Konstruktion<br />
besteht aus GFK-Rohren<br />
DN 3000, zwei Domen und einem<br />
Zugangsschacht DN 1500 mit integrierter<br />
Wendeltreppe. Es verfügt<br />
über eine Vor lagekammer mit profiliertem<br />
Sohlabsturz und ist so konstruiert,<br />
dass die Pumpen trocken<br />
aufgestellt werden können.<br />
Das Staukanalbauwerk Reicholzried<br />
ist zwar das größte, aber bei<br />
Weitem nicht das einzige GFK-Bauwerk<br />
seiner Art, das in den vergangenen<br />
24 Monaten in Deutschland<br />
installiert wurde. In seinen Abmessungen<br />
durchaus dem Reicholzrieder<br />
Bauwerk vergleichbar ist<br />
etwa ein Staukanal DN 2800/3000,<br />
der zeitgleich in Lichtenfels (Bayern)<br />
gebaut wurde und an eine GFK-<br />
Leitung DN 800 anschließt.<br />
Bei AMITECH hat man in dieser<br />
Richtung sowohl konstruktiv als<br />
auch fertigungstechnisch eine<br />
erhebliche Erfahrung gesammelt,<br />
die nun bei der Konstruktion entsprechender<br />
Anlagen den Auftraggebern<br />
in vollem Umfang zugute<br />
kommt.<br />
Kontakt:<br />
AMITECH Germany GmbH,<br />
Am Fuchsloch 19,<br />
D-04720 Mochau,<br />
Tel. (03431) 71 82-0,<br />
Fax (03431) 70 23 24,<br />
E-Mail: info@amitech-germany.de<br />
www.amitech-germany.de<br />
Das neue Entlastungsbauwerk des Staukanals in<br />
Endlage.<br />
Durchaus vergleichbar mit dem Projekt Reicholzried<br />
ist der Staukanal, der 2010 in Lichtenfels gebaut<br />
wurde.<br />
GFK Schächte ragen aus dem Boden über dem<br />
bereits erdüberdeckten Pumpenbauwerk des<br />
Reicholzrieder Staukanals.<br />
Einer für alles: Berstlining, Sanflex, ZM-Auskleidung, Compact Pipe, Swagelining<br />
www.dus-rohrsanierung.de<br />
Wilhelm-Wundt-Straße 19 · 68199 Mannheim · Tel.: 0621 8607440 · Fax: 0621 8607449 · Email: zentrale.rohrsan@dus.de<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 667
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
In allen Profilen gut gewickelt<br />
Wickelrohrverfahren von SEKSUI SPR Europe<br />
SEKISUI SPR Europe präsentierte auf der „No Dig International“, die im Rahmen der Messe WASSER Berlin<br />
stattfand, das SPR TM Verfahren als eines der Highlights in einer Live-Demonstration. In Europa noch relativ<br />
neu, ermöglicht das innovative Wickelrohrverfahren die grabenlose Sanierung von <strong>Abwasser</strong>leitungen in Großund<br />
Sonderprofilen.<br />
Die SPR TM Technologie zur grabenlosen Rohrsanierung<br />
feiert nun auch große Erfolge in Europa.<br />
Alle Abbildungen: SEKISUI SPR Europe GmbH.<br />
Beim SPR TM Verfahren wandert die Wickelmaschine<br />
durch den zu sanierenden Kanal und hinterlässt das<br />
fertig gewickelte Rohr.<br />
Die vier patentierten Wickelrohrverfahren<br />
von SEKISUI SPR<br />
Europe zur Sanierung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
basieren auf dem Prinzip<br />
eines – von der Tochterfirma<br />
SEKISUI Rib Loc hergestellten – endlosen<br />
Kunststoffstreifens, der als<br />
Liner von hoher Ringsteifigkeit und<br />
von geringem Gewicht spiralförmig<br />
direkt in das beschädigte Rohr<br />
gewickelt wird. Europapremiere feiert<br />
derzeit die SPR TM Technologie,<br />
ein Verfahren zur Sanierung von<br />
begehbaren <strong>Abwasser</strong>rohren für<br />
große Durchmesser und Sonderprofile<br />
wie z. B. Ei-, Maul- oder Drachenprofile.<br />
Ermöglicht wird das Ganze<br />
durch eine Wickelmaschine, die<br />
selbst kontinuierlich durch den<br />
Kanal wandert. Ihr wird ein Endlos-<br />
Streifen stahlverstärktes PVC-Profil<br />
zugeführt und mit jeder Profilumdrehung<br />
bewegt sich die Wickelmaschine<br />
um eine Profilbreite nach<br />
vorne und verriegelt dabei die Profilkanten<br />
zu einem Rohr. Die mechanische<br />
Schlossverbindung des Profils<br />
ist wasserdicht und kann einem<br />
starken Verformungsdruck standhalten.<br />
Nach der Aussteifung des<br />
neuen Rohres durch Stütz-Einheiten<br />
sorgt eine Ringraumverfüllung<br />
schließlich für die rechnerisch nachzuweisende<br />
Statik. Dazu wird ein<br />
speziell entwickelter Hochleistungsmörtel<br />
in den Ringraum zwischen<br />
dem Altkanal und dem gewickelten<br />
PVC-Profil eingebracht. Der gesamte<br />
Sanierungsvorgang mit SPR TM kann<br />
bei Vorflut vorgenommen werden.<br />
Wickelrohrverfahren für<br />
Kreisprofile<br />
Auch die Wickelrohrverfahren<br />
SPR TM PE, SPR TM EX und SPR TM ST<br />
sind durch ihre kurzen Installationszeiten<br />
und die geringe Beeinträchtigung<br />
der Umwelt eine kosteneffektive<br />
Alternative zum konventionellen<br />
Rohrleitungsbau. Sie werden<br />
von einer stationären Wickelmaschine<br />
eingebracht und sind für<br />
die Sanierung von Kreisprofilen<br />
konzipiert. So erneuert das System<br />
SPR TM PE aus dem Werkstoff HDPE<br />
Rohrleitungen mit großen Durchmessern<br />
von 900 bis 3000 mm. SEKI-<br />
SUI SPR Europe bietet zudem für die<br />
Sanierung von DN 150 bis 750 mm<br />
im close-fit Verfahren das System<br />
SPR TM EX, ein statisch selbsttragendes<br />
PVC-Wickelrohr ohne Ringraumverfüllung.<br />
Das SPR TM ST Verfahren<br />
saniert Rohrleitungen mit<br />
einem Durchmesser von 450 bis<br />
2500 mm und zeichnet sich durch<br />
eine besonders hohe Steifigkeit aufgrund<br />
der Verbindung von PVCund<br />
Stahlprofil aus.<br />
Kontakt:<br />
SEKISUI NordiTube Technologies SE,<br />
Julius-Müller-Straße 12,<br />
D-32816 Schieder-Schwalenberg,<br />
Tel. (05284) 94298-10,<br />
www.sekisuispr.com<br />
SPR TM PE von SEKISUI SPR Europe eignet sich zur<br />
grabenlosen Sanierung von Großprofilen.<br />
Selbsttragendes PVC-Wickelrohr ohne Ringraumverfüllung:<br />
SPR TM EX von SEKISUI SPR Europe.<br />
Juli/August 2011<br />
668 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Einsatz in Ecuador<br />
Eine für westeuropäische Verhältnisse abenteuerlich anmutende, aber<br />
kreative, sichere und funktionierende Methode, auch an höher liegende<br />
Revisionsöffnungen zu kommen: Ein Trailer auf einem Trailer.<br />
Als führender Hersteller von<br />
Kanalrohr-Inspektionsanlagen<br />
ist das Kieler Unternehmen IBAK<br />
Helmut Hunger GmbH & Co. KG mit<br />
zahlreichen Servicepartnern weltweit<br />
vertreten. Einer dieser Partner<br />
ist die VE Group in Ecuador, die mit<br />
der Technik des Kieler Unternehmens<br />
die spektakuläre Inspektion<br />
einer großprofiligen Trinkwasserleitung<br />
durchführte.<br />
Im Juni 2011 reiste der IBAK-Servicetechniker<br />
Thomas Jeschke nach<br />
Ecuador, um diesen Einsatz in Guayaquil<br />
zu begleiten. Guayaquil ist<br />
mit etwa 2,15 Mio. Einwohnern die<br />
größte Stadt Ecuadors, deren<br />
<strong>Abwasser</strong>netz von der Firma Interagua,<br />
einer Tochterfirma von Veolia,<br />
betreut und bewirtschaftet wird.<br />
Interagua wiederum beauftragte<br />
die kanadische Firma Pure Technologies<br />
mit der Feststellung des baulichen<br />
Zustands der 5000 m langen<br />
und 1250 mm großen Stahlleitung<br />
mit Betonauskleidung. Nur 18 Stunden<br />
standen für diesen Einsatz über<br />
Nacht zur Verfügung, da 250 000<br />
Menschen in Guayaquil die Trinkwasserzufuhr<br />
abgestellt worden<br />
war. Geradezu prädestiniert für diesen<br />
Einsatz war die PANORAMO-<br />
Inspektionstechnologie der Firma<br />
IBAK, weshalb die Lösung dieser<br />
Problemstellung von Pure Technologies<br />
an die VE Group als IBAKs<br />
Partner in Ecuador weitergegeben<br />
worden war.<br />
IBAK unterstützte ihren Service-<br />
Partner, indem sie den Techniker<br />
Thomas Jeschke nach Guayaquil<br />
entsandte. Seine zehnjährige Erfahrung<br />
mit den IBAK-Anlagen gab den<br />
Mitarbeitern der VE Group vor Ort<br />
die Sicherheit, auch auf eventuell<br />
unvorhergesehene Situationen entsprechend<br />
reagieren zu können, und<br />
trug zum erfolgreichen Abschluss<br />
des Projektes bei. Zusätzlich beauftragte<br />
die VE Group eine örtliche<br />
Baufirma, um einen reibungslosen<br />
Zugang zu allen Schächten und Einlasspunkten<br />
zu ermöglichen. Insgesamt<br />
waren so rund 100<br />
Personen an der Umsetzung<br />
des Projektes beteiligt.<br />
Eine besondere Herausforderung<br />
bildeten<br />
etwa zehn Einlasspunkte<br />
der Leitung, deren Höhe<br />
das direkte Einführen der<br />
PANORAMO-Kamera über<br />
das Inspektionsfahrzeug<br />
nicht erlaubte. Zum Einsatz<br />
kam so eine<br />
„Huckepack lösung“ mit<br />
einem höhenverstellbaren<br />
Trailer, der den eigens für<br />
diesen Auftrag angeschafften,<br />
mit der IBAK-<br />
Anlage ausgebauten<br />
Anhänger transportierte.<br />
Mit der hydraulischen<br />
Höhenverstellung ließ sich<br />
die Position der Anlage<br />
soweit nach oben verlagern,<br />
dass die PANO-<br />
RAMO-Kamera auch in die<br />
hoch liegenden Einlasspunkte<br />
eingelassen werden<br />
konnte.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 669
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Die IBAK-PANORAMO beim Einlassen in einige der zehn Einlasspunkte der 5000 Meter langen zu<br />
untersuchenden Strecke.<br />
Information für Anwender: Eingesetzt<br />
wurde ein PANORAMO2-<br />
BS5-System mit Kabelwinde KW 505<br />
und Inspektionssoftware IKAS32.<br />
Nach umfassenden Vorbereitungen<br />
und Sichtung der verschiedenen<br />
Einlasspunkte begann die Inspektion<br />
am Freitag, dem 03.06.2011<br />
um 20 : 00 Uhr und es wurde nonstop<br />
bis zum Samstag um 13 : 30 Uhr<br />
untersucht. Alle Beteiligten –Menschen<br />
wie Maschinen – wurden<br />
durch die ununterbrochene Arbeit<br />
und die Umgebungsbedingungen<br />
auf eine harte Belastungsprobe<br />
gestellt. Hohe Steigungen oder<br />
Gefällestrecken der Leitung von teilweise<br />
über 13 % forderten die<br />
Antriebe von Kameratraktor und<br />
Zugwinde heraus, wurden aber sehr<br />
gut gemeistert. Allerdings stellte<br />
Eine von der VE Group beauftragte Baufirma sicherte<br />
alle Einsatzorte an der zu untersuchenden Strecke<br />
des <strong>Abwasser</strong>- bzw. Trinkwassernetzes.<br />
sich heraus, dass durch Senken der<br />
Leitung auf insgesamt 1700 Meter<br />
der <strong>Wasser</strong>stand derart hoch war,<br />
dass diese Teilstrecken sich optisch<br />
nicht untersuchen ließen.<br />
An den darauf folgenden Tagen<br />
erfolgte eine detaillierte Analyse<br />
der Inspektionsdaten und die Vorstellung<br />
des Untersuchungsergebnisses<br />
im Büro der Firma Interagua,<br />
bei der auch Thomas Jeschke wieder<br />
dabei war und ergänzend technische<br />
Details von PANORAMO-<br />
Technologie und IKAS32-Software<br />
erläuterte. Alle Anwesenden zeigten<br />
sich von der hohen Bildqualität<br />
und Aussagekraft der PANORAMO-<br />
Filmung begeistert. Aber auch Guayaquils<br />
Einwohner konnten später<br />
wegen der hohen Medienpräsenz<br />
während des Vorhabens die Highlights<br />
in Funk und Fernsehen verfolgen<br />
und den Grund der Unterbrechung<br />
ihrer <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
nachvollziehen.<br />
Wieder zu Hause in Deutschlands<br />
Norden zieht Thomas<br />
Jeschkes sein persönliches Resumée:<br />
„Es war für mich interessant<br />
und spannend, an diesem Projekt in<br />
Südamerika teilzunehmen – ich<br />
habe einen guten Einblick in die<br />
Arbeitsweise und Organisation in<br />
Ecuador erhalten. Es war eine tolle<br />
Erfahrung, für den reibungslosen<br />
Ablauf und so auch direkt für das<br />
Gelingen und die 100 Mitwirkenden<br />
mitverantwortlich zu sein. Ich freue<br />
mich, dass die IBAK-PANORAMO-<br />
Technologie durch die sehr guten<br />
Ergebnisse wieder einmal überzeugt<br />
hat. Solche Auslandseinsätze<br />
sind immer auch ein kleines Abenteuer<br />
– man weiß im Vorfeld nicht,<br />
welche Bedingungen einen vor Ort<br />
erwarten und wie die Menschen<br />
„ticken“, mit denen man zusammenarbeitet.<br />
Mein Fazit: Jede Herausforderung<br />
bringt einen voran! Durch<br />
den Einsatz in Ecuador habe ich ein<br />
für mich völlig neues Land und eine<br />
andere Kultur kennen gelernt. So<br />
konnte ich sowohl berufliche als<br />
auch zwischenmenschliche Erfahrungen<br />
sammeln. Diese Vielfältigkeit<br />
macht für mich den Job im<br />
Kundendienst der Firma IBAK so<br />
interessant.“<br />
Kontakt:<br />
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG,<br />
Postfach 6260,<br />
D-24123 Kiel,<br />
Tel. (0431) 7270-0,<br />
Fax (0431) 7270-270,<br />
E-Mail: info(at)ibak.de,<br />
www.ibak.de<br />
Juli/August 2011<br />
670 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Sauberes Niederschlagswasser in Bedburg<br />
Eine ausgezeichnete Lösung dank INNOLET® von Funke<br />
Das Thema <strong>Wasser</strong> spielt in der<br />
neu eröffneten Wellness- und<br />
Saunalandschaft „monte mare“ in<br />
Bedburg eine große Rolle. Und das<br />
nicht nur im Hallenbad und in dem<br />
Saunagarten mit seinem rund<br />
2700 m 2 großen See. Besondere<br />
Beachtung wird dem nassen Element<br />
bereits auf dem Parkplatz<br />
geschenkt – und zwar ökologisch<br />
vorbildlich: Die Stadt Bedburg hat<br />
die Blandfort Tief- und Straßenbau<br />
GmbH & Co. KG damit beauftragt,<br />
die Straßenabläufe in einem<br />
2300 m 2 großen Teilbereich des<br />
insgesamt 12 000 m 2 umfassenden<br />
Stellflächenareals mit INNOLET ® von<br />
der Funke Kunststoffe GmbH auszurüsten.<br />
Das Produkt besteht aus<br />
einem Grobfilter, einem Einsatz und<br />
einer mit einem speziellen Substrat<br />
gefüllten Filterpatrone. Beim Durchfluss<br />
werden die verschmutzten<br />
Niederschlagsabflüsse von Schadstoffen<br />
gereinigt, bevor sie in einen<br />
See als Zwischenspeicher und von<br />
hier aus in den Vorfluter eingeleitet<br />
werden.<br />
Bislang war es üblich, dass Straßenabläufe<br />
zwar angespülte Grobstoffe<br />
aus dem Niederschlagswasser<br />
Die Filterpatrone wird bis zur<br />
Oberkante mit dem Substrat<br />
gefüllt.<br />
zurückhalten, die in dem <strong>Abwasser</strong><br />
vorhandenen Schadstoffe aber<br />
nicht herausfiltern. Dabei macht<br />
eine Reinigung des Regenwassers<br />
gerade auf asphaltierten Flächen<br />
mit Verkehrsbelastung Sinn: In der<br />
Regel sind Niederschlagsabflüsse<br />
nämlich nirgendwo stärker verschmutzt<br />
als auf Straßen. Die<br />
Grün de hierfür sind vielfältig: Zu<br />
den natürlichen Verunreinigungen<br />
durch Laub oder Bodeneintrag wie<br />
Sand, Schluff oder Ton kommen<br />
auf Verkehrsflächen noch Straßen-,<br />
Reifen- und Bremsabrieb, Abgase,<br />
Tropfverluste sowie Korrosionen an<br />
Pkw und Lkw hinzu, die bei Regen<br />
weggespült werden und somit in<br />
die Kanalisation gelangen.<br />
Kritisch ist dies insbesondere bei<br />
Trennsystemen, bei denen die<br />
Schadstoffe und Schwermetalle<br />
ohne eine Kläranlage zu durchlaufen<br />
direkt in die Gewässer bzw. in<br />
den Vorfluter eingeleitet werden.<br />
Ökologisch sinnvoll und<br />
wirtschaftlich<br />
So auch in Bedburg, wo die vom<br />
Parkplatz her kommenden Niederschlagsmengen,<br />
die nicht in ein<br />
Mulden-Rigolen-System entwässert<br />
werden, über Straßenabläufe in den<br />
See auf dem Gelände des Wellnessbades<br />
„monte mare“ und von<br />
diesem Zwischenspeicher dann in<br />
den Vorfluter gelangen. Planer<br />
Dipl.-Ing. Helmut Lengnick von<br />
Lengnick Consultants GmbH Ingenieurgesellschaft<br />
für Bauwesen<br />
weist in diesem Zusammenhang auf<br />
das Landeswassergesetz (LWG) von<br />
Nordrhein- Westfalen hin. § 51a (1)<br />
legt fest, dass Niederschlagswasser<br />
von Grundstücken, die nach dem<br />
1. Januar 1996 erstmals bebaut,<br />
befestigt oder an die öffentliche<br />
Kanalisation angeschlossen werden,<br />
zu versickern, zu verrieseln oder<br />
ortsnah direkt oder ohne Vermischung<br />
mit Schmutzwasser über<br />
eine Kanalisation in ein Gewässer<br />
einzuleiten ist. Mit INNOLET® bietet<br />
Funke hier eine ökologisch sinnvolle<br />
und noch dazu wirtschaftliche<br />
Lösung an, bei der das Niederschlagswasser<br />
von Schadstoffen<br />
gereinigt wird. In Kooperation mit<br />
der Unteren <strong>Wasser</strong>behörde hat die<br />
Stadt Bedburg einem Einsatz sofort<br />
zugestimmt. „Mit dem Mobau Erft<br />
Bauzentrum hatten wir auch gleich<br />
den Baustoffhändler, der die Funke-<br />
Produkte in dieser Region vertreibt“,<br />
führt Lengnick aus.“<br />
Das System, das auf der Messe<br />
DEUBAU 2010 in Essen mit dem<br />
Innovationspreis „Architektur und<br />
In Bedburg<br />
wurde das<br />
INNOLET ® -Set<br />
für<br />
quadra tische<br />
Straßenabläufe<br />
der Größe<br />
500 × 500 mm<br />
eingesetzt. Das<br />
System besteht<br />
aus einem Einsatz<br />
(hinten im<br />
Bild), einer mit<br />
einem speziellen<br />
Substrat<br />
(weißer Eimer)<br />
gefüllten Filterpatrone<br />
(li.)<br />
und einem<br />
Grobfilter (im<br />
Bild mit<br />
blauem Ring).<br />
Alle Abbildungen:<br />
Funke Kunststoffe<br />
GmbH<br />
<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 671
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Als erstes<br />
wird der<br />
INNOLET ® -<br />
Einsatz in den<br />
Straßenablauf<br />
eingesetzt …<br />
… danach<br />
kann die<br />
Filterpatrone<br />
in den Einsatz<br />
eingebracht<br />
werden.<br />
Dabei ist eine<br />
Zentrierung<br />
wichtig. <br />
Als letzter Arbeitsschritt wird der Grobfilter<br />
eingesetzt, bevor der Straßenablauf mit dem<br />
Gussrost verschlossen werden kann.<br />
Kleines System, große Wirkung: INNOLET ® filtert<br />
rund 80 % der zulaufenden Jahresmenge<br />
Regenwasser. Das überzeugt auch Helmut Lengnick,<br />
Herbert Wahner, Herbert Wimmers, Michael Schmitz,<br />
Ralf Börmann, Jürgen Schorn und Funke<br />
Anwendungstechniker Michael Hennecke (v.re.).<br />
Bauwesen“ ausgelobt wurde, reinigt<br />
die Niederschlagsabflüsse dezentral,<br />
noch bevor sie in den Regenwasserkanal<br />
gelangen. Bodenfilterbecken<br />
sind somit nicht notwendig;<br />
für den Filtervorgang wird außerdem<br />
keine zusätzliche Energie<br />
benötigt, da das Gefälle zwischen<br />
Straßenoberkante und Kanalisation<br />
genutzt wird.<br />
Einfache Funktionsweise<br />
Das INNOLET®-System besteht aus<br />
einem Einsatz, einem Grobfilter und<br />
einer mit einem speziellen Substrat<br />
gefüllten Filterpatrone. Auf diese<br />
Weise werden auch Feinstoffe aufgefangen.<br />
Planer Lengnick: „Die<br />
Funktionsweise ist denkbar einfach:<br />
Das Niederschlagswasser fließt in<br />
den mit INNOLET® ausgerüsteten<br />
Straßeneinlauf. Der Grobfilter, der<br />
zuerst durchströmt wird, hält die<br />
Grobstoffe zurück. Durch die seitlichen<br />
Öffnungen gelangt das <strong>Wasser</strong><br />
dann in die darunter liegende Filterpatrone,<br />
die mit dem Substrat<br />
gefüllt ist. Hier werden die im Oberflächenabfluss<br />
mitgeführten ge -<br />
lösten Schwermetalle sowie die<br />
organischen Substanzen wie zum<br />
Beispiel Vogelkot adsorbiert. Das auf<br />
diese Weise gereinigte <strong>Wasser</strong> kann<br />
nun in den Kanal gelangen.“ Laut<br />
Funke-Fachberater Ralf Börmann<br />
lassen sich Straßenabläufe mit mindestens<br />
70 cm Einbautiefe nach<br />
DIN 4052 einfach nachrüsten: „INNO-<br />
LET® besteht aus Edelstahl und ist in<br />
zwei Varianten erhältlich: Bei Straßenabläufen<br />
mit Gussaufsatz in der<br />
Größe 500 × 500 mm beträgt der<br />
Durchmesser 300 mm, bei Gussaufsätzen<br />
300 × 500 mm dagegen 250<br />
mm. Die Bauhöhe ist in beiden Ausführungen<br />
mit 70 cm gleich.“<br />
In Bedburg wurden auf dem<br />
2300 m 2 großen Teilbereich des<br />
Parkplatzes insgesamt 14 Straßenabläufe<br />
mit dem Funke-Produkt<br />
ausgerüstet. Straßenbaumeister<br />
Michael Schmitz vom ausführenden<br />
Unternehmen Blandfort Tief- und<br />
Straßenbau GmbH & Co. KG ist von<br />
dem einfachen Einbau überzeugt:<br />
„Nach nur wenigen Arbeitsschritten<br />
kann INNOLET® bereits in den<br />
Straßenablauf eingesetzt werden.<br />
Zunächst haben wir das Substrat bis<br />
zur Oberkante in den Ringraum der<br />
Filterpatrone eingefüllt und leicht<br />
verdichtet. Danach haben wir die<br />
Schutzkappe entfernt, die Filterpatrone<br />
mit dem Deckel verschlossen<br />
und mit der Ringmutter festgedreht.<br />
Nachdem wir den INNOLET®-<br />
Einsatz in den Straßenablauf eingesetzt<br />
und die Einbauhöhe von<br />
70 cm überprüft hatten, konnte die<br />
Filterpatrone zentriert eingesetzt<br />
werden. Danach haben wir den<br />
Grobfilter draufgesetzt. Jetzt konnten<br />
wir den Straßenablauf mit dem<br />
Gussrost verschließen.“<br />
Juli/August 2011<br />
672 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Betriebskosten sind<br />
überschaubar<br />
Seitens der Stadt Bedburg ist man<br />
mit dem Produkt zufrieden: „INNO-<br />
LET® ist eine umweltfreundliche und<br />
dabei wirtschaftliche Lösung. Entsprechend<br />
der Standortbedingungen<br />
sollte das System regel mäßig<br />
gereinigt werden. Einmal pro Jahr<br />
empfiehlt sich der Austausch des<br />
Substrates. Diese Betriebskosten<br />
und die geringen Anschaffungskosten<br />
im Vergleich zu anderen Bauten<br />
wie zum Beispiel einem Regenklärbecken<br />
sind überschaubar“, erzählt<br />
Jürgen Schorn vom Fachbereich IV<br />
Hoch- und Tiefbau der Stadt Bedburg.<br />
Und sein Kollege, Dipl.-Ing.<br />
Herbert Wahner, fügt hinzu: „Dabei<br />
ist der Nutzen für die Umwelt<br />
immens. Laut Hersteller angaben<br />
durchlaufen etwa 80 % der Jahresmenge<br />
an Regenwasser die Filterpassage<br />
der Patrone. Lediglich bei<br />
Starkregenereignissen wird das <strong>Wasser</strong><br />
über Notüberläufe abge leitet.“<br />
Der Einsatz von INNOLET® ist in<br />
Bedburg ein Pilotprojekt. Eines, das<br />
sich rechnen wird – nicht nur für die<br />
Umwelt. Denn von seiner Wirkung<br />
werden auch die Besucher des neu<br />
gebauten „monte mare“ direkt profitieren.<br />
Die Niederschlagsmengen,<br />
die vom Parkplatz in einen See auf<br />
dem Wellnessgelände eingeleitet<br />
werden, sind bereits gereinigt. Aufgrund<br />
der deutlich reduzierten<br />
Belastung mit organischen Substanzen<br />
ist deshalb unter anderem<br />
weniger Algenbefall in diesem<br />
Gewässer zu erwarten. Studien<br />
haben nämlich ergeben, dass INNO-<br />
LET® zum Beispiel Phosphat bis zu<br />
97 % zurückhalten kann.<br />
Kontakt:<br />
Funke Kunststoffe GmbH,<br />
Siegenbeckstraße 15,<br />
D-59071 Hamm-Uentrop,<br />
Tel. (02388) 3071,<br />
E-Mail: info@funkegruppe.de,<br />
www.funkegruppe.de<br />
Über diesen<br />
See auf dem<br />
Gelände des<br />
Wellnessbades<br />
werden die<br />
gereinigten<br />
Straßenabflüsse<br />
vom<br />
Parkplatz in<br />
den Vorfluter<br />
eingeleitet.
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Tiefbaulösungen maßgeschneidert<br />
Info<br />
Start-Bildschirm.<br />
Wachsende Bedürfnisse und<br />
stetig steigende Anforderungen<br />
machen den Einsatz flexibler<br />
Software unabdingbar.<br />
Viele Ingenieurbüros und Kommunen<br />
haben ihre <strong>Abwasser</strong>netze<br />
aufwendig digitalisiert, viel Arbeit,<br />
Zeit und Geld darin investiert. Wenn<br />
es darum geht diese Daten für<br />
Die Firma aRES Datensysteme mit ihrer über<br />
20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von<br />
Software im Bereich Kanalplanung und<br />
-Ve r waltung, hat sich dieser Herausforderung<br />
angenommen. Sie kann nun auch den Bedürfnissen<br />
derjenigen Anwender gerecht werden, welche<br />
gezielt für einzelne Aufgabenstellungen Software<br />
benötigen, ohne dabei gleich auf ein komplett<br />
neues System umsteigen zu wollen.<br />
Die cseDB bietet eine Plattform für den Einsatz<br />
professioneller Einzellösungen wie z. B.<br />
Kanalkataster<br />
Wertermittlung<br />
Sanierungskalkulation und -planung<br />
Konvertierung von ISYBAU nach<br />
ISYBAU-XML Daten und umgekehrt<br />
andere Anwendungsbereiche und<br />
Aufgaben heranzuziehen, bieten<br />
die verwendeten Systeme häufig<br />
keine oder nicht ausreichend Möglichkeiten.<br />
Oft sind bisher verwendete GIS<br />
oder KIS Anwendungen nicht in der<br />
Lage, mit den Daten der Kanalnetze<br />
gleich eine Wertermittlung oder<br />
Sanierungskalkulation mit anschließender<br />
Sanierungsplanung durchzuführen.<br />
Ein Umstieg auf ein komplett<br />
neues GIS oder KIS ist jetzt nicht<br />
mehr notwendig. Dank der aRES<br />
Datensysteme können ganze Netze<br />
mit entsprechenden Kanal informationen<br />
nun in einem ei nzigen<br />
Projekt gesammelt und ausgewertet<br />
werden.<br />
In Form einer Wertermittlung<br />
können Wiederbeschaffungszeitwerte,<br />
Herstellwerte und Abschreibungsdaten<br />
mit Hilfe eines Mengenschätzverfahrens,<br />
auf Grundlage<br />
der DWA-A 133 (Wertermittlung<br />
von <strong>Abwasser</strong>anlagen – Systematische<br />
Erfassung, Bewertung und<br />
Fortschreibung) von Schächten und<br />
Haltungen berechnet werden.<br />
Umgekehrt können aber auch<br />
aus vorhandenen Herstellwerten<br />
die Wiederbeschaffungskosten<br />
und entsprechenden Abschreibungswerte<br />
ermittelt werden. Die<br />
komplette Durchführung dieser<br />
Wertermittlung erfolgt dabei auf<br />
Grundlage von Preisindex- und<br />
Preistabellen für die einzelnen<br />
Komponenten.<br />
Für die Planung von Sanierungsmaßnahmen<br />
für die Kanalnetze ist<br />
eine vorherige Sanierungskalkulation<br />
unumgänglich. Auf Basis der<br />
Kosten von Sanierungsverfahren zu<br />
Schäden der Netzelemente wird<br />
eine Kalkulation durchgeführt,<br />
deren wesentliches Ziel darin<br />
be steht, einen direkten Vergleich<br />
zwischen den Sanierungsverfahren<br />
Reparatur, Renovierung und Er -<br />
neue rung zu ermöglichen. Ebenso<br />
werden in der Kalkulation Baunebenkosten,<br />
z. B. auf Grundlage<br />
von Aushubberechnungen, berücksichtigt.<br />
Aufgrund dieser Auswertung<br />
können immense Kosten<br />
gespart werden, da für jede Sanierungsmaßnahme<br />
und Einzelsanierung<br />
das ökonomischste Verfahren<br />
gewählt wird. Auch werden Rand-<br />
Die Software cseDB bietet für die<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>beseitigung<br />
Lösungen nach Maß.<br />
Juli/August 2011<br />
674 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
bedingungen in die Kalkulation mit<br />
einbezogen.<br />
Aktuell gibt es auf dem Markt<br />
keine vergleichbare Softwarelösung,<br />
welche dem Anwender so viele<br />
Möglichkeiten und Einsatz gebiete<br />
eröffnet:<br />
Umsetzung der im deutschsprachigen<br />
Raum zu verwendenden<br />
Berechnungsfunktionen nach<br />
den geltenden Regelwerken.<br />
Datenaustausch mit anderen<br />
Systemen aufgrund einer Vielzahl<br />
von Schnittstellen, eine der<br />
wichtigsten und meist verbreiteten<br />
ist die ISYBAU-Schnittstelle<br />
zum Austausch von Kanalstammdaten,<br />
Zustandsdaten uvm. über<br />
eine Vielzahl von Formatstandards.<br />
Für Interessenten wird eine kostenfreie<br />
Demoversion der cseDB<br />
auf www.demo.cseTools.de bereitgestellt.<br />
Bei Bedarf kann auch eine<br />
funktionell uneingeschränkte Testversion<br />
angefordert werden. Für<br />
weitere Fragen hierzu können<br />
Anwender unter der Telefonnummer<br />
(0345) 122 777 9-0 Kontakt<br />
aufnehmen.<br />
Kontakt:<br />
aRES Datensysteme,<br />
Talstraße 10, D-06128 Halle (Saale),<br />
Tel. (0345) 122 777 9-3,<br />
E-Mail: info@aresdata.de,<br />
www.aresData.de<br />
UMWELTSCHONEND!<br />
Duktile Gussrohrsysteme für die grabenlose Verlegung.<br />
• Höchste Zugkräfte<br />
• Schnelle und einfache Montage<br />
• Radien ab 70 m<br />
Informieren Sie sich im Internet unter www.duktus.com<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 675
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Baugrundkolloquium: Fachgerechte Erkundung<br />
vermeidet unnötige Baufolgekosten<br />
Aufschlussbohrung<br />
für eine<br />
Baugrunduntersuchung.<br />
Im Rahmen der 62. Deutschen<br />
Brunnenbauertage fand vom 13.<br />
bis 15. April in Bad Zwischenahn ein<br />
BAW-Kolloquium zum Thema „Baugrundaufschlüsse<br />
– Planung, Ausschreibung,<br />
Durchführung, Überwachung<br />
und Interpretation“ statt.<br />
Die dreitägige Veranstaltung führte<br />
mehr als 550 Fachleute aus Verwaltung,<br />
Unternehmen und Ingenieurbüros<br />
aus ganz Deutschland und<br />
dem europäischen Ausland zusammen.<br />
Ein Fazit der Veranstaltung<br />
lautet: Nur auf der Grundlage einer<br />
genauen Kenntnis des Baugrundes<br />
lassen sich die Gesamtkosten eines<br />
Bauwerks exakt kalkulieren.<br />
Auftakt der von der Bundesfachgruppe<br />
Brunnenbau, Spezialtiefbau<br />
und Geotechnik im Zentralverband<br />
des Deutschen Baugewerbes (ZDB),<br />
dem Bildungs- und Tagungszentrum<br />
Bau-ABC Rostrup und der Bundesanstalt<br />
für <strong>Wasser</strong>bau (BAW)<br />
organisierten Fachveranstaltung war<br />
im Rahmen des BAW-Kolloquiums<br />
die Vortragsreihe zum Thema „Baugrundaufschlüsse“.<br />
Im Unterschied<br />
zu den Baustoffen, deren Qualität in<br />
den Herstellungsprozessen beeinflusst<br />
werden kann, muss ein Baugrund<br />
so genommen werden, wie<br />
er ist. Er lässt sich im Prinzip zwar<br />
behandeln und somit verbessern,<br />
aber dafür muss man ihn zunächst<br />
einmal genau kennen. „Das ist<br />
eigentlich eine Binsenweisheit“,<br />
sagt Dr.-Ing. Michael Heibaum,<br />
Abteilungsleiter Geotechnik der<br />
Bundesanstalt für <strong>Wasser</strong>bau, Karlsruhe,<br />
„aber trotz dieser trivialen<br />
Erkenntnis wurde und wird bei den<br />
Bauvorhaben leider oft an dieser<br />
Stelle gespart.“<br />
Hochwertige<br />
Baugrunderkundung<br />
hat oberste Priorität<br />
Dabei haben die Kosten für eine<br />
umfassende Baugrunderkundung<br />
meist nur einen geringen Anteil an<br />
der gesamten Bausumme. „Die<br />
immer wieder zu beobachtenden<br />
Versäumnisse an diesem alles<br />
entscheidenden Ausgangspunkt<br />
müssen dann später häufig durch<br />
aufwendige Korrekturmaßnahmen<br />
behoben werden“, sagt Michael<br />
Heibaum. Schließlich verschwinden<br />
diese Korrekturkosten in der<br />
Gesamtrechnung „und werden gar<br />
nicht mehr als das wahrgenommen,<br />
was sie sind – nämlich unnötig.“<br />
Kurzum: „Ein geringer Mehraufwand<br />
bei der Baugrunderkundung<br />
kann erheblich höhere Zusatzkosten<br />
vermeiden.“<br />
Eine umfassende, qualitativ hochwertige<br />
Baugrunderkundung sollte<br />
also oberste Priorität vor Beginn<br />
einer jeden Baumaßnahme genießen.<br />
Die Randbedingungen dafür<br />
sind sogar hervorragend. Heibaum:<br />
„Die Gerätetechnik hat sich stetig<br />
weiterentwickelt und, wie auf den<br />
62. Deutschen Brunnenbauertagen<br />
deutlich wurde, stellt zum Beispiel<br />
auch die Ausbildung des Brunnenbauers<br />
sicher, dass qualifiziertes<br />
Personal vorhanden ist, um die vorhandenen<br />
Techniken auch optimal<br />
zu nutzen und einzusetzen.“ Der<br />
heutige Standard der klassischen<br />
Baugrunduntersuchung umfasst im<br />
Wesentlichen direkte Aufschlüsse<br />
durch Bohrungen sowie indirekte<br />
Aufschlüsse durch Sondierungen.<br />
Zudem besteht die Möglichkeit,<br />
geophysikalische Verfahren zur<br />
linien haften oder flächendeckenden<br />
Erkundung des Untergrundes<br />
zu nutzen. Viele Verfahren wie beispielsweise<br />
Georadar (Mehrfrequenzsysteme,<br />
Arraytechnik), Geoelektrik<br />
(Tomografie) oder die Seismik<br />
konnten in den letzten Jahren<br />
erheblich verbessert werden.<br />
Auf die Erkundung vor Ort<br />
folgt die Analyse im Labor<br />
In Bad Zwischenahn standen neben<br />
den planungs- und ausführungstechnischen<br />
Aspekten der Erkundungsarbeiten<br />
in Boden und Fels<br />
auch die daran anschließenden<br />
Arbeiten im Zentrum der BAW-Fachdiskussion.<br />
So befassten sich die<br />
Teilnehmer etwa mit dem Ausbau<br />
der Erkundungsbohrungen mit<br />
Messeinrichtungen, dem sicheren<br />
Transport von Bodenproben ins<br />
geotechnische Labor, den dort<br />
anzuwendenden Prüfverfahren und<br />
Juli/August 2011<br />
676 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
schließlich mit der Interpretation<br />
der geotechnischen Relevanz des<br />
Gefundenen. In einer begleitenden<br />
Fachausstellung präsentierten 97<br />
Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen<br />
auf den Gebieten der<br />
Baugrunderkundung, Bohrtechnik,<br />
Brunnenbau und Geothermie und<br />
konnten ihre Fachkompetenz auch<br />
in Praxisdemonstrationen auf dem<br />
großzügigen Freigelände der Bau-<br />
ABC-Rostrup demonstrieren.<br />
Das BAW-Kolloquium hat bestätigt,<br />
dass die Aussagekraft eines<br />
Baugrundgutachtens letztlich von<br />
qualitativ hochwertigen Bodenproben<br />
und deren fachgerechter<br />
Analyse im Labor abhängig ist: „Nur<br />
auf dieser Grundlage lassen sich die<br />
Baugrundverhältnisse zutreffend<br />
beschreiben und beurteilen“, fasst<br />
Michael Heibaum zusammen. „Die<br />
Teilnehmer konnten einerseits ihr<br />
Bewusstsein dafür schärfen, welche<br />
Auswirkungen die Probennahme<br />
und deren weitere Verarbeitung<br />
haben, um die aus dieser Untersuchungskette<br />
gewonnenen Erkenntnisse<br />
richtig zu bewerten und somit<br />
das Baugrundrisiko für die Bauausführung<br />
zu minimieren; zudem<br />
konnten sie ihre Kenntnisse über<br />
die zur Anwendung kommenden<br />
Modelle und die Möglichkeiten und<br />
Grenzen der Versuchstechnik er -<br />
weitern.“<br />
Der Tagungsband: „62. Deutsche<br />
Brunnenbauertage/BAW-Baugrund-<br />
Kolloquium Baugrundaufschlüsse:<br />
Planung, Ausschreibung, Durchführung,<br />
Überwachung und Interpretation“<br />
ist als PDF-Publikation verfügbar<br />
und kann unter der Adresse<br />
http://www.baw.de/de/die_baw/<br />
publikationen/kolloquien/index.<br />
php.html heruntergeladen werden.<br />
Die BAW als technisch-wissenschaftliche<br />
Bundesoberbehörde im<br />
Geschäftsbereich des Bundesministeriums<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
berät und unterstützt<br />
die Dienststellen der <strong>Wasser</strong>- und<br />
Schifffahrtsverwaltung auf dem<br />
Gebiet des Verkehrswasserbaus. Sie<br />
trägt wesentlich dazu bei, dass die<br />
<strong>Wasser</strong>straßen in Deutschland den<br />
wachsenden technischen, wirtschaftlichen<br />
und ökologischen<br />
Anfor derungen gerecht werden. Mit<br />
ihrer umfassenden Expertise ist die<br />
BAW eine national und international<br />
anerkannte Institution und maßgeblich<br />
an der Weiterentwicklung<br />
des Verkehrswasserbaus beteiligt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.baw.de<br />
Weitere Informationen<br />
und Anmeldung unter:<br />
www.muenchner-runde.de<br />
9. Münchner Runde 2011<br />
Expertenforum für Kanalsanierung<br />
Am 06.10.2011 im<br />
Bürgerhaus Garching<br />
Durch Fachwissen<br />
Vertrauen gewinnen<br />
Vorträge - Diskussion - Ausstellung<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 677
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Fachkundelehrgang<br />
Grundstücksentwässerung (ZFKD-GE)<br />
Überbetriebliche Weiterbildung bei der SAG-Akademie geht in die 2. Runde<br />
Einzelmodule<br />
Der erste Fachkundelehrgang<br />
Grundstücksentwässerung<br />
(ZFKD-GE) geht in die entscheidende<br />
Phase …<br />
Der in Kooperation mit dem<br />
Güteschutz Kanalbau e.V. seit<br />
Januar 2011 erstmalig durchgeführte<br />
Fachkundelehrgang ZFKD-<br />
GE „Zertifizierter Fachkundiger für<br />
Kanaldienstleistungen – Fachrichtung<br />
Grundstücksentwässerung“<br />
wurde mit dem Abschlusslehrgang<br />
am 20./21. Juni 2011 beendet.<br />
Die „Zweite Runde“ startete<br />
bereits am 29. Juni 2011 in Lünen.<br />
Nach dem bewährten modularen<br />
Konzept können Teilnehmer<br />
innerhalb von zwei Jahren vor Prüfungsdatum<br />
des Abschlusslehrgangs<br />
die notwendigen Einzelmodule,<br />
individuell angepasst auf<br />
die Anforderungen der Bundesländer,<br />
absolvieren. Bereits erfolgreich<br />
absolvierte Lehrgänge der SAG-<br />
Akademie oder gleichwertige Lehrgänge<br />
anderer Bildungsträger werden<br />
hierbei anerkannt.<br />
Die Gesamtkosten des 17-tägigen<br />
Regel-Lehrgangs belaufen sich<br />
bei Anmeldung zum Gesamtlehrgang<br />
auf 3300,00 € zzgl. MwSt.<br />
Bei Anmeldung jedes weiteren Teilnehmers<br />
eines Unternehmes zum<br />
Gesamtlehrgang wird eine weitere<br />
Ermäßigung von 200,00 € gewährt.<br />
Die nächsten Termine zum<br />
Abschlusslehrgang ZFKD-GE finden<br />
am 28./29. November in Lünen<br />
(NRW) sowie am 12./13. Dezember<br />
2011 in Darmstadt (Hessen) statt.<br />
Lünen<br />
Inspektion von Grundstücksentwässerungsanlagen (KI-G-GEA) 23.11. bis 25.11.2011<br />
Image-Marketing – Umgang mit dem Kunden (IM-G) 29./30.09.2011<br />
Sicherheitsunterweisung mit Ersthelferlehrgang (UVV-EH) 26./27.09.2011<br />
17./18.11.2011<br />
Grundlagen Kanalsanierung und Zustandsbewertung (KS-G) 12./13.09.2011<br />
Grundlagen Kanalsanierung und Zustandsbeurteilung (KS-ZB) 12. bis 14.09.2011<br />
Reinigung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KR-AK2) 15./16.09.2011<br />
Physikalische Dichtheitsprüfung (DI-SK) 04. bis 06.10.2011<br />
Grundlagen Kanalbau GEA (KB-GEA) 14.11.2011<br />
Darmstadt<br />
Inspektion von Grundstücksentwässerungsanlagen (KI-G-GEA) 17. bis 19.08.2011<br />
Reinigung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KR-AK2) 22./23.08.2011<br />
17./18.11.2011<br />
Sicherheitsunterweisung mit Ersthelferlehrgang (UVV-EH) 29./30.08.2011<br />
27./28.10.2011<br />
Physikalische Dichtheitsprüfung (DI-SK) 05. bis 07.09.2011<br />
05. bis 07.12.2011<br />
Grundlagen Kanalbau GEA (KB-GEA) 12.09.2011<br />
09.12.2011<br />
Grundlagen Kanalsanierung und Zustandsbeurteilung (KS-ZB) 14. bis 16.11.2011<br />
Image-Marketing – Umgang mit dem Kunden (IM-G) 01./02.12.2011<br />
Bis dahin können die Einzel module<br />
(siehe Infokasten) belegt werden.<br />
Der Fachkundelehrgang ZFKD-<br />
GE vermittelt umfassend die notwendigen<br />
theoretischen und handwerklichen<br />
Kenntnisse für ausführendes<br />
Personal zur fachgerechten<br />
Durchführung der Arbeiten rund<br />
um die Inspektion bzw. physikalischen<br />
Dichtheitsprüfung an privaten<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
(GEA) im Hinblick auf Landeswassergesetze,<br />
die Eigenkontroll<br />
verordnungen der Länder und<br />
die DIN 1986, Teil 30.<br />
Ihre Vorteile:<br />
Der Lehrgang erfüllt die Anforderungen<br />
an die Sach- und Fachkunde<br />
der Güte- und Prüfbestimmungen<br />
der RAL-Gütesicherung,<br />
RAL-961, Güteschutz<br />
Kanalbau e.V. – RAL-Gütezeichen.<br />
Ebenso erfüllt der Lehrgang die<br />
Anforderungen des § 61a LWG<br />
NRW in besonderem Maße und<br />
ist ebenso Grundlage zur Aufnahme<br />
in die Landesliste NRW<br />
(bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen<br />
des Runderlasses).<br />
Der Lehrgang erfüllt die Anforderungen<br />
der Eigenkontrollverordnung<br />
des Landes Hessen<br />
(EKVO).<br />
Der Teilnehmer erhält für jedes<br />
erfolgreich absolvierte Einzelmodul<br />
zusätzlich ein entsprechendes<br />
Zertifikat.<br />
Kontakt:<br />
SAG-Akademie GmbH für<br />
berufliche Weiterbildung,<br />
Otto-Hesse-Straße 19/T9, D-64293 Darmstadt,<br />
Tel. (06151) 101 55-0, Fax (06151) 101 55-155<br />
Schulungszentrum Lünen,<br />
Pierbusch 4, D-44536 Lünen,<br />
Tel. (0231) 225 11-11, Fax (0231) 225 11-25,<br />
E-Mail: info@SAG-Akademie.de,<br />
www.SAG-Akademie.de<br />
Juli/August 2011<br />
678 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
Zertifizierung nach GN 3<br />
Güteschutz Kanalbau und DVGW CERT arbeiten Hand in Hand<br />
Im Rahmen der <strong>Wasser</strong> Berlin International<br />
2011 hat die Thomsen<br />
GmbH Tiefbauunternehmen, Osterrönfeld,<br />
die Zertifizierungsurkunde<br />
der Gruppe GN 3 – Berstliningverfahren<br />
– der DVGW CERT GmbH<br />
erhalten. Die Prüfung im Rahmen<br />
der beantragten DVGW-Zertifizierung<br />
wurde hierbei erstmals von<br />
einem beauftragten Prüfingenieur<br />
der Gütesicherung Kanalbau RAL-<br />
GZ 961 durchgeführt. Diese Vorgehensweise<br />
ist das Ergebnis einer<br />
Kooperationsvereinbarung, welche<br />
die Gütegemeinschaft Herstellung<br />
und Instandhaltung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen e.V. (Güteschutz<br />
Kanalbau) und die DVGW<br />
CERT GmbH im vergangenen Jahr<br />
in einer gemeinsamen Presseerklärung<br />
bekannt gegeben haben.<br />
Unter dem Motto „Gemeinsam<br />
für Qualität“ bieten die beiden<br />
Organisationen ein abgestimmtes<br />
Verfahren zur Qualifikationsprüfung<br />
von Kanal- und Rohrleitungsbauunternehmen<br />
an. Vorrangiges Ziel:<br />
Durch die Abstimmung von Prüfabläufen<br />
und den Abgleich von<br />
Prüfkatalogen sollen Vereinfachungen<br />
für Unternehmen realisiert<br />
werden, die sowohl in der Sparte<br />
<strong>Abwasser</strong> als auch in der Sparte<br />
Gas/<strong>Wasser</strong> tätig sind, und die die<br />
etablierten Qualifikationsnachweise<br />
führen oder anstreben. Dabei stellt<br />
die Kooperation die Beibehaltung<br />
eines bewährten und mit den Auftraggebern<br />
abgestimmten Anforderungsniveaus<br />
für den jeweiligen<br />
Nachweis sicher. Zudem profitieren<br />
Auftraggeber und qualifizierte<br />
Unternehmen in den jeweiligen<br />
Sparten von der hohen fachlichen<br />
Kompetenz der Prüforganisationen<br />
und beauftragten Prüfer.<br />
Als Pilotprojekt hatten Güteschutz<br />
Kanalbau und DVGW CERT<br />
eine Abstimmung der Prüfverfahren<br />
bei den grabenlosen Techniken<br />
vereinbart. „Zementmörtelauskleidung,<br />
Langrohr- und Gewebeschlauchrelining<br />
sowie Berstlining<br />
werden auf der Versorgungs- wie<br />
auf der <strong>Abwasser</strong>seite angewendet“<br />
erläutert der Geschäftsführer der<br />
Gütegemeinschaft Kanalbau, Dr.-<br />
Ing. Marco Künster. „Hinzu kommt,<br />
dass das Regelwerk und die Arbeitstechniken<br />
im hohen Maße<br />
deckungsgleich sind, deshalb sind<br />
hier Synergieeffekte realisierbar.“<br />
Gemeinschaftliche<br />
Prüfungen<br />
Das Konzept zur Optimierung be -<br />
inhaltet dementsprechend gemeinschaftliche<br />
Qualitätsprüfungen durch<br />
die Prüfingenieure der Gütesicherung<br />
RAL-GZ 961 und Experten der<br />
DVGW CERT. Die Prüfergebnisse<br />
werden von beiden Organisationen<br />
übernommen und für das jeweilige<br />
Verfahren genutzt. „Hierdurch wird<br />
der Aufwand auf Seiten der Unternehmen<br />
spürbar reduziert“, so<br />
Künster weiter.<br />
Ein Potenzial, dass Dipl.-Ing.<br />
Willi Thomsen, Geschäftsführer der<br />
Thomsen GmbH Tiefbauunternehmen,<br />
nach Bekanntwerden der<br />
Kooperationsvereinbarung „unbedingt<br />
heben wollte“. Traditionell<br />
steht die Einhaltung von hohen<br />
Qualitätsstandards im Unternehmen<br />
und bei der Ausführung der<br />
Baumaßnahmen im Fokus. „Fachkundige<br />
und qualifizierte Mitarbeiter,<br />
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit<br />
sind die Grundbausteine<br />
unserer Geschäftsphilosophie“, er -<br />
klärt Willi Thomsen. Der Einsatz von<br />
erfahrenen, qualifizierten Mitarbeitern,<br />
eine kontinuierliche Weiterbildung<br />
und der Einsatz von modernsten<br />
technischen Geräten tragen<br />
entscheidend zum Gelingen einer<br />
Baumaßnahme bei“, so Thomsen<br />
weiter, der in diesem Zusammenhang<br />
darauf hinweist, dass sein<br />
Unternehmen bereits im Mai 1996<br />
das RAL-Gütezeichen für Kabelleitungstiefbau<br />
erhalten hat, mit dem<br />
ebenso wie mit dem später erworbenen<br />
RAL-Gütezeichen Kanalbau<br />
und der DVGW-Zulassung die Leistungsfähigkeit<br />
des Unternehmens<br />
dokumentiert wird.<br />
Allerdings dürfe bei aller Wichtigkeit<br />
nicht übersehen werden,<br />
dass die Erlangung der Zertifizierungen<br />
auch ein personelles und<br />
finanzielles Engagement nach sich<br />
zöge – sieht sich Thomsen im Schulterschluss<br />
mit vielen Unternehmerkollegen.<br />
Zudem befänden sich<br />
Kanal- und Rohrleitungsbaufirmen<br />
Auf der <strong>Wasser</strong><br />
Berlin wurde<br />
das erste von<br />
Güteschutz<br />
Kanalbau und<br />
DVGW CERT<br />
gemeinsam<br />
erarbeitete<br />
Zertifikat<br />
an ein<br />
Unternehmen<br />
überreicht.<br />
<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 679
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
An der Verleihung der Urkunde nahmen teil: Dr.-Ing.<br />
Marco Künster, Geschäftsführer Güteschutz Kanalbau,<br />
Dipl.-Ing. Bernd Ihlo, Abteilung Rohrleitungsbau<br />
und Geschäftsführer Dipl.-Ing. Willi Thomsen,<br />
Thomsen GmbH Tiefbauunternehmen, Dipl.-Phys.<br />
Theo B. Jannemann, Geschäftsführer DVGW CERT<br />
und rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter<br />
Hesselmann (v.li.).<br />
in einem scharfen Wettbewerb und<br />
seien bestrebt, wirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten<br />
zu nutzen.<br />
Das gemeinsame Konzept von<br />
Güteschutz Kanalbau und DVGW<br />
CERT sei deshalb ein hervorragender<br />
Ansatz, den Zertifizierungsaufwand<br />
zu optimieren. Im Ideal -<br />
fall sollen durch Abstimmung der<br />
Prüfabläufe und Abgleich der Prüfkataloge<br />
Doppelerhebungen vermieden<br />
und eine Reduzierung der<br />
zeitlichen Belastungen bei den Firmen<br />
erreicht werden, die ihre Qualifikation<br />
in der jeweiligen Sparte<br />
durch den Güteschutz Kanalbau<br />
und DVGW CERT GmbH bestätigen<br />
lassen.<br />
Anforderungen<br />
überschneiden sich<br />
Als Inhaber eines RAL-Gütezeichens<br />
für Berstliningverfahren (S 51.01)<br />
erwartete Thomsen eine Vereinfachung<br />
bei der Erlangung der<br />
entsprechenden Zertifizierung GN 3<br />
der DVGW CERT. „Zumal Regelwerk<br />
und die Arbeitstechniken im Ab -<br />
wasserbereich in hohem Maße<br />
deckungsgleich mit denen im Gas-<br />
<strong>Wasser</strong>-Bereich sind“, wie Dipl.-Ing.<br />
Dirk Stoffers, ein vom Güteausschuss<br />
der RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
beauftragter Prüfingenieur<br />
bestätigt. So finden sich in den<br />
Güte- und Prüfbestimmungen RAL-<br />
GZ 961 detaillierte Anforderungen<br />
an die Fachkunde, die technische<br />
Leistungsfähigkeit und technische<br />
Zuverlässigkeit der Bieter sowie die<br />
Dokumentation der Eigenüberwachung.<br />
Im Einzelnen betrifft<br />
dies Anforderungen an Personal,<br />
Betriebseinrichtungen und Geräte,<br />
Nachunternehmer und Eigenüberwachung,<br />
deren Erfüllung die Bieter<br />
mit Angebotsabgabe nachweisen<br />
müssen. Sichergestellt wird die<br />
Bestätigung der Qualifikation der<br />
Firmen unter anderem durch die<br />
kontinuierliche Beratung und Überprüfung<br />
durch die vom Güteausschuss<br />
beauftragten Prüfingenieure.<br />
So werden bei Firmen- und Baustellenbesuchen<br />
die Erfahrung und<br />
Zuverlässigkeit sowie die Ausstattung<br />
der Unternehmen in Bezug auf<br />
Personal und Betriebseinrichtungen<br />
und Geräte bewertet. Besondere<br />
Erfahrung des Unter nehmens und<br />
des eingesetzten Personals belegen<br />
Nachweise über entsprechende<br />
Tätigkeiten, Zuverlässigkeit wird<br />
durch Vorlage eines Organisationsmanagements<br />
dokumentiert und in<br />
unangemeldeten Baustellenbesuchen<br />
bestätigt. Hin zu kommen aussagekräftige<br />
Referenzen wie zum<br />
Beispiel Abnahmeprotokolle. Bei<br />
der Überprüfung der Ausstattung<br />
des Unternehmens geht es insbesondere<br />
um das Personal.<br />
Beurteilungsgruppe S<br />
Zu den Anforderungen der Beurteilungsgruppe<br />
S zählt ein Verantwortlicher<br />
mit erfolgreicher praktischer<br />
fünfjähriger Tätigkeit im Kanal- oder<br />
Rohrleitungsbau sowie mit Fachwissen<br />
über das jeweils anzuwendende<br />
Spezialverfahren, Fachpersonal in<br />
angemessener Zahl entsprechend<br />
dem jeweiligen Auftragsumfang,<br />
mindestens ein Vorarbeiter mit dreijähriger<br />
praktischer Erfahrung sowie<br />
ein ausgebildeter Spezialist je Bauvorhaben<br />
für das jeweils angewendete<br />
Verfahren mit personengebundenen<br />
Referenzen. Zudem ist die<br />
Schulung durch überbetriebliche<br />
Fortbildungsmaßnahmen nachzuweisen.<br />
In Bezug auf Betriebseinrichtungen<br />
und Geräte müssen alle<br />
für die Durchführung der jeweiligen<br />
Arbeiten erforderlichen Betriebseinrichtungen<br />
vorhanden sein. Geräte<br />
müssen in ausreichender Menge<br />
und funktionstüchtigem Zustand auf<br />
der Baustelle bereitgestellt werden.<br />
Ein so genannter Leitfaden gibt<br />
den Umfang der Eigenüberwachung<br />
vor. Im Rahmen der Eigenüberwachung<br />
sind die maßgeblichen<br />
Parameter zu überprüfen und deren<br />
Einhaltung zu dokumentieren. Gütezeicheninhaber<br />
der Beurteilungsgruppe<br />
„Sanierung“ verfügen über<br />
ein Handbuch für das jeweilige Verfahren,<br />
in dem Anforderungen an<br />
Material, Verfahren, Ausführung und<br />
Eigenüberwachung definiert sind.<br />
Hiermit steht ebenfalls ein wichtiges<br />
Instrument zur Verfügung, welches<br />
Aussagen über Qualifikation und<br />
Zuverlässigkeit eines Unternehmens<br />
ermöglicht.<br />
Zertifizierung nach GN 3<br />
Anforderungen in Bezug auf die<br />
Anwendung des Berstliningverfahrens<br />
werden im <strong>Abwasser</strong>bereich<br />
durch die Gütesicherung Kanalbau,<br />
Beurteilungsgruppe S51.01 und im<br />
Bereich der Versorgung durch die<br />
DVGW-Zertifizierung nach GN 3<br />
definiert. Die Anforderungen bei<br />
der Beantragung von entsprechenden<br />
DVGW-Zertifizierungen überschneiden<br />
sich mit den Anforderungen<br />
der Gütesicherung Kanalbau.<br />
„Firmen, die in der Gas/<br />
<strong>Wasser</strong>-Sparte tätig sind, weisen<br />
ihre Kompetenz, Leistungsfähigkeit<br />
und Zuverlässigkeit anhand von<br />
Zertifizierungen nach den DVGW-<br />
Arbeitsblättern GW 301 und GW<br />
302 nach“, so Stoffers weiter, der zu<br />
Beginn dieses Jahres von der DVGW<br />
CERT in die Prüfung des Antrages<br />
der Thomsen GmbH einbezogen<br />
wurde. Unternehmen, die nach<br />
GN 3 zerti fiziert werden wollen,<br />
haben der DVGW CERT GmbH eine<br />
einschlägige Dokumentation zu<br />
überlassen, die die Qualitätssicherung<br />
bei Er neuerungsverfahren<br />
Juli/August 2011<br />
680 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
gemäß GW 323 exemplarisch darstellt.<br />
Es muss bereits in der Antragsvorprüfungsphase<br />
sichergestellt<br />
werden, dass im Unternehmen<br />
geregelte Abläufe schriftlich festgelegt<br />
wurden und anhand der Dokumentation<br />
jederzeit nachvollziehbar<br />
sind. Sind diese Rahmenbedingungen<br />
nicht erfüllt, wird die<br />
Überprüfung vor Ort nicht veranlasst.<br />
Die inhaltliche Bewertung der<br />
Qualitätssicherungsmaßnahmen<br />
kann nur im Unternehmen selbst<br />
erfolgen. Sie legen den DVGW-<br />
Experten deren Eignung, Vollständigkeit<br />
und Umsetzung der Regelungen<br />
dar.<br />
Die große Schnittmenge in<br />
bestimmten Ausführungsbereichen<br />
haben beide Organisationen veranlasst,<br />
ein optimiertes Angebot zu<br />
erarbeiten. Der Kunde hat nun die<br />
Möglichkeit, ein gemeinsames<br />
Antragsverfahren zu durchlaufen.<br />
Dies vereinfacht die Zusammenstellung<br />
der Unterlagen und erlaubt<br />
eine zeitliche Abstimmung der<br />
Überprüfungen durch die Experten<br />
bzw. Prüfingenieure. Der interne<br />
Aufwand für die Vorbereitung auf<br />
die Prüfung und den Zeitbedarf für<br />
deren Durchführung kann minimiert<br />
werden. Das Angebot eines<br />
gemeinsamen Prüfungstermins soll<br />
dem Rechnung tragen. Zwar werden<br />
die Prüfungen weiterhin spartenspezifisch<br />
durchgeführt, doch<br />
sollen Störungen im Tagesgeschäft<br />
und Zeitverlust reduziert werden.<br />
Die allgemeinen Teile wie Einführungsgespräch,<br />
Vorstellung und<br />
Organisation des Unternehmens,<br />
Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit<br />
und Tiefbaukompetenz<br />
können beispielsweise zusammengefasst<br />
werden.<br />
Nach der Verleihung des ersten<br />
Zertifikates ziehen die Beteiligten<br />
ein positives Fazit. Manche Abläufe<br />
wurden spürbar vereinfacht. Deutlich<br />
wurde allerdings auch, dass<br />
noch weitere Potenziale erschlossen<br />
werden können. Auf die Hebung<br />
dieser Potenziale ist die Arbeit der<br />
beteiligten Organisationen ausgerichtet.<br />
Rohrleitungsbauverband<br />
(rbv) sowie Rohrleitungssanierungsverband<br />
(RSV) unterstützen die<br />
Prüf organisationen bei der Erarbeitung<br />
diesbezüglicher Grundlagen.<br />
Kontakt:<br />
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau,<br />
Postfach 1369,<br />
D-53583 Bad Honnef,<br />
Tel. (02224) 9384-0,<br />
Fax (02224) 9384-84,<br />
E-Mail: info@kanalbau.com,<br />
www.kanalbau.com<br />
Hochwasserschutz braucht das Wissen der Welt.<br />
Hier fließt es zusammen:<br />
11.–13. Oktober 2011<br />
CCH – Congress Center Hamburg<br />
www.acqua-alta.de<br />
Fachmesse mit intern. Kongress für Klimafolgen,<br />
Hochwasserschutz und <strong>Wasser</strong>bau<br />
11. – 13. Oktober 2011 · www.acqua-alta.de
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Systemkompetenz am SKZ<br />
für die Kunststoffrohr-Industrie<br />
Erfahrung und Know-how aus 50 Jahren<br />
Das SKZ feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Mit dem Thema Kunststoffrohrsysteme beschäftigt<br />
sich das SKZ seit seiner Gründung im Jahre 1961. Bis heute konnte am SKZ über alle Geschäftsbereiche<br />
hinweg eine umfassende Systemkompetenz in diesem Geschäftsfeld aufgebaut werden.<br />
Ob Produktprüfung mit Qualitätsnachweis<br />
oder Analysen<br />
und Gutachten nach Schadensfällen,<br />
ob anwendungsorientierte Forschung,<br />
ob Zertifizierung von Rohrprodukten<br />
oder Managementsystemen,<br />
ob Lehrgänge, Seminare und<br />
Fachtagungen – das SKZ prüft,<br />
überwacht, zertifiziert und forscht<br />
an Kunststoffrohren, Formteilen<br />
und Verbindern für unterschiedlichste<br />
Anwendungen, das SKZ bildet<br />
aus nach DVGW-, DVS- und<br />
AGFW-Richtlinien – kurzum, hier<br />
gibt es echten Rundum-Service für<br />
die Kunststoffrohr-Industrie.<br />
Prüfstand zu Unter suchungen des Einflusses von Desinfektionsmitteln<br />
(Chlor) auf die Lebensdauer von Kunststoffrohrsystemen.<br />
Qualitätssicherung und<br />
Produktzertifizierung<br />
Seit Mitte der 60er-Jahre unterliegen<br />
Kunststoffrohrprodukte einer<br />
erfolgreichen und anspruchsvollen<br />
Qualitätssicherung durch das SKZ.<br />
Anfänglich überwiegend in Deutschland<br />
aktiv, wurde bald klar, dass in<br />
ganz Europa Bedarf an externer<br />
Qualitätssicherung bestand. Diese<br />
Sicherung des Qualitätsniveaus hat<br />
die Inspektionsstelle des SKZ übernommen.<br />
Die Inspektionsstelle des Typs A<br />
ist nach DIN EN ISO/IEC 17020:2004<br />
akkreditiert und verfügt über vielfältige<br />
Anerkennungen in Deutschland,<br />
z. B. durch DIBt, DVGW, DIN<br />
CERTCO, DVS, KRV, VKR sowie auch<br />
international z. B. durch SSIV, SVGW,<br />
VSA.<br />
Die Zulassung als Zertifizierer<br />
von EuroHeat & Power im Bereich<br />
Fernwärme für Kunststoffmantelrohrprodukte<br />
ist ein weiteres Beispiel<br />
des Portfolios.<br />
Auch die Anerkennungen als<br />
akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle<br />
in den USA und in Australien<br />
sind für die SKZ-Kunden sehr<br />
nützlich.<br />
Mit rund 1000 akkreditierten<br />
Normen, nach denen das SKZ-Prüflabor<br />
arbeitet, wird der Rohrbereich<br />
sehr weit reichend abgedeckt. Aufgrund<br />
weltweiter Kooperationen<br />
kann, zum Vorteil für den Kunden,<br />
die Überwachung von Produkten<br />
für mehrere Länder gleichzeitig<br />
durchgeführt werden.<br />
Mittlerweile ist die Inspektionsstelle<br />
für Rohrsysteme weltweit in<br />
über 30 Ländern, in Europa, dem<br />
Mittleren Osten, Asien und Südamerika<br />
mit der Güte- und Qualitätssicherung<br />
tätig.<br />
Die seit 1974 eingeführten SKZ-<br />
Prüf- und Überwachungsbestimmungen<br />
haben sich mittlerweile<br />
sehr etabliert und gewinnen zunehmend<br />
auch auf dem internationalen<br />
Markt an Bedeutung. In diesem Fall<br />
werden nach einem spezifisch erarbeiteten<br />
und genau festgelegten<br />
Kriterienkatalog für Produkte (Neuentwicklungen),<br />
für die noch keine<br />
Regelwerke existieren, SKZ-Prüfund<br />
Überwachungsbestimmungen<br />
erstellt. Ebenso besteht die Möglichkeit,<br />
ein auf ein individuelles<br />
Produkt abgestimmtes SKZ-Regelwerk<br />
für den Kunststoffrohrsystemhersteller<br />
zu erarbeiten. Durch den<br />
herausragenden internationalen<br />
Bekanntheitsgrad der SKZ-Qualitätszeichen<br />
erzielen Zeicheninhaber<br />
bedeutende Wettbewerbsvorteile<br />
und vermarkten ihre Produkte<br />
dementsprechend erfolgreich.<br />
Die verschiedenen SKZ Prüf- und<br />
Überwachungsbestimmungen<br />
sowie auch die bereits vergebenen<br />
SKZ-Zeichen können auf der Homepage<br />
unter www.skz.de eingesehen<br />
werden.<br />
Bei der Qualitätssicherung von<br />
Rohren, Formteilen und Armaturen<br />
umfasst das Arbeitsgebiet die unterschiedlichsten<br />
Anwendungsbereiche.<br />
So ist das SKZ als Fremdüberwacher<br />
Juli/August 2011<br />
682 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
von rund 1000 verschiedenen Produkten<br />
tätig, wie zum Beispiel Kanalund<br />
Kabelschutzrohre mit dazugehörigen<br />
Formteilen, Druckrohre für<br />
die Gas- und <strong>Wasser</strong>ver sorgung, Fußboden-<br />
und Heizkörperanbindungen,<br />
Industrierohre, Erdwärmesondensysteme,<br />
Hängedachrinnen,<br />
Drän- und Sickerrohre, Schläuche,<br />
Klemm-, Press-, Steck- und Schiebehülsenverbinder,<br />
Heizelementmuffenschweiß-<br />
und Heizwendelschweißverbinder<br />
sowie Klebverbinder.<br />
Aufgrund der Anerkennung<br />
durch das Bayerische Staatsministerium<br />
des Inneren und das DIBt als<br />
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle<br />
(PÜZ-Stelle) kann das<br />
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)<br />
nach den Anforderungen der<br />
Bauregelliste A 1 im geregelten und<br />
nach allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Zulassungen im nicht geregelten<br />
Bereich vergeben werden.<br />
Die durch die Inspektionsstelle<br />
durchgeführte Qualitätssicherung<br />
gewinnt als Erfolgsfaktor für unternehmerisches<br />
Handeln immer stärkeres<br />
Gewicht. Das SKZ-Qualitätszeichen<br />
auf Basis regelmäßiger Produktüberwachung<br />
dokumentiert<br />
höchsten Qualitätsstandard. Die<br />
langjährige erfolgreiche Überwachungstätigkeit<br />
im In- und Ausland<br />
machen das SKZ so zum außerordentlich<br />
leistungsstarken Partner<br />
für die Kunststoffrohr-Industrie.<br />
Prüflabor<br />
Das nach DIN EN ISO/IEC 17025<br />
akkreditierte Prüflabor des SKZ bietet<br />
Prüfungen für Rohre, Formteile<br />
und Verbinder aus dem Druck- und<br />
<strong>Abwasser</strong>bereich an. Der Prüfumfang<br />
umfasst alle gängigen mechanischen<br />
und analytischen Prüfungen<br />
an Rohren und Rohrsystemen,<br />
nach nationalen und internationalen<br />
Normen, nach Prüfrichtlinien<br />
von in- und ausländischen Zertifizierern<br />
und natürlich nach den SKZeigenen<br />
Prüf- und Überwachungsbestimmungen.<br />
Ein wichtiger Schwerpunkt in<br />
diesem Tätigkeitsfeld sind die Zeitstand-Innendruckprüfungen<br />
(DIN EN<br />
ISO 1167 und 9080 sowie DIN<br />
16887). Sie dienen vorwiegend der<br />
Qualitätskontrolle von Rohren,<br />
Formteilen und Verbindern im Rahmen<br />
der Erstprüfung und Inspektion,<br />
sowie zur Erstellung von Zeitstand-Innendruckkurven<br />
von Verbundrohren<br />
und Rohr- bzw.<br />
Verbinderwerkstoffen. Hierfür stehen<br />
umfassende Prüfkapazitäten<br />
zur Verfügung: Etwa 500 Druckstationen,<br />
mit Prüfdrücken bis zu<br />
160 Bar, sowie eine Vielzahl an<br />
Prüfbecken (20 °C bis 95 °C) und Um -<br />
luftwärmeschränken (bis 135 °C),<br />
stehen zur Verfügung.<br />
Mit Hilfe eines Chlorprüfgerätes<br />
wurden die Prüfmöglichkeiten<br />
ergänzt. Die im Jahr 2009 in Betrieb<br />
genommene Prüfanlage ermöglicht<br />
es, an Kunststoffrohren mit einem<br />
Außendurchmesser bis zu 32 mm<br />
Zeitstand-Innendruckversuche<br />
unter Chloreinfluss und im Durchfluss<br />
durchzuführen. Dadurch kann<br />
die Beständigkeit der Kunststoffrohre<br />
gegenüber gechlortem<br />
<strong>Wasser</strong> unter Betriebsbedingungen<br />
ermittelt werden. Chlorkonzentrationen<br />
bis zu 100 mg/L, maximale<br />
Prüftemperaturen von 115 °C, Prüfdrücke<br />
bis zu 16 bar und ein pH-<br />
Wert von 6–8 sind mit der Anlage<br />
realisierbar.<br />
Insgesamt können umfangreiche<br />
Werkstoff- und Produktprüfungen<br />
durchgeführt werden. Dazu<br />
gehören zum Beispiel der 3-Punkt<br />
(DIN EN ISO 178) und 4-Punkt-<br />
Biegeversuch (DIN 19537-2), die<br />
Prüfung der Ringsteifigkeit (DIN<br />
16961-2, DIN EN ISO 13967 und DIN<br />
EN ISO 9969), die Prüfung der<br />
Beständigkeit gegen Dichlormethan<br />
bei einer festgelegten Temperatur<br />
(„DCMT“, nach DIN EN 580), der<br />
Schlagbiegeversuch (DIN 8078, DIN<br />
EN ISO 179-1), die Kugelfallprüfung<br />
(DIN EN 744, 1411 und 1716), die<br />
Prüfung des langsamen Risswachstums<br />
(„Kerbprüfung“, nach DIN EN<br />
ISO 13479), die Prüfung des schnellen<br />
Risswachstums („S4-Test“, nach<br />
DIN EN ISO 13477), Trennversuche<br />
an Verbundrohren (DVGW W 542,<br />
ISO 17454), der Dehnversuch an<br />
Verbundrohren (DVGW W 542) oder<br />
auch der Tauch-Temperaturwechselversuch<br />
an Verbundrohren<br />
(DVGW W 542).<br />
Auf einer Extrusionslinie im<br />
Industriemaßstab können zu Prüfzwecken<br />
oder zur Optimierung der<br />
Fertigung Rohre verschiedener praxisrelevanter<br />
Dimensionen hergestellt<br />
werden.<br />
In der Praxis kommen die Halbzeuge<br />
(vor allem Rohre und Verbinder)<br />
nicht einzeln zum Einsatz, sondern<br />
gemeinsam als System. Daher<br />
werden in den meisten Normen und<br />
Richtlinien, zusätzlich zur Prüfung<br />
der einzelnen Komponenten, auch<br />
Systemprüfungen gefordert. Besonders<br />
hervorzuheben sind hier die<br />
Temperaturwechselprüfungen für<br />
Sanitär- bzw. Heizungsinstallationen<br />
(DVGW W 534, DIN EN 12293) und<br />
Hausabflusssysteme (DIN EN 1055).<br />
Zu den vielen anderen Systemprüfungen,<br />
die im SKZ-Prüflabor<br />
angeboten werden, gehören z. B. die<br />
Zeitstandzugversuche an Schweißverbindungen<br />
(DVS 2203-4, Beiblatt<br />
1), die Dekohäsionsprüfungen an<br />
Schweißverbindungen (ISO 13953,<br />
13954 und 13955), die Dichtheitsprüfungen<br />
(DIN EN 1053, 1054 und<br />
EN 1277), die Druckverlustprüfung<br />
an Bauteilen (DIN EN 12117),<br />
die Unterdruckprüfungen (DVGW<br />
W 534, DIN EN 12294), der Druckstoßversuch<br />
(DVGW W 534, DIN<br />
EN 12295), der Biegewechselversuch<br />
(DVGW W 534), die Prüfung der<br />
Zugfestheit von Verbindungen<br />
(DVGW W 534, DIN EN 712) oder der<br />
Biegeversuch (DVGW W 534,<br />
EN 713).<br />
Gutachten und<br />
Schadensanalysen<br />
Die meisten Schäden an Rohren<br />
und Verbindungen werden durch<br />
unsachgemäßen Umgang mit den<br />
Produkten verursacht. Herstell-,<br />
Betriebs- und Konstruktionsfehler<br />
können aber ebenso wie Umwelteinflüsse<br />
maßgeblich oder überlagert<br />
schadensrelevant sein.<br />
Ob es um Qualitätsbestimmung,<br />
Lebensdauerabschätzung, Risiko-<br />
<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 683
FOKUS<br />
Tiefbau<br />
Maschineller<br />
Torsionsscherversuch.<br />
bewertung, Schweißnahtfestigkeitsuntersuchungen,<br />
Varianzanalysen,<br />
Projektbegleitung, Beratung oder<br />
Schadensbegutachtungen im Be -<br />
reich Rohre und Fügetechno logien<br />
geht, das SKZ steht seinen Kunden<br />
mit einem umfassenden „Service-<br />
Paket“ zur Verfügung.<br />
Gerade die Durchführung von<br />
Schadensuntersuchungen und Ge -<br />
richtsgutachten erfordert ein um -<br />
fangreiches Fachwissen und sehr<br />
viel Erfahrung. Die anerkannten<br />
Gutachter sind deshalb langjährige<br />
Experten in ihren Fachgebieten und<br />
greifen auf die vielfältigen, modernen<br />
und akkreditierten Prüf- und<br />
Untersuchungsmöglichkeiten<br />
zurück. So können neben allen klassischen<br />
Rohr- und Verbindungsprüfungen<br />
auch Sonderprüfungen und<br />
Nachstellungsversuche vorgenommen<br />
werden. Die SKZ-Experten<br />
sind dabei auch vor Ort tätig, und<br />
das weltweit. Es gehört zu ihren<br />
Auf gaben, nicht nur die Ursachen<br />
der Schäden anschaulich und nachvollziehbar<br />
dokumentiert zu ermitteln,<br />
sondern auch Maßnahmen zu<br />
deren künftiger Vermeidung aufzuzeigen.<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Die Forschung und Entwicklung im<br />
Bereich der Kunststoffrohrsysteme<br />
erstreckt sich über den gesamten<br />
Produktions- und Lebenszyklus<br />
vom Werkstoff über die Verarbeitung<br />
bis hin zu den Langzeiteigenschaften<br />
der Rohre. Im Fokus stehen<br />
die Bedürfnisse der Kunststoffrohr-<br />
Industrie – Forschungsergebnisse<br />
haben daher direkten Einfluss auf<br />
neue und verbesserte Produkte<br />
oder finden sich in entsprechenden<br />
Normen und Regelwerken wieder.<br />
I0n anwendungsorientierten Projekten<br />
und direkten Industriekooperationen<br />
werden vielfältige<br />
Arbeiten durchgeführt. Beispiele<br />
sind: Prozessoptimierung bei Compoundierung<br />
und Extrusion, Untersuchung<br />
von Verarbeitungseinflüssen,<br />
Entwicklung von Prüfverfahren<br />
zur Schweißnahtgüte, Untersuchungen<br />
zur Schweißnahtvorbereitung,<br />
Erforschung neuer Schweißverfahren,<br />
Weiterentwicklung herkömmlicher<br />
Schweißverfahren, z. B. für<br />
neue Werkstoffe oder auch für<br />
große Dimensionen, Analyse von<br />
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen,<br />
Zerstörungsfreie Bauteilprüfung,<br />
Einfluss von Desinfektionsmitteln,<br />
Rissinitiierung und Risswachstum,<br />
Ermüdungsverhalten unter Dauerschwingbeanspruchung,<br />
Kriechund<br />
Relaxationsverhalten unter<br />
statischer Langzeitbelastung, Alterungsverhalten<br />
und Lebens daueranalysen,<br />
Bewertung der Nachhaltigkeit<br />
der Produkte und Prozesse<br />
oder Umweltprodukterklärungen<br />
(ISO 14025).<br />
Durch Kooperationen mit Industriepartnern,<br />
Hochschulen und Forschungsinstituten<br />
werden die eigenen<br />
Kompetenzen erweitert und<br />
der Nutzen für die Kunststoffrohr-<br />
Industrie gesteigert.<br />
So wurde z. B. in einem Kooperationsprojekt<br />
mit der Firma IPT (Institut<br />
für Prüftechnik Gerätebau GmbH<br />
& Co. KG) in Todtenweis ein Prüfstand<br />
entwickelt, der es erlaubt,<br />
Kunststoffrohre unter Chloreinfluss<br />
und Betriebsbedingungen (Innendruck,<br />
Temperatur, durchfließendes<br />
Prüfmedium) bis zum Versagen zu<br />
prüfen.<br />
In einem weiteren Gemeinschaftsprojekt<br />
haben die Experten<br />
des SKZ gemeinsam mit KIWA Gastec<br />
Technology, und MPA Darmstadt<br />
die Restnutzungsdauer von PE-Rohren<br />
im Gas- und <strong>Wasser</strong>bereich nach<br />
einer Betriebsdauer von 40 Jahren<br />
untersucht. Dabei zeigte sich, dass<br />
der Zustand der Kunststoffrohre<br />
eine weitere Nutzung über die<br />
ursprünglich angenommenen 50<br />
Jahre erlaubt. Dieses Projekt wurde<br />
vom DVGW und von Unternehmen<br />
aus dem Bereich der Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
sowie von den Werkstoffherstellern<br />
getragen.<br />
Mit einer neuen Möglichkeit der<br />
zerstörungsfreien Prüfung von<br />
Kunststoffrohren mittels eines<br />
mobilen NMR-Systems beschäftigt<br />
sich ein Gemeinschaftsprojekt zwischen<br />
dem SKZ, dem Deutschen<br />
Kunststoff-Institut (DKI) in Darmstadt<br />
und dem Institut für Technische<br />
und Makromolekulare Chemie<br />
(ITMC) der RWTH Aachen.<br />
In einer gemeinsam von SKZ<br />
und M-O-SYS GmbH in Eschenfelden<br />
durchgeführten Forschungsarbeit<br />
wurde das multi-orbitale<br />
Reibschweißverfahren für Polyolefinrohrleitungen<br />
entwickelt. Die<br />
Grundlage des Verfahrens ist eine<br />
innovative Bewegungsführung, bei<br />
der im Gegensatz zu bisherigen<br />
Reibschweißverfahren erstmals<br />
beide Werkstückenden in kleinsten<br />
kreisförmigen Orbitalbewegungen<br />
translatorisch bewegt werden können,<br />
was eine Effizienzsteigerung<br />
von bis zu 100 Prozent bedeuten<br />
kann.<br />
In enger Kooperation mit der<br />
Fa. Widos GmbH in Ditzingen hat<br />
das SKZ maschinelle Torsions- und<br />
Linearscherprüfungen entwickelt,<br />
Juli/August 2011<br />
684 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau<br />
FOKUS<br />
mit denen praxistaugliche und erstmalig<br />
reproduzierbare Prüfungen an<br />
Heizwendel- (HM) und Heizelementmuffen-<br />
(HD) Schweißverbindungen<br />
durchgeführt und im Detail qualitativ<br />
bewertet werden konnten.<br />
Da die Bewertung der Nachhaltigkeit<br />
von Kunststoffrohren zunehmend<br />
wichtiger wird, erarbeitet das<br />
SKZ auch hierfür Entscheidungshilfen.<br />
Beispiel ist eine Softwareentwicklung,<br />
mit der Qualität, Kosten<br />
und Umweltwirkungen von Rohren<br />
aus PE, PP und PVC gegenübergestellt<br />
werden können. Unter<br />
anderem wurde der korrosive<br />
Angriff des <strong>Abwasser</strong>s auf die Polymere<br />
simuliert und daraus Aussagen<br />
zur Lebensdauer abgeleitet.<br />
Für die solide Nachhaltigkeitsbewertung<br />
fehlt häufig die erforderliche<br />
Datengrundlage, so auch beim<br />
Fügen von Kunststoffrohren. Erstmals<br />
untersucht das SKZ daher in<br />
einem Projekt der Deutschen Bundesstiftung<br />
Umwelt (DBU) die wichtigsten<br />
Verfahren auf ökologische<br />
sowie ökonomische Eigenschaften<br />
und deren Optimierungspotenzial,<br />
z. B. die freigesetzten Emissionen<br />
und den Energieverbrauch.<br />
Weiterbildung für<br />
die Kunststoffrohr-Industrie<br />
Das SKZ ist anerkannte Kursstätte<br />
des DVGW (Deutscher Verein des<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e.V.) und des<br />
DVS (Deutscher Verband für Schweißen<br />
und verwandte Verfahren e.V.)<br />
mit den Schwerpunkten Schweißen<br />
und Kleben von Rohren, Kanal- und<br />
Schachtsanierung mit Kunststoffen<br />
und die Sanierung von Rohrleitungen.<br />
Zusätzlich bietet das SKZ branchenspezifische<br />
und praxisorientierte<br />
Lehrgänge mit der Möglichkeit<br />
einer entsprechenden und<br />
anerkannten Qualifikation nach<br />
DVS- und DVGW-Richtlinien, sowie<br />
auch nach AGFW (Arbeitsgemeinschaft<br />
für Wärme und Heizkraftwirtschaft)<br />
und EN-Richtlinien, oder<br />
auch nach der Druckgeräterichtlinie<br />
bzw. nach dem Berufsbildungspass<br />
des Deutschen Handwerks.<br />
Die Teilnehmer der Veranstaltungen<br />
werden von Anfang an auf<br />
höchstem Niveau trainiert und können<br />
an verschiedenen Standorten<br />
weltweit z. B. zum Kunststoffschweißer,<br />
zur Schweißaufsicht, zum Fachmann<br />
für Kunststoffschweißen, zum<br />
Muffenmonteur für Fernwärmeleitungen,<br />
zum Kunststoffkleber und<br />
Klebpraktiker und zum Kunststofflaminierer<br />
ausgebildet werden.<br />
Mit Inhouse-Schulungen wird<br />
ganz individuell auf die Wünsche<br />
und Bedürfnisse der jeweiligen<br />
Firma eingegangen. Die Schulungen<br />
sind modular aufgebaut, sodass<br />
die erforderlichen Prioritäten und<br />
der Zeitumfang selbst bestimmt<br />
werden können.<br />
Seminare sind Fachveranstaltungen<br />
auf hohem Niveau, bei denen<br />
das Basiswissen aufgefrischt und<br />
vertieft wird, sowie Informationen<br />
über die neuesten Entwicklungen<br />
und Trends verfügbar gemacht werden.<br />
Das Knüpfen neuer Netzwerkkontakte<br />
in attraktiver Atmosphäre<br />
kommt hier ebenfalls nicht zu kurz.<br />
Mit hochkarätigen Experten als<br />
Referenten trägt das SKZ mit seinen<br />
Fachtagungen zum innovativen<br />
Wissenstransfer in der Kunststoffrohr-<br />
und Baubranche bei.<br />
Sowohl für Ingenieure wie auch<br />
für Führungskräfte eignen sich die<br />
vielfältigen Themenangebote. Beispiele<br />
sind: „Die sichere Deponie“<br />
(Würzburg), „Würzburger Kunststoffrohr-Tagung“,<br />
„Welding technology“<br />
(China), „Plastic piping systems<br />
Eurasia“ (Istanbul).<br />
Das SKZ bietet Veranstaltungen<br />
im In- und Ausland an. An den deutschen<br />
Standorten, z. B. in Würzburg,<br />
Halle, Peine und Stuttgart, aber<br />
auch im Ausland, z. B. in Dubai, in<br />
China, in den USA und im Iran.<br />
Die Systemkompetenz im<br />
Arbeitsgebiet Rohrsysteme ist folglich<br />
absolut umfassend, wodurch<br />
auch der Nutzen für die Kunden<br />
optimal ist.<br />
Ansprechpartner Rohrsysteme:<br />
Dr. Jürgen Wüst,<br />
Tel. (0931) 4104-238,<br />
E-Mail: j.wuest@skz.de<br />
Weitere Informationen:<br />
www.skz.de<br />
<strong>Wasser</strong>haltung<br />
Brunnenbau<br />
Umwelttechnik<br />
www.hoelscher-wasserbau.de<br />
Postfach 21 51<br />
D-49727 Haren / Ems<br />
member of IPLOCA<br />
- DIN EN ISO 9001 - SCC - DVGW W 120 - WHG § 19<br />
Tel.: +49 5934 / 7070<br />
- Bauen für den Umweltschutz<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 685
20% Rabatt<br />
für <strong>gwf</strong>-Abonnenten<br />
<strong>gwf</strong> Praxiswissen<br />
Band I<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Dieser erste Band verdeutlicht, dass Regenwasser nicht als zu entsorgendes<br />
<strong>Abwasser</strong>, sondern als natürliches Gut anzusehen ist.<br />
Seine nachhaltige Bewirtschaftung ist für den lokalen <strong>Wasser</strong>haushalt<br />
ebenso bedeutend wie für die Vorsorge vor den Auswirkungen<br />
des Klimawandels mit Starkregenereignissen oder Trockenperioden.<br />
Das Buch bietet ausführliche Hintergrundinformationen zu den rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen und richtet das Hauptaugenmerk auf die<br />
Veränderungen, durch das neue <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz. Anerkannte<br />
Experten aus der <strong>Wasser</strong>branche berichten in Fachbeiträgen über<br />
den neuesten Stand von Forschung und Technik. Zahlreiche Praxisbeispiele<br />
veranschaulichen die vielfältigen Möglichkeiten, wie sich<br />
ein sinnvoller Umgang mit Regenwasser bei ganz unterschiedlichen<br />
Voraussetzungen umsetzen lässt.<br />
Hrsg.: C. Ziegler, 1. Auflage 2011, 184 Seiten, Broschur<br />
Erhältlich als Buch mit Bonusmaterial oder als Buch mit Bonusmaterial<br />
+ vollständigem eBook auf DVD oder als digitales eBook<br />
ANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Ex. <strong>gwf</strong> Praxiswissen Band I – Regenwasserbewirtschaftung<br />
Buch mit Bonusmaterial (ISBN: 978-3-8356-3256-1)<br />
zum Preis von € 54,90 (<strong>gwf</strong>-Abonnenten: € 43,90)<br />
Buch mit Bonusmaterial + eBook auf DVD (ISBN: 978-3-8356-3258-5)<br />
zum Preis von € 69,90 (<strong>gwf</strong>-Abonnenten: € 55,90)<br />
Wir beziehen die Fachzeitschrift <strong>gwf</strong><br />
im Abonnement<br />
nicht im Abonnement<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird<br />
mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAGWFP2011<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Edition<br />
<strong>gwf</strong> Praxiswissen<br />
Diese Buchreihe präsentiert kompakt aufbereitete Fokusthemen aus der <strong>Wasser</strong>branche<br />
und Fachberichte von anerkannten Experten zum aktuellen Stand der<br />
Technik. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen individuelle Lösungen und vermitteln<br />
praktisches Know-how für ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Konzepte.<br />
Jeder Band<br />
erhältlich als Buch<br />
mit Bonusmaterial,<br />
als Buch mit Bonusmaterial<br />
+ eBook auf<br />
DVD oder als<br />
digitales eBook<br />
Band I – Regenwasserbewirtschaftung<br />
Ausführliche Informationen für die Planung und Ausführung von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung<br />
mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, Anwendungsbeispielen<br />
aus der Praxis und nützlichen Adressen.<br />
Hrsg.: C. Ziegler, 1. Auflage 2011, 184 Seiten, Broschur<br />
Buch mit Bonusmaterial (ISBN: 978-3-8356-3256-1) für € 54,90<br />
Buch mit Bonusmaterial + eBook auf DVD (ISBN: 978-3-8356-3258-5) für € 69,90<br />
eBook (ISBN: 978-3-8356-3257-8) für € 54,90<br />
Band II – Messen • Steuern • Regeln<br />
Grundlageninformationen über Automatisierungstechnologien, die dabei helfen,<br />
<strong>Wasser</strong> effizienter zu nutzen, <strong>Abwasser</strong> nachhaltiger zu behandeln und Sicherheitsrisiken<br />
besser zu kontrollieren.<br />
Hrsg.: C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch mit Bonusmaterial (ISBN: 978-3-5356-3260-8) für € 54,90<br />
Buch mit Bonusmaterial + eBook auf DVD (ISBN: 978-3-8356-3261-5) für € 69,90<br />
eBook (ISBN: 978-3-8356-3262-2) für € 54,90<br />
Band III – Energie aus <strong>Abwasser</strong><br />
Abwärme aus dem Kanal und Strom aus der Kläranlage: Wie aus großen Energieverbrauchern<br />
Energieerzeuger werden. Methoden und Technologien zur nachhaltigen<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Hrsg.: C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch mit Bonusmaterial (ISBN: 978-3-8356-3263-9) für € 54,90<br />
Buch mit Bonusmaterial + eBook auf DVD (ISBN: 978-3-8356-3265-3) für € 69,90<br />
eBook (ISBN: 978-3-8356-3264-6) für € 54,90<br />
Band IV –Trinkwasserbehälter<br />
Grundlagen zu Planung, Bauausführung, Instandhaltung und Reinigung sowie Sanierung<br />
von Trinkwasserbehältern. Materialien, Beschichtungssysteme und technische Ausrüstung.<br />
Hrsg.: C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch mit Bonusmaterial (ISBN: 978-3-8356-3266-0) für € 54,90<br />
Buch mit Bonusmaterial + eBook auf DVD (ISBN: 978-3-8356-3268-4) für € 69,90<br />
eBook (ISBN: 978-3-8356-3267-7) für € 54,90<br />
Alle Produktvarianten und Angebotsoptionen (inkl. eBook)<br />
finden Sie im Buchshop unter www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
WVER beteiligt sich an europaweitem<br />
Hochwasserschutz<br />
Der <strong>Wasser</strong>verband Eifel-Rur<br />
(WVER) beteiligt sich an einem<br />
europaweiten Projekt zum grenzüberschreitenden<br />
Hochwassermanagement<br />
mit Namen FLOOD-WISE.<br />
Dabei geht es um die Entwicklung<br />
gemeinsamer Standards und Vorgehensweisen<br />
zum Schutz vor<br />
Überschwemmungen. Besonders<br />
eng arbeitet der WVER mit der<br />
benachbarten Waterschap Roer en<br />
Overmaas (WRO) aus Sittard zusammen.<br />
Dazu trafen sich jetzt die<br />
Vorstände und die Gewässerverantwortlichen<br />
beider Verbände zu<br />
einem direkten Erfahrungsaustausch<br />
an der Rurtalsperre Schwammenauel.<br />
„Die Gefahren an der Rur können<br />
wir nur gemeinsam meistern“,<br />
erklärten WVER-Vorstand Prof. Dr.-<br />
Ing. Wolfgang Firk und sein niederländischer<br />
Kollege Dr. Jan Schrijen.<br />
Deswegen müsse man sich auch<br />
„verstehen“. Dazu seien einheitliche<br />
Standards notwendig. Dies werde<br />
auch in der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie<br />
gefordert.<br />
Im Projekt FLOOD-WISE arbeiten<br />
15 Partner aus sechs verschiedenen<br />
Flusseinzugsgebieten in elf Ländern<br />
von West- bis Südosteuropa zusammen.<br />
Dabei sind auch Länder im<br />
Osten des Kontinents, die an die EU<br />
grenzen, aber noch nicht Mitglieder<br />
sind.<br />
Das Projekt umfasst drei Schritte.<br />
Zunächst werden Daten zu Hochwassergefährdungen<br />
und ihrer<br />
Bedeutung für die Menschen, ihr<br />
Lebens- und Wirtschaftsumfeld und<br />
die Umwelt ermittelt. Im zweiten<br />
Schritt werden detaillierte Hochwassergefahren-<br />
und Risikokarten<br />
erstellt, die konkret die Bedrohungen<br />
vor Ort zeigen. In ihnen sind die<br />
von Überschwemmungen bedrohten<br />
Flächen mit ihren Wirtschaftsgütern,<br />
der Landnutzung, Besiedlungsstrukturen<br />
eingezeichnet. Die<br />
Karten beziehen sich auf verschiedene<br />
so genannte Jährlichkeiten,<br />
also statistische Wahrscheinlichkeiten,<br />
mit denen ein Hochwasser einmal<br />
in einem bestimmten Zeitraum<br />
auftritt.<br />
Der abschließende Schritt enthält<br />
die Ermittlung und Koordinierung<br />
von Maßnahmen, um die<br />
bedrohten Gebiete zu schützen.<br />
Über die Ergebnisse soll dann<br />
jeweils auch die Öffentlichkeit informiert<br />
werden. Alle sechs Flusseinzugsgebiete,<br />
darunter neben der<br />
kleinen Rur auch ein großer Fluss<br />
wie die Elbe, zeichnen sich dadurch<br />
aus, dass die Flüsse mehrere Länder<br />
durchqueren. Das Projekt läuft bis<br />
2012 und wird mit Interreg IVC-Mitteln<br />
der Europäischen Union bezuschusst.<br />
An der Rur sind neben dem<br />
WVER und der WRO auf deutscher<br />
Seite auch das Landesumweltministerium<br />
und die Bezirksregierung<br />
Köln sowie auf niederländischer<br />
Seite die Provinz Limburg und<br />
die staatliche <strong>Wasser</strong>verwaltung<br />
„Rijkswaterstaat“ in das Projekt<br />
ein gebunden. Die in FLOOD-WISE<br />
gemachten Erfahrungen werden<br />
zwischen allen Partnern international<br />
ausgetauscht. Gewonnene<br />
Informationen werden zudem in<br />
das europaweit bereits existierende<br />
<strong>Wasser</strong>-Informationssystem für<br />
Europa (WISE) eingespeist und<br />
damit für Fachleute auf dem ganzen<br />
Kontinent zugänglich gemacht.<br />
Die Experten von WVER und<br />
WRO waren sich bei ihrem Treffen<br />
einig: „Das FLOOD-WISE-Projekt<br />
wird dazu beitragen, den Hochwasserschutz<br />
zugunsten der Menschen<br />
an der Rur weiter zu verbessern.“<br />
Die fünf weiteren Flusseinzugsgebiete<br />
im FLOOD-WISE-Projekt<br />
sind neben der Rur die Maas, die<br />
Elbe, der Bug, die Sotla und der<br />
Somes. Die beteiligten Länder sind<br />
neben Deutschland und den Niederlanden<br />
Belgien, Tschechien,<br />
Polen, Ungarn, Rumänien und Slowenien<br />
sowie die EU-Anrainerstaaten<br />
Kroatien, Weißrussland und<br />
die Ukraine. Gesteuert wird das<br />
Gesamtprojekt durch die Euregio<br />
Maas-Rhein.<br />
Vorstände und Gewässerverantwortliche des <strong>Wasser</strong>verbandes Eifel Rur und der<br />
Waterschap Roer en Overmaas an der Rurtalsperre Schwammenauel.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.floodwise.eu<br />
Juli/August 2011<br />
688 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
<strong>Wasser</strong>-Experten diskutierten in Dresden<br />
die Wirkungen steigenden Grundwassers<br />
Am 16./17.05.2011 fanden im<br />
Dresdner Rathaus die Grundwassertage<br />
2011 statt. Rund 260<br />
Experten aus Wirtschaft, Behörden<br />
und Forschung folgten der Einladung<br />
des Grundwasser-Zentrums<br />
Dresden, um sich zu den „Wirkungen<br />
des Grundwasseranstiegs in den<br />
Bergbaufolgelandschaften auf die<br />
oberirdischen Gewässer, Feuchtgebiete,<br />
Bauwerke und andere Rechtsgüter“<br />
auszutauschen. Die hochkarätig<br />
besetzte Fachtagung stand<br />
unter der Schirmherrschaft des<br />
Sächsischen Staatsministeriums für<br />
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)<br />
und wurde in Kooperation mit dem<br />
BWK Landesverband Sachsen und<br />
der TU Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft<br />
durchgeführt.<br />
Zu Beginn der Veranstaltung<br />
wurde traditionell der nunmehr<br />
zehnte Dresdner Grundwasserforschungspreis<br />
für herausragende<br />
Dissertationen verliehen. Der Vorsitzende<br />
der Vergabe-Jury, Prof. Rudolf<br />
Liedl (TU Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft),<br />
beglückwünschte<br />
dazu Dr. Benjamin Creutzfeldt vom<br />
Deutschen GeoForschungszentrum<br />
Potsdam sowie Dr. Michael Glöckner<br />
(ARCADIS Deutschland GmbH), der<br />
seine Arbeit am Dresdner Grundwasserforschungszentrum<br />
e.V. erstellte.<br />
In den anschließenden Fachvorträgen<br />
wurden die vorteilhaften<br />
wie auch nachteiligen Folgen des<br />
Grundwasser-Wiederanstiegs aufgezeigt,<br />
in denen nicht nur Risiken<br />
sondern auch Chancen gesehen<br />
werden können.<br />
In einem ersten Vortragsblock<br />
wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
abgesteckt – sowohl<br />
aus wasserrechtlicher (Dallhammer,<br />
SMUL) als auch bergrechtlicher<br />
Sicht (Herrmann, sächsisches Oberbergamt)<br />
sowie in Bezug auf die<br />
WRRL (Dr. Eckardt SMUL). Dr. Gerdes<br />
(BGS Umwelt) plädierte für die<br />
Berücksichtigung der Folgen hoher<br />
Grundwasserstände in der Bauplanung<br />
mit Bezug auf das BWK-<br />
Merkblatt 8 (2009) „Ermittlung des<br />
Bemessungsgrundwasserstandes<br />
für Bauwerksabdichtungen“.<br />
Im zweiten Vortragsblock wurden<br />
strategische Lösungsansätze<br />
aus der Sicht der großen Bergbauund<br />
Sanierungsbetriebe LMBV<br />
(Scholz), MIBRAG (Dr. Jolas), WIS-<br />
MUT (Dr. Mann) sowie RWE-Power<br />
(Prof. Forkel) vorgestellt.<br />
Anschließend wurden Prognosetools<br />
für die Grundwasserstands-<br />
und Grundwasserbeschaffenheitsentwicklung<br />
näher beleuchtet.<br />
Der zweite Tag stand im Zeichen<br />
der Maßnahmebeispiele zur Minderung<br />
nachteiliger Folgen sowie zur<br />
Ausnutzung der vorteilhaften Folgen<br />
des Grundwasserwiederanstiegs.<br />
Ein Beispiel für die vorteilhaften<br />
Auswirkungen ist das Leipziger<br />
Neuseenland. Prof. Berkner vom<br />
RPV Westsachsen zeigte sehr lebendig<br />
die Erhöhung der Folgenutzungstandards<br />
durch Vernetzung<br />
der Tagebaufolgeseen auf.<br />
Im Rahmen der Vorträge wurde<br />
mehrfach darauf hingewiesen,<br />
dass die urbane Erschließung während<br />
der Grundwasser-Absenkung<br />
für den Braunkohle-Abbau Gebiete<br />
eingenommen hat, die vor den<br />
bergbaulichen Maßnahmen auf<br />
Grund der natürlichen Vernässung<br />
nicht bebaut worden waren. In solchen<br />
Fällen kann die Ein stellung<br />
Exkursion in<br />
die Lausitzer<br />
Bergbaufolgelandschaft<br />
im<br />
Rahmen der<br />
Dresdner Grundwassertage.<br />
© GWZ<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 689
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
des Bergbaus nicht für mög liche<br />
Schäden verantwortlich gemacht<br />
werden, die mit dem wiederansteigenden<br />
Grundwasser auf vorbergbau<br />
liches Niveau einhergeht.<br />
Vielmehr liegt hier die Verantwortung<br />
bei den Planern und Architekten<br />
der Baugebiete. Gleichwohl<br />
wurde im Rahmen der Vorträge auf<br />
Lösungsmöglichkeiten wie Drainagen,<br />
Abdichtungen aber auch<br />
Gebäudeanhebungen hingewiesen.<br />
Abgerundet wurde die Fachveranstaltung<br />
durch eine informative<br />
Poster- und Firmenausstellung<br />
sowie die traditionelle Dampferfahrt<br />
auf der Elbe. Die Exkursion in<br />
die Lausitzer Bergbaufolgelandschaft<br />
unter Führung der LMBV<br />
mbH bildete einen würdigen fachlichen<br />
Abschluss. Stationen der<br />
Exkursion waren die Horizontalfilterbrunnen<br />
in Hoyerswerda, die<br />
Sanierung setzungsfließgefährdeter<br />
Uferabschnitte am Knappensee, der<br />
Silbersee als aktives Sanierungsprojekt<br />
(Rüttelstopfverdichtung), die<br />
Anhebung von Wohnhäusern als<br />
Maßnahme zur Vermeidung von<br />
Sachschäden durch den Grundwasser-Wiederanstieg<br />
sowie die<br />
Kleine Spree (Eiseneintrag in Fließgewässer).<br />
Die Langfassungen der Vorträge<br />
werden wieder in den Proceedings<br />
des DGFZ e. V. (ISSN 1430-0176,<br />
voraussichtlich Heft 44) publiziert.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.gwz-dresden.de<br />
10. Dresdner Grundwasserforschungspreis<br />
an<br />
Dr. Benjamin Creutzfeldt<br />
und Dr. Michael Glöckner<br />
verliehen<br />
Im Rahmen der Grundwassertage<br />
2011 wurde traditionell der nunmehr<br />
10. Dresdner Grundwasserforschungspreis<br />
an herausragende<br />
Dissertationen verliehen. Der Preis<br />
wird von der Stiftung zur Förderung<br />
der „Wissenschaftlichen Schule Zunker-Busch-Luckner“<br />
ausgelobt und<br />
ist mit 5000 € dotiert.<br />
Auszug aus der Laudatio des<br />
Jury-Vorsitzenden, Prof. Dr. Liedl (TU<br />
Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft):<br />
Die sieben eingereichten Arbeiten<br />
wurden von der Jury als wertvolle<br />
Beiträge zur Grundwasserforschung<br />
eingestuft. Die Jury hat<br />
dabei erfreut zur Kenntnis genommen,<br />
dass eine Promotion in Österreich<br />
und zwei in der Schweiz<br />
durchgeführt wurden, sodass der<br />
Dresdner Grundwasserforschungspreis<br />
offenbar über die Landesgrenzen<br />
hinaus wahrgenommen wird.<br />
Die vergleichende Bewertung<br />
der Dissertationen erwies sich – wie<br />
des Öfteren im Vorfeld von Preisvergaben<br />
– als nicht ganz einfach.<br />
Völlig verschiedenartige Ansätze<br />
und Methoden, beispielsweise der<br />
Computermodellierung oder der<br />
Versuchstechnik, stellten die Jury<br />
vor eine schwierige, aber auch<br />
schöne Herausforderung. „Schön“<br />
deshalb, weil die Palette der eingereichten<br />
Themen wieder einmal<br />
verdeutlicht hat, dass Grundwasserforschung<br />
keine Monokultur darstellt,<br />
sondern durch Artenvielfalt<br />
gekennzeichnet ist.<br />
Vor diesem Hintergrund hat die<br />
Jury die Qualität der Darstellung,<br />
den Nutzen für die Grundwasserforschung<br />
und die wissenschaftliche<br />
Exzellenz der Themenbearbeitung<br />
als Maßstab für die Preisvergabe<br />
zugrunde gelegt. Die Jury hat sich<br />
unter Beachtung dieser Gesichtspunkte<br />
einvernehmlich dafür ausgesprochen,<br />
den Dresdner Grundwasserforschungspreis<br />
2011 jeweils<br />
zur Hälfte Dr. Benjamin Creutzfeldt<br />
und Dr.-Ing. Michael Glöckner zuzuerkennen.<br />
Beide Preisträger haben es in<br />
besonderem Maße verstanden,<br />
Methoden aus anderen Disziplinen<br />
zur Bearbeitung von Fragestellungen<br />
der Grundwasserforschung einzusetzen<br />
und unser Fachgebiet auf<br />
diese Weise mit maßgeblichen<br />
Impulsen von außen zu bereichern.<br />
Dr. Creutzfeldt hat an der Universität<br />
Potsdam zum Thema „The<br />
effect of water storages on temporal<br />
gravity measurements and the<br />
benefits for hydrology“ promoviert.<br />
In seiner Dissertation werden Gravimetermessungen<br />
von Erdschwerefeldschwankungen<br />
ausgewertet,<br />
um Änderungen unterirdisch ge -<br />
speicherter <strong>Wasser</strong>volumina festzustellen.<br />
Damit wird eine geophysikalische<br />
Technik zur Quantifizierung<br />
hydrologischer Vorgänge herangezogen.<br />
Die Dissertation von Dr. Glöckner<br />
trägt den Titel „Beitrag zur Entwicklung<br />
anoxischer Vakuum-<br />
Stripptechnologien zur Behandlung<br />
kontaminierter Grundwässer“ und<br />
wurde von der Technischen Universität<br />
Bergakademie Freiberg angenommen.<br />
Diese Arbeit ist an der<br />
Schnittstelle zwischen Grundwasserforschung<br />
und Verfahrenstechnik<br />
angesiedelt. Ziel war die technisch-ökonomische<br />
Bewertung der<br />
im Dissertationstitel genannten<br />
Sanierungstechnologien im Hinblick<br />
auf ihre Anwendbarkeit bei<br />
großflächigen Grundwasserverunreinigungen.<br />
Beide Arbeiten wurden von den<br />
betreuenden Hochschullehrern,<br />
Prof. Dr. Merz und Prof. Dr. Häfner<br />
gewürdigt und kurz vorgestellt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.zbl-stiftung.de<br />
Juli/August 2011<br />
690 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Kraftwerke einsparen statt ersetzen<br />
Energieeffiziente Pumpen bieten enorme Einsparpotenziale<br />
Aus der Kernkraft auszusteigen,<br />
ohne die Klimaziele zu gefährden<br />
– die von der Politik beschlossene<br />
Energiewende in Deutschland<br />
ist ohne Frage äußerst ambitioniert.<br />
Lebhaft diskutiert werden die forcierte<br />
Nutzung erneuerbarer Energien,<br />
der Neubau von Kohle- und<br />
Gaskraftwerken und auch der Netzausbau<br />
zum Verteilen der elektrischen<br />
Energie.<br />
Etwas in den Hintergrund gerät<br />
dabei die einfach nachvollziehbare<br />
Erkenntnis, dass nicht benötigte<br />
Energie die ökologisch wie ökonomisch<br />
beste Lösung ist. Jürgen<br />
Hambrecht – bis Mai 2011 Vorstandschef<br />
der BASF – hat dazu dieses<br />
eindrucksvolles Bild gewählt:<br />
„Die größte Ölquelle liegt unter<br />
Deutschland: Es ist die Energie-<br />
Effizienz.“<br />
Im Kontext dazu zeigt eine aktuelle<br />
Studie der Deutschen Unternehmensinitiative<br />
Energieeffizienz<br />
e. V. (DENEFF) und des Wuppertal<br />
Instituts: Durch Stromeinsparungen<br />
in Unternehmen und Haushalten<br />
lässt sich auf die Jahresproduktion<br />
von zehn Atomkraftwerken verzichten.<br />
Die co2online gemeinnützige<br />
GmbH wagt allein im Hinblick auf<br />
Pumpen diese Abschätzung: Würden<br />
die rund 20 Millionen veralteten<br />
Heizungsumwälzpumpen in<br />
Deutschland sowie ineffiziente<br />
Pumpen in Industrie und Gewerbe<br />
gegen moderne Technik ausgetauscht,<br />
könnten knapp zwei Atomkraftwerke<br />
dafür stillgelegt werden.<br />
Die heute bereits verfügbaren<br />
Technologien zur Energieeinsparung<br />
bei Pumpen – effiziente Motoren,<br />
Frequenzumformer zur Drehzahlregelung,<br />
wirkungsgradoptimierte<br />
Hydraulik – müssen dafür<br />
nur konsequent genutzt werden.<br />
Um über die immensen Einsparpotenziale<br />
moderner Pumpentechnik<br />
aufzuklären, hat die Grundfos-<br />
Gruppe weltweit die Initiative<br />
„Energy Movement“ gestartet. Hermann<br />
W. Brennecke, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der Grundfos<br />
GmbH: „Tatsache ist, dass die meisten<br />
der installierten Pumpen größer<br />
als erforderlich sind. Dazu kommt,<br />
dass ein Großteil der Pumpenmotoren<br />
ineffizient ist und unabhängig<br />
vom tatsächlichen Bedarf auf Hochtouren<br />
läuft. Mit unserem ‚Energy<br />
Movement‘ wollen wir weltweit auf<br />
diesen Missstand hinweisen.“<br />
Das „Energy Movement“ unterstützt<br />
und begleitet die EU-Richtlinie<br />
zur Gestaltung energierelevanter<br />
Produkte (ErP), die seit dem 16. Juni<br />
2011 mit der neuen Norm zur Internationalen<br />
Effizienz (IE) strikte Anforderungen<br />
an die Energieeffizienz der<br />
Motoren von Pumpen stellt. Grundfos<br />
hat diese EU-Richtlinie aktiv mitgestaltet.<br />
Und das Unternehmen<br />
geht mit eigenen Lösungen voran:<br />
Mit einem speziellen Logo (Grundfos<br />
Blueflux) kennzeichnet das Unternehmen<br />
die Antriebslösungen, die<br />
nach der bestmöglichen Energieeffizienzklasse<br />
arbeiten. Bei einer Blueflux-Lösung<br />
handelt es sich entweder<br />
um einen hocheffizienten IE3-<br />
Motor oder einen IE2-Motor mit<br />
variablem Frequenzumrichterantrieb<br />
(FU integriert oder extern).<br />
Beide Lösungen überschreiten die<br />
aktuellen und zukünftigen Gesetzesanforderungen<br />
zur Motoreffizienz.<br />
Ein Grundfos Blueflux-Motor kann in<br />
Kombination mit einem Frequenzumrichter<br />
den Energieverbrauch<br />
einer Pumpe je nach deren Lastprofil<br />
um bis zu 60 % senken. Die höheren<br />
Investitionskosten amortisieren sich<br />
in der Regel innerhalb von zwei<br />
Jahren.<br />
Das Einsparpotenzial bei industriell<br />
bzw. gewerblich eingesetzten<br />
Pumpensystemen ist enorm, wie<br />
die folgenden Beispiele vor Augen<br />
führen:<br />
In der chemischen Industrie sind<br />
490 000 Pumpen für Transport<br />
Energy Movement Pumpen der verborgene Antrieb.<br />
© Grundfos<br />
und Verarbeitung unterschiedlichster<br />
Medien installiert.<br />
Für die jährliche Produktion von<br />
4,67 Millionen Fahrzeugen in<br />
Deutschland sind in der Automobilindustrie<br />
70 000 Pumpen<br />
im Einsatz.<br />
Am Frankfurter Flughafen arbeiten<br />
über 3000 Pumpen sieben<br />
Tage die Woche – in den Heizanlagen,<br />
zur Kühlung und Belüftung<br />
sowie im Sanitärbereich.<br />
Deutschlandweit helfen 23 000<br />
Pumpen bei der jährlichen<br />
Produktion von 100 Millionen<br />
Hektolitern Bier.<br />
In der Praxis müssen die meisten<br />
Motoren dieser Pumpen lediglich<br />
5 % ihrer Betriebszeit mit höchster<br />
Drehzahl arbeiten. Eine falsche<br />
Pumpengröße und nicht regulierte<br />
Drehzahlen sorgen täglich für massive<br />
Energieverluste.<br />
Brennecke: „Pumpen und deren<br />
Motoren verbrauchen derzeit weltweit<br />
10 % der elektrischen Energie.<br />
Mit unserer Initiative ‚Energy Movement‘<br />
zeigen wir: Energieeffizienz<br />
ist die sauberste, sicherste und wirtschaftlichste<br />
Energiequelle, die wir<br />
haben.“<br />
Weitere Informationen:<br />
www.grundfos.de<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 691
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Erfahrungsaustausch über Kunststoffverarbeitung<br />
IKV-<br />
Erfahrungsaustausch<br />
bei<br />
PLASSON.<br />
Das Institut für Kunststoffverarbeitung<br />
an der RWTH Aachen<br />
(IKV) veranstaltet jährlich einen<br />
Erfahrungsaustausch zum Thema<br />
Kunststoffverarbeitung für die Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung nach dem<br />
DVGW-Regelwerk GW 330/331.<br />
Diese Fachveranstaltung richtet sich<br />
deutschlandweit an alle IKV-Kunststoffausbilder<br />
sowie Schweißaufsichtspersonen<br />
der Versorgungsunternehmen.<br />
Gastgeber war in diesem Jahr<br />
die PLASSON GmbH aus Wesel. In<br />
der Zeit vom 20. bis zum 22. Juni<br />
2011 wurden den über 60 Teilnehmern<br />
in Wesel Innovationen im Segment<br />
der Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
vermittelt. Mit den vielfältigen<br />
Themenbereichen aus Wirtschaft<br />
und Wissenschaft verschafften die<br />
Referenten aus Industrie und Versorgung<br />
den Ausbildern und<br />
Schweißaufsichtspersonen einen<br />
umfangreichen Überblick über<br />
neue Werkstoff-, System- sowie<br />
Schweißgeräteentwicklungen.<br />
Ein anschließender Praxisworkshop<br />
bei PLASSON rundete das Programm<br />
ab. Durch den jährlich stattfindenden<br />
Erfahrungsaustausch<br />
wird die Aktualität der bundesweit<br />
durchgeführten Lehrgänge optimiert.<br />
Bundesweit werden über dieses<br />
System weit über 6000 PE-<br />
Schweißer pro Jahr auf hohem<br />
Niveau qualifiziert.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.plasson.de<br />
Verbesserte Technik macht Klärschlammver brennung<br />
auch für kleinere Kläranlagen wirtschaftlich<br />
Klärschlamm lässt sich anders als Abfall nicht vermeiden. Im Gegenteil: durch die gestiegene Qualität der<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung haben auch die Klärschlammmengen zugenommen. Wurde Klärschlamm früher weitestgehend<br />
landwirtschaftlich verwertet, mehren sich verstärkt die Forderungen, Klärschlamm auf andere Art und<br />
Weise zu verwerten. Dies zum einen, um die im Klärschlamm enthaltenen Schadstoffe nicht in den Naturkreislauf<br />
zurückzuführen, aber auch weil Klärschlamm über chemisch gespeicherte Energie verfügt, die energetisch<br />
genutzt werden kann.<br />
Seit Oktober 2006 darf Klärschlamm<br />
in der Schweiz nicht<br />
mehr als Dünger in die Landwirtschaft<br />
ausgebracht werden, denn<br />
Klärschlamm enthält insbesondere<br />
viele Schwermetalle wie z. B. Quecksilber,<br />
die für Mensch und Umwelt<br />
problematisch sein können. Auch in<br />
Österreich ist das Ausbringen von<br />
Klärschlamm in einigen Bundesländern<br />
nicht mehr erlaubt.<br />
In Deutschland fielen im Jahr<br />
2008 2,1 Mio. Tonnen Klärschlamm<br />
(Trockenmasse) an. Durchschnittlich<br />
wurde davon die Hälfte des<br />
Klärschlamms landwirtschaftlich<br />
genutzt. Insbesondere in ländlich<br />
strukturierten Gebieten liegt die<br />
landwirtschaftliche Verwertung<br />
sogar bei rund 75 %.<br />
Doch seit einiger Zeit werden<br />
auch in Deutschland die zulässigen<br />
Schadstoffgehalte für landwirtschaftlich<br />
ausgebrachten Klärschlamm<br />
diskutiert. Eine weitere<br />
Verschärfung der Schadstoff-Grenzwerte<br />
ist mit der im nächsten Jahr<br />
erwarteten Novellierung der deutschen<br />
Klärschlammverordnung vorgesehen.<br />
Für einen größer werdenden<br />
Anteil von Klärschlamm muss<br />
deshalb mittel- und langfristig ein<br />
neuer wirtschaftlich und ökologisch<br />
Juli/August 2011<br />
692 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
sinnvoller Entsorgungsweg gefunden<br />
werden.<br />
Eine unter beiden Gesichtspunkten<br />
interessante Möglichkeit<br />
bietet die Monoverbrennung und<br />
thermische Nutzung von Klärschlamm.<br />
Denn der Brennwert von<br />
getrocknetem Klärschlamm ist gut,<br />
er entspricht dem hochwertiger<br />
Braunkohle. Außerdem werden bei<br />
diesem Verbrennungsprozess nicht<br />
nur die Schadstoffe eliminiert,<br />
denn er bietet als einziger die<br />
Möglichkeit, den im Klärschlamm<br />
enthaltenen Rhostoff Phospor<br />
zurückzugewinnen.<br />
Die Lambion Energy Solutions<br />
GmbH hat aus diesem Grund die<br />
Feuerungstechnik für diesen speziellen<br />
Biomasse-Brennstoff weiterentwickelt.<br />
Mit dieser verbesserten<br />
Technik (Deutsche Gebrauchsmusteranmeldung<br />
20 2010 016296.3)<br />
wird eine optimale Verbrennung<br />
von getrocknetem Klärschlamm<br />
erzielt, die das Problem der Brennraumverschlackung<br />
löst und den<br />
Wirkungsgrad der Anlagen weiter<br />
verbessert hat. Hierdurch wird die<br />
thermische Nutzung von Klärschlamm<br />
auch für kleinere Kläranlagen<br />
wirtschaftlich.<br />
Im Wesentlichen basiert die<br />
Lambion-Technik auf dem Einsatz<br />
einer rotierenden Zerkleinerungsvorrichtung<br />
für getrockneten Klärschlamm<br />
(Filterkuchen) und einer<br />
optimierten Transportvorrichtung.<br />
Da die einzelnen Klärschlammpartikel<br />
über unterschiedliche Brenneigenschaften<br />
verfügen, werden die<br />
getrockneten Partikel vor Eintritt<br />
in die Brennkammer zermahlen.<br />
Brennbare und schlecht brennbare<br />
Bestandteile des Filterkuchens werden<br />
fein vermischt und auf eine<br />
Größe modifiziert. Hierdurch entsteht<br />
ein optimierter, gleichförmiger<br />
Brennstoff; eine Voraussetzung<br />
für einen hohen Wirkungsgrad einer<br />
Biomassefeuerung.<br />
Das Zermahlen des Brennstoffes<br />
erfolgt bei der Lambion-Technik<br />
INFO<br />
Lambion ist seit über 90 Jahren mit technischen Innovationen<br />
richtungsweisend in der Feuerungstechnologie. Heute ist die<br />
Lambion Energy Solutions GmbH der Spezialist für individuelle<br />
Biomasse- Heizwerke und Kraftwerke für feste Brennstoffe auf Basis<br />
der modernen Bio-Reststoff-Technologie für Industriegrößen von<br />
1–30 MWth. Lambion liefert heute schlüsselfertige Kraftwerkstechnologie<br />
inklusive Energiekonzept.<br />
innerhalb des Brennerkopfs mit<br />
einer speziell entwickelten Luftzufuhreinrichtung.<br />
Anhaftungen und Verklumpungen<br />
des Brennstoffs werden durch<br />
automatisierte Vibrationsbewegungen<br />
im Brennerkopf vermieden.<br />
Hierdurch ist auch bei dauerhaftem<br />
Betrieb ein hoher Brennstoffdurchsatz<br />
gewährleistet.<br />
Mit einer speziell entwickelten<br />
Klärschlamm-Luftzufuhreinrichtung<br />
wird der Brennstoff automa tisiert<br />
und exakt dosiert in den Brennraum<br />
transportiert. Ein gleichmäßiges<br />
Brennbett und eine optimale Brennstoffausnutzung<br />
entstehen.<br />
Mit der aus der Verbrennung<br />
entstehenden Abwärme kann der<br />
Klärschlamm übrigens auch ge -<br />
trocknet werden, sodass der Einsatz<br />
fossiler Brennstoffe komplett vermieden<br />
werden kann.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.lambion.de<br />
Getrockneter<br />
Klärschlamm.<br />
Klärschlammprobe<br />
im Glas.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 693
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Kunden mit Leistungen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
sehr zufrieden<br />
Trinkwasser aus dem <strong>Wasser</strong>hahn<br />
wird von den Kunden in<br />
Deutschland hoch geschätzt. Die<br />
Verbraucher bescheinigen den<br />
Unternehmen der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
hohe Zuverlässigkeit<br />
und Leistungsfähigkeit. Dies bestätigt<br />
das aktuelle „Kundenbarometer<br />
<strong>Wasser</strong> 2011“, das im Auftrag des<br />
Bundesverbandes der Energie- und<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft (BDEW) erhoben<br />
wurde. Rund 91 Prozent der Verbraucher<br />
bestätigen demnach die<br />
hohe Zuverlässigkeit der <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
„Die Kunden sind nach wie vor<br />
sehr zufrieden mit den Leistungen<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft und der<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft. In den Zahlen<br />
spiegelt sich das hohe Vertrauen<br />
der Kunden wider. Auch weiterhin<br />
hat die hervorragende Qualität der<br />
Trinkwasserversorgung sowie der<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung höchste Priorität“,<br />
sagte Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer<br />
<strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong><br />
des BDEW, zu den Ergebnissen des<br />
Kundenbarometers.<br />
Der lokale Versorger wird von<br />
den Kunden als wichtig für die<br />
Region angesehen. Knapp 80 Prozent<br />
sehen die hohe Bedeutung.<br />
Den Preis für Trinkwasser bewerten<br />
rund 80 Prozent der Befragten als<br />
angemessen bis sehr gut. Die<br />
Gesamtzufriedenheit mit den<br />
Unternehmen der <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
liegt bei fast 87 Prozent.<br />
Kritisch bewertet wird lediglich<br />
das Thema <strong>Wasser</strong>härte: 53 Prozent<br />
der Befragten sehen in Bezug auf<br />
den Kalkgehalt ihre Erwartungen<br />
nicht erfüllt. Bestimmt wird der<br />
Gehalt an Mineralien, also an Kalzium,<br />
durch die Geologie der<br />
Region, in der das <strong>Wasser</strong> gewonnen<br />
wird. Tatsächlich ist hartes <strong>Wasser</strong><br />
besonders reich an Kalzium und<br />
unterstützt somit die Mineralstoffzufuhr<br />
für den menschlichen Körper.<br />
Dieses Wissen ist, so zeigen<br />
auch andere Befragungen des<br />
BDEW, bei den Kunden noch nicht<br />
präsent.<br />
Die Umfrage wurde in Privathaushalten<br />
im gesamten Bundesgebiet<br />
durchgeführt. Ziel ist es, die<br />
Stimmungslage bei den Verbrauchern<br />
zu ermitteln und die Zufriedenheit<br />
der Kunden mit den Leistungen<br />
der deutschen Trinkwasserver-<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorger zu<br />
erfahren.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.bdew.de<br />
Karl-Imhoff-Preis der DWA ausgeschrieben<br />
Wichtiger Umweltpreis wird 2012 in Magdeburg vergeben<br />
Die Deutsche Vereinigung für<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong><br />
und Abfall e. V. (DWA) hat den Karl-<br />
Imhoff-Preis als DWA-Umweltpreis<br />
ausgeschrieben. Der Preis wird aufgrund<br />
von Bewerbungen verliehen,<br />
die Preisverleihung erfolgt im Rahmen<br />
der DWA-Bundestagung im<br />
September 2012 in Magdeburg.<br />
Bewerbungen werden bis zum<br />
31. August 2011 von der Bundesgeschäftsstelle<br />
der DWA angenommen.<br />
Der Karl-Imhoff-Preis dient der<br />
Förderung wissenschaftlicher Arbeiten<br />
auf den Arbeitsgebieten der<br />
Vereinigung und wird für hervorragende<br />
Forschungsarbeiten, Dissertationen<br />
oder Prüfungsarbeiten<br />
vergeben. Er ist mit 10 000 Euro<br />
dotiert. Außerdem können Belobigungen<br />
ausgesprochen werden.<br />
Der Preis wurde von der damaligen<br />
<strong>Abwasser</strong>technischen Vereinigung<br />
(ATV) im Jahr 1956 ins Leben<br />
gerufen. Dr.-Ing. Karl Imhoff (1876–<br />
1965) war ein Ingenieur und Pionier<br />
der <strong>Abwasser</strong>technik, die er jahrzehntelang<br />
prägte. Bis 1934 war er<br />
Geschäftsführer des Ruhrverbands.<br />
Nach ihm sind das Imhoff-Becken<br />
und der Imhoff-Trichter benannt. Die<br />
DWA will mit dem Karl-Imhoff-Preis<br />
die großen Verdienste, die sich der<br />
Namensgeber um die deutsche und<br />
internationale <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
erworben hat, würdigen<br />
sowie damit zur bleibenden<br />
Erinnerung an sein Wirken beitragen.<br />
Antragsunterlagen<br />
Bewerbungen sind an die Bundesgeschäftsstelle<br />
in Hennef zu richten.<br />
Beizufügen sind in sechsfacher Ausfertigung:<br />
Angaben über Name,<br />
Geburtsdatum, Ausbildungsgang<br />
(Lebenslauf) und Anschrift<br />
des Bewerbers,<br />
die der Bewerbung zugrunde<br />
liegende Arbeit,<br />
eine Versicherung an Eides statt,<br />
dass die eingereichte Arbeit<br />
von dem Bewerber selbst<br />
angefertigt ist,<br />
Kurzfassung/Zusammenfassung.<br />
Adresse für Bewerbungen:<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle, Elke Uhe,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-238, Fax (02242) 872-135,<br />
E-Mail: uhe@dwa.de, www.dwa.de,<br />
dort: Wir über uns, Ehrungen und<br />
Auszeichnungen<br />
Juli/August 2011<br />
694 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Gütegemeinschaft Güteschutz<br />
Grundstücksentwässerung gegründet<br />
Führende Akteure der Branche bündeln ihre Kräfte<br />
Am 11. Mai 2011 wurde in Hennef (Sieg) die Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
gegründet. Ziel der neuen Gütegemeinschaft ist die Verbesserung der Qualität von Anlagen der Grundstücksentwässerung<br />
und insbesondere die Vermeidung von eventuellen Verunreinigungen von Grundwasser,<br />
Gewässern und Boden durch undichte Anlagen. Sie ist eine Gütegemeinschaft im Sinne der RAL-Grundsätze<br />
für Gütezeichen; dieser Weg wurde aufgrund der guten Erfahrungen mit der RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
gewählt.<br />
Neben der DWA und ihrem wirtschaftlichen<br />
Schwesterverein<br />
GFA waren an der Gründung des<br />
neuen Vereins beteiligt der Güteschutz<br />
Kanalbau (Bad Honnef), die<br />
Überwachungsgemeinschaft Technische<br />
Anlagen der SHK-Handwerke<br />
e. V. (Sankt Augustin), der Zentralverband<br />
Sanitär, Heizung, Klima<br />
(ZVSHK, Sankt Augustin), die Firmen<br />
Bochtler GmbH und die PKT Pader<br />
Kanal Technik – Rohrfrei GmbH & Co.<br />
KG sowie als förderndes Mitglied die<br />
Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik<br />
e. V. (GET, Diez). Vereinssitz<br />
ist Hennef. Zum Vorsitzenden wurde<br />
Bauass. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Flick<br />
(Mitglied des Vorstands der DWA)<br />
gewählt, zum stellvertretenden<br />
Vorsitzenden wählte die Gründungsversammlung<br />
Fritz Schellhorn<br />
(Mitglied des Vorstands des ZVSHK).<br />
Geschäftsführer wird Dipl.-Ing. Dirk<br />
Bellinghausen (42). Bellinghausen<br />
hat an der RWTH Aachen Bauingenieurwesen<br />
studiert und war zuletzt<br />
geschäftsführender Gesellschafter<br />
der Bellinghausen Kanalsystem<br />
GmbH in Sankt Augustin.<br />
Die Gütegemeinschaft hat die<br />
Aufgabe, die Herstellung, den baulichen<br />
Unterhalt, die Sanierung und<br />
Prüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
gütezusichern. Dabei<br />
werden Leistungen, deren Güte<br />
gesichert ist, mit dem Gütezeichen<br />
Grundstücksentwässerung gekennzeichnet.<br />
Hierfür werden Güte- und<br />
Prüfbestimmungen, eine Güte zeichensatzung<br />
und Durchführungsbestimmungen<br />
geschaffen. Gleichzeitig<br />
wird überwacht, ob Gütezeichenbenutzer<br />
die Gütezeichensatzung<br />
einhalten.<br />
Mitglieder der Gütegemeinschaft<br />
können sein bundesweit<br />
tätige Organisationen, deren Mitgliedsunternehmen<br />
im Bereich der<br />
Grundstücksentwässerung tätig<br />
sind, aber auch einzelne Betriebe<br />
und natürliche und juristische<br />
Personen. Die eigentliche Gütesicherung<br />
obliegt dem eigens eingerichteten<br />
Güteausschuss, der aus<br />
mindestens sechs Personen besteht.<br />
Dem zweiköpfigen, ehrenamtlichen<br />
Vorstand der Gütegemeinschaft<br />
gehören je ein Vertreter der<br />
DWA und des ZVSHK an. Der bis<br />
zu 17 Personen starke Fachbeirat<br />
soll aus Repräsentanten zahlreicher<br />
anderer Organisationen und Fachkreise,<br />
darunter die Bauwirtschaft,<br />
die kommunalen Spitzenverbände,<br />
die Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft,<br />
der Versicherungswirtschaft,<br />
bestehen.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.dwa.de<br />
Die Qualität<br />
von Grundstücksentwässerungen<br />
soll<br />
künftig besser<br />
werden.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 695
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Landgericht Bonn verneint Gleichwertigkeit<br />
der Angebote<br />
Gütesicherung Kanalbau und Fremdüberwachung Kanalbau der Zertifizierung Bau e.V.<br />
Öffentliche Auftraggeber und<br />
Auftragnehmer haben mit der<br />
Gütesicherung Kanalbau differenzierte<br />
Anforderungen an die Qualifikation<br />
ausführender Unternehmen<br />
formuliert. Diese gemeinsam<br />
definierten Anforderungen haben<br />
Auftraggeber zur Grundlage ihrer<br />
Vergabe gemacht.<br />
Auftraggeber legen Wert auf<br />
Neutralität bei der Prüfung, ob<br />
Unternehmen diese Anforderungen<br />
erfüllen. Die Bewertung der Bietereignung<br />
stellt allerhöchste Ansprüche<br />
an die Unparteilichkeit der<br />
Organisation, die mit dieser Bewertung<br />
befasst ist. Daher sind sowohl<br />
Auftraggeber als auch Auftragnehmer<br />
Mitglied in der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau. Es besteht damit<br />
ein grundlegender struktureller<br />
Unterschied zwischen der Gütesicherung<br />
RAL-GZ 961 und anderen<br />
Zertifizierungen in diesem Bereich.<br />
Die Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
hat Auftraggeber schriftlich über<br />
diese Unterschiede der Gütesicherung<br />
Kanalbau zur „Fremdüberwachung<br />
im Kanalbau“ der Zertifizierung<br />
Bau e.V. informiert. Die<br />
Zertifizierung Bau e.V. hatte daraufhin<br />
versucht, weite Teile dieses<br />
Schreibens gerichtlich untersagen<br />
zu lassen. Das Landgericht Bonn hat<br />
in der Verhandlung am 30. März<br />
2011 klargestellt, dass diese Klage<br />
zum weit überwiegenden Teil unbegründet<br />
ist und die Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau weiter darauf hinweisen<br />
darf, dass das Angebot der<br />
Zertifizierung Bau e.V. nicht gleichwertig<br />
der Gütesicherung RAL-GZ<br />
961 ist.<br />
Nach Ansicht des Gerichts<br />
konnte sich die Prüfung der Gleichwertigkeit<br />
von „Gütesicherung<br />
Kanalbau“ und „Fremdüberwachung<br />
im Kanalbau“ der Zertifizierung<br />
Bau e.V. darauf beschränken,<br />
ob die „Fremdüberwachung im<br />
Kanalbau“ in formaler Hinsicht den<br />
von RAL-GZ 961 vorgegebenen<br />
Strukturmerkmalen entspricht. Das<br />
Landgericht Bonn hat insoweit die<br />
Gleichwertigkeit der beiden Angebote<br />
verneint. Nach der Verhandlung<br />
ist die Gütegemeinschaft Ka -<br />
nalbau weiterhin nicht gehindert,<br />
wie folgt zu informieren: Das Angebot<br />
„Fremdüberwachung Kanalbau“<br />
des Zertifizierung Bau e.V. ist nicht<br />
gleichwertig mit der Gütesicherung<br />
Kanalbau. Es erfüllt nicht die Anforderungen<br />
der Gütesicherung RAL-<br />
GZ 961.<br />
Dem ist so, weil das, was Auftraggeber<br />
wollen und mit ihren Anforderungen<br />
an die Eignung und technische<br />
Leistungsfähigkeit voraussetzen,<br />
nicht erfüllt ist:<br />
Güte- und Prüfbestimmungen,<br />
beschlossen mit paritätischen<br />
Stimmen von Auftraggebern<br />
und Auftragnehmern,<br />
vom RAL anerkannter Güteausschuss.<br />
Dieser ist besetzt mit Vertretern<br />
der Auftraggeber und<br />
Auftragnehmer,<br />
vom Güteausschuss beauftragte<br />
Prüfingenieure. Dieses sichert<br />
die einheitliche Qualität der Prüfungen,<br />
Vorlage aller Prüfberichte im<br />
Güteausschuss, mit transparenter<br />
und jederzeit nachvollziehbarer<br />
Beschlussfassung.<br />
Ebenfalls kann die Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau weiter darauf hinweisen,<br />
dass es sich bei der von der<br />
Zertifizierung Bau e.V. angebotenen<br />
„Fremdüberwachung im Kanalbau“<br />
um eine Prüfung und Überwachung<br />
von Lieferanten (Auftragnehmern)<br />
durch eine Organisation der Lieferanten<br />
(Auftragnehmer) handelt.<br />
In dem auf Vorschlag des<br />
Gerichts geschlossenen Vergleich<br />
hat sich der Güteschutz Kanalbau<br />
lediglich verpflichtet, die fehlende<br />
Gleichwertigkeit beider Systeme<br />
künftig nicht mit Hinweis auf DIN<br />
EN 1610, Nr. 15 und Anhang C zu<br />
begründen. Das Gericht war der<br />
Auffassung, dass hierin keine zwingenden<br />
Anforderungen an Systeme<br />
zur Eignungsprüfung formuliert<br />
sind.<br />
Kontakt:<br />
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau,<br />
Postfach 1369,<br />
D-53583 Bad Honnef,<br />
Tel. (02224) 9384-0,<br />
Fax (02224) 9384-84,<br />
E-Mail: info@kanalbau.com,<br />
www.kanalbau.com<br />
Juli/August 2011<br />
696 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Nutzen für Umwelt und Gesellschaft<br />
Die Hansgrohe AG und ihr Chefchemiker Andreas Fath erhalten den<br />
UMSICHT-Wissenschaftspreis 2011<br />
Die Hansgrohe AG und ihr Chefchemiker<br />
Dr. Andreas Fath<br />
wurden am 06. Juli 2011, mit dem<br />
renommierten UMSICHT-Wissenschaftspreis<br />
ausgezeichnet, den der<br />
Förderverein des Fraunhofer-Instituts<br />
für Umwelt-, Sicherheits- und<br />
Energietechnik jährlich vergibt.<br />
Prämiert wurde eine vom Schwarzwälder<br />
Armaturen- und Brausenspezialisten<br />
entwickelte umweltfreundliche<br />
Filtertechnologie, mit<br />
der es gelingt, die Schadstoffbelastung<br />
von Galvanikabwässern drastisch<br />
zu reduzieren. „Wir hoffen, dass<br />
unsere Technologie in einigen Jahren<br />
breite Anwendung findet. Sie<br />
könnte ein wichtiger Baustein für<br />
den Gewässer- und Umweltschutz<br />
in industriell geprägten Regionen<br />
sein“, betonte Andreas Fath, der<br />
Erfinder des zukunftweisenden Verfahrens,<br />
anlässlich der Preisverleihung<br />
im Rahmen des Oberhausener<br />
Wirtschaftsforums.<br />
„Vorreiterrolle in Sachen<br />
Nachhaltigkeit“<br />
Der mit 10000 Euro dotierte<br />
UMSICHT-Wissenschaftspreis würdigt<br />
herausragende Arbeiten in den<br />
Bereichen Umwelt-, Sicherheitsund<br />
Energietechnik. Vergabeentscheidend<br />
sind dabei nicht allein<br />
das Niveau der wissenschaftlichen<br />
Arbeit und ihr Innovationsgrad.<br />
Andreas Fath und sein Team haben<br />
die Jury – so heißt es in deren<br />
Begründung – zudem mit der<br />
„hohen Praxisrelevanz“ ihres Projekts<br />
zur Zersetzung von Perfluorierten<br />
Tensiden (PFT) im Galvanikabwasser<br />
und „wegen des Nutzens<br />
für Umwelt und Gesellschaft“ überzeugt.<br />
Entsprechend groß war auch<br />
die Freude beim ausgezeichneten<br />
Unternehmen. „Der UMSICHT-Preis<br />
ist eine Auszeichnung, auf die alle<br />
bei Hansgrohe sehr stolz sind, und<br />
eine tolle Anerkennung für Andreas<br />
Fath und sein Team“, erklärte Siegfried<br />
Gänßlen, Vorstandsvorsitzender<br />
der Hansgrohe AG. „Denn wir<br />
nehmen unsere Verantwortung für<br />
die Umwelt und die Ressource<br />
<strong>Wasser</strong> sehr ernst. Wir freuen uns,<br />
dass wir dank hochqualifizierter<br />
und engagierter Mitarbeiter wie<br />
Andreas Fath im Bereich Umwelttechnologien<br />
Pionierarbeit auf<br />
hohem wissenschaftlichen Niveau<br />
leisten können. Den Preis verstehen<br />
wir daher auch als Anerkennung der<br />
Vorreiterrolle, die wir in Sachen<br />
Nachhaltigkeit spielen und von der<br />
auch andere Unternehmen profitieren.“<br />
Aus diesem Grund werde<br />
das Unternehmen das Preisgeld für<br />
die Förderung von Forschungsarbeiten<br />
im Bereich Umwelttechnologien<br />
und Gewässerschutz stiften.<br />
Perfluorierte Tenside (PFT) kommen<br />
in galvanischen Prozessen zum<br />
Einsatz – beispielsweise bei der Verchromung.<br />
Sie gewährleisten nicht<br />
nur eine gleichmäßige und stabile<br />
Beschichtung, sondern sind auch<br />
aus Gründen der Arbeitssicherheit<br />
unverzichtbar, um die Tröpfchenbildung<br />
aus gefährlichen Lösungen<br />
und das Entweichen giftiger Chrom-<br />
Dämpfe am Arbeitsplatz zu vermeiden.<br />
Allerdings gelten sie, wie<br />
man inzwischen weiß, hinsichtlich<br />
ihrer langfristigen Wirkungen auf<br />
Gesundheit und Umwelt als be -<br />
denklich. Die Hansgrohe AG und ihr<br />
Chefchemiker ergriffen daher die<br />
Initiative und entwickelten in einem<br />
gemeinsamen Pilotprojekt mit dem<br />
Umweltministerium des Landes<br />
Baden-Württemberg eine automatisierte<br />
Anlage zur Reduzierung der<br />
PFT aus dem Galavanikabwasser.<br />
Dabei wird ein elektroche mischer<br />
Prozess angewandt, der die Tenside<br />
in Fluorsäure, <strong>Wasser</strong> und Kohlendioxid<br />
mineralisiert. Somit verbleiben<br />
Prof. Dr.-Ing. Görge Deerberg, stellv. Institutsleiter<br />
Fraunhofer UMSICHT, Frank Lichtenheld,<br />
Wirtschaftsförderung Oberhausen, Wilhelm Kurze,<br />
Karl Maria Laufen Buchhandlung und Verlag,<br />
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Weidner, Institutsleiter<br />
Fraunhofer UMSICHT, Preisträger Dr. Andreas Fath,<br />
Schirmherr Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer,<br />
Wissenschaftsforum Ruhr e.V., Preisträgerin<br />
Dr. Barbara Kruse, Preisträger Dr. Arndt Reuning,<br />
Dr. Thomas Mathenia, Vorstand des UMSICHT-<br />
Förderverereins und Vorstand der EVO AG.<br />
keine Rückstände im <strong>Abwasser</strong>. Die<br />
Hansgrohe AG setzt das Verfahren<br />
bereits seit 2010 erfolgreich in ihren<br />
Werken in Schiltach und Offenburg<br />
ein.<br />
„Der Einsatz von chemischen<br />
Stoffen in der Galvanik bleibt unverzichtbar“,<br />
so Andreas Fath. „Umso<br />
wichtiger ist es, kontinuierlich nach<br />
innovativen Lösungen zu suchen,<br />
um Mensch und Umwelt so wenig<br />
wie möglich zu belasten. Die Hansgrohe<br />
AG hat sich daher im Rahmen<br />
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das<br />
Ziel gesetzt, den Einsatz von Gefahrstoffen<br />
bis 2014 um zehn Prozent zu<br />
senken. Das ausgezeichnete Verfahren<br />
leistet dazu einen wichtigen<br />
Beitrag.“<br />
Weitere Informationen:<br />
www.hansgrohe.com<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 697
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Rückblick: wat + WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
Die wat, die <strong>Wasser</strong>fachliche Aussprachetagung, fand in diesem Jahr erstmals unter dem Oberbegriff „wat +<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2011“ statt. Der neue Name steht für einen Kongress, der gemeinsam von<br />
allen relevanten Verbänden der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft unter Federführung des DVGW organisiert wurde.<br />
Entsprechend gut war die Veranstaltung besucht. Über 1500 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um in der<br />
Zeit vom 2. bis 5. Mai Fachvorträge und Diskussionen zu verfolgen und die angrenzende Fachmesse WASESER<br />
BERLIN INTER NATIONAL zu besuchen.<br />
Wie bei den beteiligten Verbänden<br />
nicht anderes zu<br />
erwarten, zeichnete sich die Veranstaltung<br />
durch ein breites<br />
Themenspektrum aus. Mehr als<br />
120 hochkarätige Experten aus<br />
Forschung, Wirtschaft und Politik<br />
berichteten in 18 Themenblöcken<br />
über nahezu alles, was die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
derzeit bewegt. Zum Beispiel<br />
den „Dauerbrenner“ Sicherheit<br />
in der Trinkwasserversorgung. Um<br />
das Fazit gleich vorweg zu nehmen:<br />
Wenn sich alle an die Technischen<br />
Regeln des DVGW halten würden,<br />
gäbe es deutlich weniger Sanierungsbedarf,<br />
hieß es. Während die<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung bis zum Hausanschluss<br />
in höchster Qualität erfolgt,<br />
können dagegen Probleme in der<br />
häuslichen Infrastruktur auftreten,<br />
beispielsweise durch eine Verkeimung<br />
des <strong>Wasser</strong>s. Die Ursachen<br />
dafür sind unterschiedlich. <strong>Wasser</strong>,<br />
das zu lange in der Leitung steht<br />
oder zu warm ist, ist besonders<br />
anfällig für die Bildung von Legionellen.<br />
Abhilfe können hier an den<br />
tatsächlichen Verbrauch angepasste<br />
Speichergrößen, regelmäßige<br />
Wartungsarbeiten und die Einhaltung<br />
der Leitungstemperatur<br />
nach DVGW W 551 schaffen. Für<br />
weiteren Handlungsbedarf sorgen<br />
eine über die Jahre veränderte<br />
Wohnraumnutzung und Fehler bei<br />
der Installation. Laut einer Erhebung<br />
des <strong>Wasser</strong>hygiene-Experten<br />
Rainer Kryschi gehen 37 Prozent<br />
von über 300 untersuchten Schäden<br />
auf eine falsche Planung<br />
zurück; in 33 Prozent waren die Installationsarbeiten<br />
schlecht durchgeführt.<br />
Desinfektion nur zur<br />
Gefahrenabwehr<br />
Ein anderes Thema, das auf dem<br />
Kongress behandelt wurde, waren<br />
Armaturen, die zur Sicherung der<br />
<strong>Wasser</strong>qualität im häuslichen Verteilbereich<br />
eingesetzt werden. Es<br />
wurde darauf hingewiesen, dass<br />
DIN 1717 für den aktuellen Stand<br />
der Technik steht. Konkret verhindern<br />
die Armaturen, dass verunreinigtes<br />
<strong>Wasser</strong> über Rückdrücke und<br />
Rücksaugen aus Geräten in den<br />
<strong>Wasser</strong>kreislauf gelangen. Obwohl<br />
hier intensiv informiert und mit<br />
dem Handwerk gesprochen wird,<br />
sind laut Aussage der Fachleute<br />
immer wieder gravierende Mängel<br />
bei der Installation anzutreffen. Ist<br />
das „Kind dann in den Brunnen<br />
gefallen“, bleibt oftmals nur die<br />
Desinfektion des betroffen Verteilsystems.<br />
Im Kongress war man sich<br />
weitestgehend einig, dass dies aber<br />
nur eine vorübergehende Maßnahme<br />
sein kann. Grundsätzlich<br />
gelte, die Desinfektion nur zur<br />
Gefahrenabwehr einzusetzen und<br />
nur so viel zu desinfizieren, wie<br />
wirklich erforderlich ist.<br />
Darüber hinaus ging es im Kongress<br />
um „Eingriffe“ in den Boden,<br />
wie sie zum Beispiel bei der Geothermie<br />
vorkommen. Vor dem Hintergrund<br />
der zunehmenden Verbreitung<br />
dieser Technologie spiele<br />
die Qualität der Bohrungen und der<br />
anschließenden Installation der<br />
Erdsonden eine wichtige Rolle, hieß<br />
es in Berlin. Bohren würden viele<br />
Firmen, doch ob sie auch die notwendige<br />
Erfahrung für die jeweilige<br />
geologische Beschaffenheit haben,<br />
stehe auf einem anderen Blatt. Ein<br />
Qualitätskriterium ist derzeit die<br />
DVGW-Regel W 120, die seit 20 Jahren<br />
den Standard für die Planung<br />
und den Bau in der <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
darstellt. Für noch mehr Qualität<br />
soll sie künftig durch eine neue<br />
Juli/August 2011<br />
698 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
W 120, die aktuell im Umsetzungsprozess<br />
ist, abgelöst werden. Karl<br />
Heinz Stawiarski vom Bundesverband<br />
Wärmepumpen e. V. empfahl<br />
in diesem Zusammenhang, bei der<br />
Planung die Bedingungen vor Ort<br />
genau zu berücksichtigen, nur<br />
hochwertige Komponenten einzusetzen<br />
und diese aufeinander abzustimmen<br />
sowie auf die exakte Ausführung<br />
der Bohrarbeiten und das<br />
anschließende Verpressen der Bohrlöcher<br />
zu achten. Zusätzlich sprach<br />
er sich für eine Anzeigepflicht für<br />
Sondenbohrungen aus. Derzeit gibt<br />
es in Deutschland rund 400 000<br />
Wärmepumpen, bis zum Jahr 2030<br />
sollen es nach Aussage des Bundesverbandes<br />
Wärmepumpen über<br />
zwei Millionen sein.<br />
Bedarf an innovativen<br />
Technologien<br />
Von den „Eingriffen“ in den Boden<br />
war es nur ein kurzer thematischer<br />
Sprung bis zum Spannungsverhältnis<br />
zwischen Pflanzen- und Gewässerschutz.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
wies Frieder Haakh vom<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart, darauf hin, dass<br />
die Belastungssituation durch Metaboliten<br />
im Trinkwasser uneinheitlich<br />
gesehen werde. Auch der rechtliche<br />
Rahmen, der einmal den Pflanzenschutz<br />
behandelt und zum anderen<br />
die Trinkwasserqualität regelt, helfe<br />
hier nicht weiter. Es handle sich<br />
um zwei unterschiedliche Rechtsbereiche,<br />
die nicht optimal aufeinander<br />
abgestimmt sind. Dass das<br />
Thema weiter eng verfolgt werden<br />
muss, ergebe sich schon alleine aus<br />
der Menge der verwendeten Pflanzenschutzmittel.<br />
In Deutschland<br />
werden pro Jahr 15 000 Tonnen Herbizide<br />
und 11 000 Tonnen Fungizide<br />
eingesetzt.<br />
Insgesamt eine Veranstaltung,<br />
die nicht nur aktuelle Branchenentwicklungen<br />
behandelte, sondern<br />
auch aufzeigte, dass in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
weiterhin ein hoher<br />
Bedarf an neuen Erkenntnissen und<br />
innovativen Technologien besteht.<br />
Schließlich geht es darum, sieben<br />
Milliarden Menschen unter veränderten<br />
klimatischen Verhältnissen<br />
und in immer mehr Megacities an<br />
eine leistungsfähige <strong>Wasser</strong>ver- und<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung anzuschließen.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.wasser-berlin.de<br />
1500 Teilnehmer<br />
informierten<br />
sich über<br />
aktuelle<br />
Themen.<br />
© WASSER BERLIN<br />
INTER NATIONAL<br />
Part of<br />
Die weltweit führende Messe<br />
für Industrie-, Trink und <strong>Abwasser</strong><br />
1 - 4 NOVEMBER<br />
AMSTERDAM • NL<br />
2011<br />
Besondere Aufmerksamkeit für die industrielle <strong>Wasser</strong>nutzung<br />
Präsentation herausragender integraler <strong>Wasser</strong>projekte auf der Plattform IAS<br />
Über 800 Aussteller aus 40 Ländern<br />
Gelegenheit zum Austausch mit tausenden Fachkollegen<br />
Sichern Sie sich hier Ihre Zugangskarte kostenfrei<br />
www.amsterdam.aquatechtrade.com<br />
Organised by:<br />
Co-located with:<br />
Supported by:
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft und Politik<br />
im Dialog<br />
DWA-Bundestagung 2011 mit neuem Konzept, Preisverleihung<br />
und hochkarätigem Vortragsprogramm<br />
Mit einem neuen Konzept präsentiert<br />
sich die Deutsche Vereinigung<br />
für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Ab -<br />
wasser und Abfall e. V. (DWA) bei<br />
ihrer diesjährigen Bundestagung<br />
am 26. und 27. September 2011 in<br />
Berlin. „Wir haben uns vorgenommen,<br />
unsere Rolle in der Politikberatung<br />
zu verstärken. Wir wollen in<br />
Berlin sichtbar sein und regelmäßig<br />
das Gespräch mit Politikern suchen“,<br />
erläutert DWA-Präsident Bauassessor<br />
Dipl. Ing. Otto Schaaf die neue<br />
Ausrichtung der Bundestagung. Der<br />
Schwerpunkt der Bundestagung<br />
unter dem Motto „<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und Politik im Dialog“ wird daher<br />
auf dem Gedankenaustausch zwischen<br />
Teilnehmenden und Politikern<br />
liegen.<br />
Die Bundestagung im neuen<br />
Zuschnitt soll künftig alle zwei Jahre<br />
in Berlin stattfinden. Im kommenden<br />
Jahr wird die DWA-Bundestagung<br />
in bekannter Form mit Vorträgen<br />
zu verschiedenen Schwerpunktthemen<br />
in Magdeburg zu<br />
Gast sein.<br />
DWA-Preisverleihung<br />
„William-Lindley-Rin g“<br />
Ein Höhepunkt der Bundestagung<br />
wird die Verleihung des William-<br />
Lindley-Ringes an den Klimaexperten<br />
und Umweltpolitiker Prof. Dr. Dr.<br />
h. c. Ernst Ulrich von Weizsäcker sein.<br />
Mit dem Ring ehrt die DWA von<br />
Weizsäckers langjährigen und engagierten<br />
Einsatz für den Klimaschutz.<br />
„Mit seiner Auffassung, ein verminderter<br />
Ressourcenverbrauch ge fährde<br />
nicht zwangsläufig den ökonomischen<br />
Wohlstand, vielmehr müssten<br />
Energie, <strong>Wasser</strong> und Rohstoffe effektiver<br />
genutzt werden, stützt von<br />
Weizsäcker die Arbeit der DWA, die<br />
sich für eine sichere und nachhaltige<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft stark macht“, be -<br />
gründet DWA-Präsident Otto Schaaf<br />
die Entscheidung für den Physiker<br />
und Biologen als Preisträger.<br />
Die DWA verleiht den William-<br />
Lindley-Ring prominenten Personen,<br />
die durch ihr Wirken die Ziele<br />
der DWA maßgeblich gefördert<br />
haben. Nach dem ehemaligen Bundesumweltminister<br />
Klaus Töpfer,<br />
dem Ex-Bundesbankpräsidenten<br />
Hans Tietmeyer und dem ehemaligen<br />
sächsischen Ministerpräsidenten<br />
Kurt Biedenkopf ist Ernst Ulrich<br />
von Weizsäcker die vierte Persönlichkeit,<br />
die die DWA mit dem<br />
William-Lindley-Ring auszeichnet.<br />
Der Ring hat seinen Namen im<br />
Gedenken an den englischen Ingenieur<br />
William Lindley, der im<br />
19. Jahrhundert zukunftsweisende<br />
Projekte im Kanalbau und in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung realisierte und<br />
als Wegbereiter der technischen<br />
Modernisierung gilt.<br />
Vorträge und Vortragende<br />
von Format<br />
Mit den Themen nachhaltige Energieversorgung,<br />
Gestaltung der<br />
deutschen und europäischen <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
wasserwirtschaftliche<br />
Herausforderungen einer modernen<br />
Großstadt, Einbindung der<br />
deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft in die<br />
Entwicklungszusammenarbeit<br />
sowie <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Wissenschaft<br />
und Technik im internationalen<br />
Dialog befassen sich die Fachvorträge,<br />
für die die DWA Prof.<br />
Jochen Flasbarth, Präsident des<br />
Umweltbundesamtes (UBA), Ministerialdirigent<br />
Dr. Fritz Holzwarth,<br />
Unterabteilungsleiter <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
im Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
(BMU), Dr.-Ing. Georg Grunwald,<br />
Vorstand Technik der Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe, Dipl.-Volkswirt Stefan<br />
Opitz, Abteilungsleiter <strong>Wasser</strong>,<br />
Energie, Transport der Deutschen<br />
Gesellschaft für Internationale<br />
Zusammenarbeit (GIZ) und Prof.<br />
Dr. Max G. Huber, Vizepräsident des<br />
Deutschen Akademischen Austauschdienstes<br />
(DAAD) gewinnen<br />
konnte.<br />
Aussteller zeigen Erzeugnisse<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Am Rande der Bundestagung präsentieren<br />
ausgewählte Firmen ihre<br />
Produkte und die neuesten Entwicklungen<br />
in der Branche.<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Grasstraße 11 • 45356 Essen<br />
Telefon (02 01) 8 61 48-60<br />
Telefax (02 01) 8 61 48-48<br />
www.aquadosil.de<br />
Tagungsprogramm sowie weiterführende<br />
Informationen:<br />
bundestagung.dwa.de<br />
Juli/August 2011<br />
700 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
NACHRICHTEN<br />
6 th IWA Specialist Conference on Membrane<br />
Technology for Water & Wastewater Treatment<br />
Die Stadt Aachen ist nicht nur<br />
eine besonders geschichtsträchtige<br />
Stadt – ihre historische<br />
Bedeutung reicht bis in das römische<br />
Reich zurück und im Mittelalter<br />
erlangte sie Berühmtheit als Lieblingspfalz<br />
von Karl dem Großen und<br />
spätere Krönungsstätte deutscher<br />
Kaiser. Es ist eine Stadt, für die <strong>Wasser</strong><br />
eine große Bedeutung hat, nicht<br />
sehr offensichtlich (Aachen verfügt<br />
über kein nennenswertes offenes<br />
Gewässer), dafür umso tiefgründiger.<br />
Der Name Aachen stammt von<br />
dem altgermanischen Wort Ahha,<br />
was nichts anderes als <strong>Wasser</strong><br />
bedeutet. Eines der ältesten Monumente<br />
in Aachen stellt der Elisenbrunnen<br />
dar, dessen heilende Wirkung<br />
schon die Römer zu schätzen<br />
wussten. Die schwefelhaltigen, warmen<br />
Quellen stellten auch einen tieferen<br />
Grund für die Bevorzugung<br />
dar, die der rheumakranke „Reisekaiser“<br />
Karl der Große Aachen in<br />
seinem mächtigen Reich gab. Heute<br />
spielen Wissenschaft und Technologie<br />
eine wichtige Rolle in der sehr<br />
universitär geprägten Stadt. Die<br />
RWTH-Aachen, die seit 2007 zur<br />
Exzellenz Initiative der deutschen<br />
Universitäten gehört, zeichnet sich<br />
besonders in den Gebieten der<br />
Ingenieurwissenschaften aus.<br />
Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
und die Aachener Verfahrenstechnik<br />
der RWTH-Aachen bieten<br />
seit 1997 alle zwei Jahre eine<br />
Plattform zum Wissensaustausch,<br />
zur Diskussion und Kommunikation<br />
über die mittlerweile untrennbar<br />
miteinander verbundenen Themen<br />
<strong>Wasser</strong> und Membranen. Die Aachener<br />
Tagung <strong>Wasser</strong> und Membranen<br />
wird im Oktober 2011 einmalig aussetzen,<br />
jedoch ersetzt werden durch<br />
ein internationales Ereignis. Die beiden<br />
Institute organisieren vom 4.<br />
bis 7. Oktober 2011 im Konferenzzentrum<br />
Eurogress die von der<br />
International Water Association<br />
(IWA) ins Leben gerufene und unterstützte<br />
„6 th IWA Specialist Conference<br />
on Membrane Technology for<br />
Water & Wastewater Treatment“. Zu<br />
dieser Tagung werden Experten aus<br />
der ganzen Welt erwartet, die in 140<br />
Vorträgen und etwa 140 Postern<br />
ihre Forschungsergebnisse zu den<br />
Themen<br />
Trinkwasseraufbereitung<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Industrielle <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>kreisläufe in der Industrie<br />
<strong>Abwasser</strong>wiederverwendung<br />
Membranmaterialien<br />
Innovative Membran-Konfigurationen<br />
Membranbioreaktoren<br />
Fouling und Reinigungsstrategien<br />
Entsalzung<br />
Konzentratbehandlung<br />
Dezentrale Systeme<br />
Prozessmodellierung<br />
Prozessoptimierung – Moduldesign<br />
und Energiereduzierung<br />
Betriebserfahrungen<br />
Spurenschadstoffe<br />
Desinfektion<br />
präsentieren.<br />
Überblick Fakten<br />
Mit dem spannenden Programm,<br />
das auf der Konferenzseite<br />
im Internet (www.iwa-mtc2011.org)<br />
in einer vorläufigen Version verfügbar<br />
ist, ist eine ausgewogene<br />
Mischung aus anwendungs- und<br />
grundlagenorientierter Forschung<br />
sowie aus der Vielzahl an für die<br />
Membrantechnik wichtigen Aspekten<br />
gelungen. Das Programmkomitee<br />
(www.iwa-mtc2011.org/programme_committee.html)<br />
hat mit<br />
der wissenschaftlichen Bewertung<br />
ihren unschätzbaren Beitrag an<br />
dem Gelingen der Tagung geleistet.<br />
Die Firmenausstellung bietet<br />
wie auch auf der Aachener Tagung<br />
„<strong>Wasser</strong> und Membranen“ mehr als<br />
nur ein Rahmenprogramm. Eine<br />
stattlihe Anzahl von Firmen präsentiert<br />
ihre Produkte und sucht den<br />
Austausch, die Diskussion und das<br />
Interesse der Tagungsteilnehmer.<br />
Ein Empfang als ungezwungener<br />
Auftakt am Abend des 3. Oktobers,<br />
ein verlängerter Abend zur Posterdiskussion<br />
und zum Ausstellungsbesuch<br />
am 4. Oktober, ein Tagungsdinner<br />
am 5. Oktober und Exkursionen<br />
am 7. Oktober runden die<br />
Veranstaltung ab. Die Exkursionen<br />
steuern hochinteressante Ziele in<br />
erreichbarer Entfernung um Aachen<br />
an (www.iwa-mtc2011.org/technical_tours.html).<br />
Was? 6 th IWA Specialist Conference on Membrane<br />
Technology for Water & Wastewater Treatment<br />
Wann? 4.–7. Oktober 2011<br />
Wo? Eurogress, Monheimsallee 48, D-52062 Aachen<br />
Anmeldung: www.iwa-mtc2011.org/registration_form.html<br />
Weitere Informationen: www.iwa-mtc2011.org<br />
Das vorläufige<br />
Programm ist<br />
bereits im<br />
Internet<br />
verfügbar.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 701
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
Aquatech Amsterdam 2011 legt Akzent auf<br />
industriellen <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
Seit ihrer Begründung im Jahr 1964 hat sich die Aquatech Amsterdam zur weltweit führenden Messe für<br />
Brauch-, Trink- und <strong>Abwasser</strong> entwickelt. Die Aquatech Amsterdam ist die einzige Fachmesse, die sich ganz<br />
dem <strong>Wasser</strong> widmet, und zugleich Treffpunkt ist für alle, die in diesem Bereich aktiv sind. Die diesjährige Veranstaltung,<br />
die vom 1. bis 4. November stattfindet, richtet sich an professionelle Akteure in allen Teilbereichen<br />
der <strong>Wasser</strong>industrie und zieht Spezialisten sowie andere beteiligte Parteien an, die in der Praxis auf die Technologie<br />
angewiesen sind.<br />
Die Besucher der Aquatech Amsterdam<br />
kommen aus der ganzen<br />
Welt. In diesem Jahr liegt der<br />
Schwerpunkt auf <strong>Wasser</strong>experten<br />
und Versorgungsmanagern in der<br />
Industrie mit einem Akzent auf<br />
hochgradig von <strong>Wasser</strong> abhängigen<br />
Industriesektoren, wie die Papierund<br />
Pulpindustrie, Lebensmittelund<br />
Textilindustrie sowie die chemische<br />
und pharmazeutische Industrie.<br />
Breites Angebot speziell<br />
für industrielle <strong>Wasser</strong>verbraucher<br />
Die Aquatech Amsterdam ist eine<br />
spezialisierte Fachmesse für die<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung und zieht da -<br />
mit Technologieanbieter aus der<br />
ganzen Welt an. In diesem Jahr sind<br />
dies wiederum über 850 Unternehmen<br />
aus 40 verschiedenen Ländern.<br />
Für industrielle <strong>Wasser</strong>verbraucher<br />
ist jedoch nicht nur die Technologie<br />
relevant. Letzten Endes ist ihr Ziel<br />
ein möglichst kostengünstiger <strong>Wasser</strong>verbrauch,<br />
der alle Umweltanforderungen<br />
erfüllt. Stärker als auf<br />
allen anderen Fachmessen finden<br />
sich unter ihnen Anbieter von kompletten<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
für industrielle Anwendungen,<br />
wie in der chemischen Industrie<br />
und der Lebensmittelbranche.<br />
Was verbirgt sich hinter<br />
„Water Resource Management“<br />
und „Water Footprint“?<br />
Den industriellen <strong>Wasser</strong>verbraucher<br />
erwartet noch viel mehr. Parallel<br />
zur Messe findet er ein einzigartiges<br />
Angebot an Präsentationen,<br />
Workshops und Konferenzen. Be -<br />
sondere Erwähnung verdienen die<br />
Premiere der „Integrated Aqua Solutions“,<br />
eine Ausstellung über besondere<br />
<strong>Wasser</strong>projekte im Be reich der<br />
<strong>Wasser</strong>bewirtschaftung und des<br />
„Fußabdruck des <strong>Wasser</strong>verbrauchs“.<br />
Die Ausstellung zeigt innovative<br />
Projekte in der nachhaltigen Nutzung<br />
von <strong>Wasser</strong>quellen in Flussoder<br />
Grundwassereinzugsgebieten.<br />
Zentrales Thema ist das Gleichgewicht<br />
zwischen der zu entziehenden<br />
<strong>Wasser</strong>menge und der Kapazitätsreserve<br />
der Quelle. Daneben<br />
spielt bei den präsentierten Projekten<br />
auch die <strong>Abwasser</strong>qualität eine<br />
Rolle, um eine Kontamination der<br />
Quelle und eine Störung des ökologischen<br />
Gleichgewichts zu verhindern.<br />
Die Zukunft: Wer bezahlt die<br />
Rechnung?<br />
Bei der integrierten <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
in Flusseinzugsgebieten<br />
geht Europa mit gutem Beispiel<br />
voran. Die große treibende Kraft<br />
hinter dieser ehrgeizigen Politik ist<br />
die Rahmenrichtlinie <strong>Wasser</strong>, die<br />
2002 EU-weit in Kraft getreten ist.<br />
Bis 2015 muss die <strong>Wasser</strong>qualität<br />
aller europäischen Gewässer die<br />
strengen Anforderungen dieser<br />
Rahmenrichtlinie erfüllen. Welche<br />
Auswirkungen hat dies auf die<br />
Landwirtschaft, die industriellen<br />
<strong>Wasser</strong>verbraucher und die <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung?<br />
Auf der Aquatech Amsterdam<br />
2011 veranstaltet das Fachblatt Global<br />
Water Intelligence einen zweitägigen<br />
Workshop über die Folgen<br />
der Einführung dieser Richtlinie.<br />
Vertreter regionaler <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverbände<br />
und Politiker aus<br />
ganz Europa berichten über ihre<br />
strategischen Ansätze.<br />
Zentrales Thema dieses Workshops<br />
sind die mit der Einführung<br />
verbundenen Kosten. Wer bezahlt<br />
die Rechnung?<br />
International Water Week<br />
Amsterdam<br />
Die Fachmesse Aquatech Amsterdam<br />
und die Ausstellung „Integrated<br />
Aqua Solutions“ sind Teil der<br />
„International Water Week Amsterdam“,<br />
der umfassenden Rahmenveranstaltung<br />
zum Thema <strong>Wasser</strong>,<br />
Juli/August 2011<br />
702 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
NACHRICHTEN<br />
die in dieser Woche in Amsterdam<br />
stattfindet. In diesem Rahmen richten<br />
sich viele Veranstaltungen vor<br />
allem an industrielle <strong>Wasser</strong>verbraucher<br />
und staatliche Vertreter:<br />
Aquatech Amsterdam 2011, die<br />
international renommierte Fachmesse<br />
mit über 850 Unternehmen<br />
in der <strong>Wasser</strong>technologie<br />
aus 40 Ländern, die hier ihre<br />
neuesten Produkte und Dienstleistungen<br />
präsentieren.<br />
Aquastages, mehrere Podien auf<br />
dem Messegelände mit durchgehenden<br />
Präsentationen.<br />
Aquaterra, Konferenz über Ge -<br />
wässerbewirtschaftung in niedrig<br />
gelegenen und stark besiedelten<br />
Deltas.<br />
The Internation Water Week Conference,<br />
mit den Themenkonferenzen<br />
Aquaterra, AquaInnovation<br />
(Beschleunigung von Innovationen<br />
in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft)<br />
und AquaIndustry (industrielle<br />
<strong>Wasser</strong>lösungen).<br />
GWI-Workshop über die Einführung<br />
der Rahmenrichtlinie <strong>Wasser</strong><br />
mit Vorträgen von industriellen<br />
Verbrauchern, die in Antizipation<br />
strenger werdender<br />
<strong>Abwasser</strong>normen eine Unternehmensstrategie<br />
entwickelt<br />
haben.<br />
Besichtigungen außergewöhnlicher<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
in den Niederlanden<br />
Im Unterhaltungsteil des Rahmenprogramms<br />
der „International Water<br />
Week“ sind verschiedene öffentliche<br />
Veranstaltungen geplant, wie<br />
beispielsweise eine Besichtigung<br />
des kürzlich auf die Welterbeliste<br />
Aquatech Amsterdam<br />
1.–4. November 2011<br />
Halle 1–7<br />
Amsterdam RAI<br />
Öffnungszeiten: 10.00–18.00 Uhr<br />
www.amsterdam.aquatechtrade.com<br />
der UNESCO gesetzten pittoresken<br />
Grachtengürtels aus dem 17. Jahrhundert.<br />
Und natürlich ist auch die<br />
dynamische Metropole Amsterdam<br />
selbst einen Besuch wert.<br />
Information:<br />
www.amsterdam.aquatechtrade.com. Dort<br />
können Sie auch eine gratis Eintrittskarte<br />
anfordern.<br />
Einladung zur Registrierung<br />
6 th IWA Specialist Conference<br />
on Membrane Technology<br />
for Water & Wastewater<br />
Treatment<br />
Sonderkonditionen<br />
für Mitarbeiter des<br />
öffentlichen Dienstes<br />
4.-7. Oktober 2011<br />
Aachen<br />
www.iwa-mtc2011.org<br />
SPECIALIST CONFERENCES<br />
Membranen in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung und <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
unterstützen maßgeblich die nachhaltige Bewirtschaftung von <strong>Wasser</strong>ressourcen<br />
– ein Verdienst intensiver Forschung. Doch liegen weitere<br />
Herausforderungen vor uns, die Membrantechnologie effizienter<br />
und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Bringen Sie sich auf der IWA<br />
MTC 2011 auf den aktuellen Stand der Entwicklung. Die Verständigung<br />
erleichtern wir durch Simultanübersetzung Englisch-Deutsch.<br />
Das Vortragsprogramm wird durch eine Fachausstellung ergänzt.<br />
Themen: Trinkwasseraufbereitung · <strong>Abwasser</strong>behandlung · Industrielle<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung · <strong>Abwasser</strong>wiederverwendung · Membranmaterialien<br />
· Membranbioreaktoren · Fouling und Reinigungsstrategien<br />
· Entsalzung · Konzentratbehandlung · Prozessmodellierung ·<br />
Prozessoptimierung · Moduldesign · Energiereduzierung · Betriebserfahrungen<br />
· Spurenschadstoffe ...<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 703
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
Hochwassergefahr – auch und gerade für<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlungsanlagen<br />
IFAT ENTSORGA 2012 legt erneut einen Fokus auf das Thema Küsten- und<br />
Hochwasserschutz<br />
© THW<br />
Pumpen, Armaturen und die<br />
ganze Welt der abwassertechnischen<br />
Produkte, Systeme und<br />
Dienstleistungen sind seit jeher<br />
zentrale Ausstellungsbereiche der<br />
internationalen Umwelttechnologiemesse<br />
IFAT ENTSORGA, die vom<br />
7. bis 11. Mai 2012 in München,<br />
stattfindet. Seit 2008 gehört auch<br />
der Küsten- und Hochwasserschutz<br />
zu den festen Themen der IFAT ENT-<br />
SORGA. Zu Recht – gewinnt dieser<br />
Bereich doch immer mehr an<br />
Bedeutung: So werden künftig<br />
Hochwasser, wie sie Deutschland<br />
heute im Durchschnitt alle 50 Jahre<br />
erlebt, alle 25 Jahre eintreten. Das<br />
ist eines der Ergebnisse einer Klimastudie,<br />
die der Gesamtverband der<br />
Deutschen Versicherungswirtschaft<br />
(GDV) zusammen mit Forschern des<br />
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung,<br />
der Freien Universität<br />
Berlin und der Universität Köln im<br />
Mai dieses Jahres präsentierte. In<br />
der Folge rechnen die Versicherer<br />
mit einer drastischen Erhöhung der<br />
Schäden durch Flussüberschwemmungen<br />
und Sturzfluten bis zum<br />
Ende des Jahrhunderts: Die finstersten<br />
Prognosen lassen sogar eine<br />
Verdreifachung erwarten. Von welchen<br />
Kosten dann auszugehen ist,<br />
zeigt ein vergleichender Blick auf<br />
das Elbe-Donau-Hochwasser im<br />
Jahr 2002. Damals zahlten die Versicherungen<br />
nach Angabe des GDV<br />
1,8 Milliarden Euro an die Geschädigten<br />
aus. Der volkswirtschaftliche<br />
Schaden lag bei mehr als elf Milliarden<br />
Euro.<br />
Um die Folgen der Überflutungen<br />
zu mindern, hat die Versicherungswirtschaft<br />
einen Forderungskatalog<br />
aufgestellt, der unter<br />
anderem eine Anpassung der Entwässerungssysteme<br />
verlangt. Auch<br />
die Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
<strong>Abwasser</strong> und Abfall<br />
(DWA) betont die Bedeutung der<br />
Hochwasservorsorge bei <strong>Abwasser</strong>anlagen.<br />
So könnten durch vom<br />
Hochwasser geflutete Kanäle oder<br />
durch hochwasserbedingte Abflussbehinderungen<br />
tiefer liegende<br />
Gebiete direkt gefährdet werden.<br />
Viele Kanalnetzbetreiber reagieren<br />
auf die Herausforderungen künftiger<br />
Starkregen und Hochwassersituationen<br />
mit dem Bau von Rückhaltebecken,<br />
Stauraumkanälen,<br />
Absperreinrichtungen oder Hochwasserpumpwerken.<br />
Ein weiteres Risiko geht von<br />
überfluteten Kläranlagen aus. Durch<br />
ein Überspülen der Klärbecken kann<br />
ungeklärtes <strong>Abwasser</strong> in den Vorfluter<br />
gelangen – mit unabsehbaren<br />
Folgen für die Umwelt. Um dem vorzubeugen,<br />
umgibt zum Beispiel das<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsamt Deggendorf<br />
das Klärwerk Straubing derzeit mit<br />
einem insgesamt 2,4 Kilometer langen<br />
Ringdeich. Der Schutzwall<br />
gegen die Donau, die in diesem<br />
Abschnitt fast jedes Jahr Hochwasser<br />
führt, wird nur an einer einzigen<br />
Stelle durch eine Zufahrtstraße<br />
unterbrochen. Diese „Schwachstelle“<br />
wird im Hochwasserfall mit einem<br />
Aluminium-Deichbalkenverschluss<br />
abgeschottet. Das rund neun Millionen<br />
Euro teure Projekt soll im Herbst<br />
2012 abgeschlossen sein.<br />
Neben der Umwelt gilt es auch,<br />
die materiellen Werte der <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
selbst – also Technik und<br />
Bauten – gegen die Fluten zu schützen.<br />
Beispielsweise zerstörte im<br />
August 2010 in der Oberlausitz ein<br />
Extremhochwasser zwei Kläranlagen<br />
der Süd-Oberlausitzer <strong>Wasser</strong>versorgungs-<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorgungsgesellschaft<br />
mbH. Eine davon wird<br />
gar nicht mehr aufgebaut, das hier<br />
zuvor behandelte <strong>Abwasser</strong> wird<br />
zukünftig zu einer anderen Kläranlage<br />
übergeleitet. Auf der zweiten<br />
Anlage in Zittau ist ein Schaden von<br />
rund 13 Millionen Euro entstanden.<br />
Hier laufen aktuell die Planungen für<br />
einen verbesserten Hochwasserschutz.<br />
Dazu zählen konzeptionelle<br />
Maßnahmen, wie das Höherlegen<br />
der elektro- und steuertechnischen<br />
Anlagen, sowie neue technische<br />
Lösungen, wie die Anschaffung von<br />
Pumpentechnik, die schadlos überflutet<br />
werden kann.<br />
Erstmalig organisiert die Messe<br />
München einen Gemeinschaftsstand<br />
„Küsten- und Hochwasserschutz“.<br />
Weitere Informationen<br />
hierzu sowie Anmeldeunterlagen<br />
erhalten interessierte Unternehmen<br />
unter der Telefonnummer (089) 949<br />
20260, E-Mail: georg.moller@<br />
messe-muenchen.de<br />
Weitere Informationen:<br />
www.ifat.de<br />
Juli/August 2011<br />
704 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
NACHRICHTEN<br />
Energieeffizienz in der <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
Schwerpunktthema auf den 2. Wilo <strong>Wasser</strong>tagen<br />
Nach der sehr erfolgreichen Premiere<br />
2007 finden in diesem<br />
Jahr die „2. Wilo <strong>Wasser</strong>tage“ am<br />
Adlersberg nahe Regensburg statt.<br />
Das zweitägige Fachsymposium am<br />
28. und 29. September 2011 richtet<br />
sich an Entscheider aus <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorgung,<br />
an Ingenieure und Fachplaner sowie<br />
an Vertreter von Umweltbehörden.<br />
Namhafte Referenten informieren<br />
die Teilnehmer mit Blick auf das<br />
Schwerpunktthema Energie über<br />
aktuelle Entwicklungen, Zukunftstrends<br />
und Innovationen der <strong>Wasser</strong>-<br />
und <strong>Abwasser</strong>branche. Dabei<br />
steht der erste Tag der Veranstaltung<br />
im Zeichen der Trinkwasserversorgung.<br />
Der zweite Tag ist der<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung gewidmet.<br />
Die Tagung bietet neben umfassenden<br />
Fachinformationen auch die<br />
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.<br />
Kommunale <strong>Wasser</strong>versorgungsund<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgungs systeme<br />
sind komplexe Anlagen. Sie müssen<br />
nicht nur äußerst zuverlässig arbeiten,<br />
sondern über ihre gesamte<br />
Lebensdauer auch einen möglichst<br />
wirtschaftlichen und umweltfreundlichen<br />
Betrieb gewährleisten. Vor<br />
diesem Hintergrund zeigen Experten<br />
aus <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
sowie aus Forschung und<br />
Umweltpolitik aktuelle Möglichkeiten<br />
und Perspektiven nachhaltiger<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
auf. Auf dem Programm<br />
www.wassertermine.de<br />
stehen u.a. geeignete Strategien zur<br />
Steigerung der Energieeffizienz, die<br />
Anlagenoptimierung durch luftfreie<br />
Förderung sowie Hinweise zu Anlagenplanung<br />
und -auslegung. Auch<br />
die Erfahrungen wasserwirtschaftlicher<br />
Netzwerke wie des Umwelt-<br />
Clusters Bayern werden präsentiert.<br />
Veranstaltet wird das Fachsymposium<br />
von der WILO SE, Spezialist<br />
unter anderem für Unterwassermotor-Pumpen,<br />
<strong>Abwasser</strong>pumpen und<br />
Tauchmotorrührwerke. Wilo ist Mitglied<br />
der German Water Partnership<br />
(GWP), des UmweltClusters Bayern<br />
und des bayerischen Kompetenzzentrums<br />
Umwelt (KUMAS).<br />
Die Teilnahme an der Veranstaltung<br />
ist kostenlos.<br />
Am zweiten<br />
Tag stehen<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
auf<br />
dem Programm<br />
– unter anderem<br />
geht es um<br />
<strong>Abwasser</strong>pumpen<br />
für<br />
Pumpwerke.<br />
© WILO SE, Dortmund<br />
Die „2. Wilo <strong>Wasser</strong>tage“ am Adlersberg informieren am 28. und<br />
29. September 2011 über aktuelle Entwicklungen, Zukunftstrends und<br />
Innovationen der <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>branche. Dabei ist der erste Tag<br />
dem Thema <strong>Wasser</strong>versorgung gewidmet. © WILO SE, Dortmund<br />
Anmeldungen:<br />
WILO SE,<br />
Sina Meschwitz,<br />
Heimgartenstraße 1–3, D-95030 Hof,<br />
Tel. (092 81) 974 275,<br />
Fax (092 81) 974 393,<br />
E-Mail: sina.meschwitz@wilo.com,<br />
www.wilo.de<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 705
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
MEORGA – Spezialmesse für Prozessleitsysteme,<br />
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik<br />
04. September 2011 in der Sparkassen-Arena in Landshut<br />
Bei der Messe zeigen etwa 150<br />
Fachfirmen Geräte und Systeme,<br />
Engineering- und Serviceleistungen<br />
sowie neue Trends im Bereich der<br />
Automatisierung.<br />
Die Messe wendet sich an Fachleute<br />
und Entscheidungsträger, die<br />
Die regionale Messe: Produkte, Systeme und Informationen<br />
vor der Haustür.<br />
in ihren Unternehmen für die<br />
Optimierung der Geschäfts- und<br />
Produktionsprozesse entlang der<br />
gesamten Wertschöpfungskette<br />
verantwortlich sind. Der Eintritt in<br />
die Messe und die Teilnahme an den<br />
Workshops sind für die Besucher<br />
kostenlos und sollen ihnen Informationen<br />
und interessante Gespräche<br />
ohne Hektik oder Zeitdruck ermöglichen.<br />
MEORGA organisiert seit mehreren<br />
Jahren mit großem Erfolg regionale<br />
Spezialmessen für die Mess-,<br />
Steuerungs-, Regelungs- und Automatisierungstechnik.<br />
Durch den<br />
wachsenden Kostendruck in den<br />
Unternehmen und die damit einhergehenden<br />
Restriktionen bei<br />
Dienstreisen finden lokale Messen –<br />
vor der Haustür – immer größeren<br />
Anklang und sind ein Gewinn für<br />
Aussteller wie für Besucher. Sowohl<br />
die Anzahl der Aussteller, als auch<br />
die der Besucher der von MEORGA<br />
organisierten Messen hat sich in<br />
den letzten drei Jahren mehr als<br />
vervierfacht.<br />
Kontakt:<br />
MEORGA GmbH,<br />
Sportplatzstraße 27,<br />
D-66809 Nalbach,<br />
Tel. (06838) 8960035,<br />
Fax (06838) 983292,<br />
E-Mail: info@meorga.de,<br />
www.meorga.de<br />
Effiziente Sanierungsplanung von Kanalnetzen<br />
BARTHAUER Roadshow in Leipzig, Köln und München<br />
Barthauer Software GmbH erneut auf Tour durch Deutschland. Vom 13. bis 15. September 2011 werden die<br />
BaSYS-Werkzeuge kompakt und praxisnah vorgestellt.<br />
Rund 17 Prozent aller Kanäle in<br />
Deutschland sind laut DWA<br />
sofort, kurz- oder mittelfristig sanierungsbedürftig.<br />
Um die Kosten<br />
nachhaltig zu senken, ist die vorausschauende<br />
Planung ein unverzichtbares<br />
Werkzeug für eine dauerhafte,<br />
problemlose und wirtschaftliche<br />
Kanalsanierung.<br />
Die BARTHAUER Roadshow präsentiert<br />
in Leipzig, Köln und München<br />
mit der Sanierungsplanung<br />
BaSYS PISA ein optimales Lösungsportfolio<br />
für eine Kosten sparende<br />
und effiziente Sanierungsplanung<br />
von Kanalnetzen. Das datenbankbasierte<br />
Leitungsinformationssystem<br />
BaSYS ermöglicht unter anderem<br />
die Erfassung und Darstellung aller<br />
Inspektionsdaten entsprechend der<br />
DIN-EN, ISYBAU, DWA und ÖWAV,<br />
die Verwaltung der Inspektionstexte<br />
und Sanierungsmaßnahmen<br />
in Bibliotheken sowie die gra fische<br />
Darstellung der Ergebnisse. Schritt<br />
für Schritt leitet die BARTHAUER<br />
Roadshow durch die softwaregestützte<br />
Sanierungsplanung und<br />
Zustandsbewertung.<br />
Die Teilnahme an der BART-<br />
HAUER Roadshow inklusive Mittagessen<br />
und Informationsmaterial ist<br />
kostenfrei. Anmeldung für den<br />
Wunschort ist ab sofort auf der<br />
Homepage möglich.<br />
Termine:<br />
13. September 2011, 10.00-14.00<br />
Uhr: Mariott Hotel, Leipzig<br />
14. September 2011, 10.00-14.00<br />
Uhr: Senats Hotel, Köln<br />
15. September 2011, 10.00-14.00<br />
Uhr: Best Western Hotel Cristal,<br />
München<br />
<br />
Kontakt:<br />
Barthauer Software GmbH,<br />
Pillaustraße 1a,<br />
D-38126 Braunschweig,<br />
www.barthauer.de<br />
Juli/August 2011<br />
706 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
verschlafen?
verschlafen?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neue Chance: November 2011<br />
<br />
<br />
21./22.11.2011<br />
Berlin
verschlafen?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neue Chance: November 2011<br />
<br />
<br />
21./22.11.2011<br />
Berlin
verschlafen?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neue Chance: November 2011<br />
<br />
<br />
21./22.11.2011<br />
Berlin
verschlafen?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neue Chance: November 2011<br />
<br />
<br />
21./22.11.2011<br />
Berlin
verschlafen?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neue Chance: November 2011<br />
<br />
<br />
21./22.11.2011<br />
Berlin
verschlafen?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Neue Chance: November 2011<br />
<br />
<br />
21./22.11.2011<br />
Berlin
energy environment engineering<br />
Schirmherr und fachlicher Träger:<br />
Nach Energie fischt<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
am besten in Berlin:<br />
<br />
<br />
<br />
Zeit für Veränderung<br />
3<br />
en 2.0<br />
21./22. November 2011<br />
andel's Hotel Berlin<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Senatsverwaltung für Wirtschaft,<br />
Technologie und Frauen<br />
Dieses Projekt wird hälftig mit Bundes- und Landesmitteln<br />
aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen<br />
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert.
Forschung und Entwicklung<br />
NACHRICHTEN<br />
HZI-Forscher zeigen, wie kleine Gen-Veränderungen<br />
den Darmkeim Yersinia gefährlicher machen<br />
Yersinien können schwere Darminfektionen auslösen: Forscher des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für<br />
Infektionsforschung (HZI) haben nun herausgefunden, warum speziell der Serotyp O:3 des Bakteriums Yersinia<br />
enterocolitica gefährlicher ist als seine Verwandten. Durch einige wenige Veränderungen in seiner Erbinformation<br />
haften die Bakterien stärker an Darmzellen an. Außerdem sind sie besser auf eine Infektion vorbereitet<br />
– ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Yersinien. Die Ergebnisse veröffentlichte jetzt das<br />
Wissenschaftsmagazin „PLoS“.<br />
Eine Gemeinschaft vieler verschiedener<br />
Bakterien besiedelt unseren<br />
Darm. Diese gesunde Darmflora<br />
hilft bei der Verdauung und hält<br />
krankmachende Keime davon ab,<br />
unseren Körper zu infizieren. Manchmal<br />
gelingt es Bakterien wie Yersinia<br />
enterocolitica jedoch, diesen Schutzschild<br />
zu überwinden, sich im Darm<br />
zu vermehren und in unsere Zellen<br />
einzudringen. Sie lösen dann<br />
schwere Durchfälle mit krampfartigen<br />
Bauchschmerzen und Fieber<br />
aus. Wenn die Bakterien in den Körper<br />
und die Blutbahn gelangen,<br />
können zusätzlich eine Blutvergiftung<br />
und Organschäden auftreten.<br />
Yersinien kommen in kontaminierten<br />
Lebensmitteln wie rohem<br />
Fleisch vor, können aber auch durch<br />
verseuchtes Trinkwasser oder infizierte<br />
Haustiere übertragen werden.<br />
Von Yersinia enterocolitica existiert<br />
eine Vielzahl verschiedener<br />
Serotypen: In Deutschland ist der<br />
Serotyp O:3 für die meisten Erkrankungen<br />
verantwortlich. Der Buchstabe<br />
„O“ bezeichnet hierbei eine<br />
Variante eines bestimmten Zucker-<br />
Fett-Moleküls auf der Oberfläche<br />
der Bakterien. Verschiedene Serotypen<br />
unterscheiden sich darin, wie<br />
dieses Molekül aufgebaut ist. In den<br />
USA kommt beispielsweise der<br />
Serotyp O:8 am häufigsten vor.<br />
„Wenn die Bakterien über die<br />
Nahrung in den Darm gelangen,<br />
haften sie sich ähnlich den bekannten<br />
EHEC-Bakterien an die Darmzellen<br />
an und dringen in sie ein“, erklärt<br />
Prof. Petra Dersch, Leiterin der<br />
Arbeitsgruppe „Molekulare Infektionsbiologie“<br />
am HZI. Um die Zellen<br />
schnell infizieren zu können, bilden<br />
Yersinien bereits vor einer<br />
Infektion bei niedrigen Temperaturen<br />
das Protein Invasin auf ihrer<br />
Oberfläche – sie sind sozusagen allzeit<br />
angriffsbereit. „Dabei hilft ihnen<br />
ein besonderes Proteinthermometer:<br />
Das Protein RovA reguliert die<br />
Bildung von Invasin“, so Dersch.<br />
Die Forscher um Petra Dersch<br />
untersuchten, warum Yersinia en -<br />
terocolitica Serotyp O:3 aggressiver<br />
und infektiöser ist als andere Serotypen.<br />
Dabei machten die Forscher<br />
zwei erstaunliche Entdeckungen:<br />
Durch eine Veränderung in der Erbinformation<br />
produzieren die Serotyp<br />
O:3-Yersinien siebenfach mehr<br />
Invasin-Protein auf ihrer Oberfläche<br />
als andere Yersinia-Serotypen. „Da -<br />
durch können die Bakterien sehr<br />
effektiv an Darmzellen anhaften<br />
und in diese eindringen“, sagt Frank<br />
Uliczka, der die Yersinien untersucht<br />
hat. Das Geheimnis liegt in einem so<br />
genannten „springenden Gen“, das<br />
sozusagen in den regulatorischen<br />
Bereich des Invasin-Gens gehüpft<br />
ist und damit die Erbinformation<br />
verändert hat.<br />
Zum anderen sorgt eine weitere<br />
Mutation dafür, dass der Regulator<br />
„RovA“ nicht mehr abgeschaltet<br />
wird und das Invasin-Gen nun kontinuierlich<br />
neues Protein zum Infizieren<br />
produziert. Normalerweise sorgt<br />
das Proteinthermometer dafür, dass<br />
die Bakterien, wenn sie erst einmal<br />
in unseren Körper gelangt sind, kein<br />
Invasin mehr produzieren. Dies soll<br />
verhindern, dass das Immunsystem<br />
die Bakterien als krankmachend entdeckt<br />
und be kämpft. Bisher konnten<br />
die Wissenschaftler jedoch noch keinen<br />
Nachteil der ständigen Invasin-<br />
Yersinien (in blau) dringen in Hep2-Zellen ein.<br />
Foto: Manfred Rohde/HZI<br />
Produktion finden. „Beide Veränderungen<br />
der Erbinformation erhöhen<br />
die Infektiosität von Serotyp O:3-Yersinien<br />
um ein Vielfaches“, sagt Frank<br />
Uliczka. „Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass die Yersinien<br />
einen Platz finden, an dem sie sich<br />
fest anheften und uns dann infizieren<br />
können.“<br />
„Zurzeit beobachten Wissenschaftler,<br />
dass der Serotyp O:3-Yersinia<br />
mit seinen Mutationen andere<br />
Yersinia enterocolitica-Serotypen<br />
verdrängt“, erklärt Prof. Petra<br />
Dersch. „Wir hoffen, mit unseren<br />
Erkenntnissen dazu beizutragen,<br />
ein besseres Verständnis dieser<br />
Infektion zu erlangen. Langfristig<br />
könnte dies helfen, Therapieformen<br />
und Medikamente gegen Yersinien-<br />
Infektionen zu verbessern.“<br />
Veröffentlichung:<br />
Uliczka F., Pisano F., Schaake J., Stolz T., Rohde<br />
M. et al.: Unique Cell Adhesion and Invasion<br />
Properties of Yersinia enterocolitica O:3, the<br />
Most Frequent Cause of Human Yersiniosis.<br />
PLoS Pathog 7(7): e1002117, 2011.<br />
doi:10.1371/journal.ppat.1002117<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 707
NACHRICHTEN<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Neues Frühwarnsystem erkennt drohende<br />
Trinkwasserverschmutzung<br />
Stehen Trinkwasserbrunnen in<br />
der Nähe von Flüssen, können<br />
sie bei Hochwasser verunreinigt<br />
werden. Forschende der Universität<br />
Basel haben nun zusammen mit der<br />
Firma Endress+Hauser eine Technologie<br />
entwickelt, mit der eine drohende<br />
Verschmutzung frühzeitig<br />
erkannt und die Entnahme von<br />
Trinkwasser differenziert gesteuert<br />
werden kann.<br />
Trinkwasserbrunnen in unmittelbarer<br />
Nähe zu Flüssen sind einer<br />
besonderen Gefahr ausgesetzt: Bei<br />
Hochwasser kann mit Bakterien und<br />
anderen Mikroben belastetes Flusswasser<br />
unterirdisch in die Grundwasserfassungen<br />
einfließen. Droht<br />
eine mikrobiologische Verunreinigung,<br />
müssen die Pumpen abgestellt<br />
werden.<br />
Für die Betreiber von <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
ist es allerdings<br />
schwierig, jederzeit richtig einschätzen<br />
zu können, wie gefährdet einzelne<br />
Grundwasserbrunnen sind.<br />
Im Messcontainer: Daniel Waldmann von E+H und<br />
die Doktorandin Rebecca Page.<br />
Forschende um Prof. Peter Huggenberger<br />
von der Universität Basel<br />
haben nun zusammen mit dem<br />
Spezialisten für Messtechnik<br />
Endress+Hauser mit Sitz in Reinach<br />
BL eine neuartige Technologie entwickelt,<br />
die auf Messungen und<br />
Modellrechnungen beruht. Sie er -<br />
laubt es, eine drohende Verschmutzung<br />
von flussnahen Brunnen frühzeitig<br />
zu erkennen und geeignete<br />
Maßnahmen bei der Trinkwassergewinnung<br />
einzuleiten.<br />
Potenzielle Gefährdung<br />
erkennen<br />
Die Wissenschaftler erforschten im<br />
Zeitraum von drei Jahren im Gebiet<br />
der Reinacherheide das komplexe<br />
Zusammenspiel von Grundwasser<br />
und Flusswasser der Birs. Da der<br />
Nachweis von Mikroorganismen in<br />
Echtzeit nur mit großem Aufwand<br />
möglich ist, suchten sie nach Parametern,<br />
die indirekt eine Gefährdung<br />
des Grundwassers anzeigen<br />
können. Dies gestaltet sich schwierig,<br />
da sich die Gefährdungssituationen<br />
bei Hochwasser ständig ändern<br />
und immer wieder unterschiedliche<br />
Messresultate liefern. Mit statistischen<br />
Verfahren lässt sich jedoch<br />
aus einer großen Anzahl von Messdaten<br />
die aktuelle Gefährdungssituation<br />
erkennen.<br />
Dazu installierten die Forschenden<br />
mehrere Sonden, die Daten zu<br />
Temperatur, pH-Wert, elektrischer<br />
Leitfähigkeit und <strong>Wasser</strong>trübung<br />
erfassen. Diese Informationen werden<br />
dann automatisch übertragen,<br />
mit statistischen Methoden ausgewertet<br />
und mit den Resultaten von<br />
Simulationen der Grundwasserströmung<br />
verglichen. Zeichnet sich eine<br />
potenzielle Gefährdung der <strong>Wasser</strong>qualität<br />
ab, alarmiert das System<br />
den Brunnenmeister, damit er die<br />
Pumpen so steuern kann, dass sich<br />
eine Verunreinigung des Trinkwassers<br />
vermeiden lässt.<br />
„Dank dem neuen Analyseverfahren<br />
kann der Brunnenmeister<br />
eine Gefährdungslage zuverlässig<br />
beurteilen, ohne dass er laufend<br />
viele unterschiedliche Messdaten<br />
interpretieren muss“, erläutert Prof.<br />
Peter Huggenberger die Vorteile<br />
des neuen Überwachungssystems,<br />
dessen Entwicklung von der Kommission<br />
für Technologie und Innovation<br />
(KTI) gefördert wurde.<br />
Technologie mit<br />
Marktpotenzial<br />
Der integrative Ansatz von Messtechnik<br />
und Gefährdungsanalyse<br />
ermöglicht es, adäquat auf eine<br />
potenzielle Gefährdung der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
zu reagieren. Das macht<br />
die Technologie für zahlreiche Trinkwasserversorger<br />
interessant und<br />
eröffnet ein großes Marktpotenzial.<br />
„Die Versorgung mit <strong>Wasser</strong> ist<br />
heute eine der großen Herausforderungen“,<br />
sagt Klaus Endress, CEO<br />
der Endress+Hauser Gruppe. „Weltweit<br />
haben über eine Milliarde Menschen<br />
keinen Zugang zu sauberem<br />
Trinkwasser. Hier können wir künftig<br />
noch besser helfen, eine sichere<br />
Versorgung zu gewährleisten.“<br />
Um die Technologie bis zur<br />
Marktreife zu entwickeln, haben die<br />
Forschenden zusammen mit dem<br />
Industriepartner Endress+Hauser<br />
bei der KTI um eine Fortsetzung des<br />
Projekts nachgesucht.<br />
Kontakt:<br />
Universität Basel,<br />
Petersplatz 1, Postfach<br />
CH-4003 Basel,<br />
Tel. +41 (0)61 267 30 17,<br />
Fax +41 (0)61 267 30 13,<br />
E-Mail: kommunikation@unibas.ch<br />
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG,<br />
Colmarer Straße 6,<br />
D-79576 Weil am Rhein,<br />
Tel. (07621) 9 75 01,<br />
Fax (07621) 9 75 55 5<br />
Juli/August 2011<br />
708 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Forschung und Entwicklung<br />
NACHRICHTEN<br />
Materialforscher wollen mit neuen<br />
Kupfer-Werkstoffen gefährliche Keime abtöten<br />
Auf blank poliertem Kupfer sterben Bakterien nach kurzer Zeit ab. Diese Wirkung von Kupfer ist seit längerem<br />
bekannt und könnte helfen, gefährliche Infektionen zu stoppen. Doch reines Kupfer bildet auf der Oberfläche<br />
eine grünliche Schicht, die so genannte Patina, mit der die antibakterielle Wirkung verloren geht. Saarbrücker<br />
Materialforscher wollen jetzt Kupfer-Werkstoffe entwickeln, die diese Nachteile überwinden helfen. Durch spezielle<br />
Oberflächen und Kupferlegierungen sollen Materialien entstehen, die aktiv über einen langen Zeitraum<br />
Bakterien abtöten können. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt, an dem auch Mikrobiologen<br />
beteiligt sind, mit 300 000 Euro.<br />
n Krankenhäusern verbreiten<br />
„Isich immer häufiger multiresistente<br />
Keime, die man selbst mit<br />
strengen Hygienemaßnahmen und<br />
häufigen Desinfektionen kaum mehr<br />
bekämpfen kann“, sagt Frank Mücklich,<br />
Professor für Funktionswerkstoffe<br />
der Saar-Uni und Direktor des<br />
Steinbeis-Zentrums für Werkstofftechnik.<br />
Hier könnten kupferhaltige<br />
Materialien zum Einsatz kommen,<br />
um zum Beispiel Lichtschalter oder<br />
Türgriffe zu beschichten. „Dazu muss<br />
man aber noch genauer erforschen,<br />
auf welche Weise Kupfer die Bakterien<br />
unschädlich macht und wie man<br />
diese Wirkung langfristig erhalten<br />
kann“, erläutert Mücklich. Der Materialforscher<br />
arbeitet hierfür mit dem<br />
internationalen Kupfer-Experten<br />
und Pharmakologen der Universität<br />
Bern, Marc Solioz, und den Mikrobiologen<br />
der Saar-Uni zusammen. Sie<br />
werden untersuchen, wie wirksam<br />
neuartige Kupfer-Werkstoffe die<br />
gefährlichen Keime abtöten können.<br />
Um Materialoberflächen zu verändern,<br />
setzt das Forscher-Team um<br />
Frank Mücklich die so genannte<br />
Laserinterferenz-Technologie ein.<br />
Da bei werden mehrere gebündelte<br />
Laserstrahlen auf das Material ge -<br />
richtet. Sie überlagern sich wie Wellen,<br />
die entstehen, wenn man Steine<br />
ins <strong>Wasser</strong> wirft. Physikalisch wird<br />
dieses Phänomen Interferenz ge -<br />
nannt. In einem Schritt kann man<br />
dadurch auf der Fläche eines Quadratzentimeters<br />
äußerst präzise Muster<br />
in der Größenordnung von wenigen<br />
Mikro- bis Nanometern erzeugen.<br />
„Das Laserlicht wirkt mit<br />
extremer Hitze sehr punktuell auf<br />
die Oberfläche ein. Wir können auf<br />
Bakterien auf einer linienstrukturierten Kupferoberfläche,<br />
die mit der Laser-Interferenztechnologie von<br />
Professor Frank Mücklich erzeugt wurde.<br />
© Universität des Saarlandes<br />
einem Zehntel Haaresbreite praktisch<br />
alle Metalle schmelzen. Direkt<br />
daneben, also etwa fünf Tausendstel<br />
Millimeter weiter, bleibt das Material<br />
unverändert“, sagt Professor Mücklich.<br />
Durch die große Hitze des Laserstrahls<br />
kann die Oberfläche auch in<br />
ihrer Topographie verändert werden,<br />
es entstehen winzig kleine Vertiefungen<br />
oder Erhebungen. „Diese haben<br />
in etwa die Größe von einzelnen<br />
Bakterien. Es wäre also theoretisch<br />
möglich, geeignete Mulden zu<br />
erzeugen, in denen die Keime wie in<br />
eine Art Falle hineingeraten und von<br />
Kupfer umschlossen werden“, erläutert<br />
der Materialforscher.<br />
Durch die Laserbehandlung wollen<br />
die Wissenschaftler außerdem<br />
Materialoberflächen erzeugen, die<br />
im Gegensatz zu reinem Kupfer keinen<br />
Belag, also keine Patina, bilden.<br />
„Die antibakterielle Wirkung der<br />
Materialien sollte möglichst lange<br />
bestehen bleiben und auch nicht<br />
durch Putz- und Desinfektionsmittel<br />
zerstört werden“, nennt Mücklich<br />
sein Ziel. Daher werde man die<br />
Laserstrahlen auch dazu benutzen,<br />
um die innere Struktur des Materials<br />
in einer hauchdünnen Schicht zu<br />
verändern. „Hierbei werden wir<br />
nicht nur mit Kupferlegierungen<br />
experimentieren, sondern auch<br />
winzige Silberpartikel verwenden.<br />
Denn Silber ist bekannt dafür, dass<br />
es Bakterien vernichten kann. Es<br />
wird daher auch für medizinische<br />
Implantate gerne verwendet“, erläutert<br />
der Saarbrücker Professor.<br />
Silber könnte für den breiten<br />
Einsatz allerdings zu teuer werden.<br />
Die neuartigen Werkstoffe sollen<br />
nämlich nicht nur für Krankenhäuser<br />
entwickelt werden, sondern<br />
auch für Haltegriffe in öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln, Türklinken in<br />
öffentlichen Gebäuden und andere<br />
Gegenstände, die von vielen verschiedenen<br />
Menschen angefasst<br />
werden. „An diesen Stellen setzen<br />
sich Viren und Bakterien gerne fest<br />
und werden über den direkten<br />
Hautkontakt verbreitet. Durch<br />
Materialoberflächen, die aktiv Bakterien<br />
hemmen, könnte man in<br />
Zukunft die gefährlichen Infektionen<br />
besser eindämmen“, hofft Frank<br />
Mücklich.<br />
Kontakt:<br />
Prof. Dr. Frank Mücklich,<br />
Universität des Saarlandes,<br />
Material Engineering Center Saarland (MECS),<br />
Tel. (0681) 302-70501,<br />
E-Mail: muecke@matsci.uni-sb.de<br />
Michael Hans<br />
Tel. (0681) 302-70545,<br />
E-Mail: michael.hans@mx.uni-saarland.de<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 709
NACHRICHTEN<br />
Forschung und Entwicklung<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung, Energieverbrauch und<br />
Umweltverträglichkeit in Einklang bringen<br />
Forschungsprojekte von Siemens machen entscheidende Fortschritte<br />
Für die Aufbereitung und den Transport von <strong>Wasser</strong> bedarf es großer Mengen an Energie, zugleich wird CO 2<br />
freigesetzt. Innovationen im Bereich der <strong>Wasser</strong>behandlung müssen deshalb Aufbereitungslösungen, Energieverbrauch<br />
und Umweltverträglichkeit in Einklang bringen. Siemens Water Technologies arbeitet in seinem<br />
globalen Forschungszentrum in Singapur daran, die Prozess- und Energieeffizienz sowohl durch Entwicklung<br />
neuer als auch durch Optimierung bestehender Technologien zu verbessern. Einige dieser Vorhaben sind entscheidende<br />
Schritte vorangekommen. Auf der Singapore International Water Week (SIWW) wird Siemens über<br />
den aktuellen Stand der Projekte zur energieneutralen <strong>Abwasser</strong>aufbereitung und elektrochemischen Meerwasserentsalzung<br />
sowie über die Membran-Bioreaktor-Versuchsanlage Changi informieren. Mit der Micro-<br />
Media-Column stellt das Unternehmen zudem einen neuartigen <strong>Wasser</strong>filter vor.<br />
Die Micro-Media-<br />
Column von<br />
Siemens entfernt<br />
Verschmutzungen<br />
bis auf PPT (parts<br />
per trillion)-<br />
Niveau.<br />
Bild: Siemens AG<br />
ngesichts der zunehmen-<br />
<strong>Wasser</strong>knappheit und<br />
„Aden<br />
des Klimawandels ist es notwendig,<br />
die <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
ganzheitlich zu betrachten“,<br />
sagte Rüdiger Knauf, Entwicklungsleiter<br />
von Siemens Water Technologies.<br />
„Das heißt, moderne Technologien<br />
müssen Kommunen und<br />
Industrie dahingehend unterstützen,<br />
dass <strong>Wasser</strong> in ausreichender<br />
Quantität und Qualität zur Verfügung<br />
steht. Zugleich sollen die Systeme<br />
möglichst kostengünstig und<br />
nachhaltig arbeiten.” Bereits heute<br />
ergänzen Technologien zur Wiederverwendung<br />
von <strong>Wasser</strong> dessen<br />
natürlichen Kreislauf. Solche integrierten<br />
Lösungen zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und -rückgewinnung<br />
weiterzuentwickeln, steht im Mittelpunkt<br />
der Forschungsaktivitäten<br />
von Siemens.<br />
Verfahren zur energieneutralen<br />
<strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
kombiniert zwei<br />
Technologien<br />
Kommunale Abwässer enthalten in<br />
Form organischer Verunreinigungen<br />
zehnmal mehr Energie als für<br />
ihre Reinigung erforderlich ist. Dieses<br />
Potenzial will Siemens mit<br />
einem neuen Verfahren zur biologischen<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung nutzen<br />
und damit eine energieautarke Kläranlage<br />
ermöglichen. Der Prozess<br />
verbindet die aerobe Biosorption,<br />
also einen belüfteten Reinigungsschritt,<br />
mit einer anaeroben, unbelüfteten<br />
Stufe. Auf diese Weise soll<br />
der Aufwand für die Belüftung<br />
gesenkt und genug Methangas<br />
gewonnen werden, um daraus so<br />
viel Energie zu erzeugen, wie für<br />
den Betrieb der Kläranlage benötigt<br />
wird. Seit 2010 behandelt eine Piloteinheit<br />
etwa einen halben Kubikmeter<br />
<strong>Abwasser</strong> täglich ohne<br />
externe Energiezufuhr. Im Gegensatz<br />
zu herkömmlichen Verfahren<br />
werden hier während der aeroben<br />
Phase die Bakterien nur kurz unter<br />
Luftzufuhr mit den organischen Verunreinigungen<br />
beladen. Infolgedessen<br />
wird zum einen weniger Energie<br />
für die Gebläse verbraucht. Zum<br />
anderen entsteht weniger Klärschlamm,<br />
da sich die Bakterien<br />
kaum vermehren. In der anschließenden<br />
anaeroben Phase vergären<br />
die Bakterien die organischen Stoffe<br />
zu Methan, das sich wiederum zur<br />
Energiegewinnung einsetzen lässt.<br />
Um diesen Prozess in größerem<br />
Maßstab weiterzuentwickeln, wird<br />
voraussichtlich noch in diesem Jahr<br />
eine größere Pilotanlage in Singapur<br />
in Betrieb gehen. Sie soll die<br />
Abwässer von rund 2000 Einwohnern<br />
klären.<br />
Technologien auf dem Weg<br />
zur Kommerzialisierung<br />
Nachdem Siemens als Sieger aus<br />
einem Forschungswettbewerb hervorgegangen<br />
war, hat das Unternehmen<br />
2008 damit begonnen, ein<br />
neues Verfahren zur Meerwasserentsalzung<br />
zu entwickeln. Ziel des<br />
Projekts ist es, im Vergleich zu herkömmlichen<br />
Technologien den<br />
Energieverbrauch um die Hälfte zu<br />
senken. Eine Versuchsanlage in Singapur<br />
bereitet täglich schon fünfzig<br />
Kubikmeter Meerwasser zu Trinkwasser<br />
auf. Die Ergebnisse zeigen,<br />
dass der Prozess – eine Kombination<br />
aus Elektrodialyse (ED) und<br />
Elektrodeionisation (CEDI) – nicht<br />
nur im Labor, sondern auch in größerem<br />
Maßstab funktioniert. Angesichts<br />
dieses Erfolgs wird Siemens<br />
bis 2013 eine Demonstrationseinheit<br />
im Originalmaßstab in der Tuas-<br />
Anlage von Singapurs <strong>Wasser</strong>versorger<br />
PUB (Public Utilities Board)<br />
errichten. Damit geht Siemens den<br />
nächsten Schritt, um die Technologie<br />
der elektrochemischen Meerwasserentsalzung<br />
in ein marktfähiges<br />
Produkt zu überführen.<br />
Juli/August 2011<br />
710 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Forschung und Entwicklung<br />
NACHRICHTEN<br />
Bereits kurz vor der Markteinführung<br />
steht ein anderes Produkt,<br />
das auf der parallel zur SIWW in Singapur<br />
stattfindenden Ultrapure<br />
Water Asia Conference vorgestellt<br />
wird. Die Micro-Media-Column<br />
(MMC) ist ein <strong>Wasser</strong>filter zur Entfernung<br />
von Verunreinigungen wie<br />
Selen, Chrom, Quecksilber und<br />
Arsen. Einsetzen lässt sie sich<br />
sowohl in der kommunalen als auch<br />
in der industriellen <strong>Wasser</strong>aufbereitung,<br />
beispielsweise in der Energiebranche,<br />
der Mikroelektronik,<br />
der pharmazeutischen Industrie<br />
sowie in der Metallbranche und im<br />
Bergbau. Neue Richtlinien schreiben<br />
vielfach niedrigere Grenzwerte<br />
für Verunreinigungen im <strong>Wasser</strong> vor,<br />
die mit herkömmlichen Ionenaustauschfiltern<br />
nicht mehr erreicht<br />
werden können. Um diese Lücke zu<br />
schließen, hat Siemens die MMC mit<br />
einem neuen Filtermedium und<br />
einer abgewandelten Strömungsführung<br />
entwickelt. Der Filter entfernt<br />
Verschmutzungen bis auf PPT<br />
(parts per trillion)-Niveau. Da das<br />
<strong>Wasser</strong> radial durch das Medium<br />
fließt, wird eine Kanalbildung vermieden.<br />
Im Vergleich zu herkömmlichen<br />
Produkten fallen für die MMC<br />
daher geringere Lebenszykluskosten<br />
an. Zudem bietet die Filtersäule<br />
trotz ihres geringen Platzbedarfs<br />
einen hohen Durchsatz. In Feldversuchen<br />
zu Beginn dieses Jahres hat<br />
die MMC <strong>Wasser</strong> wirksam von<br />
Quecksilber und Kupfer gereinigt.<br />
Für August 2011 ist nun die Markteinführung<br />
geplant.<br />
Weiterentwicklung von<br />
Technologien zur Wiederverwendung<br />
von <strong>Wasser</strong><br />
Neben der Meerwasserentsalzung<br />
setzen Industrie und Kommunen<br />
zunehmend auf Technologien zur<br />
Wiederverwendung von <strong>Wasser</strong>, um<br />
der <strong>Wasser</strong>knappheit entgegenzuwirken<br />
und eine zuverlässige Versorgung<br />
zu gewährleisten. Niederdruck-<br />
Membransysteme beispielsweise<br />
eignen sich besonders gut, um Ab -<br />
wasser so weit aufzubereiten, dass es<br />
anschließend erneut genutzt werden<br />
kann. Siemens arbeitet kontinuierlich<br />
daran, Technologien wie den<br />
Membran-Bioreaktor (MBR) zu verbessern.<br />
Im vergangenen Jahr hat<br />
das Unternehmen in der <strong>Wasser</strong>rückgewinnungsanlage<br />
Changi, Singapur,<br />
ein MBR-Versuchssystem in<br />
Betrieb genommen, um neue Konstruktions-<br />
und Betriebsparameter<br />
zu prüfen. Pro Tag behandelt die<br />
Anlage rund eine Million Liter <strong>Wasser</strong>,<br />
sodass unter Realbedingungen<br />
getestet werden kann. Nach Auswertung<br />
erster Ergebnisse konnten die<br />
Annahmen einer computergestützten<br />
Analyse der Strömungsdynamik<br />
bestätigt werden. Die Simulation war<br />
dem Bau des Versuchssystems vorausgegangen.<br />
Im Zuge der Tests<br />
wurde die Belüftung und infolgedessen<br />
der Strömungsverlauf des <strong>Wasser</strong>s<br />
im Membrane Operating System<br />
(MOS) optimiert. Auf diese Weise<br />
konnte der Energieverbrauch<br />
gesenkt und die Leistung der Anlage<br />
deutlich verbessert werden.<br />
Um die Membrantechnologie<br />
weiter voranzutreiben, ist im März<br />
2011 im Forschungszentrum von<br />
Siemens Water Technologies in Singapur<br />
eine neue Projektgruppe eingerichtet<br />
worden. Diese wird vorrangig<br />
an der Entwicklung von<br />
Membranfasern sowie der nächsten<br />
Generation von Membranfiltrationssystemen<br />
arbeiten. Durch die Erweiterung<br />
wird das Team bis Ende 2012<br />
auf insgesamt 50 Wissenschaftler,<br />
Ingenieure und Techniker an -<br />
wachsen. Das unterstreicht nicht nur<br />
die Investitionsbereitschaft des Un -<br />
ternehmens in Forschung und Entwicklung,<br />
sondern auch die Bedeutung<br />
des globalen Entwicklungszentrums.<br />
Die im Frühjahr 2007<br />
eröffnete Forschungseinrichtung<br />
wird von der Regierung in Singapur<br />
und von PUB stark unterstützt.<br />
Mehr Details zu SIWW unter:<br />
http://www.siemens.com/siww<br />
Weitere Informationen über<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungslösungen:<br />
http://www.siemens.com/water<br />
SiLibeads ® – lassen Brunnen länger sprudeln<br />
INNOVATIONS<br />
Glaskugeln als Ersatz für Filterkies in Brunnen<br />
- SiLibeads Glaskugeln entsprechen den Anforderungen des § 31 LFGB und Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, somit<br />
entfällt die Desinfektion vor der Befüllung<br />
- Einkornschüttung ermöglicht optimale Anpassung der Filterschlitzöffnungen<br />
- Kein Materialbruch beim Befüllen des Ringraumes, somit bleiben Filterschlitzöffnungen frei<br />
- Harmonische Kugelform und einheitliche Kugelgröße verhindern Brückenbildung beim Befüllen des Ringraumes<br />
- Klar- bzw. Entsandungspumpen nach dem Befüllen entfällt<br />
- Höchstmöglicher <strong>Wasser</strong>durchfluss auf Grund exakt gleicher Korngröße und Kugelform<br />
- Eisen- und Manganverockerung reduziert sich um bis zu 40%, dadurch lassen sich<br />
Kosten für Brunnenregenerierarbeiten einsparen<br />
<br />
<br />
www.sili.eu<br />
Gefördert vom<br />
Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und<br />
Technologie auf Grund<br />
eines Beschlusses<br />
des Deutschen<br />
Bundestages
NACHRICHTEN<br />
Leute<br />
Prof. Dr.-Ing. Matthias Krause neuer DVGW-Präsident<br />
V.l.n.r.: Prof. Dr.-Ing. Matthias Krause, Präsident, Dr.-Ing. Jürgen Lenz,<br />
Vizepräsident Gas, Dr.-Ing. Georg Grunwald, Vizepräsident <strong>Wasser</strong>, Dr.<br />
Karl Roth, Vizepräsident. © engelke picture<br />
Prof. Dr.-Ing. Matthias Krause (53)<br />
ist vom Vorstand des DVGW<br />
Deutscher Verein des Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>faches zum neuen Präsidenten<br />
gewählt worden. Er folgt auf<br />
Dr.-Ing. Bernhard (60), Vorstandsmitglied<br />
der Gelsenwasser AG, der<br />
zwei Jahre amtiert hat.<br />
Krause ist Geschäftsführer der<br />
Stadtwerke Halle GmbH. Nach<br />
Abschluss seines Studiums der Elektrotechnik<br />
an der Ingenieurhochschule<br />
Zittau war er dort bis zu seiner<br />
Promotion im Jahr 1988 wissenschaftlicher<br />
Assistent. Er leitete seit<br />
1990 den Bereich Energietechnik<br />
Chemie AG Bitterfeld-Wolfen, bevor<br />
er 1993 Technischer Geschäfts führer<br />
der Energieversorgung Halle wurde.<br />
Seit 2006 ist Matthias Krause Ho -<br />
norarprofessor an der Hochschule<br />
Zittau/Görlitz. Im September 2009<br />
wurde er zum Geschäftsführer der<br />
Stadtwerke Halle berufen.<br />
Dem DVGW-Präsidium gehören<br />
wie bisher Dr.-Ing. Jürgen Lenz (60)<br />
als Vizepräsident Gas und Dr.-Ing.<br />
Georg Grunwald (50) als Vizepräsident<br />
<strong>Wasser</strong> an. Dr. Karl Roth (58)<br />
wurde als neuer DVGW-Vizepräsident<br />
ins Präsidium gewählt. Die<br />
Amtszeit von DVGW-Präsident<br />
Krause beträgt satzungsgemäß ein<br />
Jahr. Im Anschluss an die erste<br />
Amtszeit kann der Präsident zweimal<br />
wiedergewählt werden.<br />
Henning R. Deters wird Vorstandsvorsitzender<br />
der GELSENWASSER AG<br />
Henning R.<br />
Deters.<br />
Henning R. Deters ist am 18. Juli<br />
2011 vom Aufsichtsrat der<br />
GELSENWASSER AG zum neuen<br />
Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens<br />
bestellt worden. Er wird<br />
seine Tätigkeit voraussichtlich zum<br />
1. Oktober 2011 bei dem traditionsreichen<br />
<strong>Wasser</strong>- und Energieversorgungsunternehmen<br />
in Gelsenkirchen<br />
aufnehmen.<br />
„Mit Henning R. Deters haben<br />
wir den idealen Nachfolger für Dr.<br />
Manfred Scholle gefunden. Aufgrund<br />
seiner Leistung und Erfahrung<br />
im Vertrieb und in Infrastrukturfragen<br />
sind wir uns sicher, dass<br />
der erfolgreiche Weg von GELSEN-<br />
WASSER in allen Geschäftsfeldern<br />
wie Trink- und <strong>Abwasser</strong> und der<br />
Energieversorgung fortbeschritten<br />
wird“, begrüßte Guntram Pehlke,<br />
Aufsichtsratsvorsitzender der GEL-<br />
SENWASSER AG, die Entscheidung<br />
des Gremiums.<br />
Henning R. Deters ist 42 Jahre alt<br />
und derzeit als Vorstand für den<br />
Bereich Technik/Infrastruktur bei<br />
E.ON Ruhrgas AG tätig, zuvor verantwortete<br />
er dort den Bereich Vertrieb.<br />
Nach dem Studium der Betriebswirtschaft<br />
an der Universität Münster<br />
begann er seine Laufbahn bei der<br />
Ruhrgas AG. Seit 1997 im Bereich<br />
Gaseinkauf eingesetzt, zeichnete er<br />
ab 2002 als Direktor des Gaseinkaufs<br />
Zentraleuropa verantwortlich. Es<br />
folgte eine zweijährige Zeit als Sprecher<br />
der Gastransportgesellschaft,<br />
der heutigen Open Grid Europe, und<br />
die anschließende Bestellung als<br />
Vorstand der Muttergesellschaft.<br />
Henning R. Deters lebt in Essen,<br />
ist verheiratet und Vater von zwei<br />
Kindern.<br />
Der bisherige Vorstandsvorsitzende<br />
Dr. Manfred Scholle wird zum<br />
30. September 2011 mit Vollendung<br />
des 65. Lebensjahres aus dem Amt<br />
ausscheiden.<br />
Juli/August 2011<br />
712 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Leute<br />
NACHRICHTEN<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Homann mit<br />
Bunsen-Pettenkofer-Ehrentafel ausgezeichnet<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Homann ist im<br />
Rahmen der DVGW-Mitgliederversammlung<br />
am 6. Juli 2011 in<br />
Bonn mit der Bunsen-Pettenkofer-<br />
Ehrentafel ausgezeichnet worden.<br />
Die Bunsen-Pettenkofer-Ehrentafel<br />
ist die höchste Auszeichnung, die<br />
der DVGW zu vergeben hat. Sie<br />
wurde anlässlich der 40. Jahresversammlung<br />
am 12. Juni 1900 in Mainz<br />
gestiftet und erinnert an die bedeutenden<br />
Chemiker und Hygieniker<br />
Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899)<br />
und Max Josef von Pettenkofer<br />
(1818-1901).<br />
Mit Homann zeichnet der DVGW<br />
eine Persönlichkeit aus, die sich in<br />
hervorragender Weise um die Förderung<br />
des Vereins sowie auf nationaler<br />
und internationaler Ebene um<br />
die wissenschaftliche und praktische<br />
Arbeit im Gasfach verdient<br />
gemacht hat.<br />
Klaus Homann begann seine<br />
berufliche Karriere 1979 bei der Vereinigten<br />
Elektrizitätswerke Westfalen<br />
AG (VEW), wo er bis 1998 verschiedene<br />
leitende Positionen im Bereich<br />
Gasversorgung/Gastechnik bekleidete.<br />
Von 1998 bis 2004 war er Mitglied<br />
des Vorstandes RWE Gas AG.<br />
Seit 2004 war Homann Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der RWE<br />
Transportnetz Gas GmbH und zuletzt<br />
Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der Thyssengas GmbH in Dortmund.<br />
Homann ist seit dem Jahr 2000<br />
Mitglied des DVGW-Vorstands. Dem<br />
DVGW-Präsidium, das er von 2005<br />
bis 2007 als Präsident führte,<br />
gehörte er von 2002 bis 2009 an.<br />
Homann engagierte sich darüber<br />
hinaus in zahlreichen Fachgremien<br />
des DVGW. Von 2003 bis 2006<br />
bekleidete er das Amt des Präsidenten<br />
der europäischen technischwissenschaftlichen<br />
Vereinigung der<br />
Gasindustrie (Marcogaz). Bis 2009<br />
war er Mitglied des Executive Board<br />
der Internationalen Gasunion (IGU),<br />
der weltweiten gasfachlichen Vereinigung.<br />
Seit 2009 ist er Präsident<br />
des DIN Deutsches Institut für Normung<br />
e. V.<br />
Neben Homann wurden Prof. Dr.-<br />
Ing. Wolfgang Kühn mit der DVGW-<br />
Ehrenmitgliedschaft und Dipl.-Ing.<br />
Fritz Guther mit dem DVGW-Ehrenring<br />
für ihre Verdienste um das Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>fach ausgezeichnet.<br />
Wolfgang Kühn hat sich im Laufe<br />
von 40 Jahren in der DVGW-<strong>Wasser</strong>forschung<br />
durch sein herausragendes<br />
Engagement für das deutsche<br />
Prof. Klaus Homann präsentiert die Ehrentafel des<br />
DVGW. © engelke picture<br />
<strong>Wasser</strong>fach und um die erfolgreiche<br />
Vernetzung der <strong>Wasser</strong>forschung in<br />
Europa verdient gemacht. Fritz<br />
Guther hat einen entscheidenden<br />
Beitrag bei der Überarbeitung der<br />
Technischen Regel für Gasinstallationen<br />
(DVGW-TRGI), eines in Europa<br />
einzigartigen Regelwerks, geleistet.<br />
Darüber hinaus hat sich Guther<br />
während seiner Obmannschaft im<br />
Technischen Komitee „Gasinstallation“<br />
in über 20 Jahren bleibende<br />
Verdienste in der Regelwerksarbeit<br />
erworben.<br />
Frank Gröschl in den Vorstand des WssTP gewählt<br />
Frank Gröschl, Bereichsleiter Forschung<br />
und Beteiligungsmanagement<br />
des DVGW, wurde am<br />
17. Mai 2011 in den Vorstand der<br />
europäischen „Water Supply and<br />
Sanitation Technology Platform“<br />
(WssTP) gewählt. WssTP wurde 2004<br />
von der Europäischen Kommission<br />
ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit<br />
in der <strong>Wasser</strong>forschung<br />
in Europa zu verbessern und so<br />
Innovation zu stärken. WssTP hat<br />
die Zusammenarbeit mit der EU-<br />
Kommission sukzessive ausgebaut,<br />
insbesondere bei der Erstellung der<br />
Forschungsrahmenprogramme. Da<br />
die EU die Ergebnisse ihrer Forschungsrahmenprogramme<br />
immer<br />
mehr für die konkrete Richtlinienarbeit<br />
nutzt, besteht für den DVGW<br />
jetzt ein erweiterter Zugang zu den<br />
Strukturen in Brüssel. WssTP hat derzeit<br />
61 Mitglieder; der DVGW ist seit<br />
2010 Mitglied dieser Organisation.<br />
Frank Gröschl.<br />
© WssTP<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 713
NACHRICHTEN<br />
Leute<br />
figawa-Präsidium und Vorstand neu gewählt<br />
V.l.n.r.: Klaus<br />
Küsel, Dr. Günter<br />
Stoll, Prof.<br />
Bernd H.<br />
Schwank,<br />
Jörn Winkels,<br />
Michael<br />
Calovini, Dr.<br />
Ralph Donath.<br />
Für die kommenden zwei Jahre<br />
hat die Mitgliederversammlung<br />
der Bundesvereinigung der Firmen<br />
im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach (figawa)<br />
e. V. Präsidium und Vorstand der mit<br />
rund 1000 Mitgliedsunternehmen<br />
mitgliederstärksten Vereinigung von<br />
Dr. Ralph Donath, Geschäftsführender<br />
Gesellschafter der<br />
Eugen Engert GmbH, Minden,<br />
Dr.-Ing. Günter Stoll, Geschäftsführer<br />
der Grünbeck <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
GmbH, Höchstadt-<br />
Donau und<br />
KG, Münster für die Fachgruppe<br />
Rohrleitungsbau,<br />
Lutz Kretschmann, Geschäftsführer<br />
der RSC Rohrbau und<br />
Sanierungs GmbH, Cottbus und<br />
Vorsitzender des Rohrleitungssanierungsverbandes<br />
e.V. für die<br />
Fachgruppe Rohrleitungssanierung,<br />
Franz-Josef Reintke, Geschäftsführer<br />
der Vormann Bohrgesellschaft<br />
mbH & Co. KG, Nottuln für<br />
die Fachgruppe <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
und<br />
Georg Taubert, Leiter Internationale<br />
Normung der Geberit<br />
International AG, Jona für die<br />
Fachgruppe Rohre und Rohrleitungszubehör.<br />
Herstellerunternehmen im Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>fach gewählt. Als Präsident<br />
des Verbandes wurde Prof. e. h.<br />
(RUS) Bernd H. Schwank, Geschäftsführender<br />
Gesellschafter der<br />
Schwank GmbH Köln, wiedergewählt.<br />
Schwank ist seit 2005 Präsident<br />
der figawa. Vizepräsident des<br />
Verbandes bleibt Klaus Küsel,<br />
Geschäftsführer der BIS Heinrich<br />
Scheven GmbH, Erkrath, der zu -<br />
gleich Präsident des eng mit der<br />
figawa verbundenen Rohrleitungsbauverbandes,<br />
rbv e. V. ist. Beide<br />
Verbände haben ihren Sitz in Köln.<br />
Weiterhin hat die Mitgliederversammlung<br />
der figawa die Gründung<br />
einer neuen Fachgruppe <strong>Wasser</strong>verwendung<br />
beschlossen, mit der die<br />
figawa ihr Engagement in diesem<br />
Bereich weiter ausbauen wird und<br />
damit ebenfalls eine strukturelle<br />
Angleichung an das Gremienumfeld<br />
vornimmt.<br />
In das Präsidium der figawa wurden<br />
für die kommenden zwei Jahre<br />
weiterhin gewählt:<br />
Michael Calovini, Geschäftsführer<br />
der Elster GmbH, Lotte/Büren,<br />
Jörn Winkels, Geschäftsführer<br />
der Salzgitter Mannesmann Pipe<br />
Line GmbH, Siegen.<br />
Mitglieder des figawa-Gesamtvorstandes<br />
sind:<br />
Dr.-Ing. Detlef Bohmann,<br />
Geschäftsführer der BEGA.tec<br />
GmbH, Berlin für die Fachgruppe<br />
Gasverwendung,<br />
Thorsten Dietz, Geschäftsführer<br />
der RMG Regel+Messtechnik,<br />
GmbH, Kassel für die Fachgruppe<br />
Gasdruckregelung und<br />
Gasmessung,<br />
Dr. rer. nat. Klaus Hagen, Stabsstelle<br />
Vertrieb/Verfahrenstechnik<br />
VWS Deutschland GmbH,<br />
Veolia Water Solutions & Technologies,<br />
Niederlassung Bayreuth<br />
für die Fachgruppe <strong>Wasser</strong>aufbereitung,<br />
Harald Jöllenbeck, Geschäftsführer<br />
der Allmess GmbH,<br />
Oldenburg für die Fachgruppe<br />
<strong>Wasser</strong>messung,<br />
Siegfried Kemper, Niederlassungsleiter<br />
der Gerhard Rode<br />
Rohrleitungsbau GmbH & Co.<br />
Als Fachleute des Gas- und <strong>Wasser</strong>fachs<br />
wurden in den Vorstand<br />
der figawa gewählt:<br />
Karl-Heinz Backhaus, Leiter<br />
Verbandsarbeit der Vaillant<br />
GmbH, Remscheid,<br />
Karl Dungs, Geschäftsführer der<br />
Karl Dungs GmbH & Co. KG,<br />
Urbach Hermann-Josef Görges,<br />
Schiedel GmbH & Co. KG, München,<br />
Willi Hecking, Geschäftsführer<br />
der Hans Sasserath & Co. KG,<br />
Korschenbroich,<br />
Prof. Dr. Reiner Homrighausen,<br />
Managing Director der BAUER<br />
Resources GmbH, Exploration &<br />
Mining Services, Pein,<br />
Klaus W. Jesse, Vice President<br />
Global Technology Management<br />
der Mertik Maxitrol GmbH & Co.<br />
KG, Senden,<br />
Pietro Mariotti, Leiter Technik<br />
der Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf,<br />
Ulrich Stemick, Technical<br />
Director / Leiter Innovation &<br />
Technik der Grundfos Water<br />
Treatment GmbH, Pfinztal und<br />
Werner Schulte, Leiter Technisches<br />
Marketing der Viega<br />
GmbH & Co KG, Attendorn.<br />
Juli/August 2011<br />
714 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Leute<br />
NACHRICHTEN<br />
Dr. Matthias Maier wird Honorarprofessor<br />
an der Hochschule Karlsruhe<br />
Am 29. Juni 2011 wurde Dr.<br />
Matthias Maier von Rektor Prof.<br />
Dr. Karl-Heinz Meisel in einem Festakt<br />
zum Honorarprofessor der<br />
Hochschule Karlsruhe – Technik und<br />
Wirtschaft ernannt.<br />
Nachdem er am <strong>Wasser</strong>wirtschaftsamt<br />
seine Berufsausbildung<br />
zum Bautechniker erfolgreich absolviert<br />
hatte, studierte Matthias Maier<br />
von 1984 bis 1988 Bauingenieurwesen<br />
mit der Vertiefungsrichtung<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft und Verkehrswesen<br />
an der damaligen Fachhochschule<br />
Karlsruhe, der heutigen<br />
Hochschule Karlsruhe. Für seine<br />
hervorragenden Studienleistungen<br />
erhielt er den Gerhard-Janssen-Preis<br />
– als erste von vielen Auszeichnungen<br />
in seinem Werdegang.<br />
1990 legte er die Staatsprüfung<br />
für den gehobenen bautechnischen<br />
Verwaltungsdienst des Landes in<br />
der <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft ab.<br />
Für die beste Staatsprüfung im Bauingenieurwesen<br />
wurde er dabei<br />
zum einen mit dem Preis des badenwürttembergischen<br />
Ministeriums<br />
für Umwelt und zum anderen mit<br />
dem Preis der Stadt Karlsruhe<br />
geehrt. 1998 konnte er seine Dissertation<br />
an der University of Surrey<br />
(England) erfolgreich abschließen,<br />
für deren herausragende wissenschaftliche<br />
Qualität er im folgenden<br />
Jahr den Preis der International<br />
Water Services Association erhielt.<br />
2004 wurde Dr. Matthias Maier zum<br />
Visiting Lecturer der University of<br />
Surrey und auf Sri Lanka 2006 zum<br />
Visiting Professor an der University<br />
Ruhuna sowie 2009 an der Ocean<br />
University Colombo ernannt.<br />
1988 begann seine berufliche<br />
Karriere bei den Stadtwerken Karlsruhe.<br />
Bereits nach zwei Jahren<br />
wurde er dort zum Leiter der Abteilung<br />
Hydrologie/Grundwasserschutz.<br />
Nach seiner berufsbegleitenden<br />
Promotion wurde ihm 2001<br />
die Leitung der Abteilung <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
übertragen, im gleichen<br />
Jahr wurde er zum stellvertretenden<br />
Hauptabteilungsleiter Technik-<br />
Werke ernannt, 2003 zum Hauptabteilungsleiter<br />
Technik-Trinkwassergewinnung.<br />
Seit Mitte der 1990er-Jahre ist Dr.<br />
Matthias Maier in einer Vielzahl von<br />
Ämtern und Funktionen in Verbänden,<br />
Arbeitsgemeinschaften, Vereinen,<br />
Kommissionen und Beiräten<br />
engagiert, beispielsweise im Verband<br />
kommunaler Unternehmen<br />
(VKU), in der Arbeitsgemeinschaft<br />
der <strong>Wasser</strong>werke an Bodensee und<br />
Rhein (AWBR), im Berufsbildungsausschuss<br />
des Regierungspräsidiums<br />
Karlsruhe, in der Internationalen<br />
Kommission zum Schutz des<br />
Rheins (IKSR), in der European Well<br />
and Fountain Society (EWFS, aktuell:<br />
Vizepräsident), in der International<br />
Water Aid Organization (IWAO, aktuell:<br />
Vorstand), im Deutschen Verein<br />
des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches (DVGW),<br />
in der Trinkwasserkommission des<br />
Bundesministeriums für Gesundheit,<br />
im Bundesverband der Energie-<br />
und <strong>Wasser</strong>wirtschaft (BDEW)<br />
und in der Integrated Water Resources<br />
Management-Konferenz (IWRM,<br />
aktuell: wissenschaftlicher Beirat).<br />
Auch als Autor und Co-Autor<br />
konnte er sich einen Namen<br />
machen: Etwa 90 wissenschaftliche<br />
Artikel wurden von ihm in deutschen<br />
und internationalen Fachzeitschriften<br />
veröffentlicht. Zudem ist<br />
er regelmäßig mit Fachvorträgen<br />
auf nationalen und internationalen<br />
Tagungen und Konferenzen vertreten.<br />
Seit 1994 betreut er rund 40<br />
Bachelor- und Diplomarbeiten,<br />
davon zehn Abschlussarbeiten an<br />
der Hochschule Karlsruhe, sowie<br />
neun Dissertationen.<br />
In den Jahren 1989 bis 1995<br />
engagierte er sich an der Hochschule<br />
Karlsruhe in der Weiterbildung ausländischer<br />
<strong>Wasser</strong>fachleute. Seit<br />
1992 ist er in den Studiengängen<br />
Bauingenieurwesen und Baubetrieb<br />
als Lehrbeauftragter tätig. Zu seinem<br />
aktuellen Lehrauftrag zu den „Grundlagen<br />
der Siedlungswasserwirtschaft“<br />
im Studiengang Bauingenieurwesen<br />
bietet Dr. Matthias Maier –<br />
stets mit tatkräftiger Unterstützung<br />
der Stadtwerke Karlsruhe – auch<br />
Laborübungen zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und Exkursionen zu Karlsruher<br />
<strong>Wasser</strong>werken an und engagiert sich<br />
neben der aktuellen Betreuung<br />
zweier Abschlussarbeiten zudem in<br />
der Organisation gemeinsamer<br />
Fachkonferenzen an der Hochschule<br />
Karlsruhe. Zur Förderung gemeinsamer<br />
Forschungsaktivitäten sorgte Dr.<br />
Matthias Maier dafür, dass die Stadtwerke<br />
Karlsruhe der Versuchsanstalt<br />
für <strong>Wasser</strong>bau der Hochschule Karlsruhe<br />
einen Versuchsstand zur Spülung<br />
von Trinkwasserrohrleitungen<br />
zur Verfügung stellen.<br />
„Mit Herrn Dr. Maier gewinnt die<br />
Hochschule Karlsruhe einen ausgewiesenen<br />
Fachmann, der herausragende<br />
wissenschaftliche Leistungen<br />
vorweisen kann und diese in nachgewiesen<br />
idealer Weise und mit<br />
außergewöhnlich großem Engagement<br />
in Lehre und angewandter<br />
Forschung einsetzt“, so Prof. Dr.<br />
Erwin Schwing, Dekan der Fakultät<br />
für Architektur und Bauwesen in seiner<br />
Laudatio. „Er kann dabei nicht<br />
nur seine didaktischen Fähigkeiten<br />
durch sehr gute Bewertungen in der<br />
studentischen Evaluation von Lehrveranstaltungen<br />
nachweisen, sondern<br />
motiviert die Studierenden darüber<br />
hinaus durch experimentelle<br />
Übungen und Exkursionen.“ Aus<br />
den Arbeitsgebieten der Stadtwerke<br />
Karlsruhe ergeben sich zudem regelmäßig<br />
aktuelle Fragestellungen für<br />
studentische Abschlussarbeiten und<br />
für gemeinsame Aktivitäten in der<br />
angewandten Forschung. „Wir sind<br />
daher davon überzeugt“, so Rektor<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Meisel, „dass Prof.<br />
Dr. Matthias Maier das Profil der<br />
Hochschule Karlsruhe im Fachgebiet<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung langfristig<br />
und nachhaltig schärfen wird.“<br />
Prof. Dr.<br />
Matthias Maier<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 715
NACHRICHTEN<br />
Leute<br />
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Karl Heinz Hunken verstorben<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Dr. h.c. Karl<br />
Heinz Hunken.<br />
Am 06. Juli 2011 verstarb Prof.<br />
Dr.-Ing. Dr. h.c. Karl Heinz<br />
Hunken im Alter von 91 Jahren.<br />
Geboren am 5. Oktober 1919 in<br />
Mannheim legte er dort 1938 das<br />
Abitur ab. Die Jahre danach bis 1945<br />
wurden von Arbeits- und Kriegsdienst<br />
beansprucht. 1950 absolvierte<br />
er das Bauingeni eurstudium<br />
an der TH Stuttgart mit dem Diplom.<br />
Zwischen 1952 und 1959 arbeitete<br />
er als Assistent bei Prof. Franz<br />
Pöpel am Lehrstuhl für Siedlungswasserbau<br />
und Gesund heitstechnik<br />
der TH Stuttgart.<br />
1959 promovierte er mit der<br />
richtungsweisenden Arbeit „Untersuchungen<br />
über den Reinigungsverlauf<br />
und den Sauerstoffverbrauch<br />
bei der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
durch das Be lebtschlammverfahren“<br />
zum Dr.-Ing. Ebenfalls 1959 wurde<br />
er Oberingenieur und erhielt Lehraufträge<br />
für In dustrieabwasserbehandlung<br />
und biologische <strong>Abwasser</strong>reinigung.<br />
1965 übernahm er<br />
den außerordentlichen Lehrstuhl<br />
für Technologie des Industriewasserbaus<br />
und 1967 den Lehrstuhl II<br />
für Siedlungswasserbau und<br />
<strong>Wasser</strong>gütewirtschaft; gleichzeitig<br />
wurde Prof. Hunken zusammen mit<br />
Prof. Franz Pöpel Direktor des Instituts<br />
für Siedlungswasserbau und<br />
<strong>Wasser</strong>gütewirtschaft. Von 1971 bis<br />
1980 war er Rektor der Universität<br />
Stuttgart.<br />
Als Forscher und Hochschullehrer<br />
erwarb sich Karl Heinz Hunken<br />
aufgrund seines hervorra genden<br />
Fachwissens, seiner vorausschauenden,<br />
die Beteiligten mit einschließenden<br />
Art und seiner Fähigkeit,<br />
kritisch Dinge zu hinterfragen und<br />
fundierte Lösungen zu entwickeln,<br />
höchste Anerken nung bei Studierenden,<br />
Mitarbeitern und Fachkollegen<br />
im In- und Ausland.<br />
Als Ordinarius hat er sieben Dissertationen<br />
auch in den Jahren seiner<br />
Rektoratszeit be treut; darunter<br />
die mit dem Imhoff-Preis ausgezeichnete<br />
Arbeit von Kh. Krauth,<br />
1971: „Der Abfluß und die Verschmutzung<br />
des <strong>Abwasser</strong>s in<br />
Mischkanalisationen bei Regen“.<br />
Seine Innovati onsfreude kam mit<br />
zum Ausdruck durch Beteiligung an<br />
Arbeiten über Algen (Disser tation<br />
Se koulov, 1972) und dem erstmalig<br />
erfolgreichen Einsatz von <strong>Wasser</strong>stoffperoxid<br />
in der Sauerstoffversorgung<br />
von Belebtschlamm (Hunken,<br />
Sekoulov u. Bardtke 1973).<br />
Nach seiner Rektoratszeit initiierte<br />
er 1980 eine Wiederaufnahme<br />
des DFG-Sonderforschungsbereiches<br />
82 „Qualitätsverbesserungen<br />
und Weiterbehandlung gereinigter<br />
Ab wäs ser“ und war dessen engagierter<br />
Sprecher. Schon kurz nach<br />
der Gründung des ATV-Fachausschusses<br />
2.6 Belebungsverfahren<br />
wurde er dort Mitglied. Intensiv<br />
widmete er sich auch wasserwirtschaftlichen<br />
Fragestellungen im<br />
Land Baden-Würt temberg. Diese<br />
Arbeiten wurden in Gutachten zum<br />
Bodensee niedergelegt und um -<br />
fassten beispielhaft den Stoffeintrag<br />
durch die Stockacher Aach,<br />
Überlegungen zu einer <strong>Abwasser</strong>ringleitung<br />
(1963) und den heiß diskutierten<br />
Bodensee-Neckarstollen<br />
(1973). Die letzte von ihm geleitete<br />
gutachterliche Ausarbeitung betraf<br />
die Behandlung der Sickerwässer<br />
der Son derabfalldeponie Billigheim<br />
(1986).<br />
Neben seinem wissenschaftlichen<br />
Engagement war Karl Heinz<br />
Hunken hochschulpolitisch eingebunden<br />
und ließ sich in bewegten<br />
Zeiten in die Pflicht nehmen. Ende<br />
der 60er-Jahre war er von Anbeginn<br />
Mitglied der Grundordnungskommission<br />
der Universität und beeinflusste<br />
damit wesentlich ihre Umgestaltung.<br />
1967 bis 1968 fungierte er<br />
als Dekan der heutigen Fakultät<br />
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften.<br />
1970 als Dekan wiedergewählt,<br />
wurde er im April 1971 als<br />
Rektor berufen. Umsichtig und<br />
erfolgreich leitete er die Geschicke<br />
der Universität bis September 1980.<br />
Er war damit der am längs ten amtierende<br />
Rektor der Universität Stuttgart<br />
seit Einführung der Rektoratsverfassung.<br />
Von 1977 bis 1980 war<br />
er zusätzlich Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz.<br />
Karl Heinz Hunken, ein Visionär<br />
in Sachen Umweltschutztechnik,<br />
war von der Notwendigkeit und<br />
Bedeutung der fachübergreifenden<br />
engen Zusammenarbeit von Ingenieuren<br />
und Natur- und Geisteswissenschaftlern<br />
im Umweltbereich<br />
überzeugt. Anfang der 1990er-Jahre<br />
hat er den bis heute hervorragend<br />
angenommenen, fakultätsübergreifenden<br />
Ingenieurstudiengang<br />
Umweltschutztechnik der Universität<br />
Stuttgart initiiert und diesen<br />
beratend lang über seine Amtszeit<br />
hinaus begleitet.<br />
Von der Ukrainischen Freien Universität<br />
erhielt er 1975 die Ehrendoktorwürde.<br />
Eine besondere Anerkennung<br />
für seine großen Verdienste erfuhr<br />
Prof. Hunken 1981 mit der Verleihung<br />
des „Verdienstkreuzes erster<br />
Klasse“ des Verdienstordens der<br />
Bundesre publik Deutschland und<br />
1987 mit der Verleihung der „Verdienstmedaille<br />
des Landes Ba den-<br />
Würt temberg“.<br />
Auch nach der Emeritierung<br />
1988 blieb Karl Heinz Hunken der<br />
Universität und dem Institut weiterhin<br />
als Mentor eng verbunden.<br />
Mit seinem Tod haben wir, das<br />
Institut und die Fachwelt einen<br />
exzellenten Wissenschaftler und<br />
Hochschullehrer aber auch einen<br />
mit Weitsicht politisch denkenden<br />
und handelnden, selbstlos an der<br />
Sache orientierten, sich nicht schonenden,<br />
hochintelligenten und<br />
überaus sensiblen Menschen mit<br />
höchster Überzeugungskraft verloren.<br />
Wir werden Karl Heinz Hunken<br />
ein ehrendes Gedenken bewahren.<br />
Heidrun Steinmetz, Stuttgart<br />
Oktay Tabasaran, Stuttgart<br />
Juli/August 2011<br />
716 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Vereine, Verbände und Organisationen<br />
NACHRICHTEN<br />
Neue Regelungen zum Gewässerschutz –<br />
DVGW sieht Nachbesserungsbedarf<br />
Der DVGW sieht bzgl. der Regelungen<br />
zu den Entwürfen einer<br />
Mantelverordnung zur Grundwasserverordnung<br />
und der Oberflächenwasserverordnung<br />
den vorsorgenden<br />
Gewässerschutz nicht ausreichend<br />
berücksichtigt.<br />
Mantelverordnung zur<br />
Grundwasserverordnung<br />
Der Referentenentwurf der Verordnung<br />
legt Anforderungen für das<br />
Einbringen und Einleiten von Stoffen<br />
in das Grundwasser, an den Einbau<br />
von Ersatzbaustoffen und für<br />
die Verwendung von Boden und<br />
bodenähnlichem Material fest. Leitbild<br />
für diese Regelungen sollte<br />
stets die langfristige Vorsorge für<br />
Boden und Grundwasser sein. Insbesondere<br />
in folgenden Punkten sieht<br />
der DVGW Nachbesserungsbedarf:<br />
Prüfwerte für trinkwasserrelevante<br />
<strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe sind<br />
unterhalb der Trinkwassergrenzwerte<br />
festzulegen.<br />
Der Ort der Beurteilung der Prüfwerte<br />
muss vor dem Eintritt in<br />
das Grundwasser und der dort<br />
stattfindenden Vermischung im<br />
<strong>Wasser</strong>körper liegen. Ein Sicherheitspuffer<br />
von mindestens 1 m<br />
oberhalb des Grundwassers ist<br />
vorzugeben.<br />
Keine pauschale Möglichkeit der<br />
Einbringung von mineralischen<br />
Ersatzbaustoffen in <strong>Wasser</strong>schutzzonen<br />
III, stattdessen differenzierte<br />
Betrachtung anhand<br />
der örtlichen Verhältnisse.<br />
Integration von Regelungen zu<br />
„neuen“ organischen Spurenstoffen<br />
und nicht relevanten<br />
Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Oberflächenwasserverordnung<br />
Der Referentenentwurf der neuen<br />
Oberflächenwasserverordnung bietet<br />
aus Sicht des DVGW keinen ausreichenden<br />
vorsorgenden Schutz<br />
für die Trinkwasserressourcen. Hierzu<br />
zählt die Verankerung der<br />
Maxime die zur Trinkwassergewinnung<br />
genutzten Oberflächenwasserkörper<br />
so zu bewirtschaften,<br />
dass der Umfang der Aufbereitung<br />
verringert wird. Ebenso sollten die<br />
Zielwerte des Verbändememorandums<br />
(ARW, AWBR, AWE, AWWR,<br />
DVGW) aus dem Jahr 2010 als<br />
Bewertungsgrundlage für den<br />
Zustand der Oberflächengewässer<br />
anstelle der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung<br />
integriert werden.<br />
Entscheidend ist letztendlich,<br />
dass bei steigenden Trends einer<br />
Belastung oder einer Überschreitung<br />
von Umweltqualitätsnormen<br />
entsprechende Gegenmaßnahmen<br />
einzuleiten sind, um damit langfristig<br />
die Ziele des vorsorgenden<br />
Gewässerschutzes auch zu erreichen.<br />
Dieser Aspekt muss in die<br />
neue Verordnung integriert werden.<br />
Neue Hilfen zur effektiven und effizienten<br />
Instandhaltung von <strong>Wasser</strong>rohrnetzen<br />
<strong>Wasser</strong>rohrnetze stellen den<br />
bei Weitem höchsten Anlagenwert<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung dar.<br />
Die langen technischen Nutzungsdauern<br />
über mehrere Generationen<br />
und die damit verbundenen Alterungsprozesse<br />
der Netze erfordern<br />
eine vorausschauende strategische<br />
Vorgehensweise bei der Instandhaltung,<br />
um langfristig technisch-wirtschaftlich<br />
sinnvolle Lösungen zu<br />
erhalten. Der DVGW hat hierzu neue<br />
praktische Hilfestellungen für den<br />
<strong>Wasser</strong>versorger erarbeitet. Grundlagen<br />
dazu sind u.a. ausreichende<br />
und belastbare Daten zum Netzbestand-<br />
und -zustand als auch praxisnahe<br />
Entscheidungshilfen für die<br />
Erneuerung von Netzen.<br />
Der DVGW-Hinweis W 402 stellt<br />
die Basis für eine qualifizierte und<br />
qualitätsgesicherte Auswahl, Erfassung,<br />
Aufbereitung, Auswertung<br />
und Speicherung der netzrelevanten<br />
Daten zu Verfügung. Es beinhaltet<br />
die auch spartenübergreifend abgestimmte<br />
Konzeption zur Erfassung<br />
und Auswertung belastbarer Be -<br />
stands-, Zustands- und Umgebungsdaten<br />
von <strong>Wasser</strong>- und Gasrohrnetzen.<br />
In Verbindung mit dem Hinweis<br />
W 403, der praxisnahe Entscheidungshilfen<br />
für die Rehabilitation<br />
von <strong>Wasser</strong>rohrnetzen gibt, kann der<br />
Versorger abgestimmt auf seine spezifischen<br />
Verhältnisse daraus eine<br />
optimierte Instandhaltungsstrategie<br />
entwickeln. Eines ist klar: Je mehr<br />
qualifizierte Kenntnisse über das<br />
eigene Rohrnetz vorliegen, desto<br />
effizienter und kostengünstiger<br />
kann im Einzelfall gehandelt werden.<br />
Die neuen Hinweise des DVGW<br />
verbinden somit technische Sicherheit<br />
und ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit<br />
auch für kommende<br />
Generationen. Beides As pekte, die in<br />
der heutigen Diskussion über eine<br />
leistungsfähige und bezahlbare<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung un trennbar miteinander<br />
verbunden sind.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 717
RECHT UND REGELWERK<br />
Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
W 406 Entwurf: Volumen- und Durchflussmessung von kaltem Trinkwasser in<br />
Druckrohrleitungen – Bemessung, Einbau und Betrieb von <strong>Wasser</strong>zählern, 07/2011<br />
Ein neuer Entwurf für DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 406 „Volumenund<br />
Durchflussmessung von kaltem<br />
Trinkwasser in Druckrohrleitungen<br />
– Bemessung, Einbau und Betrieb<br />
von <strong>Wasser</strong>zählern“ (Juli 2011) liegt<br />
vor. Bei der Einspruchsberatung<br />
zum ersten Gelbdruck vom Juli 2010<br />
wurde eine Überarbeitung im Hinblick<br />
auf einen zweiten Gelbdruck<br />
vereinbart. Das Ergebnis kann bis<br />
30. Oktober 2011 kommentiert werden.<br />
Die einschlägigen gesetzlichen<br />
Bestimmungen untermauern die<br />
Notwendigkeit einer technisch einwandfreien<br />
Zählerwahl. W 406<br />
berücksichtigt sowohl die Durchflüsse<br />
Q min , Q t , Q n , Q max nach 75/33/<br />
EWG als auch die Durchflüsse Q 1 , Q 2 ,<br />
Q 3 , Q 4 nach 2004/22/EG. Die Definitionen<br />
der obigen Durchflüsse nach<br />
75/33/EWG bzw. 2004/22/EG weichen<br />
an sich nur geringfügig voneinander<br />
ab. Ihre Verhältnisse, d. h. die<br />
Durchflussbereiche nach 2004/22/<br />
EG und die metrologischen Klassen<br />
nach 75/33/EWG, decken sich aber<br />
Tabelle. Tabelle 1 aus W 406:2011-07 – Zähler fü r ein<br />
einzelnes Wohngebäude (WE = Zahl der Wohneinheiten).<br />
75/33/EWG<br />
2004/22/EG<br />
Q n Q max Q 3 Q 4<br />
in m³/h<br />
WE ≤ 30 2,5 5 4 4<br />
WE ≤ 200 6 12 10 12,5<br />
WE ≤ 600 10 20 16 20<br />
nicht (z. B.: Q max /Q n = 2, Q 4 /Q 3 =<br />
1,25). Darauf ist bei Umstellungen<br />
(Zählerwechsel) zu achten.<br />
In Ermangelung aktueller, repräsentativer<br />
Daten kann die Zählergröße<br />
Q n = 2,5 m 3 /h (Q 3 = 4 m 3 /h)<br />
für mehr als 30 Wohneinheiten nicht<br />
empfohlen werden. In Verbindung<br />
mit den neuen Einsatzgrenzen der<br />
Zählergrößen Q n = 6 m 3 /h (Q 3 =<br />
10 m 3 /h) bzw. Q n = 10 m 3 /h (Q 3 =<br />
16 m 3 /h) bei 200 bzw. 600 Wohneinheiten<br />
entspricht Tabelle 2 von<br />
W 406:2011-07 konsequent den<br />
Ergebnissen des DVGW-Forschungsprogramms<br />
02-WT 956, das der Vorgängerausgabe<br />
W 406:2003-12 bzw.<br />
der Veröffentlichung <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<br />
<strong>Abwasser</strong> Nr. 122, Heft 11, 1981,<br />
S. 541 vorangegangen ist und die<br />
Durchschnittswerte 2,5 Einwohner<br />
pro Wohneinheit und 155 Liter pro<br />
Einwohner und Tag ansetzt.<br />
Messtechnisch gibt es keinen<br />
zwingenden Grund, Zählergrößen<br />
kleiner als Q n = 2,5 m 3 /h (Q 3 =<br />
4 m 3 /h) vorzusehen, auch wenn<br />
man geringere als die vorgenannten<br />
Durchschnittswerte ansetzt. Für<br />
alle sonstigen Bemessungsfälle<br />
(Nicht-Wohngebäude) verzichtet<br />
W 406 nun auf die Angabe konkreter<br />
Bemessungsgrenzen und verweist<br />
stattdessen auf die Bedarfsermittlung<br />
bzw. Durchflussberechnung<br />
für das jeweilige Objekt.<br />
Kein Messgerät misst exakt. Für<br />
alle <strong>Wasser</strong>zähler im geschäftlichen<br />
Verkehr gelten dieselben, rechtsverbindlichen<br />
Fehlergrenzen. Die verschiedenen<br />
Bauformen – für Hauswasserzähler<br />
werden vor allem Flügelradzähler<br />
und Ringkolbenzähler<br />
eingesetzt – weisen unterschiedliche<br />
Eigenschaften auf. Die Auswahl<br />
liegt beim Versorgungsunternehmen.<br />
Inwieweit es bei einem<br />
bestimmten Zähler zu einer Mehroder<br />
Mindermessung kommt und<br />
inwieweit sich die Verhältnisse<br />
durch einen Wechsel der Zählergröße<br />
oder -bauform ändern, hängt<br />
von den Einzelfallumständen ab<br />
und kann nicht pauschal vorhergesagt<br />
oder im Nachhinein ermittelt<br />
werden. Wenn ein eingebauter Zähler<br />
also gültig geeicht ist (75/33/<br />
EWG) bzw. die CE/M-Kennzeichnung<br />
(2004/22/EG) trägt und nach W 406<br />
bemessen ist, gibt es fachlich keinen<br />
begründeten Anlass für einen Austausch.<br />
Preis:<br />
20,59 € für Mitglieder;<br />
27,45 € für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
wvgw Wirtschafts- und<br />
Verlagsgesellschaft Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3,<br />
D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9191-40,<br />
Fax (0228) 9191-499,<br />
www.wvgw.de<br />
Juli/August 2011<br />
718 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
RECHT UND REGELWERK<br />
Ankündigung zur Fortschreibung der<br />
DVGW-Regelwerke<br />
Folgende Regelwerke werden überarbeitet<br />
DVGW-Merkblatt W 319: Reinigungsmittel<br />
für<br />
Trinkwasserbehälter Einsatz,<br />
Prüfung und Beurteilung<br />
Das technische Komitee W-TK-2-2<br />
<strong>Wasser</strong>speicherung hat die Überarbeitung<br />
des DVGW-Merkblattes<br />
W 319:1999-05 Reinigungsmittel für<br />
Trinkwasserbehälter Einsatz, Prüfung<br />
und Beurteilung beschlossen.<br />
Dazu wurde ein entsprechender<br />
Projektkreis einberufen.<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 316<br />
Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern –<br />
Qualifikationskriterien für<br />
Fachunternehmen –<br />
Fachaufsicht und Fachpersonal<br />
für die Instandsetzung<br />
von Trinkwasserbehältern;<br />
Lehr- und Prüfungsplan<br />
Das technische Komitee W-TK-2-2<br />
<strong>Wasser</strong>speicherung hat die Überarbeitung<br />
des DVGW-Arbeitsblattes<br />
W 316:2004-03 Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern – Qualifikations<br />
kriterien für Fachunternehmen<br />
– Fachaufsicht und Fachpersonal für<br />
die Instandsetzung von Trinkwasserbehältern;<br />
Lehr- und Prüfungsplan<br />
beschlossen. Dazu wurde ein entsprechender<br />
Projektkreis ein berufen.<br />
Bei Interesse und Rückfragen:<br />
Dipl.-Ing. Peter Frenz,<br />
Referent Korrosionsschutz &<br />
<strong>Wasser</strong> speicherung,<br />
<strong>Wasser</strong>bereich,<br />
Tel. (0228) 9188-654,<br />
Fax (0228) 9188-988,<br />
E-Mail: frenz@dvgw.de<br />
Ankündigung zur Überarbeitung von Regelwerken gemäß GW 100<br />
W 316: Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern –<br />
Qualifikationskriterien für<br />
Fachunternehmen –<br />
Fachaufsicht und Fachpersonal<br />
für die Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern;<br />
Lehr- und Prüfungsplan<br />
W 319: Reinigungsmittel für<br />
Trinkwasserbehälter Einsatz,<br />
Prüfung und Beurteilung<br />
GW 335-A1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme<br />
in der Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung; Anforderungen<br />
und Prüfungen –<br />
Teil A1: Rohre und daraus<br />
gefertigte Formstücke aus<br />
PVC-U für die <strong>Wasser</strong>verteilung<br />
GW 368: Längskraftschlüssige<br />
Muffenverbindungen für Rohre,<br />
Formstücke und Armaturen aus<br />
duktilem Gusseisen oder Stahl<br />
W 336: <strong>Wasser</strong>anbohrarmaturen;<br />
Anforderungen und Prüfungen<br />
Bei Rückfragen:<br />
DVGW,<br />
Josef-Wirmer-Straße 1–3,<br />
D-53123 Bonn,<br />
www.dvgw.de<br />
Ihre Hotlines für <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Redaktion<br />
Mediaberatung<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, München<br />
Inge Matos-Feliz, München<br />
Telefon (089) 45051-318 Telefon (089) 45051-228<br />
Telefax (089) 45051-323 Telefax (089) 45051-207<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Leserservice <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Brigitte Krawczyk, München<br />
Postfach 9161, 97091 Würzburg Telefon (089) 45051-226<br />
Telefon +49 (0) 931/4170-1615 Telefax (089) 45051-300<br />
Telefax +49 (0) 931/4170-492<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
e-mail: leserservice@oldenbourg.de<br />
Wenn Sie spezielle Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 719
RECHT UND REGELWERK<br />
Recht und Regelwerk<br />
DVGW-Regelwerk zur Epoxidharzinnensanierung wird zurückgezogen<br />
Das Lenkungskomitee <strong>Wasser</strong>verwendung hat auf seiner Sitzung am 24. Mai 2011 beschlossen, das Regelwerk<br />
zur Epoxidharzinnensanierung mit sofortiger Wirkung zurückzuziehen, da derzeit aus trinkwasserhygienischer<br />
und technischer Sicht relevante Datengrundlagen und Voraussetzungen fehlen bzw. nicht bekannt sind.<br />
Die Rohrinnensanierung ist ein<br />
vor 1987 entstandenes, alternatives<br />
Sanierungsverfahren für Trinkwasser-Installationen.<br />
Die Rohre<br />
werden von innen gereinigt und mit<br />
einem Epoxidharz neu beschichtet.<br />
Trinkwasser-Installationen insbesondere<br />
aus verzinktem Stahlrohr<br />
weisen nach längerem Gebrauch<br />
häufig erhebliche Ablagerungen<br />
aus Korrosionsprodukten auf der<br />
Innenseite auf. Es kann dadurch zu<br />
vermindertem Durchfluss und/oder<br />
Leckagen kommen. Üblicherweise<br />
werden solche stark geschädigten<br />
Rohrleitungen ausgetauscht; dies<br />
ist eine aufwendige, aber auch<br />
besonders dauerhafte Lösung. Mit<br />
diesen Verfahren soll aber die Installation<br />
konservativ behandelt werden.<br />
Dazu werden durch Strahloder<br />
Beizverfahren die Ablagerungen<br />
entfernt. Anschließend wird<br />
eine Auskleidung mit einem Epoxidharz<br />
vorgenommen, um die freigelegte<br />
Rohrinnenfläche gegen Korrosion<br />
zu schützen. Der Erfolg des Verfahrens<br />
hängt entscheidend von<br />
der korrekten Ausführung aller<br />
Detailschritte vor Ort ab; es handelt<br />
sich also keineswegs um ein einfach<br />
zu beherrschendes System. Besonders<br />
die vollständige Entfernung<br />
aller Ablagerungen ist für eine<br />
dauerhafte Instandsetzung unerlässlich.<br />
Wichtig für eine Kontrolle<br />
der Ausführung der Arbeiten ist<br />
eine umfangreiche Dokumentation<br />
aller Verfahrensschritte, eine nachträgliche<br />
zerstörungsfreie Prüfung<br />
ist nicht möglich. Die hygienische<br />
Beurteilung bzw. Bewertung des<br />
Harzes fußt dabei auf der Beschichtungsleitlinie<br />
des Umweltbundesamtes.<br />
Besonders die Eignung des<br />
Harzes aus hygienischer Sicht ist in<br />
den letzten Jahren Gegenstand<br />
intensiver Diskussionen. Bislang<br />
existierte nur ein Harz, das seitens<br />
des Umweltbundesamtes für den<br />
Einsatz gelistet war. Die bisherige<br />
Listung für dieses Harz beim<br />
Umweltbundesamt ist seit September<br />
2010 abgelaufen. Damit fehlt<br />
momentan die hygienische Empfehlung<br />
des Umweltbundesamtes<br />
für diese Werkstoffe im Kontakt mit<br />
Trinkwasser.<br />
Das bisherige Regelwerk für<br />
diese Verfahren umfasste:<br />
Die DVGW-Prüfgrundlage VP<br />
548 (Nachweis der Gebrauchstauglichkeit<br />
des Verfahrens,<br />
Baumusterprüfung)<br />
Das DVGW-Arbeitsblatt W 545<br />
(Nachweis der Eignung des<br />
Ausführenden Unternehmens)<br />
Das DVGW-Merkblatt W 548<br />
(Bewertung der beschichteten<br />
Installationen)<br />
Damit die grundlegenden Daten<br />
und Voraussetzungen für dieses<br />
Verfahren eruiert werden können,<br />
soll ein Forschungsvorhaben mit<br />
Beteiligung der Industrie und der<br />
ausführenden Firmen initiiert werden.<br />
Die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens<br />
bilden dann die<br />
Grundlage für die weitere fachliche<br />
Betrachtung des Themas im DVGW.<br />
Recht und Regelwerk<br />
Zurückgezogene Regelwerke<br />
Folgendes Regelwerk wurde zurückgezogen:<br />
VP 548<br />
Thermostatische Zirkulationsventile für den hydraulischen Abgleich in<br />
Warmwasser-Trinkwassersystemen<br />
08/1998 Wird ersetzt durch<br />
W 554<br />
Juli/August 2011<br />
720 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
RECHT UND REGELWERK<br />
Neue Merkblätter erschienen<br />
Merkblatt DWA-M 771: <strong>Abwasser</strong> aus der Wäsche, Pflege und<br />
Instandhaltung von Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeugen<br />
Bei Unfällen mit Ölen und flüssigen<br />
Chemikalien kommt der<br />
Gefahrenabwehr und Schadenbegrenzung<br />
einschließlich dem vorbeugenden<br />
Gesundheits- und<br />
Umweltschutz besondere Bedeutung<br />
zu. Bei diesen Maßnahmen ist<br />
der Einsatz von geeigneten Öl- und<br />
Chemikalienbindemitteln entscheidend.<br />
Bei unsachgemäßer Handhabung<br />
kann es zu gefährlichen Reaktionen<br />
kommen. Ziel ist es, durch<br />
einheitliche Vorgaben zur Prüfung<br />
und Bewertung von Bindemitteln<br />
die wahrscheinliche Eignung für den<br />
angestrebten Einsatzzweck sowie<br />
die Zuverlässigkeit solcher Produkte<br />
anhand der Verpackungshinweise<br />
erkennbar zu machen. Auf diese<br />
Weise kann der sachlich richtige und<br />
schnelle Einsatz sichergestellt und<br />
ein besserer Schutz der Anwender<br />
(z. B. Einsatzkräfte von Feuerwehren<br />
und Katastrophenschutz, Industrie<br />
und Gewerbe) sowie der Umwelt<br />
gewährleistet werden.<br />
Das Arbeitsblatt DWA-A 716 fasst<br />
die Regelwerke LTwS 27 mit dem Teil<br />
„Anforderungen an Ölbinder“ (BMU,<br />
Stand: April 1998) sowie LTwS 31<br />
„Anforderungen an Chemikalienbindemittel“<br />
(UBA, zwischenzeitlich<br />
zurückgezogen) unter Berücksichtigung<br />
der neuesten Erkenntnisse<br />
und gesetzlichen Regelungen<br />
zusammen.<br />
Da diese Zusammenfassung sehr<br />
umfangreich und die Gesamterarbeitung<br />
einige Jahre dauern wird,<br />
wird das Arbeitsblatt DWA-A 716 in<br />
verschiedene Teile aufgeteilt. Der<br />
nun vorliegende Teil 1 beschreibt<br />
die „Allgemeinen Anforderungen“<br />
an alle Öl- und Chemikalienbindemittel<br />
und bildet die Grundlage für<br />
alle weiteren Blätter. Es stellt ein<br />
Klassifizierungssystem für Öl- und<br />
Chemikalienbindemittel vor. Außerdem<br />
werden grundlegende sicherheitstechnische,<br />
arbeitsmedizinische<br />
und umwelttechnische Anforderungen,<br />
die für alle Bindemittel<br />
gelten, aufgezeigt. Allgemeingeltende<br />
Vorgaben zur Prüfung werden<br />
festgeschrieben.<br />
Die Arbeitsblätter DWA-A 716-1<br />
und folgende wenden sich speziell<br />
an die Hersteller, Vertreiber und<br />
Prüfinstitute von Öl- und Chemikalienbindemitteln.<br />
Information, Bezug:<br />
Juli 2011, 136 Seiten,<br />
ISBN 978-3-941897-92-2,<br />
Ladenpreis 55,00 €,<br />
fördernde DWA-Mitglieder 17,60 €.<br />
Arbeitsblatt DWA-A 716-1: Öl- und Chemikalienbindemittel<br />
Anforderungen/Prüfkriterien/Zulassung. Teil 1: Allgemeine Anforderungen<br />
Bei Unfällen mit Ölen und flüssigen<br />
Chemikalien kommt der<br />
Gefahrenabwehr und Schadenbegrenzung<br />
einschließlich dem vorbeugenden<br />
Gesundheits- und<br />
Umweltschutz besondere Bedeutung<br />
zu. Bei diesen Maßnahmen ist<br />
der Einsatz von geeigneten Öl- und<br />
Chemikalienbindemitteln entscheidend.<br />
Bei unsachgemäßer Handhabung<br />
kann es zu gefährlichen Reaktionen<br />
kommen. Ziel ist es, durch<br />
einheitliche Vorgaben zur Prüfung<br />
und Bewertung von Bindemitteln<br />
die wahrscheinliche Eignung für<br />
den angestrebten Einsatzzweck<br />
sowie die Zuverlässigkeit solcher<br />
Produkte anhand der Verpackungshinweise<br />
erkennbar zu machen. Auf<br />
diese Weise kann der sachlich richtige<br />
und schnelle Einsatz sichergestellt<br />
und ein besserer Schutz der<br />
Anwender (z. B. Einsatzkräfte von<br />
Feuerwehren und Katastrophenschutz,<br />
Industrie und Gewerbe)<br />
sowie der Umwelt gewährleistet<br />
werden.<br />
Das Arbeitsblatt DWA-A 716 fasst<br />
die Regelwerke LTwS 27 mit dem Teil<br />
„Anforderungen an Ölbinder“ (BMU,<br />
Stand: April 1998) sowie LTwS 31<br />
“Anforderungen an Chemikalienbindemittel“<br />
(UBA, zwischenzeitlich<br />
zurückgezogen) unter Berücksichtigung<br />
der neuesten Erkenntnisse<br />
und gesetzlichen Regelungen<br />
zusammen.<br />
Da diese Zusammenfassung sehr<br />
umfangreich und die Gesamterarbeitung<br />
einige Jahre dauern wird,<br />
wird das Arbeitsblatt DWA-A 716 in<br />
verschiedene Teile aufgeteilt. Der<br />
nun vorliegende Teil 1 beschreibt<br />
die „Allgemeinen Anforderungen“<br />
an alle Öl- und Chemikalienbindemittel<br />
und bildet die Grundlage für<br />
alle weiteren Blätter. Es stellt ein<br />
Klassifizierungssystem für Öl- und<br />
Chemikalienbindemittel vor. Außerdem<br />
werden grundlegende sicherheitstechnische,<br />
arbeitsmedizinische<br />
und umwelttechnische Anforderungen,<br />
die für alle Bindemittel<br />
gelten, aufgezeigt. Allgemeingeltende<br />
Vorgaben zur Prüfung werden<br />
festgeschrieben.<br />
Die Arbeitsblätter DWA-A 716-1<br />
und folgende wenden sich speziell<br />
an die Hersteller, Vertreiber und<br />
Prüfinstitute von Öl- und Chemikalienbindemitteln.<br />
Information, Bezug:<br />
Juli 2011, 136 Seiten,<br />
ISBN 978-3-941897-92-2,<br />
Ladenpreis 55,00 Euro,<br />
fördernde DWA-Mitglieder 17,60 Euro.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 721
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>Wasser</strong>preiskontrolle in Deutschland –<br />
Wie stellt sich die Branche dazu?<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Preisvergleich, Versorgungsunternehmen<br />
Gunda Röstel<br />
Als letzter zu Recht verbleibender Monopolbereich ist<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft aus Kundensicht in der Pflicht,<br />
bei Preisvergleichen die Unterschiede zu erläutern<br />
und sich der Preisdiskussion zu stellen. Dies gilt keineswegs<br />
nur vor dem Hintergrund der politisch initiierten,<br />
spektakulären Entscheidungen der Landeskartellbehörde<br />
in Hessen, die für Zündstoff mit bundesweiter<br />
Ausstrahlung sorgten, sondern vor allem auch<br />
in wohlverstandenem Eigeninteresse, Transparenz<br />
und Kommunikation zu verbessern.<br />
Water Price Control in Germany – How does the<br />
Branch position itself in Addition?<br />
The water industry is the last rightly remaining monopoly<br />
sector. From the customer’s point of view, it<br />
therefore has a duty to explain price differences and<br />
to clarify its position within the price discussion. This<br />
is by no means only necessary due to the politically<br />
initiated and spectacular decisions made by the state<br />
monopoly commission in Hessen (Landeskartellbehörde<br />
in Hessen), which had an explosive impact nationwide.<br />
It is above all indispensable for the sake of<br />
improving transparency and communication. Of<br />
course, this is also in the interest of the industry itself.<br />
1. Unruhe in der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Manch einer, der die <strong>Wasser</strong>wirtschaft als wacher Kunde<br />
oder umweltinteressierter Bürger von außen begleitet,<br />
mag sich in diesen Tagen verwundert die Augen reiben.<br />
Werden, orientiert an den geübten Preissenkungsverfügungen<br />
in Hessen von zum Teil über 30 Prozent, in der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft etwa gigantische Profite zu Lasten der<br />
Bürger erzielt?<br />
Was ändert sich, wenn die Versorgungsunter nehmen<br />
in öffentlich-rechtliche Organisationsformen wechseln,<br />
um dem Zugriff des Kartellamtes zu entgehen? Und vor<br />
allem: Ist die durch die hessischen Signale geweckte<br />
Erwartungshaltung enormer Einsparungen für die Bürger<br />
gerechtfertigt? Der derzeitige Umgang mit der <strong>Wasser</strong>preiskontrolle<br />
berührt die Unternehmen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und ihre überwiegend kommunalen Anteilseigner<br />
in den Grundfesten.<br />
Umso wichtiger ist es, dass sich die Branche dem<br />
Thema aktiv stellt und den Kartellbehörden – bei allem<br />
Respekt vor deren Aufgaben – die Bühne nicht allein<br />
überlässt. Denn eine Vogelstraußpolitik wird nicht funktionieren,<br />
das ist allen klar. Tröstlich dabei ist, dass die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft keinesfalls bei Null beginnt.<br />
2. Drei große Fehlannahmen über<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Ohne im Detail auf die Chronologie einzelner Kartellrechtsverfahren<br />
eingehen zu wollen, zeigt sich die Ausgangssituation<br />
nach dem Auftakt in Hessen vor über<br />
zwei Jahren als einigermaßen verworren, in Einzelfällen<br />
unternehmerisch nahezu existenzgefährdend und von<br />
mindestens drei Fehlannahmen gekennzeichnet:<br />
1. <strong>Wasser</strong> sei prinzipiell zu teuer.<br />
Dabei wird nicht hinterfragt, was Qualität, Versorgungssicherheit<br />
mit diesem nicht zu substituierenden<br />
Gut auch im Vergleich zu anderen Versorgungssparten<br />
wert sein könnte, von einer Prüfung real<br />
entstehender Kosten einer nachhaltigen Trinkwasserbereitstellung<br />
unter höchst verschiedenen Voraussetzungen<br />
ganz zu schweigen.<br />
2. Aus der ersten Annahme resultiert beim Kunden eine<br />
Erwartungshaltung enormer Einsparungspotenziale.<br />
Vergleicht man beispielsweise die <strong>Wasser</strong>preise für<br />
einen 3 Personen-Haushalt zwischen Augsburg mit<br />
etwa 280 Euro und Gelsenkirchen mit etwa 375 Euro<br />
pro Jahr, ist die Differenz für den Kunden auf den ersten<br />
Blick vielleicht nicht plausibel. Dass infolge der<br />
industriellen Vorgeschichte und der naturräum lichen<br />
Gegebenheiten deutlich mehr Aufbereitungsaufwand<br />
entsteht, ehe das Trinkwasser in Gelsen kirchen in gleicher<br />
Qualität wie in Augsburg aus dem <strong>Wasser</strong>hahn<br />
schießt, ist der <strong>Wasser</strong>rechnung nicht zu entnehmen.<br />
Dies müssen die jeweiligen Versorgungsunternehmen<br />
erklären. Wenn ein Bürger in Gelsenkirchen also<br />
pro Tag etwa 10 Cent mehr für sauberes Trinkwasser<br />
zahlt als in Augsburg, mag man sich darüber streiten,<br />
ob dies viel oder wenig ist Damit bestehen aber nicht<br />
automatisch enorme Einsparpotenziale.<br />
Juli/August 2011<br />
722 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
3. Bei einem Wechsel in den öffentlich-rechtlichen Bereich<br />
sei von einer grundsätzlich anderen, „sichereren“<br />
Marktsituation auszugehen.<br />
Dies mag kurzfristig für betroffene Unternehmen<br />
aufgehen. Sicherheit bietet es nicht. Denn die Höhe<br />
des <strong>Wasser</strong>preises/der <strong>Wasser</strong>gebühr ist nicht<br />
abhängig von der Organisationsform, sondern wird<br />
von der Kostenseite bestimmt. Bei einer „Flucht ins<br />
Gebührenrecht“ müssten Wirtschafts- und Innenminister<br />
also gleichermaßen ins Grübeln kommen.<br />
Dennoch ist dieser Schritt für die individuell betroffene<br />
Unternehmenssituation nachvollziehbar, denn<br />
mit der Anwendung des Kartellrechts auf den <strong>Wasser</strong>sektor,<br />
analog den Erfahrungen im Energiebereich,<br />
wurde die Gleichartigkeit der Unternehmen<br />
bejaht, ohne dass die Vergleichsgrundlagen einer<br />
generellen Überprüfung und Stichhaltigkeit unterzogen<br />
worden wären. Auch wenn die Zuständigkeit<br />
der Kartellbehörden für privat-rechtlich organisierte<br />
Unternehmen nicht anzuzweifeln ist, wirft die Basis<br />
bisheriger Vergleiche mehr als ein Fragezeichen auf.<br />
Bild 1. Medienspiegel. Quelle: Zeitschrift Kommunalwirtschaft, Handelsblatt,<br />
Giessener Anzeiger<br />
3. Preisvergleiche ohne einheitliche<br />
Kalkulationsgrundlagen und belastbare<br />
Kostenstrukturen führen in die Irre!<br />
Bei all dem wissen wir, dass es längst nicht nur topographische<br />
oder demographische Parameter sind, die den<br />
Preis relevant beeinflussen. Der Umgang mit Zuschüssen,<br />
die Art und Weise der Finanzierung oder die Berücksichtigung<br />
kalkulatorischer Kosten, wie Abschreibungen,<br />
Zinsen und Eigenkapitalverzinsung, spielen ebenfalls<br />
eine wesentliche, wenn nicht die entscheidende Rolle.<br />
Gerät nun ein Unternehmen durch relativ oberflächliche<br />
Preisvergleiche in den Fokus der Landeskartellbehörde,<br />
so liegt die Rechtfertigungslast auf seinen<br />
Schultern, ohne auf datenmäßig gesicherte Grundlagen<br />
anderer Unternehmen zurückgreifen zu können. Haben<br />
mögliche Vergleichsunternehmen das Kostendeckungsprinzip<br />
vollständig angewandt? Sind technische Standards<br />
komplett umgesetzt und wird der Substanzwert<br />
der Anlagen erhalten? Wird dem Minimierungsprinzip<br />
auch unter der Maßgabe des vorsorgenden Umweltschutzes<br />
Rechnung getragen? Fragen, deren Antworten<br />
im Vergleich zunächst keine Rolle spielen. Ist aber die<br />
Vergleichsbasis unklar, wird in den Unternehmen Verunsicherung<br />
geschürt: Investitionen in den Umweltschutz,<br />
Investitionen in energiesparende Technologien, Investitionen<br />
im Bereich der Landwirtschaft für einen weiträumigen<br />
Flächenschutz – all diese Investitionen<br />
schreibt der Gesetzgeber nicht vor. Deshalb werden<br />
diese bei einer möglichen Verteidigung vielleicht nicht<br />
oder nicht im vollen Umfang berücksichtigt?<br />
Umgekehrt gilt jedoch, dass die Fragen nach Transparenz<br />
und Effizienz in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft deutlich<br />
besser beantwortet werden müssen, um den hohen<br />
Vertrauensstatus, den die Branche hinsichtlich Versorgungssicherheit<br />
und -qualität ihrer Dienstleistung bei<br />
Bürgern und Politik genießt, zu erhalten.<br />
Einer negativen und zudem einseitig auf oberflächliche<br />
<strong>Wasser</strong>preisvergleiche fokussierten Berichterstattung<br />
folgen negative Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis<br />
zwischen Versorger und Kunden (Bild 1).<br />
Dies ist umso misslicher, weil die <strong>Wasser</strong>wirtschaft in<br />
toto in vielen Jahren verlässlicher und mühevoller<br />
Arbeit einen guten Ruf errungen hat. Über 90 Prozent<br />
von 1000 Befragten sind mit ihrer <strong>Wasser</strong>qualität „sehr<br />
zufrieden“ bis „in höchstem Maße zufrieden“. Mehr als<br />
80 Prozent sind generell mit ihrem <strong>Wasser</strong>versorger „im<br />
höchsten Maß“ oder „sehr zufrieden“. Gefragt nach der<br />
Zufriedenheit bei der Leistung des <strong>Abwasser</strong>beseitigers<br />
antworteten 77 Prozent, dass sie entweder „in höchstem<br />
Maße zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ sind (vgl. BDEW-<br />
Kundenbarometer 2009).<br />
Auch wenn eine deutliche Mehrheit der Befragten<br />
weder den eigenen Verbrauch noch die tatsächlichen<br />
Ausgaben für eine sichere und qualitätsgerechte Trinkund<br />
<strong>Abwasser</strong>dienstleistung kennt, wird durch diese<br />
Diskussionen ein öffentlich negativ-gefühltes Meinungsbild<br />
transportiert, welches nicht zuletzt Einfluss<br />
auf politische Aktivitäten nehmen wird, ja nehmen<br />
muss. Ob dies aktionistisch oder fundiert geschieht, hat<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft selbst in der Hand. Hier ließe sich<br />
einiges aus den Erfahrungen der Energiewirtschaft lernen!<br />
Aktuell hat die Bundesregierung den Regulierungsbestrebungen<br />
der Bundesnetzagentur sowie der<br />
Monopolkommission eine Absage erteilt. Diese Absage<br />
ist aber gleichzeitig eine Aufforderung an die <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
selbst zu handeln!<br />
Welche überzeugenden Antworten konnte die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft beim Thema <strong>Wasser</strong>preiskontrolle bisher<br />
liefern, auf Fragen, die berechtigter Weise im letzten<br />
verbliebenen Monopolbereich entweder von den<br />
Landeskartellbehörden bei <strong>Wasser</strong>preisen oder den<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 723
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Kommunalaufsichten bei <strong>Wasser</strong>gebühren im Verbraucherinteresse<br />
zu stellen sind:<br />
1. Ist die Preis- oder die Gebührenbildung berechtigt<br />
und transparent nachvollziehbar erfolgt?<br />
2. Wie kann, wenn übliche Marktmechanismen wie<br />
Angebot und Nachfrage sowie Wettbewerb im <strong>Wasser</strong>sektor<br />
richtigerweise nicht zu etablieren sind,<br />
dennoch für Effizienz in der Branche und in den<br />
einzelnen Unternehmen gesorgt werden?<br />
Daraus ergibt sich für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft eine dreifache<br />
Hausaufgabe:<br />
Erstens sind die Vergleichsgrundlagen auf wirtschaftlich<br />
fundierter Kostenbasis zu klären.<br />
Zweitens müssen Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit<br />
und<br />
drittens Transparenz verständlich und nachvollziehbar<br />
gegenüber den Bürgern/den Kunden, aber auch<br />
gegenüber Politik und Öffentlichkeit erklärt werden.<br />
Wie eingangs formuliert, beginnen wir dabei nicht<br />
bei Null. Ein großer Teil der Hausaufgabe wurde insbesondere<br />
in den letzten Jahren im Rahmen der Verbandsarbeit<br />
mit seinen aktiven Ausschüssen und den Unternehmen<br />
selbst Erfolg versprechend geleistet.<br />
4. Erste Antwort: Einheitliche Vergleichsgrundlagen<br />
mit Kalkulationsleitfäden<br />
Derzeit sind einheitliche Kalkulationsleitfäden für den<br />
Trink- und <strong>Abwasser</strong>bereich in Arbeit – d. h. bei ihrer<br />
Anwendung lassen sich einheitliche Vergleichsgrundlagen,<br />
welche Preise verursachergerecht und kostendeckend<br />
sind, wie eigentlich vom Gesetzgeber vorgegeben,<br />
abbilden. Mit Ende des zweiten Quartals 2011<br />
wird die endgültige Fertigstellung für den Kalkulationsleitfaden<br />
im Trinkwasserbereich erwartet.<br />
Nach einem Jahr intensiver Arbeit liegt der Kalku -<br />
lationsleitfaden für den <strong>Abwasser</strong>bereich ebenfalls in<br />
den Endzügen.<br />
Ohne den Schulterschluss zwischen den Verbänden<br />
wäre die Erstellung dieses Instruments für den Trinkwasserbereich<br />
unmöglich gewesen. Als wesentlicher<br />
Bestandteil der Preisbildung machen die Leitfäden die<br />
Vergleichsbasis transparent. Damit werden daraus resultierende,<br />
berechtigte Kosten als solche anerkannt und<br />
Grundlage für Vergleiche.<br />
Fairness in der Rechtfertigung entsteht darüber hinaus<br />
nur dann, wenn ein vergleichbarer Bezug zu den<br />
Daten gegeben ist. Eines der wichtigen Instrumente ist<br />
daher ein Datenpool von Unternehmensdaten, welcher<br />
sich beginnend aus den Unternehmen speist, die im<br />
Kontext der Bundeskartellamtsaktivitäten zu Auskünften<br />
verpflichtet wurden, und freiwilligen Teilnehmern,<br />
die im Sinne des Nutzens zur Mitwirkung aufgerufen<br />
sind. Selbstverständlich ist eine Zusammenarbeit mit<br />
der Kartellbehörde Voraussetzung. In den einzelnen<br />
Bundesländern ist das Vorgehen recht unterschiedlich.<br />
Ein sachlich und fachlich geprägter Dialog zwischen<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsunternehmen und Kartellbehörden<br />
erbringt in jedem Fall für beide Seiten Nutzen.<br />
5. Zweite Antwort: Wirtschaftlichkeit und<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Nicht nur weil die Abgaben- und Steuerbelastung der<br />
Bürger und Unternehmen ein sensibles Thema ist,<br />
sondern vor allem weil es eben keine natürlichen Marktmechanismen<br />
im Monopolbereich gibt, kommt der<br />
Frage nach der Leistungsfähigkeit der Branche eine<br />
erhebliche Bedeutung zu. Das ist ein Grund, weshalb die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft selbst über die Initiierung von Benchmarking-Prozessen<br />
seit Jahren in einem „Als-Ob-Wettbewerb“<br />
von den jeweils Besten lernt und Verbesserungen<br />
prozessbezogen initiiert. Hinzu kommen seit Jahren<br />
typische unternehmensinterne Lenkungs- und Controllinginstrumente<br />
wie z. B. Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme<br />
(QUMS), Risikoberichte, Wirtschaftlichkeitsrechnungen,<br />
Investitionscontrolling, Quartalsund<br />
Jahresberichterstattung in den Aufsichtsgremien.<br />
Trotzdem gilt es in Benchmarking-Prozessen die Aktivitäten<br />
zu intensivieren und zu kommunizieren. Die Teilnahmequote<br />
lässt sich steigern, ebenso die Transparenz<br />
der Benchmarking-Effekte.<br />
Neben dem nationalen Benchmarking wird die Kernfrage<br />
der Leistungsfähigkeit besonders auch im europäischen<br />
Vergleich der VEWA-Studie deutlich, die im<br />
vergangenen Herbst in Brüssel zum zweiten Mal und in<br />
einem erweiterten Modus vorgestellt wurde. Darin wurden<br />
die <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>preise in Deutschland,<br />
England/Wales, Frankreich, Niederlande, Österreich und<br />
Polen in mehreren Stufen miteinander verglichen. In der<br />
ersten Stufe findet zunächst ein reiner Preisvergleich<br />
statt, ohne dass entscheidende Einflussparameter<br />
geprüft werden. In der zweiten Stufe des Preisvergleichs<br />
werden dann etwaige Zuschüsse (Subventionen, Fördergelder<br />
u. ä.) berücksichtigt. In einer dritten und letzten<br />
Stufe wird zusätzlich ein einheitliches Leistungsniveau<br />
zwischen den Ländern errechnet und unterstellt,<br />
welches die europäischen Vorgaben zur Trinkwasserverund<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung, den Anschlussgrad an Kläranlagen,<br />
die Ausstattung mit Zählern, die Erneuerungsrate<br />
der Netze sowie die <strong>Abwasser</strong>behandlungsleistung<br />
ins Kalkül zieht. Erst diese Stufe schafft eine annähernd<br />
vergleichbare Basis.<br />
Im Ergebnis ist für den Trinkwasserbereich festzustellen,<br />
dass in Stufe II unter Berücksichtigung von Zuschüssen<br />
Deutschland und England hinter Frankreich zunächst<br />
mit an der Spitze liegt. Wird nun in der dritten Stufe ein<br />
einheitliches Leistungsniveau vorausgesetzt, rangiert<br />
Deutschland mit den Niederlanden im guten Mittelfeld<br />
der Ausgaben für sauberes Trinkwasser (Bild 2).<br />
Noch deutlicher sprechen die Zahlen im <strong>Abwasser</strong>bereich.<br />
Trotz der unangefochten höchsten Standards<br />
Juli/August 2011<br />
724 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
an Sicherheit, Qualität, Technologie und der Berücksichtigung<br />
von Umweltbelangen, liegt Deutschland<br />
(123 Euro pro Kopf und Jahr) mit Österreich (119 Euro<br />
Pro Kopf und Jahr) bei den <strong>Abwasser</strong>preisen im europäischen<br />
Vergleich erneut im guten Mittelfeld. Mit<br />
anderen Worten kann der Branche eindeutig ein wirtschaftlich-leistungsfähiges<br />
Arbeiten unterstellt werden<br />
(Bild 3).<br />
Für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft ist Leistungsfähigkeit folglich<br />
Branchenstandard. Den besten Beweis liefert ein<br />
Blick auf die Preisindices. Schon heute hat es die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
durch Effizienzsteigerungen innerhalb der<br />
Unternehmen geschafft, die Preise und Gebühren deutlich<br />
unterhalb der Inflationsrate zu entwickeln. Wenn<br />
seit dem Jahr 2000 der allgemeine Inflationsindex um<br />
15,9 Prozent nach oben geklettert ist, der Index der<br />
<strong>Wasser</strong>kosten aber nur um fünf und die der <strong>Abwasser</strong>gebühren<br />
trotz enormer Investitionen immerhin nur um<br />
14 Prozent, zeigt dies doch, dass die <strong>Wasser</strong>wirtschaft in<br />
der Regel nach strikten Wirtschaftlichkeitsprinzipien –<br />
und das mit Erfolg – agiert. (vgl. Branchenbild 2011)<br />
6. Dritte Antwort: Kommunikation –<br />
„Tue Gutes und rede darüber“<br />
In einem Punkt, das hat sich gezeigt, hat die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
einen deutlichen Nachholbedarf: in der Kommunikation<br />
und Transparenz gegenüber Öffentlichkeit und<br />
Kunden. Gerade weil die <strong>Wasser</strong>wirtschaft ein erfolgreicher<br />
Umweltdienstleister ist, macht sich niemand<br />
Gedanken darüber, was im Hintergrund passiert, wenn<br />
der Badewannenstöpsel gezogen ist oder was alles<br />
geschehen muss, ehe klares, sauberes <strong>Wasser</strong> aus dem<br />
Hahn fließt. Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft muss erklären, welche<br />
Kostenblöcke den Preis bestimmen und warum es<br />
berechtigt ist, dass man in Augsburg weniger für einen<br />
Kubikmeter Trinkwasser bezahlt als in Gelsenkirchen,<br />
Essen oder Berlin und dabei gleichermaßen Sicherheit<br />
und Qualität unter höchst verschiedenen Rahmen- und<br />
Ausgangsbedingungen zu garantieren sind.<br />
Vor knapp zwei Jahren wurde auf Initiative der Verbraucherschutzzentrale<br />
gemeinsam mit den Verbänden<br />
BDEW und DVGW ein Instrument namens „Kundenbilanz“<br />
(Kundenbilanz 2010, in Bearbeitung) für den Trinkwassersektor<br />
initiiert. Ähnlich wie bei der VEWA-Studie<br />
wird auch hier mittels eines Stufenmodells die Kostenstruktur<br />
erläutert (Bild 4).<br />
Der VKU untermauerte dieses Pilotprojekt durch<br />
das sogenannte „Holländer-Gutachten“ (vgl. Holländer<br />
2009) wissenschaftlich. Inzwischen nehmen an diesem<br />
Kommunikationsprojekt 44 <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
teil. Aktuell erfolgt die Sicherung einer validen<br />
Datenbasis und für die teilnehmenden Unternehmen<br />
die Aufarbeitung als ganz individuell verfügbares<br />
Kommunikationsinstrument.<br />
Für den <strong>Abwasser</strong>bereich ist die Kundenbilanz derzeit<br />
in Arbeit. Auch hier werden die durchschnittlichen<br />
Bild 2. Ergebnis VEWA-Studie 2010, Vergleich Trinkwasserkosten<br />
bei gleichem Leistungsniveau. Quelle: civity Management Consultants<br />
Bild 3. Ergebnis VEWA-Studie 2010, Vergleich <strong>Abwasser</strong>kosten bei<br />
gleichem Leistungsniveau. Quelle: civity Management Consultants<br />
Bild 4. Stufenmodell einer Kostenstruktur. Quelle: bdew<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 725
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 5. Übergabe des Branchenbildes. v.l.n.r.:<br />
Ralf Rauch, Hauptgeschäftsführer Thüringer Fernwasserversorgung,<br />
Vorstandsmitglied der ATT; Otto Schaaf, Vorstand Stadtentwässerungsbetriebe<br />
Köln, Präsident der DWA; Gunda Röstel, Kaufm. Geschäftsführerin<br />
Stadtentwässerung Dresden GmbH, Mitglied des Erweiterten<br />
Fachvorstandes, BDEW; Parlamentarischer Staatssekretär Hans-<br />
Joachim Otto im Bundeswirtschaftsministerium; Dr. Bernhard Hörsgen,<br />
Vorstandsmitglied Gelsenwasser AG, Präsident des DVGW; Dr. Michael<br />
Beckereit, Geschäftsführer Hamburg <strong>Wasser</strong>, Vizepräsident des VKU;<br />
Hans-Adolf Boie, Verbandsvorsteher, Präsident des DBVW. Quelle: BDEW<br />
Bild 6. Teile eines Branchenstandards in der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Ausgaben pro Kopf unter Berücksichtigung struktureller<br />
Rahmen (Topographie, Siedlungsdichte, Geologie etc.),<br />
Leistungs- und Qualitätsmerkmale sowie mit einem<br />
Annex zu Kalkulationsprinzipien Schritt für Schritt<br />
erklärt.<br />
Die Kundenbilanz ist in jedem Fall Hilfe für den<br />
Rechtfertigungsfall von Unternehmen, aber mehr noch<br />
ist sie ein sehr gutes verständliches Kommunikationsinstrument,<br />
welches Leistungs- und Kostenbeziehungen<br />
für Bürger und Öffentlichkeit nachvollziehbar und<br />
transparent macht.<br />
Erfolg und Akzeptanz gegenüber der Politik werden<br />
ähnlich wie im Benchmarkbereich nur dann erreicht –<br />
und dies ist ein Appell an die <strong>Wasser</strong>wirtschaft selbst –<br />
wenn von diesem Instrument auch Gebrauch gemacht<br />
und es nicht durch Parallelaktivitäten verwässert wird.<br />
Die <strong>Wasser</strong>wirtschaftsunternehmen haben nichts zu<br />
verbergen. Die Kundenbilanz erklärt, warum die Preisunterschiede<br />
individuell zustande kommen.<br />
Gute Kommunikation bedeutet aber auch, die eigenen<br />
Leistungen und Erfolge nicht unter den Scheffel zu<br />
stellen. Diese Aufgabe erfüllt das inzwischen zum dritten<br />
Mal erschienene Branchenbild der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Nach monatelanger aufwändiger Kleinarbeit<br />
und vielschichtigen Abstimmungsprozessen zwischen<br />
den Verbänden der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
konnte es im Frühjahr dieses Jahres anlässlich des Tags<br />
des <strong>Wasser</strong>s öffentlich dem Parlamentarischen Staatssekretär<br />
Hans-Joachim Otto im BMWi überreicht werden.<br />
Ein derartiges „Mammutprojekt“, an dem mehrere große<br />
Verbände beteiligt sind, ist in Europa einmalig (Bild 5).<br />
Zur Kommunikation gehört auch ein intensiver<br />
Dialog mit der Politik und ganz besonders mit BMU und<br />
BMWi, wenn es um Umwelt- bzw. wirtschaftliche<br />
Belange geht. Stärker als bisher muss die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
auch in den Dialog mit der Verbraucherschutzzentrale<br />
treten.<br />
Immerhin stehen die <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverbände<br />
mittlerweile fachlich, enger beieinander, weshalb die<br />
ein oder andere Stellungnahme oder sogar Gutachten<br />
gemeinsam erarbeitet werden. Es vereinfacht die Kommunikation<br />
mit der Politik ganz wesentlich, wenn<br />
zumindest bei Fragen von zentraler Bedeutung der<br />
sonst nicht selten vielschichtige Chor der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
dann in der gleichen Tonart singt.<br />
Machen wir uns nichts vor, kein Politiker, kein Bürger,<br />
keine Zeitung wird sich jeweils die Mühe machen oder<br />
die Mühe machen können, das bunte Puzzle der <strong>Wasser</strong>branche<br />
zu einem aussagefähigen und überzeugenden<br />
Gesamtbild zusammenzusetzen.<br />
Diese Aufgabe eines einheitlichen Bildes im Sinne<br />
eines anerkannten Branchenstandards mit den Bestandteilen<br />
Benchmarking<br />
Kundenbilanz<br />
Kalkulationsgrundlagen<br />
Kontrolle durch LKBs und Kommunalaufsicht<br />
Branchenbild<br />
Technische Standards<br />
muss die <strong>Wasser</strong>wirtschaft selbst leisten (Bild 6).<br />
Gute Erfahrungen der Selbstorganisation hat die<br />
deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft wie keine andere Branche<br />
mit den technischen Regelsetzungen und Standards.<br />
Andere Puzzlesteine sind geübte Praxis oder in<br />
Arbeit. Das vielfache Gebrauchen der Instrumente, die<br />
Juli/August 2011<br />
726 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
verständliche Kommunikation nach außen und das<br />
Zusammenfügen der Einzelteile zu einem Bild einer<br />
modernen, verlässlichen und wirtschaftlich agierenden<br />
Branche, ist die Puzzleaufgabe der nächsten Monate.<br />
Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft muss nachweisen, dass trotz<br />
natürlichem Monopol ständige Verbesserungen und<br />
ein kundenorientierter Umgang mit Entgelten oder<br />
Gebühren im Tagesgeschäft selbstverständlich sind. Mit<br />
dem Branchenbild, zahlreichen Benchmarking-Prozessen,<br />
der Erarbeitung von Kalkulationsleitfäden für die<br />
Trink- und <strong>Abwasser</strong>wirtschaft oder der Entwicklung<br />
ganz neuer Instrumente, wie der Kundenbilanz, sind<br />
längst wichtige und richtige Weichen gestellt. Diese gilt<br />
es, konsequent auszubauen und in enger Diskussion<br />
und Kooperation mit den kommunalen Anteilseignern,<br />
der Landes- und Bundespolitik in einen einvernehmlichen<br />
und verlässlichen Rahmen zu bringen. Anders als<br />
im Energiesektor hat die <strong>Wasser</strong>wirtschaft die Chance,<br />
mit Mut, Dynamik und Offenheit selbst zu gestalten.<br />
Nutzen wir diese Chance!<br />
Literatur<br />
ATT, BDEW, DBVW, DVGW, DWA, VKU (Hrsg.): Branchenbild der<br />
deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft 2011. WVGW, Bonn, 2011.<br />
BDEW (Hrsg.) (2010a): Eckpunkte einer <strong>Wasser</strong>entgeltkalkulation in<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft. Berlin, 2010.<br />
BDEW (Hrsg.) (2010b): VEWA – Vergleich Europäischer <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>preise. Berlin, 2010.<br />
BDEW (Hrsg.) (2010c): Gutachten Kundenbilanz (Entwurfsstadium).<br />
Berlin, 2010.<br />
Holländer, R. (IIRM Universität Leipzig) im Auftrag vom Verband<br />
kommunaler Unternehmen (VKU): Gutachten. Trinkwasserpreise<br />
in Deutschland – Wie lassen sich verschiedene<br />
Rahmenbedingungen für die <strong>Wasser</strong>versorgung anhand<br />
von Indikatoren abbilden. Kernaussagen. Leipzig, 2009.<br />
Eingereicht: 18.07.2011<br />
Autoren<br />
Gunda Röstel<br />
Kaufmännische Geschäftsführerin<br />
und Prokuristin GELSENWASSER AG |<br />
E-Mail: Gunda.Roestel@se-dresden.de |<br />
Stadtentwässerung Dresden GmbH |<br />
Scharfenberger Straße 152 |<br />
D-01139 Dresden<br />
Zeitschrift KA – <strong>Abwasser</strong> · Abfall<br />
In der Ausgabe 8/2011 lesen Sie u. a. fol gende Bei träge:<br />
Liebscher/Gillar/Bosseler<br />
Weinig u. a.<br />
Neumann<br />
Beck<br />
Felmeden/Kluge/Michel<br />
Janssen-Overath<br />
Sanierung von <strong>Abwasser</strong>schächten – Untersuchung von Materialien und<br />
Systemen zur Abdichtung und Beschichtung – Teil 1: Aufgabenstellung und<br />
Untersuchungsprogramm<br />
Testmethode für die Wirkung von Arzneimitteln bei der dezentralen<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Neue Technische Regeln zum Schutz vor Mikroorganismen<br />
Sammlung und Entsorgung von Straßenkehricht – der bayerische Weg<br />
Effizienz und Nachhaltigkeit kommunaler <strong>Wasser</strong>-Infrastrukturen<br />
Die neue Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen – VAUwS – Informationen zum aktuellen Verordnungsentwurf<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 727
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände und<br />
Gewässerschutz – neue Lösungsansätze<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Pflanzenschutzmittel, Gewässerschutz, Trinkwasserversorgung,<br />
Lösungsansätze<br />
Frieder Haakh<br />
Nach wie vor zählt die Gewässerbelastung mit Pflanzenschutzmittelrückständen<br />
und deren Metaboliten<br />
zu den drängenden Problemen. Dies betrifft die<br />
Unklarheit über die tatsächliche Belastungssituation<br />
und, dass die Risiken trotz strenger Auflagen im<br />
Zulassungsverfahren im „Normalbetrieb“ der PSM-<br />
Anwendung entstehen. Darüber hinaus haben die<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen erhebliche Probleme<br />
dadurch, dass das Pflanzenschutzrecht, das<br />
<strong>Wasser</strong>recht und das Trinkwasserrecht nicht aufeinander<br />
abgestimmt sind. Dies betrifft die Vielzahl der<br />
sog. nicht relevanten Metaboliten.<br />
Zur Problemlösung haben die Verbände der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
(DVGW, VKU, BDEW), die führenden PSM-<br />
Hersteller und der IVA den sog. „Runden Tisch“<br />
gegründet mit dem operativen Ziel, eine bundesweite<br />
Rohwasserdatenbank zu betreiben. Dies bedarf aber<br />
der freiwilligen Unterstützung aller <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
in Form der kostenfreien Überlassung<br />
entsprechender Analysenergebnisse. Weitere<br />
Schritte zur Risikominimierung folgen aus der neuen<br />
Pflanzenschutzmittelzulassungsverordnung und der<br />
„Richtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen<br />
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung<br />
von Pestiziden“. Der Vorschlag der LAWA, in der<br />
Grundwasserverordnung einen Schwellenwert von<br />
1 μg/L für nicht relevante Metabolite einzuführen,<br />
wird begrüßt. Regelmäßige Veröffentlichungen des<br />
UBA und des BVL zu PSM-Wirkstoffen und deren<br />
Metaboliten schaffen Transparenz. Wirksamkeit versprechen<br />
auch die am „Runden Tisch“ entwickelten<br />
Maßnahmenpakete zur Sanierung von „hot-spot-<br />
Regionen“.<br />
Pesticide Residues and Water Protection –<br />
new Approaches<br />
Water pollution with pesticide residues and its<br />
metabolised products is still a problem of concern.<br />
Here, we refer to the lack of clarity of the actual pollution<br />
situation and to the fact that the risks arise<br />
during “normal operation” of pesticide use, despite<br />
strict regulations in the approval procedure. Furthermore,<br />
the water supply companies are experiencing<br />
considerable problems with the fact that pesticide<br />
law, water law and drinking water law are not sufficently<br />
linked with each other. This refers to the diversity<br />
of so-called non-relevant metabolites.<br />
To resolve the problem, the German water management<br />
associations (DVGW, VKU, BDEW), the leading<br />
pesticide manufacturers and the agricultural association<br />
“IVA” founded a so-called “Round Table”, whose<br />
operating target it is to run a nationwide natural<br />
water database. However, this requires the voluntary<br />
support of all water supply companies in the form of<br />
providing free access to corresponding analysis<br />
results. Further steps which need to be taken in order<br />
to minimise the risk can be found in the new pesticide<br />
approval regulation and the “Guideline for the<br />
sustainable use of pesticides and the Directive<br />
2009/128/EC establishing a framework for Community<br />
action to achieve the sustainable use of pesticides“.<br />
We welcome the recommendation of the German<br />
Working Group of the Federal States on Water<br />
Issues (LAWA) to introduce a threshold value of 1<br />
μg/L for non-relevant metabolites in the national<br />
implementation of the EU-Groundwater-Directive.<br />
Regular publications by the Federal Environment<br />
Agency (UBA) and the Federal Office of Consumer<br />
Protection and Food Safety (BVL) on pesticides’<br />
active substances and their metabolites in the<br />
national implementation of the EU-Groundwater<br />
Directive are providing transparency. The Round<br />
Table’s package of measures also promises to provide<br />
effective results in the decontamination of “hot-spot<br />
regions”.<br />
Juli/August 2011<br />
728 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
1. Einleitung<br />
Das Auftreten von Pflanzenschutzmittelrückständen in<br />
den Rohwasserressourcen wird nach wie vor als brisant<br />
eingeschätzt (Bild 1). Die Themen „Pflanzenschutzmittel<br />
und Nitrat“ rangieren bei den <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
an oberster Stelle, aber auch die <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverwaltung<br />
und die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln<br />
sind an einer frühzeitigen Problemlösung<br />
interessiert, denn allzu leicht wird das Trinkwasserimage<br />
durch negative Berichterstattung beschädigt, wobei<br />
nicht nur das Trinkwasser betroffen ist (Bild 2).<br />
2. Die Problemlage<br />
Auch die jüngst von der LAWA publizierten Daten [1]<br />
belegen, dass in vielen Bundesländern ein systematisches<br />
und auch flächendeckendes Monitoring zu PSM-<br />
Rückständen im <strong>Wasser</strong> fehlt. Die Betroffenheit der <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
wurde durch eine Studie<br />
des DVGW-TZW im Jahr 2006 [2] nachgewiesen. Bemerkenswert<br />
ist, dass nach dieser Studie in 40 % der Rohwasserressourcen<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände ge -<br />
funden wurden. Von diesen Positiv befunden waren 50 %<br />
der Wirkstoffe nicht mehr zugelassen, bei 43 % handelt<br />
es sich um zugelassene Wirkstoffe, 7 % waren Metabolite.<br />
Die Auswertung des DVGW-TZW zeigt weiterhin,<br />
dass etwa 20 Wirkstoffe bzw. Metabolite den <strong>Wasser</strong>versorgern<br />
die größten Sorgen bereiten.<br />
Ein Kernproblem besteht darin, dass die Belastungen<br />
mit Pflanzenschutzmittelrückständen trotz strenger<br />
Auflagen im Zulassungsverfahren quasi im Normalbetrieb<br />
der Anwendung im umweltoffenen System der<br />
Landwirtschaft entstehen [3]. Der Landwirt muss sich<br />
jedoch darauf verlassen können, dass zugelassene<br />
Pflanzenschutzmittel bei sachgerechter Anwendung zu<br />
keinen Gewässergefährdungen führen.<br />
Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Pflanzenschutzrecht<br />
auf der einen Seite sowie das <strong>Wasser</strong>recht<br />
und das Trinkwasserrecht auf der anderen Seite unterschiedlich<br />
im EG-Vertrag verankert sind. Das Pflanzenschutzrecht<br />
lässt sich auf Artikel 174 EG-Vertrag zurückführen<br />
(Bild 3). Das gilt auch für die <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie,<br />
wohingegen sich die Trinkwasserrichtlinie aus dem<br />
Artikel 152 EG-Vertrag ableitet. Die Rechtsbereiche sind<br />
unvollständig aufeinander abgestimmt, die Unterschiede,<br />
insbesondere bei Regelungen zu Metaboliten,<br />
bereiten Schwierigkeiten.<br />
Konkret zeigt sich dies daran, dass die sog. nicht relevanten<br />
Metaboliten, also Abbauprodukte der Wirkstoffe,<br />
die keine Wirkstoffeigenschaften mehr besitzen, mit<br />
unterschiedlichen Grenzwerten bzw. gesundheitlichen<br />
Orientierungswerten (GOW) belegt sind. So dürfen<br />
Wirkstoffe zugelassen werden, selbst wenn diese Metabolite<br />
mit Konzentrationen von bis zu 10 μg/L freisetzen,<br />
während den <strong>Wasser</strong>versorgern vom Umweltbundesamt<br />
gesundheitliche Orientierungswerte von 1 bzw.<br />
3 μg/L, letzterer gilt für toxikologisch gut untersuchte,<br />
Nitrat<br />
gereinigtes <strong>Abwasser</strong><br />
Altlasten<br />
Mikrobiologie<br />
<strong>Abwasser</strong> aus Rüben<br />
Sonstiges<br />
Siedlungen<br />
4,0 3,0 2,0 1,0<br />
Priorität<br />
Bild 1. Grundwasserschutz – Prioritäten aus Sicht der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen.<br />
Bild 2. Die Risiken aus der PSM-Anwendung entstehen im<br />
Normal betrieb.<br />
Artikel 174 EG-Vertrag<br />
Erhaltung und Schutz der Umwelt<br />
sowie Verbesserung ihrer Qualität;<br />
Schutz der menschlichen Gesundheit<br />
Pflanzenschutzrecht<br />
Verordnung (EG) Nr.<br />
1107/2009<br />
Allgem.<br />
Gewässerschutz<br />
PflSchG<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
Pflanzenschutzmittelverordnung<br />
… und die<br />
entsprechenden<br />
Metaboliten<br />
„ordnungsgemäße<br />
Landbewirtschaftung“<br />
<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
2000/60/EG<br />
vgl. TWK im<br />
BGesBlatt 4 2007<br />
Artikel 7 (3)<br />
WHG<br />
Artikel 152 EG-Vertrag<br />
„Schutz der menschlichen<br />
Gesundheit“<br />
§ 19 <strong>Wasser</strong> -<br />
schutzgebiete<br />
Schutzverstärkungsrecht<br />
0,1-er Grenzwert entstammt<br />
dem Vorsorgegrundsatz<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
§ 5 (3)<br />
Trinkwasserrichtlinie<br />
98/83/EG<br />
Verbot von<br />
Terbuthylazin<br />
TrinkwV<br />
SchALVO<br />
… und die<br />
entsprechenden<br />
Metaboliten<br />
… und die<br />
relevanten<br />
Metaboliten<br />
Bild 3. Pflanzenschutz- <strong>Wasser</strong>recht und Trinkwasserrecht sind<br />
unterschiedlichen Ursprungs und nur unzureichend aufeinander<br />
abgestimmt.<br />
§ 5 (3)<br />
… oder an<br />
deren Abbauprodukten<br />
…<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 729
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Sicherheit bzw. Risiko<br />
sicherer un sicherer<br />
zusätzliches<br />
Risiko<br />
TrinkwV<br />
(Aldin, Dieldrin,<br />
Heptachlor,..)<br />
PflSchG/<br />
Zulassung<br />
TrinkwV<br />
PflSchG/<br />
Zulassung<br />
GOW<br />
nrM 1<br />
GOW<br />
nrM 2<br />
PflSchG/<br />
Zulassung<br />
0.001 0.01 0.1 1 3 10 100<br />
Konzentration [ μg/L ]<br />
Bild 4. Zwischen Pflanzenschutz- und Trinkwasserrecht klafft<br />
ins besondere bei den nicht relevanten PSM-Metaboliten (nrM) eine<br />
rechtliche Lücke.<br />
Jahresabsatz in Deutschland in 1000 t<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Anzahl<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
15,411<br />
91<br />
51<br />
10,988<br />
… davon: Lysimeter-/Feldversickerungsstudien<br />
82<br />
12<br />
0,946 4,25<br />
Herbizide Fungizide Insektizide,<br />
Akarizide/Nematizide<br />
58<br />
Sonstige<br />
26<br />
7 1<br />
Herbizide Fungizide Insektizide,<br />
Sonstige<br />
Akarizide/Nematizide<br />
32<br />
28<br />
24<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
320<br />
280<br />
240<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
Σ<br />
31,595<br />
Bild 5. In Deutschland werden eine Vielzahl von Wirkstoffen<br />
eingesetzt (257 Wirkstoffe, etwa 32 000 t pro Jahr in Deutschland).<br />
Dimethachlor<br />
S-Metolachlor<br />
Metazachlor<br />
Chloridazon<br />
Chlorthalonil<br />
Benalaxyl-M<br />
Trifloxystrobin<br />
Tolylfluanid<br />
Metalaxyl-M<br />
Azoxystrobin<br />
Picoxystrobin<br />
Dimethenamid-P<br />
Dimoxystrobin<br />
Flurtamone<br />
Pethoxamid<br />
Fluopicolide<br />
Thiacloprid<br />
Quinmerac<br />
Flufenacet<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
max. Konzentration von PSM-Metaboliten im Lysimeterversuch [ µg/L ]<br />
Bild 6. Zulassung von Wirkstoffen mit Metabolitenkonzentrationen<br />
> 10μg/L. Quelle: BVL; 2010<br />
Σ<br />
257<br />
71<br />
nicht relevante Metabolite, vorgegeben werden.<br />
Erkennbar besteht eine rechtliche Lücke zwischen 1<br />
bzw. 3 μg/L der GOW’s und den 10 μg/L aus dem<br />
Zulassungsver fahren (Bild 4).<br />
Das vierte Problem, auf das wir stoßen, ist die Vielzahl<br />
der Stoffe und Metabolite, die unterschiedliche<br />
Untersuchungstiefe hierzu sowie die unveröffentlichten<br />
regionalen Anwendungsmengen. In Deutschland werden<br />
pro Jahr über 15 000 t Herbizide, knapp 11 000 t<br />
Fungizide, etwa 1000 t Insektizide und Akarizide und<br />
etwa 4250 t sonstige Wirkstoffe verkauft (Bild 5). Die<br />
Jahresmenge beläuft sich auf 32 000 t Pflanzenschutzmittelwirkstoffe,<br />
die Jahr für Jahr in Deutschland verkauft<br />
werden, und 257 zugelassene Wirkstoffe mit einer<br />
bis dato noch nicht überschaubaren Anzahl von Metaboliten.<br />
Lysimeter- und Feldversickerungsstudien liegen<br />
bei den Herbiziden für 51 von 91 vor, bei den Fungiziden<br />
sind es nur 12 von 82, bei den Insektiziden 7 von<br />
58 und bei den Sonstigen 1 von 26 (vgl. Bild 5).<br />
Was daraus resultiert, sind Probleme in <strong>Wasser</strong>schutzgebieten<br />
und sog. „sensitive areas“, sensiblen<br />
Gebieten für Grundwasser und/oder Oberflächenwasser,<br />
beispielsweise Einzugsgebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen<br />
mit geringen Deckschichten, hoch<br />
durchlässigen Böden, abschwemmungsgefährdeten<br />
Böden, vulnerablen Grundwasserleitern (z. B. Karstgebiete)<br />
und/oder nutzungsspezifischen Risiken wie<br />
Monokulturen. So ergab beispielsweise eine Stichtagsbeprobung<br />
im <strong>Wasser</strong>schutzgebiet „Donauried-Hürbe“,<br />
das im Karst der Schwäbischen Alb liegt, bei der auf<br />
142 Wirkstoffe und Metabolite untersucht wurde, Positivbefunde<br />
bei 12 dieser Wirkstoffe bzw. Metabolite.<br />
Der sechste Problempunkt besteht darin, dass entgegen<br />
entsprechender Vorgaben aus dem sog.<br />
„Guidance Document“ der Kommission, das einfordert,<br />
dass keine Wirkstoffe zugelassen werden sollen, deren<br />
Metabolitenkonzentrationen über 10 μg/L liegen, solche<br />
Wirkstoffe dennoch eine Zulassung erhalten. Vom<br />
BVL 1 , der deutschen Zulassungsbehörde, sind Wirkstoffe<br />
zugelassen worden, die nicht nur einen, sondern<br />
auch mehrere Metabolite in Konzentrationen deutlich<br />
über 10 μg/L, in Einzelfällen bis zum 3- und 4-fachen,<br />
freisetzen. Hinzu zählen Dimethachlor, Metazachlor,<br />
Chlorthalonil, Trifloxystrobin, Metalaxyl-M usw. (Bild 6).<br />
Die Situation lässt sich wie folgt zusammenfassen:<br />
Die Belastungssituation ist unklar: Ein bundesweit<br />
koordiniertes, systematisches Monitoring fehlt.<br />
Die Risiken aus der PSM-Anwendung entstehen im<br />
Normalbetrieb.<br />
Das Pflanzenschutzrecht, das <strong>Wasser</strong>recht und das<br />
Trinkwasserrecht sind unzureichend aufeinander<br />
abgestimmt.<br />
1<br />
BVL = Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
Juli/August 2011<br />
730 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Die Vielzahl der Stoffe und Metabolite (257 Wirkstoffe,<br />
etwa 32 000 t pro Jahr in Deutschland) ist derzeitig<br />
nicht überschaubar.<br />
Die Probleme mit PSM-Rückständen in Grund- und<br />
Oberflächengewässern in <strong>Wasser</strong>schutzgebieten<br />
(„sensitive Areas“).<br />
Die Zulassung von Wirkstoffen mit Metabolitenkonzentrationen<br />
> 10 μg/L.<br />
3. Lösungsansätze<br />
3.1 Die Zusammenarbeit mit den<br />
Pflanzenschutzmittel-Herstellern<br />
Hier soll zunächst ein wesentlicher Punkt herausgearbeitet<br />
werden: Die Zusammenarbeit zwischen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und Herstellern von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auch wenn sich beide Seiten in der Vergangenheit<br />
wiederholt „in den Haaren gelegen“ haben, gilt auch<br />
hier: „Es ist immer besser miteinander zu reden als<br />
übereinander.“ Aus dieser Motivation heraus wurde<br />
2007 der „Runde Tisch“ gegründet, um dort die Probleme<br />
zu erörtern und Lösungsansätze zu entwickeln.<br />
Im Laufe der Zeit ist die anfängliche Zurückhaltung auf<br />
beiden Seiten einer konstruktiven fachlichen Diskussion<br />
gewichen. Bereits am 22. Januar 2009 konnte das<br />
Papier „Gemeinsam die Zukunft sichern“, welches sich<br />
auf die Zusammenarbeit von <strong>Wasser</strong>versorgung und<br />
Agrarchemie in Deutschland bezieht, mit den Unterschriften<br />
der Präsidenten der jeweiligen Verbände<br />
besiegelt werden (Bild 7). Ziel und Zweck der Zusammenarbeit<br />
sind:<br />
Förderung des vorsorgenden Gewässerschutzes bei<br />
der Fortentwicklung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln<br />
für eine nachhaltig betriebene Landwirtschaft.<br />
Gegenseitige Information und offene Diskussion<br />
über die beide Seiten berührenden Probleme, um<br />
die gegenseitige Akzeptanz zu fördern und die am<br />
Gewässerschutz orientierten Handlungsmöglichkeiten<br />
für den Einsatz von Pflanzenschutzmittel fortzuentwickeln.<br />
Erarbeitung einer gemeinsamen Vorgehensweise<br />
zur abgestimmten Information von Politik und<br />
Öffentlichkeit im Bedarfsfall. Über Positionspapiere<br />
und offizielle Stellungnahmen der Verbände mit<br />
Bezug zum chemischen Pflanzenschutz wird gegenseitig<br />
informiert.<br />
Die Zusammenarbeit erfolgt auf freiwilliger Basis<br />
unter Anerkennung der besonderen Verantwortung<br />
für die Auswirkungen der Tätigkeit gegenüber Menschen<br />
und Umwelt.<br />
Die Zusammenarbeit wurde unter folgenden Leitgedanken<br />
gestellt:<br />
„Wir lösen Probleme so, als ob wir „ein Unternehmen“<br />
wären, das sowohl Pflanzenschutzmittel als auch<br />
Trinkwasser bester Qualität produziert.“<br />
Die gemeinsamen Positionen wurden wie folgt festgelegt:<br />
1. Das Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung<br />
soll weitgehend unbelastet sein. Pflanzenschutzindustrie<br />
und <strong>Wasser</strong>wirtschaft verpflichten<br />
sich, gemeinsam das Maß der Beeinträchtigungen<br />
durch Pflanzenschutzmittel und ihren Metaboliten<br />
mit dem Vorsorgeprinzip bzw. den gesundheit lichen<br />
Orientierungswerten in Einklang zu bringen.<br />
2. Die unter heutigen agrarökonomischen Bedingungen<br />
vorwiegend praktizierte, leistungsfähige und<br />
intensive Landwirtschaft erfordert die Verwendung<br />
von umweltschonenden Pflanzenbehandlungs- und<br />
Schädlingsbekämpfungsmitteln und den verantwortungsvollen<br />
Umgang mit diesen Stoffen in der<br />
Umwelt. Dadurch gelingt es auch, den Ernährungsbedarf<br />
zu decken und Ressourcen, wie z. B. Fläche<br />
und Energie, zu schonen.<br />
3. Der Schutz der Trinkwasserressourcen kann nach<br />
den naturräumlichen Standortbedingungen Maßnahmen<br />
erfordern, die über die Anforderungen des<br />
flächendeckenden Gewässerschutzes hinausgehen.<br />
4. Die Entwicklung neuer Pflanzenbehandlungs- und<br />
Schädlingsbekämpfungsmittel zielt darauf ab, Wirkstoffe<br />
herzustellen, die in noch besserem Umfang<br />
biochemisch abbaubar, weniger persistent und<br />
damit umweltverträglicher sind.<br />
3.2 Operative Lösungsansätze<br />
Es wurde sich darauf verständigt, gemeinsam eine „Rohwasserdatenbank<br />
Deutschland“ aufzubauen, um die<br />
PSM-Befundsituation herauszuarbeiten und um Trends<br />
frühzeitig zu erkennen, bevor sie über Grenzwertüberschreitungen<br />
zu wirklichen Problemen für <strong>Wasser</strong>versorger<br />
und Pflanzenschutzmittelhersteller werden. Flankierend<br />
wurden am Runden Tisch Maßnahmenpakete<br />
zur Sanierung bzw. Problemabwehr betroffener Gebiete<br />
entwickelt (Bild 8).<br />
Bild 7. Nach der Unterzeichnung des Papiers „Gemeinsam die Zukunft<br />
sichern“ am 22. Januar 2009 in Berlin (BDEW).<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 731
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 8.<br />
Datenfluss und<br />
Entscheidungsabläufe<br />
„Runder<br />
Tisch“ –<br />
Rohwasserdatenbank<br />
–<br />
WVU (nach<br />
DVGW-TZW<br />
2008).<br />
Start<br />
Eigenschaften<br />
von Wirkstoffen und<br />
Metaboliten<br />
vorliegende<br />
Rohwasserdaten<br />
von WVU<br />
Informationen zur<br />
Anwendung (Spektren,<br />
regionale Schwerpunkte,<br />
Empfehlungen)<br />
Beirat<br />
Auswertung I<br />
Rohwasserdatenbank<br />
Auswertung II<br />
Bewertung<br />
durch<br />
Beirat<br />
empfiehlt Monitoringprogramm<br />
(Wirkstoffe/Metaboliten, Gebiete, Dauer, Häufigkeit)<br />
Festlegung, Umsetzung &<br />
Evaluierung von Maßnahmen<br />
Befund ≥ Maßnahmewert II<br />
Monitoring durch<br />
lokales WVU<br />
Information an Behörde (BVL)<br />
Daten-/Informationsfluss<br />
Aktivitäten<br />
Eingangsinformation<br />
Beirat<br />
Rohwasserdatenbank (DB)<br />
Maßnahmewert I ≤Befund<br />
< Maßnahmewert II<br />
Festlegung, Umsetzung &<br />
Evaluierung von Maßnahmen<br />
Befund <<br />
Maßnahmewert I<br />
keine Maßnahmen<br />
erforderlich<br />
Information an lokales WVU<br />
Stop<br />
Der zweite Ansatzpunkt, um möglichen PSM-Problemen<br />
in den Gewässern zu begegnen, besteht darin,<br />
Risiken zu minimieren. Hier ist 2009 mit der Verabschiedung<br />
der neuen Pflanzenschutzmittelzulassungsverordnung<br />
[4] ein wesentlicher Schritt gelungen. Zukünftig<br />
dürfen keine Pflanzenschutzmittelwirkstoffe mehr<br />
zugelassen werden, wenn sie erbgutverändernd, krebserzeugend,<br />
fortpflanzungsgefährdend, hormonell wirksam<br />
sowie beständig mit hohem Anreicherungsvermögen<br />
sowie giftig oder sehr beständig und mit sehr<br />
hohem Anreicherungsvermögen sind. Dies sind die sog.<br />
„cut-off-Kriterien“, sie setzen wesentliche Forderungen<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft um.<br />
Die Kerninhalte der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009<br />
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 2<br />
sind (vgl. [5]):<br />
keine Zulassung, wenn: erbgutverändernd, krebserzeugend,<br />
fortpflanzungsgefährdend, hormonell<br />
wirksam, beständig und mit hohem Anreicherungsvermögen<br />
sowie giftig oder sehr beständig und mit<br />
sehr hohem Anreicherungsvermögen<br />
zonale Gliederung „Nord – Mitte – Süd“<br />
Definition von PSM-Rückständen, Aufzeichnungspflichten,<br />
Möglichkeit des Nachzulassungsmonitoring<br />
gegenseitige Anerkennung der Zulassung<br />
Bezug zu Zielen der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie.<br />
2<br />
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des EUROPÄISCHEN PARLA-<br />
MENTS UND DES RATES vom Oktober 2009 über das Inverkehrbringen<br />
von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der<br />
Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates<br />
Das Ganze wird flankiert durch eine Richtlinie über<br />
einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige<br />
Anwendung von Pestiziden 3 . Diese soll auf nationaler<br />
Ebene durch den sog. „Nationalen Aktions plan zur<br />
nachhaltigen Anwendung von Pflanzen schutz mitteln“<br />
umgesetzt werden [6].<br />
Ziel des nationalen Aktionsplans ist, die Risiken, die<br />
durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entstehen<br />
können, weiter zu reduzieren. Dazu sollen geeignete<br />
Maßnahmen, die von Bund und Ländern durchgeführt<br />
und getragen werden, beitragen. Es sollen:<br />
Risiken reduziert werden, die durch die Anwendung<br />
chemischer PSM entstehen,<br />
die Intensität der Anwendung dieser PSM zurückgeführt<br />
werden,<br />
keine Anwendungen über das „notwendige Maß“<br />
hinaus erfolgen,<br />
chemische Pflanzenschutzmaßnahmen durch nichtchemische<br />
ersetzt werden,<br />
Rückstände von PSM in Agrarprodukten weiter<br />
zurückgehen und damit ein wesentlicher Beitrag<br />
zum vorsorgenden Verbraucherschutz geleistet werden,<br />
die wirtschaftliche Situation der Betriebe verbessert<br />
werden, indem Kosten für unnötige Anwendungen<br />
von Pflanzenschutzmitteln vermieden werden.<br />
3<br />
Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von PSM<br />
(Umsetzung der Richtlinie2009/128/EG DES EUROPÄISCHEN<br />
PARLAMENTS UND DES RATES über einen Aktionsrahmen der<br />
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden)<br />
[15]<br />
Juli/August 2011<br />
732 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Allerdings krankt der Nationale Aktionsplan daran,<br />
dass mit sehr viel Allgemeinplätzen und unbestimmten<br />
Rechtsbegriffen gearbeitet wird [7, 8, 9]. Der Prozess ist<br />
allerdings noch nicht abgeschlossen. Unbefriedigend ist<br />
auch, wie das BMELV die Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
handhabt. Konkrete Dissenspunkte werden in Protokollen<br />
„unter den Teppich gekehrt“, die formale Beteiligung<br />
der Öffentlichkeit steht über einer inhaltlichen Lösung<br />
der Aufgabe.<br />
Die nächste Aufgabe besteht darin, dass rechtliche<br />
Lücken geschlossen werden müssen. Eine ganz entscheidende<br />
Initiative geht hier von den LAWA-Ausschüssen<br />
„Grundwasser und <strong>Wasser</strong>versorgung“ sowie<br />
„Recht“ aus. Mit dem Papier „Vorkommen und Bedeutung<br />
der pflanzenschutzrechtlich nicht relevanten<br />
Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln für Grundwasser<br />
und <strong>Wasser</strong>versorgung Deutschlands und rechtliche<br />
Rahmenbedingungen zur Bewertung von nicht relevanten<br />
Metaboliten in Grund- und Trinkwasser sowie Ableitung<br />
und Vorschlag eines Schwellenwertes für nicht<br />
relevante Metabolite in der Grund was ser verordnung“<br />
[1] wird der richtige Weg beschritten. Mit diesem Papier<br />
als Vorlage zur 140. Vollversammlung der LAWA wird<br />
vorgeschlagen, für nicht relevante Metabolite im Grundwasser<br />
in der kommenden Artikelverordnung der<br />
Grundwasser ver ordnung einen Schwellenwert von<br />
1 μg/L einzuführen. Genau damit kann die Diskrepanz<br />
zwischen gesund heitlichen Orientierungswerten und<br />
dem 10 μg/L-Wert aus dem „Guidance Document“ (vgl.<br />
[10]) geschlossen werden. Damit kann es gelingen, die<br />
bestehende Lücke zwischen Pflanzenschutzgesetz,<br />
<strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz und Trinkwasserverordnung<br />
durch Maßnahmen, aber auch durch Nachschärfung<br />
beim Umweltrecht zu schließen.<br />
Begrüßenswert ist, dass das BVL und auch das UBA<br />
zunehmend Transparenz schaffen hinsichtlich der Vielzahl<br />
der Wirkstoffe und der Metabolite. Nach dem „Platzen<br />
der Bombe“ mit Tolylfluanid und Desphenylchloridazon<br />
Ende 2006 ist bereits im Mai 2007 eine erste Veröffentlichung<br />
des BVL zu Wirkstoffen mit auffällig hohen<br />
Metabolitenkonzentrationen, also > 10 μg/L, erschienen.<br />
Die nächste folgte im Mai 2008. Dann begann das<br />
UBA, diese Ergebnisse für die Trinkwasserversorgung<br />
mit gesundheitlichen Orientierungswerten aufzuarbeiten.<br />
Das jüngste Papier aus dem BVL vom 25.11.2010<br />
[11] weist bereits 20 Wirkstoffe mit 49 Metaboliten aus,<br />
der Prozess hin zu mehr Transparenz ist noch nicht<br />
abgeschlossen (Bild 9).<br />
Zur Erinnerung: Bundesweit sind 257 Wirkstoffe zugelassen.<br />
Es kann also davon ausgegangen werden, dass in<br />
Zukunft noch weitere Wirkstoffe und deren Metabolite<br />
hinzukommen. Zu begrüßen ist auch, dass die Analysenverfahren<br />
offen gelegt und Transparenz geschaffen wird,<br />
welche Metaboliten in welchen Lysimeterkonzentrationen<br />
freigesetzt werden ‒ ein ganz wichtiger Schritt für<br />
die Rohwasserüberwachung. Eine ausreichende Transparenz<br />
wird aber erst erreicht sein, wenn von den Herstellern<br />
die Tonnagen der verkauften Wirkstoffe, differenziert<br />
nach Regionen, veröffentlicht werden.<br />
Weiterhin ist es erforderlich, die Probleme in den<br />
<strong>Wasser</strong>schutzgebieten und „sensitive areas“ frühzeitig<br />
anzugehen und „hot spots“ zu beseitigen. Dies erfordert<br />
zunächst valide Monitoringergebnisse, anschließend<br />
konkrete Maßnahmen. Auch dieses Problem wurde am<br />
Runden Tisch diskutiert und bearbeitet. Analog zum<br />
Grenzwertkonzept der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie und den<br />
UBA-Empfehlungen zu gesundheitlichen Orientierungswerten<br />
(GOW) konnten folgende Maßnahmepakete<br />
ausgearbeitet werden:<br />
Erste Maßnahmen bei Überschreitung des Maßnahmenwertes<br />
I:<br />
Wirkstoffe und relevante Metabolite 0,075 μg/L<br />
Nicht relevante Metabolite 75 % des GOW<br />
Weitergehende Maßnahmen bei Überschreitung des<br />
Maßnahmenwertes II:<br />
Wirkstoffe und relevante Metabolite 0,1 μg/L<br />
Nicht relevante Metabolite 1 bzw. 3 μg/L<br />
Zunächst geht es um die Intensivierung des Monitorings<br />
zur Identifizierung besonders kritischer Teilgebiete.<br />
Der Informationsfluss zu den Landwirten, zum<br />
Agrarhandel, aber auch zur Offizialberatung ist durch<br />
Offenlegung der Befundlage zu verbessern, und die<br />
Beratung ist entsprechend zu intensivieren. Was kann<br />
mit Wirkstoffsplitting, mit einer Veränderung der Fruchtfolge<br />
oder gar einem Wirkstoffverzicht erreicht werden?<br />
Es sollen flächenspezifische Minimierungs konzepte<br />
erarbeitet werden bis hin zur Veränderung der Produktanwendung,<br />
was soweit führen kann, dass ein Hersteller<br />
gegebenenfalls einen Wirkstoff in diesem Einzugsgebiet<br />
vom Markt nimmt.<br />
Last but not least geht es um die Zulassung von<br />
Wirkstoffen mit Metabolitenkonzentrationen > 10 μg/L.<br />
Anzahl [ 1 ]<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
13<br />
5<br />
BVL<br />
39<br />
15<br />
BVL<br />
5 7 9 11 1 3 5 7 9 11<br />
2007 2008 2009<br />
2010<br />
Wirkstoffe<br />
27<br />
8<br />
15<br />
UBA<br />
UBA<br />
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11<br />
nicht relevante Metabolite<br />
Bild 9. Transparenz schaffen: Entwicklung der Anzahl der<br />
Wirkstoffe und nrM, zu denen umfassende Daten veröffentlicht<br />
wurden. Quelle: Veröffentlichungen UBA und BVL<br />
27<br />
49<br />
BVL<br />
20<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 733
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Sicherheit bzw. Risiko<br />
sicherer unsicherer<br />
zusätzliches<br />
Risiko<br />
TrinkwV<br />
(Aldin, Dieldrin,<br />
Heptachlor,...)<br />
PflSchG/<br />
Zulassung<br />
TrinkwV<br />
PflSchG/<br />
Zulassung<br />
land“ zu klären. Bis Mitte des Jahres 2011 ist die Rohwasserdatenbank<br />
aufgebaut. Ebenfalls sehr positiv ist die<br />
neue Pflanzenschutzmittelzulassungsverordnung mit<br />
den genannten „cut-off-Kriterien“, da wesentliche Problempunkte,<br />
beispielsweise die Persistenz von Metaboliten<br />
angegangen wurde. Wenig aussichtsreich, weil<br />
zu unkonkret, ist der Nationale Aktionsplan des BMELV,<br />
weil sich hinter dem politischen Feigenblatt der Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
die Verweigerung zur Problemlösung<br />
– aus welchen Gründen auch immer – verbirgt.<br />
Zu begrüßen ist der Vorstoß der LAWA bezüglich<br />
eines Schwellenwertes für nicht relevante Metabolite in<br />
Höhe von 1 μg/L. Dies kann den <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
sehr viel weiterhelfen, wenn eine Verklammerung<br />
zu verbindlichen Sanierungsmaßnahmen über<br />
das WHG hergestellt wird, und es wird auch den vorsorgenden<br />
flächendeckenden Grundwasserschutz fördern.<br />
Als rundweg positiv sind die regelmäßige Veröffentlichung<br />
des BVL zu Wirkstoffen und Metaboliten und<br />
entsprechende Hinweise zu den Analyseverfahren. Die<br />
„Geheimniskrämerei“, die noch vor zehn Jahren vorherrschte,<br />
ist der Transparenz gewichen.<br />
Ebenfalls positiv ist der Ansatz, dass sich Pflanzenschutzmittelhersteller<br />
und <strong>Wasser</strong>versorgungsverbände<br />
geeinigt haben, in hot-spot-Regionen konkrete<br />
Maßnahmen gemeinsam vor Ort zu initiieren. Positiv ist<br />
hier auch zu erwähnen, dass sich die Länder Baden-<br />
Schwellenwert<br />
in<br />
GWVO<br />
GOW<br />
nrM 1<br />
GOW<br />
nrM 2<br />
PflSchG/<br />
Zulassung<br />
0.001 0.01 0.1 1 3 10 100<br />
Konzentration [ μg/L ]<br />
Bild 10. Probleme frühzeitig angehen, „hot spots“ beseitigen,<br />
das Maßnahmenkonzept vom „Runden Tisch“ sowie<br />
LAWA-Vorschlag zu Schwellenwert in GWVO.<br />
Dieses Problem ist nur teilweise gelöst. Aber auch hier<br />
wird der Ansatz der LAWA weiterhelfen, wenn es gelingt,<br />
diesen 1-Mikrogramm-pro-Liter-Schwellenwert in der<br />
Grundwasserverordnung unterzubringen (Bild 10) [12].<br />
4. Ausblick<br />
Positiv zu bewerten ist der Lösungsansatz, die Belastungssituation<br />
mit der „Rohwasserdatenbank Deutsch-<br />
Tabelle 1. Die gegenwärtigen Probleme mit Rückständen von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und deren Metabolite im<br />
Rohwasser, Lösungsansätze sowie Bewertung der Lösungsansätze.<br />
Problem Lösung Bewertung<br />
Belastungssituation unklar: letzte<br />
bundesweite Erhebung LAWA<br />
1997/2003;<br />
TZW-Studie 2006, DVGW W1/02/05.<br />
Die Risiken aus der PSM-Anwendung<br />
entstehen im Normalbetrieb.<br />
Planzenschutz- <strong>Wasser</strong>recht und<br />
Trinkwasserrecht sind unzureichend<br />
aufeinander abgestimmt.<br />
Die Vielzahl der Stoffe und Metabolite<br />
(257 Wirkstoffe, ca. 32.000 t<br />
pro Jahr in Deutschland)<br />
<strong>Wasser</strong>schutz gebiete und „sensitive<br />
areas“.<br />
Zulassung von Wirkstoffen mit<br />
Metabolitenkonz. > 10μg/L.<br />
Belastungssituation klären:<br />
Initiative „Runder Tisch“, „Aufbau und Betrieb einer Rohwasserdatenbank<br />
Deutschland” durch DVGW, iva, VKU und BDEW<br />
Risiken minimieren:<br />
Pflanzenschutzmittelzulassungsverordnung<br />
Nationaler Aktionsplan des BMVEL<br />
Rechtliche Lücken schließen:<br />
Initiative UMK (75. UMK 12.11.2010)<br />
Schwellenwert für rechtlich nicht relevante Metabolite im Grundwasser<br />
von 1 μg/L in GWVO in Ergänzung der Grundwasserverordnung<br />
(Artikelverordnung)<br />
Transparenz schaffen:<br />
BVL veröffentlicht (Informationen zu) Daten aus dem Zulassungsverfahren<br />
zu Wirkstoffen und Metabolite, erstmals 29.6.2007 (über<br />
LAWA), letztmals: 25.11.2010<br />
Probleme frühzeitig angehen, „hot spots“ beseitigen:<br />
Freiwillige Vereinbarung der Länder Bayern und Baden-Württemberg<br />
mit dem Zulassungsinhaber;<br />
Problembehebung durch Maßnahmenkatalog des „Runden Tisches“<br />
Rechtliche Lücken schließen –<br />
+ +<br />
+ + +<br />
–<br />
+ + +<br />
+ + +<br />
+ +<br />
+ +<br />
Juli/August 2011<br />
734 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Württemberg und Bayern mit den Herstellern darauf<br />
verständigt haben, dass in sensiblen Gebieten kein<br />
Chloridazon mehr vertrieben werden soll. Im Augenblick<br />
noch nicht befriedigend ist, dass nach wie vor<br />
Wirkstoffe mit Metaboliten > 10 μg/L zugelassen sind.<br />
Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich mit<br />
den Ansätzen Erfolg versprechende Schritte zur Lösung<br />
der bestehenden Probleme mit PSM-Wirkstoffen und<br />
Metaboliten in den Rohwässern abzeichnen. Tabelle 1<br />
gibt hierzu einen Überblick.<br />
In der Gesamtschau überwiegen die positiven<br />
Punkte. Durch ein gewachsenes Problembewusstsein,<br />
mehr Transparenz und mehr Kooperation ist man beim<br />
Thema „Pflanzenschutzmittel“ in den vergangenen<br />
Jahren ein gutes Stück vorangekommen, auch wenn<br />
noch nicht alle Probleme gelöst sind.<br />
Hinweis: Der Beitrag geht auf einen Vortrag zurück, den der Verfasser auf der<br />
WAT WASSER BERLIN 2011 gehalten hat.<br />
Literatur<br />
[1] Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong> (LAWA): Bericht<br />
zur Grundwasserbeschaffenheit – Pflanzenschutzmittel –<br />
Berichtszeitraum 2001–2008; Sächsisches Staatsministerium<br />
für Umwelt und Landwirtschaft, Archivstr. 1, Postfach<br />
10 05 10, 01076 Dresden.<br />
[2] Sturm, S., Kiefer, J. und Eichhorn, E.: Befunde von<br />
Pflanzenschutz mitteln in Grund- und Oberflächengewässern<br />
und deren Eintragspfade – Bedeutung für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und das Zulassungsverfahren. DVGW-Forschungsvorhaben<br />
W 1/02/05, durchgeführt am Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong> Karlsruhe 2006.<br />
[3] Keil, F.: Vorsorge durch gemeinsame Verantwortung. Integrative<br />
Strategien zu Risikominderung im chemischen Pflanzenschutz.<br />
Eine Handreichung für die Praxis (Projekt start 2 ).<br />
Herausgegeben vom Institut für sozial-ökologische Forschung<br />
GmbH, Frankfurt 2010.<br />
[4] Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen<br />
von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung<br />
der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates, ABl.<br />
L 309 vom 24.11.2009, S. 1–50.<br />
[5] Böhmer, B.: EU-Parlament verabschiedet Pflanzenschutz-<br />
Novelle: Was ändert sich für Landwirtschaft und Gartenbau?<br />
Herausgeber „Gemüse. Das Magazin für den professionellen<br />
Gemüsebau“, Heft 2, 2009.<br />
[6] BMELV – Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz: Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen<br />
Anwendung von Pflanzenschutz mitteln, April 2008.<br />
[7] BDEW – Bundesverband der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
e.V.: Nationaler Aktionsplan Pestizide (NAP): Schutz der Rohwasserressourcen<br />
für die Trinkwasserversorgung verankern.<br />
Stellungnahme im Anschluss an die BMELV-Workshops zum<br />
NAP vom 21.–23. September 2010.<br />
[8] BMELV – Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz: Eckpunktepapier zur Weiter entwicklung<br />
des Nationalen Aktionsplans zur nach haltigen<br />
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, verabschiedet auf<br />
einem Fachwork shop vom 23. bis 25. Juni 2009 in Potsdam.<br />
[9] BMELV – Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz: Diskussionsentwurf „Nationaler<br />
Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln<br />
2013 – 2025 (Zeitabschnitt 2013 – 2018)“,<br />
Stand 04.11.2010.<br />
[10] Michalski, B., Stein, B., Niemann, L., Pfeil, R. und Fischer, R.:<br />
Beurteilung der Relevanz von Metaboliten im Grundwasser<br />
im Rahmen des nationalen Zulassungs verfahrens für Pflanzenschutzmittel.<br />
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd.<br />
2004, S. 52–59.<br />
[11] Tüting, W.: Übersicht nicht relevanter Grundwassermetaboliten<br />
von Pflanzen schutzmittel-Wirkstoffen. Herausgegeben<br />
vom BVL – Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit,<br />
Abteilung Pflanzenschutzmittel, 25.<br />
November 2010.<br />
[12] LAWA-Ausschüsse „Grundwasser und <strong>Wasser</strong>versorgung“<br />
(LAWA-AG) und „Recht“ (LAWA-AR): Vorkommen und Bedeutung<br />
der pflanzenschutzrechtlich nicht relevanten Metaboliten<br />
von Pflanzenschutzmitteln für Grundwasser und <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Deutschlands und rechtliche Rahmenbedingungen<br />
zur Bewertung von nicht rele vanten Metaboliten in<br />
Grund- und Trinkwasser sowie Ableitung und Vorschlag<br />
eines Schwellenwertes für nicht relevante Metaboliten in<br />
der Grundwasserverordnung – Entwurf zur Vorlage bei der<br />
140. Vollversammlung der LAWA, Mai 2010.<br />
[13] Holländer, R., Zenker, Ch., Pielen, B. und Fälsch, M.: Gewässerschutz<br />
und Landwirtschaft: Widerspruch oder lösbares Problem?.<br />
Herausgegeben vom WWF Deutschland, Frankfurt<br />
2008.<br />
[14] LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz<br />
Baden-Württem berg: Grundwasser-Überwachungsprogramm.<br />
Ergebnisse der Beprobung 2009, Karlsruhe 2010.<br />
[15] Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und<br />
des Rates vom 21. Okto ber 2009 über einen Aktionsrahmen<br />
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwen dung von Pestiziden,<br />
ABl. L 309, S. 71–86.<br />
[16] Sturm, S., Kiefer, J., Kollotzek, D. und Rogg, J.-M.: Aktuelle<br />
Befunde der Metaboliten von Tolylfluanid und Chloridazon<br />
in den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen<br />
Baden-Württembergs. <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
151 (2010) Nr. 10, S. 950–959.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 04.03.2011<br />
Korrektur: 04.07.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh<br />
Technischer Geschäftsführer |<br />
E-Mail: haakh.f@lw-online.de |<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung |<br />
Schützenstraße 4 |<br />
D-70182 Stuttgart<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 735
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Der Einfluss moderner Haushaltsgeräte<br />
auf den Trinkwasserbedarf der Haushalte<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, <strong>Wasser</strong>verbrauch, <strong>Wasser</strong>bedarf, Prognose, Haushaltsgeräte<br />
Ulrich Roth, Hermann Mikat und Holger Wagner<br />
Im Rahmen des Verbundprojektes „Anpassungsstrategien<br />
an Klimatrends und Extremwetter und Maßnahmen<br />
für ein nachhaltiges Grundwassermanagement“<br />
wurde eine <strong>Wasser</strong>bedarfsprognose für 2100<br />
aufgestellt. Als Grundlage hierfür wurde die Entwicklung<br />
des <strong>Wasser</strong>verbrauchs in verschiedenen Verbrauchssektoren<br />
untersucht. Der vorliegende Artikel<br />
befasst sich im Speziellen mit den Auswirkungen<br />
moderner <strong>Wasser</strong> sparender Haushaltsgeräte. Die<br />
resultierenden Spareffekte wurden zwischen 1980<br />
und 2010 wirksam und sind als weitgehend abgeschlossen<br />
anzusehen.<br />
The Influence of Modern Household Appliances on<br />
the Drinking Water Demand in Households<br />
The joint project “adaptation strategies for climate<br />
trends and extreme weather and steps towards a sustainable<br />
groundwater management” includes a prognosis<br />
of water consumption up to 2100. As a basis for<br />
the prognosis the development of water demand for<br />
different purposes was analysed. The special subject<br />
of this article is the effect of modern water saving<br />
household appliances. The consequences have been<br />
taken effect between 1980 and 2010 and to a large<br />
extent they are complete.<br />
1. Anlass und Gegenstand der<br />
Untersuchungen<br />
Im Rahmen des im Förderschwerpunkt klimazwei des<br />
Bundesministeriums für Bildung und Forschung<br />
(BMBF) geförderten Verbundprojektes „Anpassungsstrategien<br />
an Klimatrends und Extremwetter und Maßnahmen<br />
für ein nachhaltiges Grundwassermanagement“<br />
(AnKliG) [1], das zum Ziel hat, die wasserwirtschaftlichen<br />
Auswirkungen des Klimawandels im<br />
Raum Südhessen bis zum Jahr 2100 abzuschätzen,<br />
wurde eine entsprechend langfristige <strong>Wasser</strong>bedarfsprognose<br />
aufgestellt [2]. Die Prognose basiert auf<br />
einem Datenbestand bis 2006.<br />
Eine Grundlage dieser Prognose bildet die Analyse<br />
der bisherigen Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs<br />
bzw. des Pro-Kopf-Verbrauchs in Deutschland, der<br />
Ursachen und Hintergründe dieser Entwicklung sowie<br />
der daraus abzuleitenden Trends im Prognosezeitraum<br />
[3]. Dabei wurden die Entwicklungen in allen Verbrauchssektoren<br />
betrachtet. Neben der Entwicklung im<br />
Bereich der Toilettenspülung [4] ist der Anteil für<br />
Wäschewaschen und Geschirrspülen ein wesentlicher<br />
Aspekt, der anteilig etwa 18 % des Trinkwasserverbrauchs<br />
ausmacht. Der Bedarf in diesem Sektor wird<br />
maßgeblich von der technischen Entwicklung der<br />
Haushaltsgeräte beeinflusst, sodass seine Entwicklung<br />
in Vergangenheit und Zukunft relativ präzise zu<br />
beschreiben ist. Im Rahmen des AnKliG-Projektes wurden<br />
frühere Untersuchungsergebnisse [5] aktualisiert<br />
und präzisiert.<br />
2. Entwicklung der Verbrauchsanteile<br />
in Deutschland<br />
Der Pro-Kopf-Verbrauch im Sektor „Haushalte und Kleingewerbe“<br />
ist in Deutschland zwischen 1990 und 2006<br />
von 147 Liter pro Einwohner und Tag (L/(E · d)) um 15 %<br />
auf 125 L/(E · d) zurückgegangen; der aktuelle Wert für<br />
2009 wird auf 122 L/(E · d) geschätzt [6]. Der DVGW<br />
nennt in seinem Arbeitsblatt W 410 [7] als mittelfristigen<br />
voraussichtlichen Wert rund 120 L/(E · d). Die unterschiedliche<br />
Entwicklung in den alten und den neuen<br />
Bundesländern und ihre Ursachen sind in [4] beschrieben,<br />
sodass an dieser Stelle darauf verzichtet wird.<br />
Auslöser für die Entwicklung <strong>Wasser</strong> sparender Haushaltsgeräte<br />
war in den alten Bundesländern die Ölkrise<br />
1973, die dazu führte, dass der Energieverbrauch von<br />
Wasch- und Spülmaschinen gesenkt wurde. Da in diesen<br />
Geräten ein Großteil der Energie für das Erwärmen<br />
von <strong>Wasser</strong> verwendet wird, war es dazu erforderlich,<br />
den <strong>Wasser</strong>verbrauch der Geräte zu reduzieren. Somit<br />
wurden <strong>Wasser</strong> sparende Haushaltsgeräte entwickelt,<br />
die ab Ende der 1970er Jahre auf den Markt kamen und<br />
bis heute weiter verbessert werden [5]. Die Entwicklung<br />
<strong>Wasser</strong> sparender Haushaltsgeräte war demnach ein<br />
Nebeneffekt der Bemühungen, Energie zu sparen. In<br />
den neuen Bundesländern war nach 1990 das konzentrierte<br />
Wirksamwerden von Spareffekten, unter anderem<br />
durch die Ausstattung der Haushalte mit Wasch- und<br />
Spülmaschinen nach modernem westlichem Standard,<br />
ursächlich für einen deutlichen Rückgang des Trinkwasserverbrauchs.<br />
Juli/August 2011<br />
736 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Die Bilder 1 und 2 zeigen die Verbrauchsstruktur im<br />
Sektor „Haushalte und Kleingewerbe“ um 1990 [8], 2006<br />
[6] und die „mittelfristigen voraussichtlichen“ Werte, wie<br />
sie in dem DVGW-Arbeitsblatt W 410 [7] dargestellt sind.<br />
Danach ist der Verbrauch in diesem Sektor zwischen<br />
1990 und 2006 von etwa 146 L/(E · d) auf rund<br />
126 L/(E · d) zurückgegangen und mittelfristig ist mit<br />
einem Wert von 120 L/(E · d) zu rechnen. Die Anteile für<br />
Wäschewaschen und Geschirrspülen sind mit 12 % bzw.<br />
6 % konstant geblieben, wobei allerdings die resultierenden<br />
Verbrauchszahlen für das Wäschewaschen von<br />
17,5 L/(E•d) auf etwa 15 L/(E · d) und für das Geschirrspülen<br />
von 8,75 L/(E · d) auf 7,6 L/(E · d) zurückgegangen<br />
sind. Mittelfristig ist nach dem DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 410 bei konstantem prozentualen Anteil mit einem<br />
weiteren leichten Bedarfsrückgang auf rechnerisch 14,4<br />
bzw. 7,2 L/(E · d) zu rechnen.<br />
Die Darstellungen in den Bildern 1 und 2 basieren<br />
überwiegend auf Schätzungen von Fachleuten. Die verschiedenen<br />
Quellen mit derartigen Darstellungen enthalten<br />
unterschiedliche und zum Teil auch widersprüchliche<br />
Angaben. Der Verbrauchsanteil des „Kleingewerbes“<br />
ist oft nicht eindeutig definiert und wird nicht<br />
konsequent aufgeführt (so z. B. gemäß [8] in Bild 1), was<br />
in der Diskussion oft zu Missverständnissen in Bezug auf<br />
den Verbrauchsanteil der „Haushalte“ führt.<br />
Etwas andere Ergebnisse lieferte eine in Mannheim<br />
durchgeführte Untersuchung zur Verbrauchsstruktur in<br />
ausgewählten Haushalten (Bild 3 [9]). Danach entfielen<br />
1995/96 je 17,7 L/(E · d) oder je rund 15 % auf Wäschewaschen<br />
und Geschirrspülen. Daneben ist für den<br />
Verbrauch von Kondensationswäschetrocknern ein<br />
Wert von 2,5 L/(E · d) angegeben. Insgesamt lag der Verbrauchsanteil<br />
für Wäschewaschen und Geschirrspülen<br />
damit bei etwa 38 L/(E · d) oder 31 %.<br />
3. Ausstattung der Haushalte mit<br />
Wasch- und Spülmaschinen<br />
Bild 4 zeigt die Entwicklung des Ausstattungsgrades<br />
der privaten Haushalte in Deutschland mit Waschmaschinen<br />
und Geschirrspülmaschinen seit 1962/63 (alte<br />
Bundesländer) bzw. seit 1993 (neue Bundesländer) [10].<br />
Waschmaschinen wurden in Westdeutschland wie<br />
auch in der DDR in den 1960er Jahren zum Standard.<br />
Seit Mitte der 1990er Jahre liegt der Ausstattungsgrad<br />
der Haushalte mit Waschmaschinen über 90 %, zuletzt<br />
bei rund 94 %. Man kann davon ausgehen, dass heute<br />
praktisch jeder Haushalt eine Waschmaschine hat oder<br />
zumindest nutzen kann. Dabei ist der Ausstattungsgrad<br />
in den neuen Bundesländern etwas höher als im alten<br />
Bundesgebiet. Bei der letzten Verbrauchsstichprobe des<br />
Statistischen Bundesamtes im Jahr 2008 wurden Waschmaschinen<br />
nicht mehr berücksichtigt, weil sie zur<br />
Standardausstattung jedes Haushaltes gehören.<br />
Spülmaschinen waren in Westdeutschland bis in die<br />
1970er Jahre ein Luxusartikel – 1990 hatten etwa ein<br />
Trinken und Kochen<br />
2%<br />
Autopflege<br />
2%<br />
Gartenbewässerung<br />
4%<br />
Körperpflege<br />
6%<br />
Geschirrspülen<br />
6%<br />
Wäschewaschen<br />
12%<br />
Sonstiges<br />
6%<br />
146 L/(E•d)<br />
Baden/Duschen<br />
30%<br />
Toilettenspülung<br />
32%<br />
Bild 1. Verbrauchsstruktur im Sektor Haushalte und Kleingewerbe<br />
nach LAWA, ca. 1990 [8].<br />
Essen und Trinken<br />
4%<br />
Raumreinigung,<br />
Autopflege, Garten<br />
6%<br />
Geschirr spülen<br />
6%<br />
Wäsche waschen<br />
12%<br />
Kleingewerbe<br />
9%<br />
126 bzw. 120 l/(E•d)<br />
Baden, Duschen,<br />
Körperpflege<br />
36%<br />
Toilettenspülung<br />
27%<br />
Bild 2. Verbrauchsstruktur im Sektor Haushalte und Kleingewerbe<br />
nach BDEW 2008 [6] bzw. DVGW 2008 [7].<br />
Gartenbewässerung<br />
4%<br />
Kondensationswäschetrockner<br />
2%<br />
Geschirrspülen<br />
15%<br />
Wäschewaschen<br />
15%<br />
Sonstiges, Trinken,<br />
Kochen<br />
4%<br />
122 L/(E•d)<br />
Duschen<br />
18%<br />
Toilettenspülung<br />
29%<br />
Baden<br />
13%<br />
Bild 3. Verbrauchsstruktur im Sektor Haushalte (ohne Kleingewerbe)<br />
in Mannheim nach Bächle et al. 1995/96 [9].<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 737
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 4.<br />
Ausstattungsgrad<br />
der<br />
privaten<br />
Haushalte in<br />
Deutschland<br />
mit Waschund<br />
Spülmaschinen<br />
seit 1962/63<br />
[10].<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
Ausstattungsgrad der Haushalte in %<br />
82 83<br />
75<br />
61<br />
Waschmaschinen Deutschland<br />
Waschmaschinen alte Länder<br />
Waschmaschinen neue Länder<br />
Spülmaschinen Deutschland<br />
Spülmaschinen alte Länder<br />
34<br />
Spülmaschinen neue Länder<br />
86<br />
29<br />
89<br />
30<br />
92<br />
45<br />
94<br />
57<br />
63<br />
20<br />
24<br />
10<br />
15<br />
7<br />
0<br />
2<br />
1960 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Liter pro Waschgang<br />
Mittlerer <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
von Waschmaschinen<br />
des angegebenen Baujahrs<br />
Ölkrise<br />
Mittlerer <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
aller Geräte in den Haushalten<br />
(12,5 Jahre Standzeit)<br />
Bild 5. Entwicklung des <strong>Wasser</strong>verbrauchs von Waschmaschinen.<br />
Anteiliger Pro-Kopf-Verbrauch für Wäsche Waschen in Liter pro Einwohner und Tag<br />
Verlauf, wie er allein aufgrund der<br />
technischen Entwicklung zu erwarten<br />
gewesen wäre: Rückgang um ca. 12,5 L/E•d<br />
Ölkrise<br />
Ist-Wert 2006 lt. BDEW<br />
15<br />
Bedarfszunahme infolge<br />
verändertem Verhalten:<br />
- häufigeres Waschen<br />
- kleinere Haushalte<br />
0<br />
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015<br />
Bild 6. Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs für das Wäschewaschen.<br />
Drittel der Haushalte eine Spülmaschine. In der DDR<br />
waren Spülmaschinen ein ausgesprochenes Luxusgut,<br />
das nur einzelnen Bürgern zur Verfügung stand. Seit der<br />
Wiedervereinigung hat die Zahl der Spülmaschinen in<br />
den alten Bundesländern weiter zugenommen. In den<br />
neuen Bundesländern hat sie sich innerhalb weniger<br />
Jahre dem westlichen Niveau weitgehend angenähert.<br />
2008 hatten 63 % aller Haushalte eine Spülmaschine –<br />
im alten Bundesgebiet 64 %, in den neuen Bundesländern<br />
55 %. Der Trend ist weiter zunehmend, auch wenn<br />
sich die Kurve erkennbar abflacht.<br />
4. Verbrauchsentwicklung im Bereich<br />
Wäschewaschen<br />
Tabelle 1 zeigt Angaben für den <strong>Wasser</strong>verbrauch im<br />
Bereich Wäschewaschen, wie sie in der einschlägigen<br />
Fachliteratur der letzten 50 Jahre enthalten sind.<br />
Demnach wurde der <strong>Wasser</strong>verbrauch für das<br />
Wäschewaschen zunächst durchaus unterschiedlich und<br />
mit erheblicher Bandbreite angegeben. Im Vergleich zu<br />
den Angaben aus den 1950er-Jahren und den Angaben<br />
ab etwa 1990 erscheinen vor allem die oberen Werte aus<br />
den Jahren 1973 und 1982 relativ hoch. Erst ab etwa<br />
1990 werden die Daten einheitlicher und gehen von<br />
Werten um 20 L/(E•d) auf zuletzt etwa 15 L/(E · d) zurück.<br />
Nach der Ölkrise wurde der <strong>Wasser</strong>verbrauch der<br />
Waschmaschinen von durchschnittlich etwa 145 L pro<br />
Waschgang Mitte der 1970er-Jahre bis Anfang der<br />
1990er-Jahre um etwa 60 % auf etwa 60 L pro Waschgang<br />
gesenkt (Bild 5, Ansätze nach Herstellerangaben). Durch<br />
weitere Optimierung der Maschinen konnte ihr Verbrauch<br />
seitdem nur noch geringfügig reduziert werden –<br />
Juli/August 2011<br />
738 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
der durchschnittliche Verbrauch in einem Standardprogramm<br />
liegt derzeit bei etwa 55 bis 60 L pro Waschgang.<br />
Da die Standzeit der Geräte in den Haushalten im Mittel<br />
etwa 12,5 Jahre beträgt, wird der Modernisierungseffekt<br />
mit entsprechender Verzögerung wirksam (Bild 5).<br />
Ausgehend von einem geschätzten Verbrauchsanteil<br />
von 20 L/(E · d) (vgl. Bild 1, Tabelle 1) und entsprechend<br />
dem Rückgang des <strong>Wasser</strong>verbrauchs pro Waschgang<br />
um 60 % müsste bei gleich bleibendem Verbraucherverhalten<br />
im Zeitraum 1980 bis etwa 2005 ein Spareffekt<br />
von rund 12,5 L/(E · d) wirksam geworden sein. Dies<br />
ergäbe einen Rückgang des Bedarfsanteils auf knapp<br />
8 L/(E · d) (Bild 6) [5, 16, 17]. Der zu erwartende Effekt ist<br />
bis auf geringe Restpotenziale durch den Austausch<br />
sehr alter Maschinen abgeschlossen.<br />
BDEW und DVGW geben den aktuellen Verbrauchsanteil<br />
für das Wäschewaschen mit etwa 15 L/(E · d) an [6, 7].<br />
Demnach ist der Spareffekt infolge der Reduzierung des<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauchs der Waschmaschinen etwa zur Hälfte<br />
durch gegenläufige Effekte aufgezehrt worden, z. B. durch<br />
häufigeres Waschen, den Betrieb gering beladener<br />
Maschinen und zusätzliche Spülgänge, die von Hand betätigt<br />
werden, um Waschmittelreste auszuspülen.<br />
Auch unter Annahme eines etwas höheren Ausgangswertes<br />
für den anteiligen Pro-Kopf-Verbrauch zu<br />
Beginn des Verbrauchsrückgangs beträgt dieser rund<br />
60 %. Ausgehend zum Beispiel von 25 L/(E · d) im Jahr<br />
1970 (vgl. Bild 6, Tabelle 1) hätte der Verbrauchsanteil<br />
auf knapp 10 L/(E · d) zurückgehen müssen. Auch dieser<br />
Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Bedarfswert<br />
von rund 15 L/(E · d).<br />
Damit ist dokumentiert, dass das Verbraucherverhalten<br />
im Bereich des Wäschewaschens zu einer Verbrauchszunahme<br />
geführt hat, die durch gleichzeitig<br />
wirksam werdende, durch technischen Fortschritt<br />
bedingte Verbrauchsrückgänge kompensiert oder<br />
sogar überkompensiert wurden.<br />
Aktuell werden Waschmaschinen mit Verbrauchsdaten<br />
um 40 L pro Waschgang beworben. Der tatsächliche<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauch dieser Maschinen liegt je nach<br />
Waschprogramm bei rund 35 bis 70 L, wobei die Standardprogramme<br />
eher im oberen Bereich liegen. Für ein<br />
vollständiges Waschprogramm liegt die technisch<br />
bedingte Untergrenze für den <strong>Wasser</strong>verbrauch nach<br />
aktuellen Hersteller-Informationen bei etwa 37 L. Demnach<br />
liegt die derzeitige Geräte-Generation nah an der<br />
Tabelle 1. Angaben für den <strong>Wasser</strong>verbrauch für das Wäschewaschen.<br />
Quellen und angegebene Verwendungszwecke<br />
Angaben für den <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
L pro Vorgang L/(E · d)<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 1. Auflage 1956 [11] Wäschewaschen 10–15<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 6. Auflage 1973 [11] Wäschewaschen (4 kg), von Hand 250–300<br />
Wäschewaschen (4 kg), mit Maschine 100–180<br />
Wäschewaschen 20–40<br />
Umweltbundesamt 1982 [12] Wäschewaschen 20–50<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 10. Auflage 1991 [11] Wäschewaschen 4 kg, Waschmaschine 80–140<br />
Wäschewaschen 15–30<br />
LAWA ca. 1990 / 1993 [8] Wäschewaschen 17,5 bzw. 19<br />
ASEW 1994 [13] Waschen 20<br />
DVGW-Merkblatt W 410, 1995 [14]<br />
Haushaltswaschmaschinen (5 kg),<br />
Baujahr 1980<br />
125–175<br />
Baujahr 1985 100–125<br />
Baujahr 1990 70–125<br />
Baujahr 1993 50<br />
Bächle, Fischer et al. 1995/96 [9] Wäschewaschen 17,7<br />
Kondensationswäschetrockner 2,5<br />
BGW 1997 [15] Wäschewaschen 15,5<br />
ASEW 2001 [13] Waschen 15<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 14. Auflage 2007 [11] Wäschewaschen 5 kg, Waschmaschine<br />
je nach Programm und Alter<br />
50–130<br />
Wäschewaschen 16<br />
BDEW für 2006 [6] Wäschewaschen 15<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 410, 2008 [7] Wäschewaschen 15<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 739
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Grenze des Machbaren, wie auch der Verlauf der<br />
Graphen in Bild 5 nahe legt.<br />
Bezogen auf einen tatsächlichen aktuellen Verbrauchsanteil<br />
von 15 L/(E · d) (Bild 6) entspricht ein<br />
Rückgang um jeweils weitere 5 L pro Waschgang (bezogen<br />
auf derzeit rund 60 L rund 8 %) einem rechnerischen<br />
Spareffekt von nur noch 1,2 L/(E · d). Dem weiteren<br />
Bedarfsrückgang im Sektor Wäschewaschen sind<br />
also offensichtlich Grenzen gesetzt.<br />
Der auf der Grundlage bestehender Waschtechniken<br />
noch zu prognostizierende Spareffekt ist demnach<br />
gering bzw. nahezu gleich Null. Theoretisch lässt sich auf<br />
Grundlage des von BDEW und DVGW angegebenen<br />
aktuellen Verbrauchsanteils von 15 L/(E · d) und einem<br />
weiteren Verbrauchsrückgang um etwa 15 L pro Waschgang<br />
auf einen möglichen Rückgang des Pro-Kopf-<br />
Bedarfs um maximal noch etwa 3 bis 4 L/(E · d) schließen.<br />
Nebeneffekte ergeben sich z. B. durch ein zusätzliches<br />
Angebot an kleinen Geräten für Single-Haushalte.<br />
Regenwasser sollte zwar nicht zum Wäschewaschen<br />
eingesetzt werden [18], unabhängig davon bietet die<br />
Industrie Waschmaschinen mit mehreren <strong>Wasser</strong>anschlüssen<br />
an. Im Fall einer konsequenten Umsetzung<br />
alternativer bzw. ökologischer Sanitärkonzepte (Ecosan)<br />
[19] würden Waschmaschinen vermutlich mit Regenoder<br />
Grauwasser betrieben werden, sodass der Trinkwasserbedarf<br />
entsprechend weiter zurückgehen würde.<br />
Ein nennenswerter zusätzlicher Effekt durch das Umsteigen<br />
von Hand- auf Maschinenwäsche besteht wegen<br />
des hohen Ausstattungsgrades (vgl. Bild 4) nicht.<br />
Für die im Rahmen des AnKliG-Projektes aufzustellende<br />
<strong>Wasser</strong>bedarfsprognose bis 2100 wurden auch<br />
Entwicklungsoptionen betrachtet, die über die auf<br />
Grundlage der bestehenden Waschtechniken zu<br />
erwartenden Trends hinausgehen bzw. davon abweichen.<br />
Ob und inwieweit die Forschung andere Waschkonzepte<br />
entwickeln wird, bleibt grundsätzlich abzuwarten.<br />
In der Fachpresse wurde über die Entwicklung<br />
Tabelle 2. Angaben für den <strong>Wasser</strong>verbrauch für das Geschirrspülen.<br />
Quellen und angegebene Verwendungszwecke<br />
Angaben für den <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
L pro Vorgang L/(E · d)<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 1. Auflage 1956 [11] Trinken, Kochen, Reinigen 25–40<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 6. Auflage 1973 [11] Geschirrspülen von Hand 10–25<br />
Geschirrspülmaschinen, Normalprogramm 20–45<br />
Küchenwolf 4–5<br />
Geschirrspülen 4–10<br />
Umweltbundesamt 1982 [12] Geschirrspülen 4–15<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 10. Auflage 1991 [11] Geschirrspülen von Hand 10–25<br />
Geschirrspülmaschinen, Normalprogramm 20 – 45<br />
Küchenwolf 4–5<br />
Geschirrspülen 10–20<br />
LAWA ca. 1990 / 1993 [8] Geschirrspülen 8 bzw. 9<br />
ASEW 1994 [13] Geschirrspülen 9<br />
DVGW-Merkblatt W 410, 1995 [14] Haushaltsgeschirrspüler, Baujahr 1980 45–55<br />
Baujahr 1985 30–40<br />
Baujahr 1990 20–30<br />
Baujahr 1992 20–22<br />
Spülen mit Hand 30–40<br />
Bächle, Fischer et al. 1995/96 [9] Geschirrspülen 17,7<br />
BGW 1997 [15] Geschirrspülen 8<br />
ASEW 2001 [13] Geschirrspülen 8<br />
Mutschmann/Stimmelmayr, 14. Auflage 2007 [11] Geschirrspülen von Hand 25–40<br />
Geschirrspülmaschine, je nach Programm<br />
und Alter<br />
15–50<br />
Geschirrspülen 8<br />
BDEW für 2006 [6] Geschirrspülen 7,6<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 410, 2008 [7] Geschirrspülen 7,2<br />
Juli/August 2011<br />
740 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
von Waschmaschinen berichtet, die ganz oder weitgehend<br />
ohne <strong>Wasser</strong> auskommen [20]. Abweichend<br />
davon wurde im Rahmen der Recherchen für die vorliegende<br />
Untersuchung seitens namhafter Hersteller<br />
die Auskunft erteilt, dass die entsprechenden Forschungen<br />
eingestellt worden seien, weil die Ergebnisse<br />
unbefriedigend waren. Unabhängig davon ist die<br />
langfristige Entwicklung auf diesem Sektor selbstverständlich<br />
nicht vorherzusagen.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
Liter pro Spülgang<br />
Mittlerer <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
von Spülmaschinen<br />
des angegebenen Baujahrs<br />
Mittlerer <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
aller Geräte in den Haushalten<br />
(12,5 Jahre Standzeit)<br />
5. Verbrauchsentwicklung im Bereich<br />
Geschirrspülen<br />
Tabelle 2 enthält Daten für den <strong>Wasser</strong>verbrauch im<br />
Bereich Geschirrspülen, wie sie in der Fachliteratur der<br />
letzten 50 Jahre zu finden sind.<br />
Demnach wurde der <strong>Wasser</strong>verbrauch für das<br />
Geschirrspülen in der Vergangenheit durchaus unterschiedlich<br />
eingeschätzt, wobei die Randwerte der Bandbreite<br />
mit 4 bis über 20 L/(E · d) erkennbar aus dem Rahmen<br />
fallen. Seit 1973 haben sich die Angaben in der<br />
Fachliteratur wenig geändert. Aus der damaligen<br />
Angabe von 4 bis 10 L/(E · d) [11] kann auf einen Mittelwert<br />
geschlossen werden, der durchaus dem aktuellen<br />
Wert von 8 L/(E · d) [6] entspricht. Allerdings war in der<br />
Untersuchung von Bächle et al. [8] in Mannheim 1995/96<br />
ein höherer Wert von 17,7 L/(E · d) festgestellt worden.<br />
Dieser enthält jedoch möglicherweise auch andere Verbrauchsanteile<br />
an der gleichen Verbrauchsstelle, nämlich<br />
dem <strong>Wasser</strong>hahn an der Spüle.<br />
Gemäß Tabelle 2 lag der durchschnittliche <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
für das Geschirrspülen Anfang der 1990er-<br />
Jahre bei etwa 8 bis 10 L/(E · d). Er ist seitdem auf etwa 7<br />
bis 8 L/(E · d) zurückgegangen. Darin enthalten sind<br />
Anteile für das Spülen von Hand und mit der Maschine,<br />
die sich mit Zunahme des Ausstattungsgrades der<br />
Haushalte entsprechend verändert haben (vgl. Bild 4).<br />
Da moderne Spülmaschinen deutlich weniger <strong>Wasser</strong><br />
verbrauchen, als beim Spülen von Hand verbraucht<br />
wird [21], besteht auch ein Sparpotenzial durch das<br />
Umsteigen von Hand- auf Maschinenspülen. Daneben<br />
wird immer ein gewisser Anteil von Geschirr mit der<br />
Hand gespült z. B. empfindliche und große Teile wie<br />
Messer und Gläser bzw. Töpfe und Pfannen. Das Verbraucherverhalten<br />
spielt somit im Sektor Geschirrspülen<br />
eine relativ große Rolle.<br />
Nach der Ölkrise wurde der <strong>Wasser</strong>verbrauch von<br />
Spülmaschinen von durchschnittlich etwa 62 L pro<br />
Spülgang Mitte der 1970er-Jahre bis Anfang der 1990er-<br />
Jahre auf etwa 20 L und bis zum Jahr 2000 auf etwa<br />
17,5 L gesenkt, insgesamt also um über 70 % (Bild 7,<br />
Ansätze nach Herstellerangaben, vgl. [5]). Bezogen auf<br />
einen geschätzten Verbrauchsanteil von anfangs etwa<br />
2 L/(E · d) für das maschinelle Spülen ist hierdurch<br />
zumindest ein Spareffekt von etwa 1 bis 1,5 L/(E · d) wirksam<br />
geworden. Durch Umsteigen von Handspülen auf<br />
Maschinenspülen und den laufenden Austausch alter<br />
20<br />
10<br />
Ölkrise<br />
0<br />
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015<br />
Bild 7. Entwicklung des <strong>Wasser</strong>verbrauchs von Spülmaschinen.<br />
Maschinen auf Geräte der jeweils neuesten Generation<br />
beträgt der Spareffekt im Zeitraum 1980 bis 2010 insgesamt<br />
etwa 3 L/(E · d) (Bild 8). Der Effekt ist bis auf geringe<br />
Restpotenziale abgeschlossen.<br />
Der BDEW gibt den aktuellen Verbrauchsanteil im Sektor<br />
Geschirrspülen mit 7,6 L/(E · d) an. Aufgrund der dokumentierten<br />
Spareffekte durch <strong>Wasser</strong> sparende Spülmaschinen<br />
wäre aber mit einem Rückgang auf etwa 5 L/(E · d)<br />
zu rechnen gewesen (Bild 8). Demnach wurde auch im<br />
Bereich des Geschirrspülens der wirksam werdende Spareffekt<br />
zum Teil durch gegenläufige Effekte wie häufigeres<br />
Spülen und kleinere Haushalte aufgezehrt.<br />
Auch unter Annahme eines etwas höheren Ausgangswertes<br />
für den anteiligen Pro-Kopf-Verbrauch zu<br />
Beginn des Verbrauchsrückgangs, zum Beispiel 10 L/<br />
(E · d) im Jahr 1970 (vgl. Bild 8, Tabelle 2) hätte der Verbrauchsanteil<br />
auf etwa 6 L/(E · d) zurückgehen müssen.<br />
Auch dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen<br />
Bedarfswert von 7,6 L/(E · d).<br />
Aktuell werden Spülmaschinen mit Verbrauchsdaten<br />
um 10 L pro Spülgang beworben. Die Angaben sind<br />
verbunden mit dem Hinweis, dass sich der Wert auf das<br />
„Standardprüfprogramm“ bezieht. Aus den Bedienungsanleitungen<br />
geht dann hervor, dass der <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
in den zur Anwendung empfohlenen Universalprogrammen<br />
deutlich höher, meist bei etwa 13 bis<br />
18 L liegt, z. T. auch höher. Eine technische Grenze wird<br />
von den Herstellern bei etwa 8 L pro Spülgang gesehen<br />
– darunter wäre eine Kreislaufnutzung des <strong>Wasser</strong>s in<br />
der Maschine mit entsprechend aufwändiger Filtertechnik<br />
notwendig. Die aktuelle Maschinen-Generation<br />
liegt bereits nahe an dieser Grenze.<br />
Der durchschnittliche <strong>Wasser</strong>verbrauch von neuen<br />
Spülmaschinen liegt somit nur wenig unter dem zuletzt<br />
angesetzten Wert von 17,5 L pro Spülgang. Der durch<br />
einen weiteren Rückgang zu erwartende zusätzliche<br />
Spareffekt ist sehr gering. Bezogen auf einen Verbrauchsanteil<br />
von etwa 5 L/(E · d) entspricht z. B. ein<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 741
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 8.<br />
Entwicklung<br />
des Pro-Kopf-<br />
Verbrauchs<br />
für das<br />
Geschirrspülen.<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
Anteiliger Pro-Kopf-Verbrauch für Geschirrspülen in Liter pro Einwohner und Tag<br />
Verlauf, wie er allein aufgrund der<br />
technischen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre:<br />
Rückgang um ca. 3,0 bis 3,5 L/E•d<br />
Ist-Wert 2006 lt. BDEW<br />
7,6<br />
Bedarfszunahme infolge<br />
verändertem Verhalten:<br />
- häufigeres Spülen<br />
- kleinere Haushalte<br />
5<br />
Zunahme des Ausstattungsgrades<br />
- von unter 10 % (1973)<br />
- auf über 60 % (2008)<br />
Anteil für Maschinenspülen<br />
(Ansatz um 1990)<br />
4<br />
ca. Anteil für Maschinenspülen<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Ölkrise<br />
Anteil für Handspülen<br />
(Ansatz um 1990)<br />
ca. Anteil für Handspülen<br />
0<br />
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015<br />
Rückgang von 17,5 auf 16 L pro Spülgang (rund 9 %)<br />
einem rechnerischen Spareffekt von 0,45 bzw. etwa<br />
0,5 L/(E · d). Der weiteren Entwicklung sind auch hier<br />
offensichtlich Grenzen gesetzt, und die noch zu erwartenden<br />
zusätzlichen Effekte sind sehr gering.<br />
Bei der Abschätzung des zusätzlichen Sparpotenzials<br />
durch das Umsteigen von Handspülen auf Spülmaschinen<br />
ist zu berücksichtigen, dass der Ausstattungsgrad<br />
einen deutlich niedrigeren Sättigungspunkt haben<br />
wird als z. B. bei Waschmaschinen (vgl. Bild 4). Zudem<br />
werden bestimmte Gegenstände immer von Hand<br />
gespült. Wie bei Waschmaschinen ergeben sich Nebeneffekte<br />
durch kleine Geräte für Single-Haushalte.<br />
Der auf Grundlage bestehender Spültechniken noch<br />
zu prognostizierende Spareffekt ist sehr gering. Theoretisch<br />
lässt sich ausgehend von dem im DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 410 angegebenen Wert von 7 L/(E · d) noch ein<br />
geringfügiger Rückgang des Pro-Kopf-Bedarfs um rund<br />
1 L/(E · d), langfristig eventuell auch 2 L/(E · d) abschätzen.<br />
Tabelle 3. Verbrauchs- bzw. Bedarfsanteile für Wäschewaschen und<br />
Geschirrspülen, Bestand und Prognose 2100.<br />
Verbrauchs- bzw. Bedarfsanteil in L/(E · d)<br />
Bestand Prognose 2100<br />
BDEW DVGW W 410<br />
Moderates<br />
Szenario<br />
2006 mittelfristig oben unten<br />
Wäschewaschen 15 15 15 12 5<br />
Geschirrspülen 8 7 7 5 5<br />
Ecosan-<br />
Szenario<br />
Die auf Grundlage bestehender Spültechniken und<br />
der Abläufe in den Haushalten zu erwartenden Entwicklungen<br />
sind bekannt und weitgehend umgesetzt.<br />
Langfristig davon abweichende Trends, wie sie im<br />
Rahmen der Prognose bis 2100 zu berücksichtigen<br />
wären, sind nicht zu erkennen. Solange in Haushalten<br />
Geschirr genutzt wird, wird auch <strong>Wasser</strong> zum Spülen<br />
gebraucht. Versuche zur Konzeption von Spülmaschinen,<br />
die ohne <strong>Wasser</strong> auskommen, waren bisher wenig<br />
erfolgreich. Unabhängig davon ist langfristig nicht auszuschließen,<br />
dass neue Spülkonzepte entwickelt<br />
werden, die mit sehr wenig oder evtl. sogar ganz ohne<br />
<strong>Wasser</strong> auskommen.<br />
6. In der Prognose für 2100 zugrunde<br />
gelegte Szenarien<br />
Der Prognose für die Bedarfszahlen für die Bereiche<br />
Wäschewaschen und Geschirrspülen im Jahr 2100 [2]<br />
liegen folgende Überlegungen zugrunde:<br />
Ein Bedarfsanstieg über das derzeitige Niveau hinaus<br />
ist sehr unwahrscheinlich.<br />
Die Sparpotenziale infolge <strong>Wasser</strong> sparender Haushaltsgeräte<br />
wurden überwiegend bereits in der Vergangenheit<br />
umgesetzt. Die mittelfristig noch zu<br />
erwartenden Effekte sind sehr gering. Unabhängig<br />
davon sind langfristig noch gewisse Bedarfsrückgänge<br />
denkbar, die in der unteren Variante der Prognose<br />
berücksichtigt werden.<br />
Im Ecosan-Szenario, also bei langfristig konsequenter<br />
Umsetzung „alternativer“ bzw. „ökologischer“<br />
Sanitärkonzepte ist für den Bereich des Wäschewaschens<br />
ein deutlicher Bedarfsrückgang denkbar. Im<br />
Juli/August 2011<br />
742 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Bereich des Geschirrspülens scheidet diese Variante<br />
aus hygienischen Gründen jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
aus.<br />
Vor diesem Hintergrund werden folgende Szenarien<br />
definiert (Tabelle 3):<br />
Als oberer Wert wird für Wäschewaschen der<br />
Bestandswert von 15 L/(E · d) angenommen – das<br />
Sparpotenzial also mit Null angesetzt. Für Geschirrspülen<br />
wird der im DVGW-Arbeitsblatt W 410 angegebene<br />
Wert von 7 L/(E · d) angenommen – das<br />
Sparpotenzial also mit etwa Null bis 1 L(E · d) angesetzt.<br />
Als unterer Wert werden leichte Rückgänge auf<br />
12 L/(E•d) für Wäschewaschen bzw. 5 L/(E · d) für<br />
Geschirr Spülen angenommen.<br />
Im Ecosan-Szenario könnte der Trinkwasserverbrauch<br />
für Wäschewaschen noch deutlich darunter<br />
liegen, als Durchschnittswert abhängig vom Umsetzungsgrad<br />
bis 2100 z. B. bei 5 L/(E · d). Beim Geschirr<br />
Spülen entfällt diese Option.<br />
7. Zusammenfassung<br />
Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland ist seit etwa 20<br />
bis 30 Jahren mehr oder weniger stark zurückgegangen.<br />
Im Sektor „Haushalte und Kleingewerbe“ ist seit 1990<br />
ein Rückgang von etwa 147 L/(E · d) auf derzeit etwa<br />
125 L/(E · d) erfolgt. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung<br />
hatte neben der Reduzierung der Spülmenge<br />
in Toiletten auch die Entwicklung <strong>Wasser</strong> sparender<br />
Haushaltsgeräte als Folge der Ölkrise 1973. Seit Ende<br />
der 1970er-Jahre ist der Pro-Kopf-Verbrauch dadurch<br />
um etwa 15 L/(E · d) zurückgegangen bzw. hätte um diesen<br />
Betrag zurückgehen müssen.<br />
Dabei ist der tatsächlich wirksam gewordene Verbrauchsrückgang<br />
deutlich geringer als aufgrund des<br />
Rückgangs des <strong>Wasser</strong>verbrauchs der Wasch- und Spülmaschinen<br />
zu erwarten gewesen wäre. Parallel zur<br />
Umsetzung der Spareffekte infolge der technischen Entwicklung<br />
hat eine Verbrauchszunahme infolge von<br />
Änderungen des Verbraucherverhaltens stattgefunden.<br />
Diese Änderungen haben die eingetretenen Spareffekte<br />
zum Teil aufgezehrt und damit den eigentlich zu erwartenden<br />
Verbrauchsrückgang gedämpft.<br />
Die Spareffekte durch <strong>Wasser</strong> sparende Haushaltsgeräte<br />
wurden überwiegend im Zeitraum 1980 bis 2010<br />
wirksam und sind als weitgehend abgeschlossen zu<br />
betrachten. Ausgehend vom gegenwärtigen Niveau ist<br />
auch dann nur noch ein geringfügiger Rückgang des<br />
Pro-Kopf-Bedarfs zu erwarten, wenn der Verbrauch der<br />
Maschinen noch weiter reduziert werden sollte.<br />
Für mittelfristige Prognosen, wie sie für die Planungen<br />
der Versorgungsunternehmen und <strong>Wasser</strong>bedarfsnachweise<br />
benötigt werden, sind die noch zu erwartenden<br />
Effekte durch <strong>Wasser</strong> sparende Haushaltsgeräte<br />
somit als sehr gering anzusehen und de facto mit Null<br />
zu beziffern. Gegenläufige Effekte bestehen ggf. durch<br />
Aspekte des Verbraucherverhaltens wie häufigeres<br />
Waschen und Spülen und den anhaltenden Trend zu<br />
kleinen Haushalten.<br />
Langfristige Entwicklungen z. B. durch neue Waschund<br />
Spültechniken oder weitere Änderungen der<br />
Lebensumstände bzw. -gewohnheiten bleiben unabhängig<br />
davon abzuwarten.<br />
Literatur<br />
[1] Kämpf, M., Gerdes, H., Mikat, H., Berthold, G., Hergesell, M. und<br />
Roth, U.: Auswirkungen des Klimawandels auf eine nachhaltige<br />
Grundwasserbewirtschaftung. DVGW energie/wasserpraxis<br />
59 (2008) Nr. 1, S. 49–53.<br />
[2] Mikat, H., Wagner, H. und Roth, U.: <strong>Wasser</strong>bedarfsprognose<br />
für Südhessen 2100 – Langfristige Prognose im Rahmen<br />
eines Klimafolgen-Projektes. <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 151<br />
(2010) Nr. 12, S. 1178–1186.<br />
[3] Roth, U.: Bestimmungsfaktoren für <strong>Wasser</strong>bedarfsprognosen.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 139 (1998) Nr. 2, S. 63–69.<br />
[4] Roth, U., Mikat, H. und Wagner, H.: Der Einfluss moderner Toilettenspülungen<br />
auf den Trinkwasserbedarf der Haushalte.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 152 (2011) Nr. 3, S. 254–260.<br />
[5] Roth, U.: Der Einfluss moderner Haushaltsgeräte auf den<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauch der Haushalte. <strong>Wasser</strong> und Boden 45<br />
(1995) Nr. 10, S. 58-62.<br />
[6] BDEW et al. (Hrsg.): Branchenbild der Deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
2008 und 2011.<br />
[7] DVGW: Technische Regel – Arbeitsblatt W 410 – <strong>Wasser</strong>bedarf<br />
- Kennwerte und Einflussgrößen. Bonn, 2008.<br />
[8] Länderarbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong> – LAWA: Faltblatt „Wer<br />
den Tropfen nicht ehrt“ (ohne Datumsangaben, ca. 1990<br />
und 1993.<br />
[9] Bächle, A. et al.: Prognose zur Trinkwasserbedarfsentwicklung<br />
im Versorgungsgebiet der MVV Mannheim. <strong>gwf</strong>-<br />
<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 139 (1998) Nr. 2, S. 70–78.<br />
[10] Statistisches Bundesamt: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe<br />
– Ausstattung privater Haushalte mit ausgewählten<br />
Verbrauchsgütern (Fachserie 10, Heft 1). Wiesbaden,<br />
2011. www.destatis.de<br />
[11] Mutschmann/Stimmelmayr: Taschenbuch der <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
1. Auflage, Frankh’sche Verlagshandlung, Stuttgart<br />
1956. 6. Auflage, Frankh’sche Verlagshandlung, Stuttgart,<br />
1973. 10. Auflage, Frankh-Kosmos, Stuttgart, 1991. 14. Auflage,<br />
Vieweg, Wiesbaden, 2007.<br />
[12] Umweltbundesamt (Krusche, P. et al.): Ökologisches Bauen.<br />
Bauverlag. Wiesbaden/Berlin, 1982.<br />
[13] Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und <strong>Wasser</strong>verwendung<br />
im VKU – ASEW: Wertvolles <strong>Wasser</strong>: Warum<br />
Umweltfreunde Trinkwasser mit Bedacht nützen und auch<br />
das Grundwasser schützen. Köln 1994, 2001.<br />
[14] DVGW: Technische Regel – Merkblatt W 410 – <strong>Wasser</strong>bedarfszahlen.<br />
Bonn, 1995.<br />
[15] Bundesverband der deutschen Gas- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
e.V. (BGW): 109. <strong>Wasser</strong>statistik 1997.<br />
[16] Stamminger, R.: Der <strong>Wasser</strong>verbrauch von Hausgeräten –<br />
Seine technische Entwicklung und gesamtwirtschaftliche<br />
Bedeutung. Gesundheits-Ingenieur-Haustechnik-Bauphysik-Umwelttechnik<br />
113 (1992) Nr. 1, S. 31–38.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 743
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
[17] Öko-Institut e.V. (Rüdenauer et al.): Eco-Efficiency Analysis of<br />
Washing machines – Life Cycle Assessment and determination<br />
of optimal life span; revised extended version. Freiburg<br />
i.B., 2005.<br />
[18] Umweltbundesamt (Hrsg.): Versickerung und Nutzung von<br />
Regenwasser. Dessau, 2005.<br />
[19] http://de.wikipedi.org/wiki/Ecosan (Zugriff am 12.1.2011).<br />
[20] EUWID: Forscher erfinden (fast) wasserlose Waschmaschine.<br />
EUWID Wa Nr. 25 v. 17.6.2008 (S. 15).<br />
[21] Stamminger, R.: Daten und Fakten zum Geschirrspülen per<br />
Hand und in der Maschine. SÖFW-Journal - Internationales<br />
Journal für angewandte Wissenschaft 132 (2006) Nr. 3.<br />
Eingereicht: 31.03.2011<br />
Korrektur: 30.06.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Autoren<br />
Dr.-Ing. Ulrich Roth<br />
Beratender Ingenieur |<br />
Auf der Hardt 33 |<br />
D-56130 Bad Ems |<br />
E-Mail: Dr.Roth-BadEms@t-online.de<br />
Dr. rer. nat. Hermann Mikat<br />
E-Mail: Hermann.Mikat@hessenwasser.de<br />
Dipl.-Geol. Holger Wagner<br />
Hessenwasser GmbH & Co. KG |<br />
Taunusstraße 100 |<br />
D-64521 Groß-Gerau |<br />
E-Mail: Holger.Wagner@hessenwasser.de<br />
Parallelheft <strong>gwf</strong>-Gas | Erdgas<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Sie lesen u. a. fol gende Bei träge:<br />
Pöppl<br />
Sosna/Schulze<br />
Günther/Hofmann/Mikow<br />
Baden<br />
Behmer/Meyer<br />
Flexibler Prozess-Gaschromatograph für die neuen Anforderungen<br />
an Gasanalysegeräte<br />
AERIUS G4-Gaszähler: Gasverbrauchsmessung mit mikrothermischen<br />
Strömungssensoren<br />
BCM-Biogastest-1000 zur Bestimmung der maximalen Biogasbzw.<br />
Biomethanausbeute<br />
Die Evolution zu Smart Energy<br />
Verdichterstation Ochtrup mit Elektroantrieb und regelbarem Planetengetriebe<br />
Bockhorn/Frimmel/Klinger/ Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und<br />
Kolb/Reimert Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>, Karlsruhe (TZW) im Jahre 2010<br />
Juli/August 2011<br />
744 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Know-how für<br />
Trinkwasser-Experten<br />
Mikrobiologie des Trinkwassers<br />
Grundlegendes Fachwissen zum Betrieb einer seuchenhygienisch<br />
einwandfreien Trinkwasserversorgung<br />
Grundlagenwerk mit den gesammelten Erkenntnissen zur hygienisch einwandfreien<br />
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser.<br />
Um eine seuchenhygienisch zuverlässige Trinkwasserversorgung betreiben<br />
zu können, erfordert dies Kenntnisse über Risiken durch Krankheitserreger, deren<br />
Vorkommen und Ausbreitung mit dem <strong>Wasser</strong>. Es werden allgemein verständlich<br />
Kenntnisse zum Betrieb einer zuverlässigen <strong>Wasser</strong>versorgung vermittelt, die sich<br />
aus Beobachtungen von Epidemien und ähnlichen<br />
Zwischenfällen ableiten.<br />
D. Schoenen<br />
1. Auflage 2011, ca. 250 Seiten, Hardcover<br />
Trinkwasserdesinfektion<br />
Vorstellung aller relevanten Verfahren, Anlagen und Geräte, die<br />
zur Trinkwasserdesinfektion und -kontrolle eingesetzt werden.<br />
Neben der Desinfektion mit chemischen Mitteln wie Chlor, Chlordioxid<br />
und Ozon werden auch die praxisrelevanten physikalischen Verfahren wie<br />
UV-Bestrahlung und Membranfiltration behandelt. Übersichtliche Ergebnisdarstellungen<br />
mit Tabellen zur Beurteilung nach Trinkwasserverordnung<br />
und abschließendem Kostenvergleich.<br />
W. Roeske<br />
3. Auflage 2011, ca. 200 Seiten, Hardcover<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle auf Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Ex.<br />
Mikrobiologie des Trinkwassers<br />
Fachbuch (ISBN: 978-3-8356-3247-9)<br />
1. Auflage 2011 für € 149,90 (zzgl. Versand)<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Ex.<br />
Trinkwasserdesinfektion<br />
Fachbuch (ISBN: 978-3-8356-3251-6)<br />
1. Auflage 2010 für € 49,90 (zzgl. Versand)<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAMBTW2011<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
Engler-Bunte-Institut des Karlsruher<br />
Instituts für Technologie (KIT)<br />
und Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>,<br />
Karlsruhe (TZW) im Jahre 2010<br />
Engler-Bunte-Institut , DVGW-Forschungsstelle, Forschungsstelle für Brandschutztechnik,<br />
Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>, Tätigkeitsbericht, Forschung und Lehre, Ausbildung, Weiterbildung<br />
Henning Bockhorn, Fritz H. Frimmel, Josef Klinger, Thomas Kolb und Rainer Reimert<br />
Dieser Bericht soll einen Überblick über aktuelle Entwicklungen<br />
und Aktivitäten im Jahr 2010 am Engler-<br />
Bunte-Institut, der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut<br />
sowie der Forschungsstelle für<br />
Brandschutztechnik ermöglichen. Ebenso wird über<br />
das aus dem Engler-Bunte-Institut hervorgegangene<br />
Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW) berichtet. Wie in<br />
den vergangenen Jahren erscheinen die gasspezifischen<br />
Beiträge im <strong>gwf</strong>-Gas/Erdgas und die wasserspezifischen<br />
Beiträge des TZW und des EBI im <strong>gwf</strong>-<br />
<strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong>. Im Mittelpunkt des Berichtes steht<br />
die Entwicklung der oben angegebenen Einrichtungen<br />
mit Beiträgen über die universitäre Lehre, die<br />
Ausbildung und Weiterbildung, über Forschungsund<br />
Entwicklungsprojekte, über Beratung und Firmenkontakte<br />
sowie über sonstige Aktivitäten. Der<br />
Bericht streift ebenso die Entwicklung des Karlsruher<br />
Instituts für Technologie (KIT), das durch die Zusammenführung<br />
der Universität Karlsruhe (TH) und des<br />
Forschungszentrums Karlsruhe als neue Struktur mit<br />
den Aufgaben einer Landesuniversität und einer<br />
Großforschungseinrichtung des Bundes in der Helmholtz-Gemeinschaft<br />
entstanden ist.<br />
Karlsruhe Institute of Technology<br />
This report aims at giving an overview about actual<br />
developments and activities of the Engler-Bunte-<br />
Institute, its Research Centers as well as the Water<br />
Technology Center (TZW) which developed from the<br />
Engler-Bunte-Institute. As usual, the gas related parts<br />
can be found in <strong>gwf</strong>-Gas/Erdgas and the water related<br />
parts in <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong>. The report highlights<br />
academic teaching, courses and advanced education,<br />
and focuses on scientific research and development<br />
projects, on consulting and contacts to business companies<br />
as well as on other activities of the Engler-<br />
Bunte-Institute, the DVGW-Research Center, the<br />
Research Center of Fire Protection Technology and<br />
the Water Technology Center (TZW). The report is<br />
also focused on the development of the Karlsuhe<br />
Institute of Technology (KIT), which evolved from the<br />
fusion of the University of Karlsruhe (TH) and the<br />
Research Centre of Karlsruhe.<br />
Zur Geschichte und zum Umfeld<br />
Das Engler-Bunte-Institut am Karlsruher Institut für<br />
Technologie ist hervorgegangen aus der ehemaligen<br />
„Lehr- und Versuchsgasanstalt“ (1907–1919), die wiederum<br />
in das „Gasinstitut“ (1919–1959) bzw. das „Institut<br />
für Gastechnik, Feuerungstechnik und <strong>Wasser</strong>chemie“<br />
(1959–1971) überführt wurde. Wesentlich für diese nun<br />
mehr als hundertjährige Entwicklung ist die enge Verbindung<br />
zur Praxis, die dadurch zum Ausdruck kommt,<br />
dass die „Lehr- und Versuchsgasanstalt“ und später das<br />
„Gasinstitut“ zwar wirtschaftlicher Besitz des Deutschen<br />
Vereins von Gas- und <strong>Wasser</strong>fachmännern (DVGW,<br />
heute: Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.)<br />
waren, ihre Leiter aber in Personalunion Lehrstuhlinhaber<br />
an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Im Jahr<br />
1959 wurde das Gasinstitut ein staatliches Hochschulinstitut<br />
mit der entsprechenden personellen und baulichen<br />
Ausstattung, wobei die in der Zwischenzeit eingetretenen<br />
Veränderungen durch die Gründung einer<br />
Abteilung für <strong>Wasser</strong>chemie und die Namensgebung<br />
des Instituts: Gastechnik, Feuerungstechnik und <strong>Wasser</strong>chemie,<br />
berücksichtigt wurden.<br />
Seit 1971 schließlich führt das Institut den Namen<br />
„Engler-Bunte-Institut“. Die enge Verbindung zum<br />
DVGW und damit zur Praxis des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches<br />
äußert sich darin, dass die jeweiligen Lehrstuhlinhaber,<br />
Juli/August 2011<br />
746 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
gegenwärtig „Chemische Energieträger – Brennstofftechnologie“,<br />
„Verbrennungstechnik“ und „<strong>Wasser</strong>chemie“<br />
auch in Personalunion Leiter der fachlich entsprechenden<br />
Bereiche einer Forschungsstelle des DVGW im<br />
Engler-Bunte-Institut sind.<br />
Im Jahr 2009 wurde die Verschmelzung der Universität<br />
Karlsruhe (TH) mit dem Forschungszentrum Karlsruhe<br />
zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit<br />
den Aufgaben einer Landesuniversität und einer Großforschungseinrichtung<br />
in der Helmholtzgemeinschaft<br />
vollständig Wirklichkeit. Seit dem 1. Oktober 2009 existiert<br />
das Karlsruher Institut für Technologie als „legal<br />
entity“, und die Pläne, mit denen die Universität Karlsruhe<br />
(TH) im Wettbewerb um die Förderung von Exzellenz-Universitäten<br />
erfolgreich war, sind zum größten<br />
Teil umgesetzt. Mittlerweile sind die Strukturen eingerichtet,<br />
in denen in Zukunft Lehre, Weiterbildung und<br />
Forschung auf höchstem Niveau durchgeführt werden<br />
sollen. Die Schwerpunktsetzung des KIT als ein internationales<br />
Zentrum der Forschung auf dem Gebiet der<br />
Energie und des <strong>Wasser</strong>s ist sichtbar geworden und hat<br />
in den KIT-Zentren „Energie“ sowie „Klima und Umwelt“<br />
eine entsprechende Struktur. Das Engler-Bunte-Institut<br />
ist wichtiger Teil des KIT-Zentrums Energie für die Bereiche<br />
Energieumwandlung und Erneuerbare Energien<br />
sowie des KIT-Zentrums Klima und Umwelt im Bereich<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
Der vorliegende Tätigkeitsbericht enthält Beiträge<br />
der einzelnen Bereiche des Engler-Bunte-Instituts und<br />
des Technologiezentrums <strong>Wasser</strong> (TZW).<br />
Die zahlreichen Projekte aus dem Gas- und Verbrennungsfach<br />
sowie dem <strong>Wasser</strong>fach zeugen von der<br />
internationalen Bedeutung der Lehrstühle und der Praxisnähe<br />
der ihnen zugeordneten Laboratorien und Technologieeinheiten.<br />
Einen Schwerpunkt bildet der Sonderforschungsbereich<br />
606 „Instationäre Verbrennung: Transportphänomene,<br />
chemische Reaktionen, Technische<br />
Systeme“ (Sprecher: H. Bockhorn), der in seiner letzten<br />
Förderperiode bis zum Ende des Jahres 2012 mit 19 Teilprojekten<br />
(Förderumfang insgesamt rund 8 Mio Euro)<br />
nunmehr die in den vergangenen Jahren ent wickelten<br />
Grundlagen auf praxisnahe Systeme überträgt. Das vom<br />
KIT in 2010 erfolgreich eingeworbene EU-Großprojekt<br />
KIC InnoEnergy (Knowledge & Innovation Community)<br />
wird mit starker Beteiligung des EBI aufgebaut werden.<br />
Darüber hinaus arbeiten die drei Bereiche des Engler-<br />
Bunte-Instituts in zahlreichen Verbund-Großprojekten<br />
an maßgeblicher Stelle mit. Hierzu finden sich detaillierte<br />
Angaben auf den nächsten Seiten.<br />
Mittlerweile hat der zweite Kurs des 2006 erstmals<br />
eingeführten englischsprachigen Master-Studiengangs<br />
„Utilities and Waste – Sustainable Processing“ seine Ausbildung<br />
abgeschlossen. Der dritte Kurs dieser erfolgreichen<br />
Initiative geht in sein zweites Jahr. Der Studiengang<br />
wird im Wesentlichen von den drei Lehrstühlen des Engler-Bunte-Instituts<br />
getragen. Aufbauend auf vertiefende<br />
Spezialvorlesungen über Brennstoffe, Verbrennungsvorgänge,<br />
die thermische Abfallbehandlung und über<br />
moderne <strong>Wasser</strong>technologien wird von den Studierenden<br />
ein „Design Project“ bearbeitet, in dem eine praxisnahe<br />
Aufgabenstellung bis ins Detail ausgearbeitet wird.<br />
Neben der Studierenden- und Doktorandenausbildung<br />
stand wie immer auch die Weiterbildung der<br />
bereits im Beruf stehenden Fachleute auf dem Programm.<br />
Der Gaskurs wurde als traditionsreicher und<br />
geschätzter Dauerbrenner auch 2010 wieder durchgeführt,<br />
ebenso wie der jährliche Erfahrungsaustausch der<br />
Chemiker und Ingenieure des Gasfachs, sowie der GDCH-<br />
Fortbildungskurs „Praxisgerechte <strong>Wasser</strong>beurteilung“.<br />
Die in der Praxis konkret anstehenden Fragestellungen<br />
werden vor allem in der DVGW-Forschungsstelle,<br />
der Abteilung Gastechnologie, dem Prüflaboratorium<br />
Gas und der Forschungsstelle für Brandschutztechnik<br />
bearbeitet. Das Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> mit seiner<br />
praxisgerechten Kompetenz in Analytik, Aufbereitung,<br />
Ressourcenschutz, Korrosion, Verteilungsnetze und Um -<br />
weltbiotechnologie bedient <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen,<br />
Behörden und Verbände.<br />
Viele der Projekte wurden und werden durch Institutionen<br />
wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
(DFG), dem Deutschen Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>fachs<br />
(DVGW), dem Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
(BMBF), der Europäischen Kommission und<br />
anderen Drittmittelgebern des Bundes und des Landes<br />
gefördert. Ein erheblicher Anteil wird aber auch durch<br />
Forschungsaufträge aus der Industrie und von Unternehmen<br />
finanziert. Schließlich trugen Stiftungen und<br />
gemeinnützige Fördervereinigungen zur Umsetzung so<br />
mancher Forschungsidee bei.<br />
Aus all dem erwuchs eine beachtliche Zahl von Publikationen,<br />
die zum großen Teil in den führenden internationalen<br />
Fachjournalen nach strenger Begutachtung<br />
erschienen sind. Die Listen der Veröffentlichungen sind<br />
den Berichten der einzelnen Bereiche zu entnehmen.<br />
Auch das Jahr 2010 hat gezeigt, dass das Engler-<br />
Bunte-Institut mit seinen Lehrstühlen, Prüfstellen und<br />
der DVGW-Forschungsstelle sowie das Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong> des DVGW gut aufgestellt sind. Neu eingeworbene<br />
Forschungsprojekte weiten die Kooperationen<br />
innerhalb Deutschlands und international aus. Die Neubesetzung<br />
des Lehrstuhls für „Chemie und Technik von<br />
Gas, Erdöl und Kohle“ wurde im Jahr 2010 abgeschlossen.<br />
Dieser Lehrstuhl wird fortan die Bezeichnung „Chemische<br />
Energieträger – Brennstofftechnologie“ tragen.<br />
Die Vorbereitungen zur Neubesetzung des Lehrstuhls<br />
<strong>Wasser</strong>chemie − zukünftig Lehrstuhl für <strong>Wasser</strong>chemie<br />
und <strong>Wasser</strong>technologie sind abgeschlossen, sodass die<br />
Kontinuität in der Forschung und Lehre gewährleistet<br />
werden kann.<br />
Weitere Informationen sind auf den nächsten Seiten<br />
und im Internet auf den Seiten des Instituts und der<br />
einzelnen Bereiche zu finden.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 747
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
1. Aktivitäten des Lehrstuhls für <strong>Wasser</strong>chemie und der DVGW-Forschungsstelle,<br />
Bereich <strong>Wasser</strong>chemie<br />
Prof. Dr. rer. nat. Fritz H. Frimmel, Akad. Direktorin Dr. rer. nat. Gudrun Abbt-Braun<br />
1.1 Lehre und Forschung am KIT<br />
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Zusammenschluss<br />
der Universität (TH) und des Forschungszentrums<br />
Karlsruhe (FZK) hat nach seiner Gründung<br />
2009 inzwischen zur alltäglichen Funktionsfähigkeit<br />
gefunden. Das bedeutet u. a. eine neue Dimension der<br />
Forschung durch abgestimmte Planung und Beantragung<br />
im thematischen Rahmen von Kompetenzzentren<br />
und Kompetenzbereichen. In der Lehre bringt<br />
die gewonnene Attraktivität des KIT steigende Studierendenzahlen<br />
aus Gesamteuropa. Das Chemieingenieurwesen<br />
und dort die <strong>Wasser</strong>chemie und <strong>Wasser</strong>technologie<br />
zeigen einen besonders großen Zuspruch.<br />
Klima und Umwelt, <strong>Wasser</strong>ressourcen-Management<br />
und energieeffiziente <strong>Wasser</strong>versorgung stehen im Vordergrund<br />
der z. T. englisch angebotenen Lehre und der<br />
einschlägigen Forschungsthemen.<br />
Lehre<br />
Im Zuge des Bologna-Prozesses wurden in unserer<br />
Fakultät die Bachelor-Studienfächer für Chemieingenieurwesen<br />
und Bioingenieurwesen eingeführt. Im<br />
zulassungsbeschränkten Studiengang Bioingenieurwesen<br />
konnte als Reaktion auf das steigende Studenteninteresse<br />
die Zahl der Anfänger auf 80 erhöht<br />
werden. Dies war möglich durch ein vom Land Baden-<br />
Württemberg neu aufgelegtes Programm zur Erhöhung<br />
von Studienplätzen. Somit konnten am Lehrstuhl für<br />
<strong>Wasser</strong>chemie weitere Praktikumsplätze für die Grundausbildung<br />
in Allgemeiner Chemie und Chemie in wässrigen<br />
Lösungen eingerichtet werden.<br />
Der Lehrstuhl für <strong>Wasser</strong>chemie bietet Lehrveranstaltungen<br />
(Profilfächer) mit Schwerpunkten in <strong>Wasser</strong>chemie<br />
und <strong>Wasser</strong>technologie, weitere Spezialvorlesungen,<br />
Übungen und Praktika sowie Exkursionen zu<br />
Ver- und Entsorgungsunternehmen an. In der Grundlehre<br />
des Bachelorstudiengangs ist die Einführung<br />
„Allgemeine Chemie und Chemie in wässrigen Lösungen“<br />
mit Übungen und den jeweiligen Praktika fester<br />
Bestandteil. Der Lehrstuhl ist ebenfalls mit vertiefenden<br />
Profilfächern zur <strong>Wasser</strong>technologie im internationalen<br />
Aufbaustudiengang mit Masterabschluss „Utilities and<br />
Waste“ und in anderen Masterstudiengängen der Studienrichtungen<br />
Geoökologie, Angewandte Hydrologie<br />
und Wirtschaftswissenschaften mit vertiefender Ingenieurausbildung<br />
eingebunden.<br />
Preise<br />
Dr.-Ing. Florencia Saravia erhielt den Willy-Hager-Preis<br />
der DECHEMA, der jährlich an exzellente Jungwissenschaftler<br />
für praxisrelevante Arbeiten im <strong>Wasser</strong>fach<br />
verliehen wird.<br />
Mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und<br />
damit ihrer höchsten Auszeichnung würdigte die International<br />
Humic Substances Society (IHSS) Prof. Fritz H.<br />
Frimmels „bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiet der<br />
aquatischen Huminstoffe, ihrer Reaktionen und Umsetzungen<br />
in der Umwelt und bei der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
sowie für sein außerordentliches Engagement für die<br />
Belange der IHSS“.<br />
Internationale Kooperationen in Forschung<br />
und Lehre<br />
Auch im vergangenen Jahr haben zahlreiche Gäste aus<br />
dem Ausland dazu beigetragen, den Alltag in den<br />
Laboratorien interessant und farbig zu gestalten und<br />
wertvolle Ergebnisse zu erzielen. Durch die Förderung<br />
von ERASMUS, SOCRATES und speziellen DAAD-Programmen<br />
war es Studierenden aus Argentinien, Brasilien,<br />
der Türkei und anderen Ländern möglich, das<br />
Studienfach <strong>Wasser</strong>technologie zu vertiefen und experimentelle<br />
Arbeiten anzufertigen.<br />
Die Zusammenarbeit im Austauschprogramm für<br />
Doktoranden, Postdoktoranden und Professoren zur<br />
gemeinsamen Durchführung von Arbeiten zum Thema<br />
„Verständnis und Beherrschung komplexer Systeme<br />
(ZO IV Programm)“ zwischen der Moskauer Staatlichen<br />
Lomonosov-Universität und dem KIT wurde weiter<br />
intensiviert. Zwei russische Jungwissenschaftler konnten<br />
im Jahr 2010 im Bereich <strong>Wasser</strong>chemie und im<br />
Bereich Verfahrenstechnische Maschinen (Prof. Nirschl)<br />
ihre Forschungsarbeiten durchführen.<br />
Die seit mehreren Jahren bestehende Zusammenarbeit<br />
mit Wissenschaftlern der Polytechnischen Universität<br />
Tomsk wurde fortgesetzt. Im September 2010 fand<br />
ein von Prof. Fritz H. Frimmel und Dr. Birgit Gordalla organisierter<br />
gemeinsamer Workshop in Form einer Videokonferenz<br />
statt, in dessen Fokus die Synthese und<br />
Charakterisierung metallischer und oxidischer Nanopartikel,<br />
die Stabilität und Entfernbarkeit nanoskaliger <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe<br />
sowie die Anwendbarkeit von Elektropulsmethoden<br />
zur <strong>Wasser</strong>reinigung standen. Dr.-Ing.<br />
Markus Delay trug über den Einfluss natürlicher organischer<br />
<strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe auf die Stabilität von<br />
Silbernanopartikeln in wässrigen Systemen vor. Des<br />
Weiteren wurden von der Doktorandin Ksenia Machekhina<br />
aus Tomsk Arbeiten zur Ultra- und Nanofiltration<br />
von eisenkolloidhaltigen Lösungen vorgestellt, die<br />
diese unter der Betreuung von Dipl.-Ing. Angela Klüpfel<br />
im Rahmen eines Forschungsaufenthalts im Bereich<br />
<strong>Wasser</strong>chemie des EBI durchgeführt hatte. Weitere Beiträge<br />
zum Workshop seitens des KIT kamen aus dem<br />
Institut für Technische Thermodynamik und Kältetechnik<br />
und aus dem Bereich Verfahrenstechnische<br />
Juli/August 2011<br />
748 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
Ma schinen. Besuch aus Tomsk bekam das EBI im November<br />
2010. Eine 17-köpfige Delegation von Professoren<br />
und Vertretern des akademischen Mittelbaus der Polytechnischen<br />
Universität Tomsk besuchte unser Institut<br />
zum Informationsaustausch über die Organisation von<br />
Studium, Promotion und Forschungsförderung auf dem<br />
Gebiet des Ingenieurwesens.<br />
Im September fand in Schloss Maurach der Late<br />
Summer Workshop zum Thema „Nanoparticles and<br />
Nanomaterials in Aquatic Systems“ statt. Der internationale<br />
Workshop, der von der <strong>Wasser</strong>chemischen Gesellschaft,<br />
Fachgruppe der Gesellschaft Deutscher Chemiker<br />
(GDCh), ausgerichtet wurde, diente der Knüpfung neuer<br />
Kontakte und dem Wissensaustausch zu aktuellen<br />
Arbeiten auf dem Gebiet der Nanopartikel. Das Institut<br />
war mit zwei Vorträgen und zwei Postern durch Dr.-Ing.<br />
Markus Delay und Dipl.-Ing. Heiko Schwegmann ver treten.<br />
Im Rahmen weiterer Kooperationen konnten wir zahlreiche<br />
Gäste aus dem Ausland bei uns begrüßen, u. a.:<br />
Prof. Bernabe Rivas Quiroz (Universität Concepción,<br />
Chile) im Januar 2010;<br />
Alexander Kondrakov (Lomonossow Universität,<br />
Moskau, Russland) von Februar bis Mai 2010;<br />
Jaqueline Nicolini (Universidade Federal do Paranà,<br />
Curitiba, Brasilien) von April bis Dezember 2010;<br />
Prof. Iara Messerschmidt und Dr. Betània Pereira<br />
(Universidade Federal do Paranà, Curitiba, Brasilien)<br />
im September 2010.<br />
Seit September 2010 ist Meijie Ren aus China im Rahmen<br />
eines Stipendiums des Ministeriums für Erziehung der<br />
Volksrepublik China Promotionsstudentin am Lehrstuhl<br />
für <strong>Wasser</strong>chemie.<br />
Vom 4. bis zum 6. Oktober fand der GDCh-Fortbildungskurs<br />
349/10 „Praxisgerechte <strong>Wasser</strong>beurteilung“ mit<br />
internationaler Beteiligung statt. Dieser Kurs wird zusammen<br />
mit den Professoren M. Jekel (TU Berlin) und E. Worch<br />
(TU Dresden) jährlich veranstaltet. Dieses Jahr wurde er<br />
turnusgemäß von unserem Lehrstuhl orga nisiert.<br />
Promotionen<br />
Luis Tercero hat seine Promotion mit dem Thema<br />
„Heterogene Photokatalyse in wässrigen Titandioxid-<br />
Suspensionen in Anwesenheit von Bromid und gelöstem<br />
organischem Kohlenstoff“ im Mai 2010 und Ulrich<br />
Metzger seine Promotion mit dem Thema „Extrazelluläre<br />
polymere Substanzen aus Biofilmen – Aufklärung von<br />
Strukturen und ihr Einfluss auf die Foulingbildung in<br />
Membranbioreaktoren“ im Dezember 2010 erfolgreich<br />
abgeschlossen.<br />
Beide Arbeiten erhielten das Prädikat „mit Auszeichnung“.<br />
Im Folgenden sind die Arbeiten kurz dargestellt.<br />
Die vollständigen Arbeiten können im Rahmen der<br />
Institutsschriftenreihe „Schriftenreihe Bereich <strong>Wasser</strong>chemie,<br />
Engler-Bunte-Institut am Karlsruher Institut für<br />
Technologie “, Band 51 bzw. Band 52 bezogen werden.<br />
Heterogene Photokatalyse in wässrigen<br />
Titan dioxid-Suspensionen in Anwesenheit von<br />
Bromid und gelöstem organischem Kohlenstoff<br />
(L. Tercero)<br />
Die heterogene Photokatalyse – einer der sog.<br />
Ad vanced Oxidation Processes (AOPs) – hat sich als<br />
leistungsfähiges Oxidationsverfahren bei zahlreichen<br />
Untersuchungen erwiesen. Titandioxid (TiO 2 ) ist<br />
dabei der meistuntersuchte Photokatalysator zur<br />
Verwendung in wässrigen Phasen. Thermodynamisch<br />
betrachtet sind nahezu alle organischen Verbindungen<br />
mit TiO 2 in Kombination mit Sauerstoff und UV-<br />
Strahlung oxidierbar. Da AOPs auf der oxidativen<br />
Wirkung von OH-Radikalen basieren, ist der Abbau<br />
von organischen Verbindungen in großem Maße<br />
unselektiv. Die Bildung von unerwünschten Nebenprodukten,<br />
ähnlich wie bei anderen oxidativen<br />
Verfahren, ist daher ein potenzielles Problem, das<br />
bisher wenig Beachtung fand.<br />
Photokatalytischer Abbau natürlicher<br />
organischer Materie<br />
Es wurde die photokatalytische Behandlung eines<br />
huminstoffreichen <strong>Wasser</strong>s (Hohlohsee, Nordschwarzwald)<br />
unter simulierter UV-Sonnenstrahlung untersucht.<br />
Dabei standen sowohl die Größenverteilung der<br />
natürlichen organischen Materie (NOM) als auch die Bildung<br />
von kleinen organischen Säuren im Fokus der<br />
Unter suchung. Es wurde mittels Größenausschlusschromatographie<br />
mit Detektion des gelösten organischen<br />
Kohlenstoffs (SEC-DOC) gezeigt, dass die NOM-Fraktionen<br />
mit höheren Molmassen bevorzugt abgebaut<br />
werden. Bei längeren Bestrahlungszeiten wurden auch<br />
die kleineren Fraktionen photokatalytisch abgebaut.<br />
Dies wurde auf die größenselektive Adsorption von<br />
NOM an die TiO 2 -Oberfläche zurückgeführt und anhand<br />
einer zu Überprüfungszwecken entwickelten computergestützten<br />
Simulation verifiziert. Des Weiteren wurde<br />
der photokatalytische Abbau von NOM in Anwesenheit<br />
von Cu 2+ , Mn 2+ , Fe 3+ und Zn 2+ im Konzentrationsbereich<br />
von 0 bis 10 μmol L –1 untersucht. Es stellte sich heraus,<br />
dass die Zugabe von Cu 2+ zu einer Verlangsamung des<br />
NOM-Abbaus führt. Die Stärke des Effekts hing jedoch<br />
auch mit der Konzentration von Mn 2+ zusammen<br />
(Wechselwirkungseffekt). Der Effekt von Mn 2+ alleine<br />
und der anderen Metalle war untergeordnet. Die<br />
Bildung kleiner organischer Säuren (Ameisen-, Oxal-,<br />
Bernstein- und Glutarsäure) wurde ebenfalls durch<br />
Zugabe von Cu 2+ gemindert.<br />
Bildung bromierter Nebenprodukte in<br />
bromidhaltigen Titandioxid-Suspensionen<br />
Versuche in Abwesenheit und Anwesenheit von NOM<br />
(ρ0 (DOC) = 1 bis 10 mg L –1 ) zeigten keine Bildung von<br />
Bromat. Im Gegenteil wurde dieses rasch und vollständig<br />
(soweit messbar) zu Bromid reduziert, wenn Bromat<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 749
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
am Anfang der Bestrahlung zugegeben wurde (bis zu<br />
10 mg L –1 ).<br />
In Anwesenheit von Bromid und NOM kommt es<br />
zunächst zur Bildung von bromorganischen Verbindungen<br />
(Bild 1), die sich summarisch als an Aktivkohle<br />
adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)<br />
quantifizieren lassen. Schließlich kommt es zur Bildung<br />
von Bromoform. Die Bromoformbildung wurde in<br />
Abhängigkeit von der Art und Konzentration des Photokatalysators<br />
(Degussa P25 und Hombikat UV100, jeweils<br />
ρ (TiO 2 ) = 0,5 bis 1,5 g L −1 ), der Anfangskonzentration<br />
von Bromid (ρ0 (Br − ) = 1 bis 3 mg L −1 ) und der Art (NOM<br />
oder Modellsubstanz) und Anfangskonzentration des<br />
gelösten organischen Kohlenstoffs (ρ0 (DOC) = 1,1 bis<br />
5,5 mg L −1 ) untersucht. Dabei führten erhöhte Bromidanfangskonzentrationen<br />
sowie höhere TiO 2 -Konzentrationen<br />
zu einer höheren Bromoformbildung. Eine Erhöhung<br />
von ρ0 (DOC) hingegen führte zu minderer Bromoformbildung.<br />
Ein wichtiger Synergismus wurde<br />
beobachtet, wenn die Konzentrationen von Br – und TiO 2<br />
gleichzeitig erhöht wurden. Die gemessenen Bromoformkonzentrationen<br />
lagen bei den gewässertypischen<br />
Edukt konzen trationen jedoch stets weit unter dem<br />
Grenzwert für Trinkwasser.<br />
Die Zeitspanne zwischen dem Anfang der Bestrahlung<br />
und dem Auftreten messbarer Bromoformkonzentrationen<br />
vergrößerte sich mit steigender ρ0 (DOC) und<br />
Bild 1. Bromoform-Bildung nach der Bestrahlung von Braunwasser<br />
(NOM) und einer wässrigen Lösung von 2,4-Dihydroxybenzoesäure<br />
(DHBA) (jeweils ρ0 (DOC) = 1,1 mg L –1 ) in Gegenwart von<br />
ρ (Br – ) = 3 mg L −1 und Titandioxid P25 (ρ (TiO 2 ) = 1,5 g L −1 ).<br />
wurde durch höhere ρ (TiO 2 ) verkürzt. Der beschleunigende<br />
Effekt einer Erhöhung der ρ (TiO 2 ) wurde durch<br />
höhere ρ0 (Br − ) noch verstärkt (Synergismus). Eine Erhöhung<br />
von ρ0(Br − ) alleine zeigte jedoch keinen großen<br />
Effekt.<br />
Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die Bildung<br />
von Bromoform entscheidend von der Art des<br />
Photokatalysators abhängt: mit P25 (≈ 75 % Anatas,<br />
≈ 25 % Rutil) wurden Bromoformkonzentrationen von<br />
bis zu 20 μg L −1 gebildet, wohingegen mit Hombikat<br />
UV100 (100 % Anatas) keine signifikante Bildung von<br />
Bromoform (< 3 μg L −1 ) gemessen wurde. Die Zugabe<br />
von Cu 2+ führte ebenfalls zu geminderter Bromoformbildung<br />
(< 5 μg L −1 ).<br />
Extrazelluläre polymere Substanzen aus Biofilmen<br />
– Aufklärung von Strukturen und ihr Einfluss auf<br />
die Foulingbildung in Membranbioreaktoren<br />
(U. Metzger)<br />
Die Arbeit enthält grundlegende Unter suchungen zur<br />
Extraktion und Charakterisierung von extrazellulären<br />
polymeren Substanzen (EPS) aus Biofilmen sowie zu<br />
deren Einfluss auf die Foulingbildung in Membranbioreaktoren<br />
(MBR). Die im Rahmen der Arbeit neu und<br />
weiter entwickelten instru mentell-analytischen Methoden<br />
– ins be sondere die 13C CPMAS NMR-spektroskopische<br />
Methode zur Aufklärung von Strukturen in EPS und<br />
Biofilmen – dienen dem besseren Ver ständnis der strukturellen<br />
Zusammensetzung von EPS in Abhängigkeit<br />
von der Extraktionsmethode sowie der spezifischen<br />
Anreicherungen von EPS in Membranfoulingschichten.<br />
Die strukturelle Charakterisierung von eEPS und SMP<br />
wurde für verschiedene Biofilm-Systeme durchgeführt.<br />
Hierzu wurden sowohl Reinkultur-Biofilme als auch praxisrelevante<br />
Belebtschlammflocken aus MBR untersucht.<br />
Aufbauend auf der detaillierten molekularen<br />
Charakterisierung gelang es, den Einfluss von EPS und<br />
Biomasse auf das Membranfouling in MBR zu beschreiben<br />
und somit dazu beizutragen, das makroskopische<br />
Phänomen des Foulings zu erklären.<br />
Grundlegende Untersuchungen zur Charakterisierung<br />
der strukturellen EPS-Zusammensetzung wurden<br />
an Modell-Substanzen und Reinkultur-Biofilmen der<br />
Spezies Aureobasidium pullulans und Pseudomonas<br />
putida durchgeführt. Dazu wurde eine 13C CPMAS NMRspektroskopische<br />
Methode (CP, engl.: cross polarization,<br />
MAS, magic angle spinning) zur Strukturaufklärung entwickelt,<br />
die eine quantitative Analyse organischer chemischer<br />
Strukturelemente in den Biofilm- und EPS-Proben<br />
und deren Zuordnung zu biologischen Strukturen<br />
(Proteine und Kohlenhydrate) zulässt. Des Weiteren<br />
konnten die Anteile an Nukleinsäuren sowie an aliphatischen<br />
Zellwandbestandteilen abgeschätzt werden.<br />
Die unter Variation verschiedener physi kalischchemischer<br />
Bedingungen durchgeführten EPS-Extraktionen<br />
erlauben einen detaillierten Vergleich gängiger<br />
Juli/August 2011<br />
750 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
Organics in mg/m 2<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Carbohydrates<br />
Proteins<br />
Upper Intermediate Lower<br />
Fouling Fraction<br />
Bild 2. Fraktionierung der Foulingschichten in unterschiedlichen<br />
Höhen der Deckschichten (oberer (upper), Zwischen (intermediate)-<br />
und unterer (lower) Bereich).<br />
Extraktionsmethoden in Bezug auf deren EPS-Ausbeute,<br />
die strukturelle EPS-Zusammensetzung sowie hinsichtlich<br />
auftretender Zelllyse. Die EPS-Ausbeuten verschiedener<br />
Extraktionsmethoden unterschieden sich deutlich<br />
voneinander und waren für den eukaryotischen<br />
A. pullulans Biofilm jeweils höher als für den prokaryotischen<br />
P. putida Biofilm. Besonders die Kombination<br />
von NMR-spektroskopischen Untersuchungen mit den<br />
Ergebnissen der Elementanalyse (N, C) bot neue und<br />
tiefere Einblicke in die strukturelle Zusammensetzung<br />
von EPS- und Biofilmproben und ließ die Quantifizierung<br />
spezifischer An- und Abreicherungen als Folge der<br />
Extraktion zu. Zellwandbestandteile und Nukleinsäuren<br />
wurden durch sämtliche Extraktionsverfahren effektiv<br />
von den EPS entfernt. Neben dem Protein/Kohlenhydrat-Verhältnis,<br />
den n-Alkan- und DNA-Strukturen, konnten<br />
weitere NMR-Signale z. B. dem Extraktionshilfsmittel<br />
EDTA zugeordnet werden. EDTA machte einen Anteil<br />
von bis zu 46 % (w/w) an der eEPS-Fraktion aus, was die<br />
scheinbar hohen Ausbeuten der Methode und die niedrigen<br />
Protein- und Kohlenhydrat-Gehalte von eEPS aus<br />
unkritisch erhobenen Literaturdaten erklärt.<br />
Aufbauend auf den Untersuchungen an Modell-Substanzen<br />
und Reinkultur-Biofilmen wurde eine anwendungsbezogene<br />
Charakterisierung von EPS aus MBR<br />
durchgeführt. Neben der Extraktion von EPS aus Biomasse<br />
eines kommunalen und eines kleintechnischen<br />
MBR wurden SMP aus dem kommunalen MBR angereichert,<br />
mittels mehrstufiger Ultrafiltration (mst-UF) fraktioniert<br />
und weitergehend charakterisiert. Auf Grundlage<br />
der Ergebnisse wurden strukturelle Unterschiede<br />
verschiedener SMP-Größenfraktionen und zwischen<br />
extrahierbarer EPS und SMP gezeigt.<br />
Mittels Ultrafiltration wurden SMP angereicht und<br />
mit mst-UF in drei Größenklassen fraktioniert. Nach der<br />
Anreicherung waren etwa 50 % des DOC (dissolved<br />
organic carbon) im Permeat (< 1 kDa) enthalten, während<br />
sich die anderen 50 % gleichmäßig auf die verschiedenen<br />
Größenfraktionen verteilten. Die einzelnen<br />
Größenfraktionen besaßen eine breite Molekülgrößenverteilung<br />
und enthielten Molekülgrößen aus dem<br />
gesamten Bereich der Ausgangsprobe.<br />
Tendenziell enthielten höhermolekulare Fraktionen<br />
einen größeren Anteil an Proteinen und Nukleinsäuren,<br />
während in niedermolekularen Fraktionen eine Anreicherung<br />
von Kohlenhydrat- und aliphatischen Strukturen<br />
festzustellen war. Dies spiegelte sich auch in einer<br />
Zunahme des N/C-Verhältnisses für Fraktionen mit<br />
zunehmender nomineller Molekülgröße wider.<br />
Foulingexperimente lieferten detaillierte Informationen<br />
über den Einfluss der Betriebsweise auf den Aufbau<br />
und die Zusammensetzung der Foulingschicht im<br />
MBR. Um das Ausmaß des Foulings auf der Membranoberfläche<br />
und im Membraninneren zu quantifizieren,<br />
wurde ein Reinigungsverfahren entwickelt, welches die<br />
vollständige Entfernung der Foulingschicht in drei Fraktionen<br />
ermöglicht. Die entstandenen Fraktionen wurden<br />
reversiblem und irreversiblem Fouling zugeteilt<br />
und die strukturelle Zusammensetzung der Foulingschichten<br />
sowie der Beitrag von SMP und Biomasse am<br />
Fouling untersucht.<br />
Es hat sich gezeigt, dass Betriebsweisen mit höheren<br />
Brutto-Permeatflüssen nach Ende der Filtration höhere<br />
hydraulische Foulingwiderstände aufwiesen. Die Anwendung<br />
physikalischer Reinigungen konnte die Ausbildung<br />
des Foulings dabei nur begrenzt kompensieren. In etwa<br />
50 % des hydraulischen Gesamt-Foulingwiderstands der<br />
Membranen konnte auf irreversibles Fouling und 50 %<br />
auf reversibles Fouling zurückgeführt werden.<br />
Die Fraktionierung der Foulingschichten und die<br />
chemisch-physikalische Analyse der Deckschicht-Fraktionen<br />
ergaben einen aufschlussreichen Einblick in die<br />
Struktur der Foulingschicht. Dicht gepackte, globuläre<br />
Protein-Strukturen dringen bevorzugt in die Membranporen<br />
ein, wo sie durch sterische Effekte und/oder<br />
Adsorption zurückgehalten werden; langkettige/verzweigte<br />
Kohlenhydrat-Strukturen lagern sich bevorzugt<br />
auf der Membranoberfläche ab und lassen sich somit<br />
durch Rückspülen und/oder Relaxation besser entfernen<br />
(Bild 2).<br />
Die vorliegende Arbeit liefert einen wesentlichen<br />
Beitrag zur Strukturaufklärung von EPS und unterstreicht<br />
den ausgeprägten Einfluss von EPS auf das<br />
Membranfouling in MBR. Es konnte gezeigt werden,<br />
dass die 13C NMR-Spektroskopie eine leistungsfähige<br />
Methode zur Strukturaufklärung von EPS und Membranfouling<br />
ist. Aufbauend auf den Ergebnissen und fortführenden<br />
Studien ist es möglich, die für das Fouling<br />
verantwortlichen Substanzen im MBR-System zu detektieren<br />
und ihnen gezielt entgegen zu wirken. Dies ist<br />
eine wichtige Grundlage für die Auslegung und den<br />
Betrieb eines nachhaltigen MBR-Prozesses, welcher<br />
nach wie vor durch die durch Fouling verminderte Pro-<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 751
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
Bild 3.<br />
Hefezelle mit<br />
adsorbierten<br />
Nanopartikeln<br />
(Fe 2 O 3 ) auf<br />
einer<br />
0,2 μm-<br />
Membrane.<br />
zessleistung mit hohen Reinigungs- und Betriebskosten<br />
verbunden ist. Die hohe Praxisrelevanz der Untersuchungen<br />
wird damit unterstrichen.<br />
1.2 In Arbeit befindliche, im Jahre 2010<br />
abgeschlossene und neu begonnene<br />
Forschungsprojekte<br />
Wichtige Forschungsschwerpunkte im Bereich <strong>Wasser</strong>chemie<br />
sind die erweiterten Oxidationsverfahren (AOP)<br />
und speziell die Photokatalyse, ferner die Membrantechniken<br />
Ultrafiltration und Nanofiltration, wobei sowohl<br />
ihre Anwendung, z. B. zur Schwimmbadwasserbehandlung,<br />
als auch die Auswirkungen von Porenverblockung<br />
und Fouling untersucht werden. Mehrere Arbeiten<br />
befassen sich auch mit der Funktion von Nanopartikeln.<br />
Die folgende Übersicht stellt einige wichtige, in 2010<br />
bearbeitete Forschungsvorhaben vor. Mehr Information<br />
kann über die Projektverantwortlichen erhalten werden.<br />
Die Kontaktaufnahme ist über die Internetadresse<br />
http://www.wasserchemie.uni-karlsruhe.de/ möglich.<br />
Zu unseren Drittmittelförderern zählen der Deutsche<br />
Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches (DVGW), die Deutsche<br />
Forschungsgemeinschaft (DFG), das Bundesministerium<br />
für Forschung und Technologie (BMBF) sowie die<br />
Industrie und andere Förderinstitutionen.<br />
Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismen,<br />
Nanopartikeln und natürlicher organischer<br />
Materie in der aquatischen Umwelt<br />
Dipl.-Ing. Heiko Schwegmann, Förderung: KIT,<br />
Kompetenzbereich Erde und Umwelt (STUB)<br />
Nanopartikel (NP) sind zunehmend von ökonomischem<br />
Interesse, da sie aufgrund ihrer funktionalen Grenzflächen<br />
und ihren großen Oberflächen neue Eigenschaften<br />
aufweisen (Bild 3). Durch den ansteigenden Einsatz<br />
der NP ist jedoch davon auszugehen, dass am Ende des<br />
Lebenszyklusses eine erhöhte Exposition der NP im <strong>Wasser</strong>kreislauf<br />
zu erwarten ist. Verschiedene Laboratoriumsunter<br />
suchun gen zeigten nachteilige Effekte durch NP<br />
auf aquatische Mikroorganismen (MO). Daher sind mögliche<br />
negative Effekte auf die MO in komplexeren Systemen,<br />
in denen auch die natürliche organische Materie<br />
(NOM) eine gewichtige Rolle spielt, nicht auszuschließen.<br />
Ziel des Vorhabens war es, die Interaktion und Toxizität<br />
von neuartigen Nanopartikeln mit Modell-Mikroorganismen<br />
in der aquatischen Umwelt zu beschreiben.<br />
Hierzu wurde die Sorption von natürlichen organischen<br />
Stoffen (NOM, hier Fulvinsäuren) auf unterschiedlichen<br />
Nanopartikeln, wie beispielsweise Fe 2 O 3 , SiO 2 und TiO 2 ,<br />
in Gegenwart von Mikroorganismen (E. coli, P. putida,<br />
L. plantarum) untersucht. Durch die Sorption der Fulvinsäuren<br />
auf den NP erfolgt eine Änderung des Zetapotentials<br />
der NP zu negativen Werten. Dadurch verringert<br />
sich die Toxizität der NP gegenüber den ebenfalls negativ<br />
geladenen Mikroorganismen.<br />
Optimierung des Filtrationsverhaltens<br />
von Membranen durch Oberflächenmodifizierung<br />
mit Silber<br />
Dipl.-Ing. Angela Klüpfel, Dr.-Ing. Markus Delay,<br />
Förderung: KIT, Kompetenzbereich<br />
Systeme und Prozesse (STUB)<br />
Die Betriebsdauer und damit die Wirtschaftlichkeit des<br />
Einsatzes von Membrananlagen hängt entscheidend<br />
von der Deckschichtbildung an der Membranoberfläche<br />
ab. Wichtige Mechanismen der Deckschichtbildung sind:<br />
Ausfallen von Salzen (Scaling), Adsorption und Ablagerung<br />
organischer Stoffe (Fouling) sowie Wachstum von<br />
Biofilmen (Biofouling) mit der dabei bakteriell gebildeten<br />
extrazellulären polymeren Substanz (EPS). Vor allem<br />
in der Behandlung von Abwässern (industriellen oder<br />
kommunalen) kommt es insbesondere durch Fouling<br />
und Biofouling zu einer Verminderung der Permeabilität<br />
der Membran und damit zu einer Verkürzung der Laufzeit.<br />
Dies wirkt sich negativ auf den wirtschaftlichen<br />
Betrieb der Membrananlagen aus. Um die Leistungsfähigkeit<br />
von Membrananlagen über einen längeren<br />
Zeitraum zu gewähr leisten, stehen – je nach verwendeter<br />
Membran – ver schie dene physikalisch-chemische<br />
Verfahren zur Verfügung (Rückspülung, Einsatz von<br />
Chemi ka lien, gepulster Flux). Der Einsatz dieser Verfahren<br />
geht mit einer Verringerung der Ausbeute einher.<br />
Die chemische Reinigung verursacht zusätzliche Kosten<br />
und erfordert eine längere Unterbrechung des kontinuierlichen<br />
Betriebs.<br />
Die Oberflächenmodifikation von Membranen mit<br />
Silber (Silber-modifizierte Membranen, SMM) stellt<br />
einen vielversprechenden Ansatz für die Aufrechterhaltung<br />
der Membran per for mance bei vermindertem Chemikalieneinsatz<br />
im Betrieb dar. Zum einen weist Silber<br />
antibakterielle Ei gen schaften auf, die dem Biofouling<br />
entgegenwirken können; zum anderen kann durch das<br />
Auf bringen von Silber das Anhaften von organischen<br />
Substan zen und Mikroorganismen ver min dert werden.<br />
Auf diesem Gebiet liegen bislang kaum systematische<br />
Untersuchungen vor. Daraus ergibt sich ein akuter Forschungsbedarf,<br />
der auf eine umfassende und verläss -<br />
Juli/August 2011<br />
752 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
liche Grundlage für belastbare Aussagen über die<br />
Anwendbarkeit solcher SMM zielt.<br />
Der dynamische Kapillarsaum Dynamic Capillary<br />
Fringes – ein multidisziplinärer Denkansatz:<br />
Teilprojekt 5: Refraktäre organische Substanzen<br />
im Kapillarsaum: ihre Dynamik, Gradienten<br />
und Reaktionen<br />
Dr. Gudrun Abbt-Braun,<br />
Förderung: DFG<br />
Das Verhalten von synthetischen organischen Substanzen<br />
und ihre biologische Abbaubarkeit in gesättigten<br />
und ungesättigten Bereichen des Bodens sind von<br />
großer ökologischer Bedeutung. Die möglichen Abbauprodukte<br />
der Schadstoffe und ihre Integration in die<br />
Bodenmatrix wurden allerdings noch nicht eingehend<br />
erforscht. Es wird erwartet, dass der Kapillarsaum bereich<br />
eine hohe Bioaktivität beim Abbau und bei der Umformung<br />
der Schadstoffe aufweist. Dieser „natürliche Bioreaktor“<br />
führt zu einem makromolekularen Material aus<br />
Biomasse, in welchem die Xenobiotika und ihre Abbauprodukte<br />
integriert werden können.<br />
In Laboruntersuchungen werden die (bio-)chemischen<br />
Umwandlungen ausgewählter Modellsubstanzen<br />
und der sich daraus entwickelnden Schadstoffe<br />
untersucht, die einen schwankenden Oberflächenspiegel<br />
des Grundwassers simulieren. Das Hauptaugenmerk<br />
liegt auf der Abhängigkeit der Reaktionen und der<br />
Wechselwirkungen der speziellen Bedingungen im<br />
Kapillarsaum sowie auf den durch die Oberflächenschwankung<br />
entstehenden Gradienten (z. B.: Redoxpotenzial,<br />
pH-Wert, <strong>Wasser</strong>gehalt, vertikale und horizontale<br />
Strömung). Durch die quantitativen Ergebnisse<br />
wird ein umfassenderes Verständnis und damit eine<br />
näherungsweise Berechnung der Vorgänge im Kapillarsaum<br />
erwartet.<br />
Das Forschungsvorhaben wird im Rahmen der von<br />
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten<br />
Forschergruppe DYCAP gefördert. Weitere Kooperationspartner<br />
sind das Institut für Ingenieurbiologie und<br />
Biotechnologie des <strong>Abwasser</strong>s am KIT (Prof. Winter, Koordinator),<br />
das Institut für Parallele und Verteilte Systeme,<br />
Universität Heidelberg (Prof. Bastian), das Zentrum für<br />
angewandte Geowissenschaften, Universität Tübingen<br />
(Prof. Grathwohl), und das Helmholtzzentrum für Umweltforschung<br />
UFZ in Leipzig (Prof. Geistlinger).<br />
Application of Oil Shale By-Products in Agriculture<br />
and as Sorbent for Water Purification<br />
Dr. Gudrun Abbt-Braun, Dr.-Ing. Markus Delay,<br />
Förderung: BMBF<br />
Um die Wiederverwertbarkeit von Abfallstoffen, die<br />
beim Ölschieferabbau bzw. bei der Weiterverarbeitung<br />
anfallen, für den Einsatz in der Landwirtschaft und/oder<br />
zur Bodenverbesserung zu bewerten, wurden unterschiedliche<br />
Materialien hinsichtlich ihrer Elementzusammensetzung<br />
und ihres Stofffreisetzungsverhaltens<br />
mit <strong>Wasser</strong> eluiert. Ebenso wurden Mischungen dieser<br />
Materialien mit einem Ober boden material untersucht.<br />
Diese Materialien und Mischungen wurden in Brasilien<br />
auf Versuchs feldern ausgebracht, mit dem Mutter boden<br />
vermischt und bearbeitet.<br />
Zur Untersuchung der homogenisierten Feststoffe<br />
im Labor wurden diese in Batchversuchen mit demineralisiertem<br />
<strong>Wasser</strong> nach einem standardisierten Verfahren<br />
(S4) sowie mit Säulenelutionsverfahren behandelt.<br />
In den Eluaten wurden die Konzentrationen an Metallen,<br />
Schwermetallen, Anionen und organischen Stoffen<br />
bestimmt. Außerdem erfolgte eine weitergehende Charakterisierung<br />
der organischen Stoffe durch gelchromatographische<br />
Auftrennung. Des Weiteren wurden die<br />
Feststoffproben mit Cyclohexan extrahiert und polyzyklische<br />
aroma tische Kohlen wasserstoffe (PAK) in den<br />
Extrakten quantifiziert.<br />
Es zeigte sich, dass die untersuchten Materialien und<br />
Materialmischungen hin sichtlich ihres kurz- und mittelfristigen<br />
Freisetzungspotenzials für anorganische<br />
Schadstoffe als nahezu unbedenklich zu be werten sind.<br />
Für die Laboruntersuchungen wurde ein Mischungsverhältnis<br />
von Boden und Abfall produkten von 90 : 10<br />
(w/w) gewählt – in der praktischen Anwendung hingegen<br />
wird ein weit größeres Mischungsverhältnis eingesetzt<br />
werden. Der Massenanteil des Abfallprodukts an<br />
der Gesamtmasse wird in der Praxis also geringer ausfallen.<br />
Die Untersuchungen stellen somit einen Worstcase-Fall<br />
für die Freisetzung potenzieller Schadstoffe<br />
dar. Das Freisetzungsverhalten wurde zusätzlich mittels<br />
eines Säulenelutionstests untersucht. Das Freisetzungsverhalten<br />
ausgewählter anorganischer Komponenten<br />
(insbesondere der Ionen K, Na, Ca und Mg) konnte mit<br />
Hilfe von Modellrechnungen beschrieben werden. Das<br />
Freisetzungs verhalten der meisten Elemente ist durch<br />
eine initiale, schnelle Freisetzung (gut lösliche Anteile)<br />
und eine langsamere, allmähliche Freisetzung (langsame<br />
Auflösung und Umwandlung der Matrix, Diffusion)<br />
gekennzeichnet. Ähnlich wie bei den Ergebnissen<br />
für die Schüttelversuche lässt sich auch bei den<br />
Säulenversuchen die Freisetzung aus den Materialmischungen<br />
aus Abfallstoffen und Bodenmaterial nicht<br />
durch lineare Kombi nation der Ergebnisse für die „Reinstoffe“<br />
beschreiben. Die sich bei der Mischung der<br />
Abfallstoffe mit dem Bodenmaterial ändernden physikalisch-chemischen<br />
und hydraulischen Materialeigenschaften<br />
(insbesondere pH-Wert und Korngrößenverteilung)<br />
und die resultierenden Wechselwirkungen<br />
zwischen gelöster und fester Phase beeinflussen die<br />
Freisetzung der einzelnen Komponenten unterschiedlich.<br />
Für eine detaillierte Modellierung des Freisetzungsverhaltens<br />
müssen die Mineralphasen sowie thermodynamische<br />
Daten berücksichtigt werden.<br />
Das Projekt wurde durch das Internationale Büro des<br />
BMBF gefördert und im Jahr 2010 abgeschlossen. Die<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 753
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
Kooperation erfolgt mit der Universidade Federal do<br />
Paraná (Curitiba, Brasilien) und der Empresa Brasileira de<br />
Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA).<br />
1.3 Aus der Tätigkeit der DVGW-Forschungsstelle,<br />
Bereich <strong>Wasser</strong>chemie<br />
Die Schwerpunkte der Arbeiten lagen im Jahre 2010 in<br />
den Kompetenzfeldern <strong>Wasser</strong>aufbereitung, Gewässergüte<br />
und analytische Untersuchungen, wobei die<br />
Belange der <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen besonders<br />
berücksichtigt wurden.<br />
Im Einzelnen sind hier zu nennen:<br />
Membranverfahren, Hybridverfahren,<br />
Biofilme: Wirkung von Desinfektionsmitteln auf<br />
Mikroorganismen,<br />
Bildung und Minimierung unerwünschter Nebenprodukte<br />
im Schwimmbeckenwasser,<br />
Bildung und Reaktion von Bromverbindungen unter<br />
wasserversorgungsrelevanten Bedingungen,<br />
Gewässerqualität.<br />
Im Folgenden werden einige der Projekte im Einzelnen<br />
vorgestellt:<br />
Sustainable Management of Available Water<br />
Resources with Innovative Technologies<br />
(SMART II) – Brackish Water Usage<br />
Dipl.-Ing. Angela Klüpfel, Dr.-Ing. Florencia Saravia,<br />
Förderung: BMBF<br />
Das Ziel des Forschungsprojektes „SMART“ ist die Entwicklung<br />
eines übertragbaren Ansatzes für integriertes<br />
<strong>Wasser</strong>resourcenmanagement (IWRM, engl.: Integrated<br />
Water Resources Management) in der Region des unteren<br />
Jordantals, die häufig unter <strong>Wasser</strong>knappheit leidet.<br />
In diesem Zusammenhang spielen die folgenden Fragen<br />
eine zentrale Rolle:<br />
Bild 4. Fouling und Scaling bei Membranen.<br />
1. Wie lassen sich die <strong>Wasser</strong>verfügbarkeit und die<br />
<strong>Wasser</strong>qualität im Einzugsgebiet des unteren<br />
Jordantals erhöhen, ohne zentrale Ökosysteme und<br />
das soziale und wirtschaftliche Gemeinwohl zu<br />
gefährden?<br />
2. Welche innovativen Technologien, Entscheidungsfindungssysteme<br />
und Managementstrategien können<br />
auf sinnvollem und effektivem Weg für eine<br />
nachhaltige Nutzung von <strong>Wasser</strong>ressourcen angewandt<br />
werden?<br />
Im Teilprojekt „Brackwassernutzung“ werden das<br />
Potenzial und die Herausforderungen des Einsatzes von<br />
Membrantechnologien für die Aufbereitung von hochsalzigem<br />
Brunnen-, Quell- oder Grundwasser auf lokaler<br />
Ebene untersucht.<br />
Bei der Brackwasserentsalzung führen hohe Calcium,<br />
Carbonat- und Sulfatkonzentrationen zu einem erhöhten<br />
Risiko von Scaling auf der Membranoberfläche und<br />
zu einem damit verbundenen Rückgang der Membranleistung.<br />
Ziel der Arbeiten ist es, Mechanismen der<br />
Deckschichtbildung bei der Brackwasseraufbereitung<br />
zu untersuchen (Bild 4). Dabei stehen die Verminderung<br />
der Deckschichtbildung und die Optimierung hinsichtlich<br />
des Einsatzes von Low-Pressure-Reverse-Osmosis<br />
im Vordergrund. Mem bran verfahren zur Aufbereitung<br />
von Brackwasser werden in Laboruntersuchungen und<br />
in Kooperation mit einem Industriepartner mittels einer<br />
Pilotanlage vor Ort im Unteren Jordantal getestet, um<br />
einen optimierten Einsatz des Verfahrens zur Brackwasseraufbereitung<br />
für die Grundwasseranreicherung, für<br />
die Bewässerung und für die Aufbereitung von Trinkwasser<br />
anzuwenden. Dazu werden in Kooperation mit<br />
den Projektpartnern mögliche <strong>Wasser</strong>ressourcen von<br />
minderer Qualität quantifiziert und zweckorientierte<br />
Lösungsstrategien aufgezeigt. Mögliche Anwendungsgebiete<br />
sind die landwirtschaftliche Bewässerung, die<br />
Grundwasseranreicherung und die Trinkwasserversorgung.<br />
Die Arbeiten laufen in Kooperation mit dem Institut<br />
für angewandte Geowissenschaften, Abteilung Hydrogeologie<br />
am KIT (Koordination), dem Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong> (TZW), dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung<br />
(UFZ), dem Geowissenschaftlichen Zentrum,<br />
Universität Göttingen, mit Universitäten in Israel, Palästina<br />
und Jordanien sowie israelischen und jordanischen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen und Ministerien und<br />
deutschen Industrieunternehmen. Weitere Informationen<br />
finden sich unter http://www.iwrm-smart.org/<br />
Assessement of Nutrients, Micropollutants and<br />
fine Particles in Raw Waters and Sediments<br />
Dr. Gudrun Abbt-Braun, Dipl. Chem. Nicole Hebben,<br />
Förderung: BMBF<br />
Die Trinkwasserversorgung beruht in manchen Regionen<br />
fast ausschließlich auf der Nutzung von Ober-<br />
Juli/August 2011<br />
754 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
flächengewässern. Bei einer ungenügenden <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
und durch diffuse Abschwemmungen<br />
werden die Oberflächengewässer häufig mit organischen<br />
anthropogenen Schadstoffen belastet und<br />
weisen hohe Konzentrationen von Phosphor und Stickstoff-Verbindungen<br />
auf. Im Rahmen der Internationalen<br />
<strong>Wasser</strong>forschungsallianz Sachsen (IWAS) werden Beiträge<br />
zu einem integrierten <strong>Wasser</strong>ressourcen-Management<br />
(IWRM) in fünf hydrologisch sensitiven Regionen<br />
weltweit erarbeitet. Das IWAS Água DF Projekt ist<br />
Teil des Regionalprojektes Lateinamerika, mit dem<br />
Fokus auf der Hauptstadt Brasiliens und dessen Bundesdistrikt.<br />
Um die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung<br />
Brasílias auch in Zukunft zu sichern, wird der Lago do<br />
Paranoá als Rohwasserquelle für eine weitere Trinkwasseraufbereitungsanlage<br />
in Betracht gezogen. Momentan<br />
wird der See für die Energiegewinnung, Fischerei<br />
und für Freizeitaktivitäten genutzt und dient darüber<br />
hinaus als Vorfluter für zwei Kläranlagen.<br />
Ziel des Projektes ist es, Daten zur <strong>Wasser</strong>qualität zu<br />
erheben. Dies geschieht unter Einbeziehung von detaillierten<br />
Untersuchungen der Abflüsse aus den Einzugsgebieten,<br />
aus den Kläranlagenabläufen sowie aus den<br />
Flusssedimenten. Damit sollen Aussagen über Eintragspfade<br />
(diffuse und punktuelle Quellen), Umwandlungsprozesse<br />
(in <strong>Wasser</strong> und Sedimentphasen), sowie Quellen<br />
und Senkenfunktionen erhalten werden. Die Ergebnisse<br />
bieten die Grundlage für Empfehlungen für ein<br />
nachhaltiges <strong>Wasser</strong>management und für geeignete<br />
Aufbereitungsverfahren.<br />
Die Arbeiten laufen in Kooperation mit dem Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong> (TZW), dem Helmholtz Zentrum<br />
für Umweltforschung (UFZ, Koordination), der Universität<br />
Dresden (Koordination), der Universität der Bundeswehr<br />
München, der Sachsen <strong>Wasser</strong> GmbH und den<br />
Partnern in Brasilia, Universidade de Brasília und Companhia<br />
de Saneamento Ambiental do Distrito Federal<br />
Brasília (CASEB).<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.iwas-sachsen.ufz.de/index.php?de=17427<br />
http://www.iwas-sachsen.ufz.de/index.php?de=18049<br />
Nutzungsorientierte <strong>Wasser</strong>qualität<br />
im Einzugsgebiet der Wolga<br />
Dr. Gudrun Abbt-Braun,<br />
Förderung: BMBF<br />
Aufbauend auf vorangegangen Arbeiten in den Jahren<br />
2001 bis 2003 wurde im Rahmen einer deutsch-russischen<br />
Kooperation die Bestandsaufnahme der Flusswasserqualität<br />
der Moskva, sowie Teilen der Oka und<br />
Wolga durchgeführt. Dazu wurden an wichtigen<br />
geographischen Punkten (Moskva-Einmündung in die<br />
Oka nahe Kolomna, Oka-Einmündung in die Wolga bei<br />
Nizhny Novgorod) über Jahreszeiträume Monatsmischproben<br />
untersucht. Von besonderer Bedeutung sind<br />
hierbei der gelöste organische Kohlenstoff (DOC), AOX,<br />
Phosphor- und Stickstoffverbindungen und Schwermetalle.<br />
Diese langfristigen Untersuchungen gaben<br />
Aufschluss über die jahreszeitlichen Schwankungen der<br />
Flusswasserqualität und die Varianz der Analysenergebnisse.<br />
Ein besonderes jahreszeitliches Ereignis stellt<br />
dabei die in diesem Untersuchungsgebiet übliche<br />
Schneeschmelze im Frühjahr dar, die zu einer besonderen<br />
Abflusssituation in den untersuchten Flüssen<br />
beiträgt.<br />
Aufbauend auf den in früheren Jahren (2001 bis<br />
2003) erhaltenen Daten war es möglich, längerfristige<br />
Trendaussagen zur <strong>Wasser</strong>qualität der Moskva, Oka und<br />
Wolga zu machen, um langfristige Prognosen für eine<br />
zukünftige Entwicklung der <strong>Wasser</strong>qualität zu stellen.<br />
Die Ergebnisse können eine sichere Entscheidungsgrundlage<br />
für ein nachhaltiges Gebiets-Flussmanagement<br />
liefern.<br />
Das Projekt wurde in Kooperation mit der Universität<br />
Heidelberg, dem Institut für Umwelt-Geochemie (IUG),<br />
dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle (UFZ),<br />
Department Bodenphysik, und dem Institut für <strong>Wasser</strong><br />
und Gewässerentwicklung, Bereich <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und Kulturtechnik am KIT, sowie mit Partnern aus Nishny<br />
Novgorod (Staatliche Akademie für Architektur und<br />
Bauingenieurwesen) und Moskau (Allrussisches Forschungsinstitut<br />
für Hydrotechnik und Melioration VNI-<br />
IGIM) durchgeführt. Die Arbeiten wurden im Jahr 2010<br />
abgeschlossen<br />
Bild 5. DOC Konzentrationen in der Wolga bei Nishny Novgorod vor<br />
(Wolga 1) und nach der Einmündung der Oka, (Wolga 2), in der Oka<br />
vor der Stadt Nishny Novgorod (Oka 3) und kurz vor der Einmündung<br />
in die Wolga (Oka 4), n (2003) = 18; n (2008) = 21, zum Vergleich<br />
LAWA-Güteklasse II, ρ (DOC) = 2,5 mg L –1 ).<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 755
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
Einfluss des pH-Werts auf die photokatalytische<br />
Desinfektion von Mikroorganismen<br />
Dipl.-Ing. Heiko Schwegmann, Förderung: DVGW<br />
Die hygienische Belastung von Oberflächengewässern<br />
insbesondere von Fließgewässern kam in den letzten<br />
Jahren vermehrt in den Fokus. Ein Beitrag zur Reduzierung<br />
der Keimbelastung kann durch eine Desinfektion<br />
von <strong>Abwasser</strong>strömen erreicht werden. Deshalb wurde<br />
der Einfluss von verschiedenen Parametern auf die photokatalytische<br />
Desinfektion mit Titandioxid untersucht.<br />
Es zeigte sich, dass bei niedrigeren pH-Werten die Desinfektion<br />
schneller verlief, da die elektrostatische Anziehung<br />
zwischen Mikroorganismus und Titandioxidpartikel<br />
größer war. Bei höheren DOC-Konzentrationen<br />
adsorbierte der DOC an den Partikeln und reduzierte<br />
dadurch die Desinfektionsleistung.<br />
Entwicklung genormter Verfahren zur<br />
<strong>Wasser</strong>untersuchung<br />
Dr. Birgit Gordalla, Förderung:<br />
<strong>Wasser</strong>chemische Gesellschaft in der GDCh<br />
Genormte, standardisierte Verfahren werden zur Untersuchung<br />
von <strong>Abwasser</strong> und Gewässern, aber auch im<br />
Trinkwasserbereich angewandt. Ihre Anwendung bei<br />
der Überwachung sorgt für Vergleichbarkeit und dient<br />
der Sicherstellung justiziabler Ergebnisse sowie der Einhaltung<br />
festgelegter Spezifikationen für die Analytik.<br />
Genormte Analysenverfahren zur <strong>Wasser</strong>untersuchung<br />
werden auf europäischer bzw. internationaler Ebene in<br />
den technischen Komitees CEN/TC 230 „<strong>Wasser</strong>analytik“<br />
des europäischen Komitees für Normung (CEN) bzw.<br />
ISO/TC 147 „<strong>Wasser</strong>beschaffenheit“ der International<br />
Organization for Standardization (ISO) erarbeitet. Die<br />
fachliche Arbeit an den Normen erfolgt in Arbeitsgruppen<br />
von Experten aus den beteiligten Ländern. Die<br />
Normen werden im Entwurfsstadium der Fachwelt zur<br />
Prüfung und Kommentierung vorgelegt und durchlaufen<br />
vor ihrer Veröffentlichung ein mehrstufiges Abstimmungsverfahren.<br />
Für Verfahren zu kontinuierlich messbaren<br />
Parametern ist außerdem die Validierung durch<br />
einen externen Ringversuch vorgeschrieben.<br />
In beiden o. g. technischen Komitees hat das Deutsche<br />
Institut für Normung (DIN) die Federführung. Alle<br />
auf europäischer Ebene erarbeiteten Verfahren und<br />
viele ISO-Verfahren werden in das deutsche Normenwerk<br />
übernommen. Der DIN-Arbeitsausschuss „<strong>Wasser</strong>untersuchung“<br />
fungiert dabei als deutsches Spiegelgremium.<br />
Darüber hinaus arbeiten projektbezogene<br />
nationale Arbeitskreise an den technischen Inhalten der<br />
Verfahren mit. Bei Bedarf werden auch Verfahren entwickelt,<br />
die nur als Deutsche Normen vorgesehen sind.<br />
Das Ergebnis der Aktivitäten ist ein Portfolio von insgesamt<br />
etwa 280 DIN-, DIN EN-, DIN EN ISO- oder DIN ISO-<br />
Verfahren, die das breite Spektrum der chemischen und<br />
mikrobiologischen <strong>Wasser</strong>untersuchung, der Abbaubarkeits-<br />
und Ökotoxizitätstestung sowie der Untersuchung<br />
von Gewässerökologie und -morphologie<br />
ab decken. Die Arbeiten zur Verfahrensnormung werden<br />
von der <strong>Wasser</strong>chemischen Gesellschaft in der GDCh<br />
mitgetragen; die erarbeiteten Normen werden Bestandteil<br />
der Loseblattsammlung „Deutsche Einheitsverfahren<br />
zur <strong>Wasser</strong>-, <strong>Abwasser</strong>- und Schlammuntersuchung“,<br />
die von der <strong>Wasser</strong>chemischen Gesellschaft und vom<br />
Normenausschuss <strong>Wasser</strong>wesen im DIN gemeinschaftlich<br />
herausgegeben wird.<br />
Damit war der Bereich <strong>Wasser</strong>chemie auch im Jahre<br />
2010 in den aktuellen Themen der <strong>Wasser</strong>technik und<br />
des internationalen Gewässerschutzes aktiv tätig. Die<br />
Beratertätigkeit im Bereich <strong>Wasser</strong>chemie fokussiert<br />
sich auf den Themenkomplex der weitergehenden<br />
DOC-Charakterisierung bei der <strong>Wasser</strong>aufbereitung mit<br />
physikalisch-chemischen und biologischen Methoden.<br />
Es werden mit internationalen Firmen Projekte und Studien<br />
zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung und zur Behandlung von<br />
Spezialwässern durchgeführt.<br />
1.4 Veröffentlichungen<br />
Veröffentlichungen in peer-reviewed referierten<br />
Fachjournalen<br />
Alkhoury, W., Ziegmann, M., Frimmel, F. H., Abbt-Braun, G. and Salameh,<br />
E.: Water quality of the King Abdullah Canal/Jordanimpact<br />
on eutrophication and water disinfection. Toxicol.<br />
Environ. Chem. 92 (5), 855–877 (2010).<br />
Delay, M., Tercero Espinosa, L. A., Metreveli, G. and Frimmel, F. H.: Coupling<br />
techniques to quantify nanoparticles and to characterize<br />
their interactions with water constituents. In: Frimmel,<br />
F. H., Niessner, R. (Eds.): Nanoparticles in the Water Cycle.<br />
Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 139–163 (2010).<br />
Frimmel, F. H. and Niessner, R. (Eds.): Nanoparticles in the Water<br />
Cycle. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg (2010).<br />
Frimmel, F. H. and Delay, M.: Introducing the ”Nano-world“. In:<br />
Frimmel, F. H., Niessner, R. (Eds.): Nanoparticles in the Water<br />
Cycle. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 1–11 (2010).<br />
Gordalla, B. C.: Standardisation. In: Frimmel, F. H., Niessner, R. (Eds.):<br />
Nanoparticles in the Water Cycle. Springer-Verlag Berlin-<br />
Heidelberg, 207–231 (2010).<br />
Jobelius, C., Ruth, B., Griebler, C., Meckenstock, R. U., Hollender, J.,<br />
Reineke, A., Frimmel, F. H. and Zwiener, C.: Metabolites indicate<br />
hot spots of biodegradation and biogeochemical gradients<br />
in a high-resolution monitoring well. Environ. Sci. Technol.<br />
45, 474–481 (2011).<br />
Klüpfel, A. M. and Frimmel, F. H.: Nanofiltration of river water - fouling,<br />
cleaning and micropollutant rejection. Desalination<br />
250, 1005–1007 (2010).<br />
Metreveli, G., Abbt-Braun, G. and Frimmel, F. H.: Influence of NOM on<br />
the mobility of metal(loid)s in water-saturated porous<br />
media. Aquatic Geochemistry 16, 85–100 (2010).<br />
Schwegmann, H. and Frimmel, F. H.: Nanoparticles: interaction with<br />
microorganism. In: Frimmel, F. H., Niessner, R. (Eds.): Nanoparticles<br />
in the Water Cycle. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg,<br />
162–182 (2010).<br />
Schwegmann, H., Feitz, A. J. and Frimmel, F. H.: Influence of the zeta<br />
potential on the sorption and toxicity of iron oxide nanoparticles<br />
on S. cerevisiae and E. coli. Journal of Colloid and Interface<br />
Science 347 (1), 43–48 (2010).<br />
Juli/August 2011<br />
756 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
Tercero Espinoza, L. A., Malerba, R. R. and Frimmel, F. H.: Influence of<br />
dissolved organic carbon source, photocatalyst identity and<br />
copper (II) ions on the formation of bromoform in irradiated<br />
titanium dioxide suspensions. Catalysis Today 151, 84–88<br />
(2010).<br />
Ter Haseborg, E., Mateu Zamora, T., Fröhlich, J. and Frimmel, F. H.: Nitrifying<br />
microorganisms in fixed-bed biofilm reactors fed<br />
with different nitrite and ammonia concentrations. Bioresource<br />
Technology 101, 1701–1706 (2010).<br />
Ziegmann, M. and Frimmel, F. H.: Photocatalytic degradation of<br />
clofibric acid, carbamazepine and iomeprol using conglomerated<br />
TiO 2 and activated carbon in aqueous suspension.<br />
Water Sci. Technol. 61.1, 273–281 (2010).<br />
Ziegmann, M., Abert, M., Müller, M. and Frimmel, F. H.: Use of fluorescence<br />
fingerprints for the estimation of bloom formation<br />
and toxin production of Microcystis aeruginosa. Water Res.<br />
44, 195–204 (2010).<br />
Ziegmann, M., Saravia, F., Torres, P. A. and Frimmel, F. H.: The hybrid<br />
process TiO 2 /PAC: performance of membrane filtration.<br />
Water Sci. Technol. 62.5, 1205–1212 (2010).<br />
Veröffentlichungen und Tagungsbeiträge (Auswahl)<br />
Delay, M., Mangold, S., Sembritzki, R. und Frimmel, F. H.: Chrom-<br />
Speziierung in Abfallmaterialien und wässrigen Eluaten.<br />
Tagungsband Jahrestagung der <strong>Wasser</strong>chemischen Gesellschaft,<br />
10.–12.05.2010, Bayreuth, S. 120–124.<br />
Frimmel, F. H. and Delay, M.: Can Engineered Nanoparticles Swim?<br />
Vom <strong>Wasser</strong> 108 (3), 97–98 (2010).<br />
Frimmel, F. H., Abbt-Braun, G., Saravia, F. and Tercero Espinoza, L. A.:<br />
The role of humic NOM in advanced water technology. In:<br />
González-Pérez, J. A., González-Vila, F. J., Almendros, G. (Eds.):<br />
Advances in Natural Organic Matter and Humic Substances<br />
Research 2008–2010. Proceedings Book of the Communications<br />
presented to the 15 th Meeting of the International<br />
Humic Substances Society, Tenerife – Canary Islands, June<br />
27–July 2, Vol. 1, 211–214 (2010).<br />
Drosos, M., Abbt-Braun, G., Frimmel, F. H. and Delingiannakis, Y.: On<br />
the additivity of the properties of humic acid fractions. In:<br />
González-Pérez, J. A., González-Vila, F. J., Almendros, G. (Eds.):<br />
Advances in Natural Organic Matter and Humic Substances<br />
Research 2008–2010. Proceedings Book of the Communications<br />
presented to the 15 th Meeting of the International<br />
Humic Substances Society, Tenerife – Canary Islands, June<br />
27–July 2, Vol. 2, 162–165 (2010).<br />
Klüpfel, A. und Frimmel, F. H.: Rückhalt von Desinfektionsnebenprodukten<br />
und ihrer Präkursoren in der Schwimmbeckenwasseraufbereitung<br />
mit Nanofiltration. Tagungsband Jahrestagung<br />
der <strong>Wasser</strong>chemischen Gesellschaft, 10.–12.05.2010,<br />
Bayreuth, S. 232–235.<br />
Klüpfel, A., Jouette, L. and Frimmel, F. H.: Influence of operating conditions<br />
and membrane properties on nanofiltration fouling.<br />
Proceedings of 13 th Aachen Membrane Colloquium. October<br />
27–28, 2010 Aachen, 443–446 (2010).<br />
Saravia, F.: Rückhalt und Fouling bei getauchten Membranen und<br />
Hybridverfahren. Tagungsband Jahrestagung der <strong>Wasser</strong>chemischen<br />
Gesellschaft, 10.–12.05.2010, Bayreuth,<br />
S. 19–21.<br />
2. Aktivitäten des Technologiezentrums <strong>Wasser</strong>, Karlsruhe<br />
Dr. Josef Klinger<br />
Das Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW) ist eine organisatorisch<br />
und haushaltsmäßig verselbstständigte,<br />
gemeinnützige Einrichtung des DVGW und verfügt über<br />
Standorte in Karlsruhe, Dresden und Hamburg. Das TZW<br />
bildet unter dem Dach des DVGW die größte tragende<br />
Säule. Das TZW bearbeitet auf einer wissenschaftlichtechnischen<br />
Basis und unter Berücksichtigung neuer<br />
Praxiserfahrungen Lösungsvorschläge für konkret<br />
anstehende Fragestellungen für <strong>Wasser</strong>werke und<br />
begleitet aktiv die Umsetzung des DVGW-Regelwerkes.<br />
Dazu richtet das TZW seine angewandte Forschung auf<br />
die Bereiche Analytik, Aufbereitung, Korrosion, Mikrobiologie,<br />
Ressourcenschutz, Verteilung sowie Umweltbiotechnologie<br />
aus. Die Forschungsarbeiten werden im<br />
Auftrag der <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen, des<br />
BMBF, des BMWi, des DVGW, der EU sowie weiterer<br />
In stitutionen durchgeführt. Ab 01.04.2010 hat Dr. Josef<br />
Klinger die Nachfolge von Prof. Dr. Wolfgang Kühn als<br />
Geschäftsführer des TZW angetreten Dr. Klinger studierte<br />
in Karlsruhe Chemie und hat seine Promotion<br />
bereits am TZW durchgeführt. Seit 2007 war er Leiter<br />
der Prüfstelle <strong>Wasser</strong> und Abteilung Korrosion.<br />
Im Berichtszeitraum wiesen die wissenschaftlichtechnischen<br />
Untersuchungen des TZW verschiedene<br />
Schwerpunkte auf, die im Folgenden näher beleuchtet<br />
werden.<br />
Die Abteilung Analytik konzentrierte sich im Bereich<br />
Forschung und Entwicklung auf die Themenschwerpunkte<br />
<strong>Wasser</strong>qualität, Entwicklung von selektiven und<br />
sensitiven Analysenmethoden sowie praxisnahen Studien<br />
zu Vorkommen, Verbleib, Entfernung und Bewertung<br />
von organischen Spurenstoffen im <strong>Wasser</strong>kreislauf.<br />
Dazu wurden im Berichtszeitraum 14 Forschungsvorhaben<br />
mit unterschiedlichen Fragestellungen<br />
be arbeitet. Von besonderem Interesse sind derzeit<br />
die Bestimmung, Identifizierung und toxikologische<br />
Be wertung von Oxidations- und Desinfektionsnebenprodukten,<br />
die beispielsweise bei der Ozonung oder bei<br />
der Desinfektion mit Chlor aus unkritischen Vorläufersubstanzen<br />
gebildet werden. Daneben wird in weiteren<br />
Forschungsprojekten der Frage nachgegangen, welche<br />
stabilen Transforma tionsprodukte beim mikrobiellen<br />
Abbau im Untergrund bei unterschiedenen Redox-<br />
Verhältnissen entstehen können. Für die beinahe<br />
unüberschaubare Anzahl von per- und polyfluorierten<br />
Einzelverbindungen wird derzeit im Rahmen eines<br />
Forschungsprojekts ein summa rischer Parameter für<br />
fluororganische Verbindungen entwickelt. Weitere Projekte<br />
befassen sich vor allem mit der Zielstellung, durch<br />
Einsatz innovativer Aufbereitungstechniken den Eintrag<br />
von toxischen und persistenten Spurenstoffen in die<br />
Gewässer soweit wie möglich zu vermindern, wobei die<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 757
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
Bild 6. Installation eines Belüftungssystems im <strong>Wasser</strong>werk Bantul<br />
(Indonesien).<br />
analytische Abteilung in der Regel die analytische<br />
Bestimmung und Bewertung der Befunde übernimmt.<br />
Auch im Bereich der Neu- bzw. Weiterentwicklung von<br />
Analysenverfahren und -systemen konnten bei praktischen<br />
Arbeiten zur Online-Ana lytik bzw. quasi-kontinuierlichen<br />
Bestimmung von Qualitätsparametern wichtige<br />
Fortschritte erzielt werden.<br />
In der Abteilung Grundwasser und Boden war das<br />
systematische, prozessbasierte Risikomanagement in<br />
der Trinkwasserversorgung („Water Safety Plans“, WSP)<br />
im Berichtszeitraum Gegenstand vieler Aktivitäten. So<br />
wurde im Auftrag eines WVU der am TZW weiterentwickelte<br />
Ansatz zur GIS-gestützten Risikobewertung im<br />
Einzugsgebiet angewandt. In einem weiteren Projekt<br />
wurde damit begonnen, für ein <strong>Wasser</strong>werk gemeinsam<br />
mit dem <strong>Wasser</strong>versorger ein Risikomanagementsystem<br />
gemäß DVGW-Hinweis W 1001 zu erarbeiten und<br />
umzusetzen. Die Erfahrungen zum Thema „Sicherheit in<br />
der Trinkwasserversorgung“ wurden durch Vorträge auf<br />
Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen des DVGW<br />
eingebracht. Daneben wurden Gefährdungsanalysen<br />
für <strong>Wasser</strong>werke nach diesem Ansatz erarbeitet, um<br />
etwa die Erfordernis von aufbereitungstechnischen<br />
Maßnahmen oder die Auswirkungen von geplanten<br />
Fließgewässerrenaturierungen zu beurteilen. Wie in den<br />
Vorjahren wurde die baden-württembergische Grundwasserdatenbank<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung (GWD-WV) wissenschaftlich<br />
begleitet und das mittlerweile zwanzig<br />
Jahre laufende Grund- und Zusatzmessprogramm<br />
gesondert ausgewertet.<br />
In der Abteilung Technologie stand der Fokus der<br />
Forschungsprojekte beim Einsatz biologisch abbaubarer<br />
Antiscalants bei der zentralen Enthärtung mittels<br />
Membrantechnik, der Umsetzung des DVGW-Regelwerks<br />
bei der UV-Desinfektion und der standortangepassten<br />
Trinkwasseraufbereitung in Asien. Beispielsweise<br />
wurde im Rahmen eines BMBF-Forschungsvorhabens<br />
(Förderkennzeichen 02WM0894) in Indonesien<br />
eine geeignete Prozessführung zur Behandlung saurer,<br />
stark manganhaltiger Grundwässer, wie sie in den Tropen<br />
häufig angetroffen werden, entwickelt. Dies wurde<br />
bei einem bestehenden <strong>Wasser</strong>werk, dessen Rohwasser<br />
sehr hohe Mangangehalte von 3 mg/L aufweist, kostengünstig<br />
und erfolgreich in die Praxis umgesetzt (Bild 6).<br />
Damit ist das Werk als eines von wenigen <strong>Wasser</strong>werken<br />
in Indonesien in der Lage, die WHO-Trinkwasserempfehlungen<br />
einzuhalten. Gleichzeitig wurde der<br />
Durchsatz verdoppelt. Weiterhin wurden im Rahmen<br />
direkter Kooperationen der Abteilung Technologie mit<br />
den Versorgungsunternehmen und Kommunen aus<br />
dem Inland insbesondere Fragestellungen zur zentralen<br />
Enthärtung und zur adsorptiven Entfernung von Spurenstoffen<br />
bearbeitet. Anfragen von einem Versorger<br />
aus Singapur konzentrierten sich auf Verfahren zur<br />
Aufbereitung von huminstoffreichem Seewasser.<br />
Der Bereich Prüfstelle <strong>Wasser</strong> und Korrosion befasste<br />
sich mit hygienischen Prüfungen für Produkte und<br />
Materialien für den Einsatz im Trinkwasserbereich.<br />
Mechanische Produkt- und Armaturenprüfungen, die<br />
nach den Vorgaben entsprechender Regelwerke durchzuführen<br />
sind, waren ein weiterer Schwerpunkt. Weitere<br />
Prüfaktivitäten ergaben sich im Bereich von Anlagen zur<br />
UV-Desinfektion. Hierbei führt die Prüfstelle <strong>Wasser</strong> zwischenzeitlich<br />
alle Prüfungen, die sich aus den Anforderungen<br />
von DVGW Arbeitsblatt W 294 für den Zertifizierungsprozess<br />
ergeben, in Eigenregie durch. Zur Durchführung<br />
von Prüfungen steht zwischenzeitlich eine<br />
neue Prüfhalle zur Verfügung, die im Laufe des Jahres<br />
2010 soweit gebäude- und prüftechnisch ausgestattet<br />
wurde, dass alle Prüfstände und Prüfapparaturen, teilweise<br />
mit technischen Neuerungen und Erweiterungen,<br />
wieder in Betrieb genommen werden konnten. Durch<br />
diese Erweiterungsmaßnahme kann somit sichergestellt<br />
werden, dass auch in Zukunft die über 100 verschiedenen<br />
Prüfungen, für die die Prüfstelle <strong>Wasser</strong><br />
akkreditiert ist, zeitnah und zur Kundenzufriedenheit<br />
durchgeführt werden können. Der Bereich Korrosion<br />
fokussierte seine Tätigkeiten im Berichtszeitraum einerseits<br />
auf die Migration von Legierungselementen aus<br />
metallenen Werkstoffen. Andererseits wurde die Aufklärung<br />
und Begutachtung von Schadensfällen an metallenen<br />
Bauteilen weiterentwickelt. Die Tätigkeiten blieben<br />
nicht auf den Bereich Trinkwasser beschränkt. Auch<br />
Schäden, die bei der technischen Verwendung von <strong>Wasser</strong><br />
aufgetreten sind, wurden begutachtet und bewertet.<br />
Durch Mitarbeit in nationalen und internationalen<br />
Normungsgremien wird eine schnelle Überführung von<br />
neuen Erkenntnissen in die Praxis sichergestellt.<br />
Juli/August 2011<br />
758 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
FACHBERICHTE<br />
Die Abteilung Mikrobiologie setzte neu etablierte<br />
Analysenverfahren zum Nachweis von Bakteriophagen<br />
zur zusätzlichen Charakterisierung der Rohwasserqualität<br />
ein. Insbesondere für <strong>Wasser</strong>versorger, die Uferfiltrat<br />
als Rohwasser nutzen, lässt sich damit der Rückhalt<br />
der Uferpassage für Viren beurteilen. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt lag in der Zusammenarbeit mit <strong>Wasser</strong>versorgern<br />
zur Beurteilung der Aufbereitungsnotwendigkeit<br />
in Bezug auf mikrobielle Kontaminationen und zum<br />
anderen die Prüfung der Desinfektionsnotwendigkeit.<br />
Sofern eine Desinfektionsnotwendigkeit gegeben ist,<br />
war zu prüfen, ob eine Abschlussdesinfektion durch<br />
Mittel auf Chlorbasis notwendig ist, oder ob ein Ersatz<br />
durch eine UV-Desinfektion ohne Restgehalte im Leitungsnetz<br />
machbar ist. Hierfür war vor allem das Bakterienvermehrungspotenzial<br />
der Reinwässer (assimilierbarer<br />
organischer Kohlenstoff, AOC) von Bedeutung, da<br />
dies zu Koloniezahlerhöhungen im Leitungsnetz führen<br />
kann, wenn keine Restgehalte an Desinfektionsmitteln<br />
mehr vorhanden sind. Dies ist sowohl dann der Fall,<br />
wenn z. B. von einer Chlorung auf eine UV-Desinfektion<br />
umgestellt wird, als auch, wenn auf eine Desinfektion<br />
völlig verzichtet wird.<br />
Die Abteilung Umweltbiotechnologie und Altlasten<br />
befasste sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung<br />
molekularbiologischer Methoden zum Nachweis von<br />
Viren und Bakterien, der Elimination von pharmazeutischen<br />
Reststoffen und pathogenen Organismen bei<br />
der <strong>Abwasser</strong>reinigung und Grundwasseranreicherung,<br />
der Bewertung von Biomonitoren im Rahmen der<br />
Sicherheitsforschung, dem mikrobiologischen Abbau<br />
von halogenierten Substanzen, der Erweiterung der<br />
An alysenverfahren für heterozyklische Kohlenwasserstoffe<br />
im Rahmen der Bewertung kontaminierter Standorte<br />
und mit der praktischen Umsetzung von integrierten<br />
Konzepten unter Einbindung natürlicher Abbauprozesse<br />
(Natural Attenuation). Beispielsweise lag ein<br />
Arbeitsschwerpunkt im Abschluss eines vom BMBF<br />
geförderten Projektes (Förderkennzeichnen 02WR0753)<br />
zur Ermittlung des Potenzials einer biologischen Reduktion<br />
des Gasdrucks in Zusammenhang mit der passiven<br />
hydraulischen Untergrundsanierung mittels permeablen<br />
reaktiven Wänden (Bild 7).<br />
Die Außenstelle des TZW in Dresden befasst sich mit<br />
den Gebieten <strong>Wasser</strong>verteilung, Trinkwasseraufbereitung<br />
und Trinkwassergüte. Auf dem Gebiet der Verteilung<br />
stand die Optimierung bzw. Außerbetriebnahme<br />
von Anlagen zur Nach- bzw. Sicherheitsdesinfektion, die<br />
Identifizierung und Beseitigung mikrobiologischer Probleme,<br />
die Aufklärung und Beseitigung der Ursachen<br />
von Braunwasserproblemen, die Optimierung oder<br />
Außerbetriebnahme der Dosierung von Korrosionsinhibitoren<br />
und die Entwicklung zustandsorientierter<br />
Spülpläne im Zentrum der Arbeiten. Bei der Aufbereitungstechnologie<br />
wurden schwerpunktmäßig Untersuchungen<br />
zur Ermittlung der Leistungsgrenzen von<br />
Talsperrenwasseraufbereitungsanlagen bei ansteigender<br />
DOC-Konzentration im Rohwasser durchgeführt. In<br />
dem Bereich <strong>Wasser</strong>güte wurden verschiedene Online-<br />
Detektions metho den auf Basis der optischen Spektroskopie<br />
im Bereich von UV-VIS und der Fluoreszenz<br />
weiterentwickelt.<br />
Länderübergreifende Aktivitäten des TZW lagen in<br />
der Mitwirkung beim Aufbau von ACQUEAU, eines<br />
neuen europäischen Forschungsnetzwerkes für das<br />
<strong>Wasser</strong>fach. ACQUEAU ist der erste EUREKA-Cluster, der<br />
sich in Umwelttechnologien bzw. wasserbezogenen<br />
Technologien engagiert. Er hat das Ziel, Innovationen<br />
und praxisnahe Lösungen zu unterstützen sowie neue<br />
Technologien zu entwickeln. ACQUEAU wird von mehr<br />
als 20 Ländern und mehr als 100 Firmen unterstützt. Das<br />
Ziel eines EUREKA-Clusters besteht darin, eine gemeinschaftliche<br />
europäische <strong>Wasser</strong>forschung und technologische<br />
Entwicklungen zum Nutzen des europäischen<br />
<strong>Wasser</strong>sektors zu erleichtern. Das TZW stellt den Second<br />
Vice-Chairman of the Board of Directors und ist im<br />
Bild 7. Vier parallel betriebene Säulensysteme zur Untersuchung der<br />
mikrobiologischen Besiedelung und des Gasaustrags.<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 759
FACHBERICHTE Ausbildung – Lehre und Forschung<br />
Scientific Committee von ACQUEAU vertreten. (http://<br />
www.acqueau.eu)<br />
Das TZW ist weiterhin aktives Mitglied in der GWRC,<br />
Global Water Research Coalition, einer internationalen<br />
Vereinigung zum Informationsaustausch von prioritären<br />
Forschungszielrichtungen im <strong>Wasser</strong>fach. (http://<br />
www.globalwaterresearchcoalition.net)<br />
Der TZW-Newsletter erschien im Berichtsjahr 2010 in<br />
zwei Ausgaben mit Kurzinformationen zu aktuellen Themen<br />
wie beispielsweise der Korrosion und Korrosionsinhibierung<br />
von Kupfer und kupfergebundenen Werkstoffen,<br />
der Umsetzung von N,N-Dimethylsulfamid (DMS )<br />
bei Desinfektionsmaßnahmen mit Chlor oder praktischen<br />
Aspekten an Produkteigenschaften von Aktivkohle. Seit<br />
Dezember erscheint der Newsletter in einem neuen,<br />
attraktiveren Layout. Die TZW-Schriftenreihe wurde um<br />
drei Exemplare erweitert und umfasst nun 47 Bände.<br />
Das TZW richtete im Berichtszeitraum mehrere Veranstaltungen<br />
aus, um den Wissenstransfer zu den Versorgungsunternehmen<br />
zu unterstützen. Beispielsweise<br />
fand das 19. Dresdener Trinkwasserkolloquium am<br />
27. April 2010 unter Teilnahme von ca. 120 Mitarbeitern<br />
aus Versorgungsunternehmen und Behörden statt. Zum<br />
15. TZW-Kolloquium am 1. Dezember 2010 reisten mehr<br />
als 110 Fachleute aus dem <strong>Wasser</strong>fach zum TZW nach<br />
Karlsruhe.<br />
Zusätzlich wurde mit der TZW-Diskussionsreihe eine<br />
Plattform etabliert, um aktuelle Themen unter Fachleuten<br />
zu diskutieren und gemeinsame Handlungsstrategien<br />
festzulegen. In der ersten Veranstaltung am<br />
12. November 2010 trafen sich Experten aus <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen,<br />
DVGW-Gremien und wissenschaftlichen<br />
Forschungseinrichtungen und diskutierten<br />
intensiv die aktuellen Aspekte der Anwendung von<br />
Kornaktivkohle zur Spurenstoffentfernung.<br />
Zur Fortbildung bzw. zur Förderung des Informationsaustausches<br />
unter den Mitarbeitern des TZW wurden<br />
TZW-interne Seminare organisiert. Dazu diskutieren<br />
Mitarbeiter des TZW aktuelle Projekte. Im Jahr 2010<br />
wurden acht dieser Seminare durchgeführt.<br />
Im Berichtsjahr befanden sich am TZW 54 Forschungsvorhaben<br />
in Bearbeitung bzw. wurden im<br />
Berichtsjahr abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum wurden<br />
am TZW 84 Publikationen in Fachzeitschriften sowie<br />
Konferenzunterlagen angefertigt. Davon sind 10 Publikationen<br />
beispielhaft nachstehend aufgeführt. Eine<br />
vollständige Liste der Publikationen sowie Informationen<br />
zu ausgewählten Forschungsvorhaben stehen über<br />
die Homepage des TZW zum Download zur Verfügung<br />
(http://www.tzw.de).<br />
Veröffentlichungen<br />
Sacher, F., Körner, B., Thoma, A., Brauch, H.-J. and Khiari, D.: Behaviour<br />
of brominated and chlorinated flame retardants during drinking<br />
water treatment. Water Science & Technology: Water<br />
Supply 10 (4), 610–617 (2010).<br />
Scheurer, M., Brauch, H.-J., Lange and F. T.: Performance of conventional<br />
multi-barrier drinking water treatment plants for the<br />
removal of four artificial sweeteners. Water Res. 44, 3573–3584<br />
(2010).<br />
Müller, U., Baldauf, G. and Biwer, G.: Ceramic membranes for water<br />
treatment. Water Science and Technology: Water Supply 10<br />
(6), 987–994 (2010).<br />
Tiehm, A., Augenstein, T., Ilieva, D., Schell, H., Weidlich, C. and Mangold,<br />
K.-M.: Bio-electro-remediation: electrokinetic transport<br />
of nitrate in a flow-through system for enhanced toluene<br />
biodegradation. J. Appl. Electrochem. 40, 1263–1268 (2010).<br />
Zhao, H.-P., Schmidt, K. R. and Tiehm, A.: Inhibition of aerobic metabolic<br />
cis-1,2-dichloroethene biodegradation by other chloroethenes.<br />
Water Research 44, 2276–2282 (2010).<br />
Sturm, S., Kiefer, J., Kollotzek, D. and Rogg, J.-M.: Aktuelle Befunde<br />
der Metaboliten von Tolylfluanid und Chloridazon in den zur<br />
Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen<br />
Baden-Württembergs. <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 10/2010,<br />
950–959 (2010).<br />
Lipp, P., Sacher, F. and Baldauf, G.: Removal of organic micro-pollutants<br />
during drinking water treatment by nanofiltration and<br />
reverse osmosis. Desalination and Water Treatment 13, 226–<br />
237 (2010).<br />
Kiefer, J., Ball, Th., Karch, U. und Köppel, W.: Energiepflanzenanbau<br />
und Gewässerschutz. In: Graf, F.; Bajohr, S. (Hrsg.; 2010): Biogas:<br />
Erzeugung, Aufbereitung, Einspeisung. Oldenbourg<br />
Indus trieverlag GmbH München, ISBN 978-3-8356-3211-0,<br />
339–369 (2010).<br />
Korth, A., Richardt, S. und Wricke, B.: Optimierte Spülpläne für Trinkwassernetze.<br />
DVGW energie|wasser-praxis 05/2010, 66–71<br />
(2010).<br />
Stauder, S., Hambsch, B. und Baldauf, G.: Trübstoffe und Partikel im<br />
Schwimm- und Badebeckenwasser. AB Archiv des Badewesens<br />
03, 156–165 (2010).<br />
Autoren<br />
Eingereicht: 18.05.2011<br />
Prof. Dr.-Ing. Henning Bockhorn<br />
Prof. Dr. rer. nat. Fritz H. Frimmel<br />
Prof. Dr.-Ing. Thomas Kolb<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert<br />
Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts<br />
für Technologie (KIT) |<br />
Engler-Bunte-Ring 1 |<br />
D-76131 Karlsruhe<br />
Dr. rer. nat. Josef Klinger<br />
TZW: DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> |<br />
Karlsruher Straße 84 |<br />
D-76139 Karlsruhe<br />
Juli/August 2011<br />
760 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNGEN<br />
Buchbesprechungen<br />
Handbuch des Deutschen <strong>Wasser</strong>rechts<br />
Neues Recht des Bundes und der Länder<br />
Herausgegeben von Prof. Dr. iur. Heinrich Frhr. von<br />
Lersner, Dr. jur. Konrad Berendes, Michael Reinhardt.<br />
Begründet von Prof. Dr. jur. Alexander Wüsthoff<br />
und Prof. Dr.-Ing. E. h. Walther Kumpf. Berlin,<br />
Bielefeld, München: Erich Schmidt Verlag 2011.<br />
Loseblatt-Kommentar einschließlich der 3. Lieferung,<br />
16172 S. in 8 Ordnern, Preis: € 268,00, ISBN<br />
978-3-503-00011-1.<br />
Das Werk wird regelmäßig durch Nachlieferungen<br />
ergänzt, und bringt das Werk auf den<br />
neuesten Stand.<br />
Aktuelle Kommentierungen stehen zu folgenden<br />
Gesetzen zur Verfügung:<br />
<strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
<strong>Abwasser</strong>abgabengesetz<br />
Wasch- und Reinigungsmittelgesetz<br />
Bundeswasserstraßengesetz.<br />
In den über 50 Jahren seines Bestehens hat sich das<br />
Handbuch des Deutschen <strong>Wasser</strong>rechts einen führenden<br />
Platz als Standardwerk in der Fachwelt gesichert.<br />
Als ständiges Arbeitsmittel in der Praxis ist es<br />
ebenso anerkannt wie als Nachschlagewerk zu Spezialfragen.<br />
Das vielseitige Werk enthält Vorschriften<br />
und Verordnungen, die nicht leicht zugänglich sind.<br />
Die wichtigsten Vorteile, die dieses Werk bietet:<br />
Schneller Überblick über die komplexe Materie,<br />
die einzelnen Kommentierungen sind sehr<br />
ausführlich und gut verständlich.<br />
Alle relevanten wasserrechtlichen Vorschriften<br />
des Bundes und der Länder stehen zur Verfügung.<br />
Jedes Bundesland ist in diesem Werk mit einem<br />
Mitarbeiter vertreten, der sich speziell um die<br />
Vorschriften aus diesem Bundesland kümmert<br />
und sich hier besonders gut auskennt.<br />
Als „HDW“-Abonnent hat man einen kostenlosen Zu -<br />
gang zur Umweltrechtsdatenbank unter www.<br />
UMWELTdigital.de! Hier stehen zusätzlich laufend<br />
aktualisierte wasserrechtliche Normen zur Ver fügung.<br />
Mit der 3. Ergänzungslieferung werden beim hessischen<br />
Landesrecht das neue <strong>Wasser</strong>gesetz und die<br />
neue <strong>Abwasser</strong>eigenkontrollverordnung in das<br />
HDW aufgenommen. Außerdem wird das Saarländische<br />
<strong>Wasser</strong>gesetz an die umfangreichen Änderungen<br />
vom November 2010 angepasst.<br />
Bestellmöglichkeit online:<br />
www.ESV.info/978 3 503 00011 1<br />
Hygiene/Präventivmedizin/<br />
Umweltmedizin systematisch<br />
Herausgeber: Prof. Dr. Klaus Fiedler und Prof. Dr.<br />
Michael Wilhelm. Klinische Lehrbuchreihe, 2., neubearb.<br />
Auflage. Bremen: UNI-MED Verlag AG 2011.<br />
544 S., 156 Abb., Preis: € 34,80, ISBN 978-3-8374-<br />
1180-5.<br />
Seit dem Erscheinen der Erstauflage hat sich auf<br />
dem Gebiet der Hygiene und Umweltmedizin – insbesondere<br />
durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse,<br />
aktuelle Rechtsvorschriften und Empfehlungen<br />
– enorm viel geändert. Fundiertes aktuelles<br />
Wissen auf diesen Gebieten ist für den vorbeugenden<br />
Gesundheitsschutz nach wie vor unverzichtbar.<br />
Zwar sind heute in der Menschheitsgeschichte nie<br />
gekannte Fortschritte bezüglich Lebensverlängerung<br />
und Verbesserung der Lebensqualität erreicht<br />
worden. Doch Umweltveränderungen, neue technische<br />
Entwicklungen mit vielfach noch nicht<br />
bekanntem Risikopotenzial oder auch das (Wieder-)<br />
Auftreten alter und neuer Krankheitserreger durch<br />
zunehmende Antibiotika-Resistenz stellen die<br />
Menschheit im 21. Jahrhundert vor ganz neue Herausforderungen.<br />
Das komplett aktualisierte Lehrbuch wendet sich<br />
vor allem an Studenten der Medizin, Zahnmedizin<br />
und anderer Fachrichtungen mit Bezug zur Hygiene<br />
und Umweltmedizin sowie an Ärzte aller Fachrichtungen,<br />
aber auch an sonstige Fachkräfte, die auf<br />
dem Gebiet der Hygiene, der Umweltmedizin und<br />
des Umweltschutzes tätig sind sowie an interessierte<br />
Bürger. Es vermittelt unter anderem Kenntnisse der<br />
Lebensmittel- und Ernährungshygiene, des Infektionsschutzes,<br />
der <strong>Wasser</strong>-, <strong>Abwasser</strong>-, Boden- und<br />
Abfallstoffhygiene, der exogenen Krebsnoxen, der<br />
Lufthygiene und des Lärmschutzes.<br />
Bestell-Hotline<br />
UNI-MED Verlag AG,<br />
Bremen<br />
Fax + 49 (0) 421 2041-555<br />
E-Mail: buch@uni-med.de<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 761
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Modulare Ventilgehäuse: multifunk tionale<br />
Lösungen, die Platz und Kosten sparen<br />
Kompaktes<br />
Design ohne<br />
konventionelle<br />
Verrohrung:<br />
Die modularen<br />
Ventilgehäuse<br />
von Bürkert<br />
ermög lichen<br />
individuelle<br />
und innovative<br />
Ventillösungen.<br />
Bei modernen Ventillösungen sind neben hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit zunehmend kompakte<br />
Maße und Flexibilität für die Anpassung an individuelle Anwendungen gefordert. Um diesen Anforderungen<br />
gerecht zu werden, hat der Fluidtechnikspezialist Bürkert ein innovatives, modulares Ventilgehäusekonzept<br />
auf Basis der bewährten Ventiltypen 2000 INOX, ELEMENT und CLASSIC entwickelt.<br />
Zu den großen Herausforderungen<br />
beim fluidischen Verbinden<br />
von Ventilen und Sensoren in der<br />
Prozessindustrie zählen die Planung<br />
und Installation einer einfachen,<br />
kostengünstigen und leckagefreien<br />
Verrohrung, die möglichst wenig<br />
Bauraum benötigt. Mit einem innovativen,<br />
modularen Ventilgehäusekonzept<br />
bietet Bürkert Anlagenplanern,<br />
Rohrleitungsbauern und<br />
In stallateuren eine Lösung, die eine<br />
konventionelle Verrohrung teilweise<br />
überflüssig macht.<br />
Multifunktionsblock<br />
2000 INOX<br />
Mit dem modularen Blocksystem<br />
auf Basis des Ventiltyps 2000 INOX<br />
lassen sich bei Nennweite DN10 auf<br />
kleinstem Raum komplexe Lösungen<br />
umsetzen. Die anreihbaren<br />
Ventilgehäuse werden bei diesem<br />
System über Zugstangen fest miteinander<br />
verschraubt. Der Montageaufwand<br />
reduziert sich erheblich,<br />
konventionelle Rohrverbindungselemente<br />
wie z. B. Bögen oder<br />
T- Stücke entfallen gänzlich. Durch<br />
die Beseitigung potenziell undichter<br />
Stellen, einen geringeren Materialeinsatz<br />
und minimierten Platzbedarf<br />
lässt sich durch Einsatz des<br />
Multifunktionsblocks die gesamte<br />
Systemleistung spürbar verbessern.<br />
Die Blöcke können in Anlagen zentrale<br />
Grundfunktionen wie das Verteilen,<br />
Sammeln und Mischen sowie<br />
die Integration von Sensorik, Filtern<br />
und Rückschlagventilen Platz sparend<br />
umsetzen.<br />
Multifunktionsblöcke<br />
ELEMENT und CLASSIC<br />
Bei den modularen Systemlösungen<br />
auf Basis der Ventiltypen ELE-<br />
MENT und CLASSIC in DN20 und<br />
DN25 werden mehrere Ventilgehäuse<br />
durch ein Orbitalschweißverfahren<br />
(WIG) zu einem Block<br />
zusammengefügt. Die Maße der<br />
Grundgehäuse sind so ausgelegt,<br />
dass dabei handelsübliche Orbitalschweißzangen<br />
eingesetzt werden<br />
können. Die so entstehende Ventillösung<br />
ist durch die verschweißten<br />
Gehäuse extrem robust und kompakt.<br />
Die Gehäuse lassen sich mit<br />
allen Antrieben aus dem Bürkert-<br />
Standardprogramm kombinieren,<br />
die wiederum gemeinsam mit<br />
einem Positionsrückmelder oder<br />
Positioner verwendet werden können.<br />
Darüber hinaus lassen sich<br />
auch hier Sensoren für die Messung<br />
von Durchfluss, Temperatur oder<br />
Druck integrieren.<br />
Zielgruppe für das neue Ventilgehäusekonzept<br />
sind OEMs sowie<br />
Anlagenbauer und Integratoren,<br />
denen für die Lösung fluidischer<br />
Funktionen nur ein begrenzter Einbauraum<br />
zur Verfügung steht. Durch<br />
den deutlich reduzierten Aufwand<br />
für die Verrohrung werden nicht nur<br />
Platz, sondern auch Kosten für eine<br />
aufwändige Planung und Installation<br />
sowie Material eingespart. Weniger<br />
Rohrverbindungen bedeuten zudem<br />
weniger potenzielle Schwachstellen<br />
und eine erhöhte Funktionssicherheit<br />
durch ein geringeres Leckagerisiko.<br />
Aber auch Endanwender in der<br />
Industrie können direkt von den Vorteilen<br />
der innovativen Lösung profitieren.<br />
Das Konzept wurde unter der<br />
Prämisse der „Mass Customization“<br />
entwickelt und ermöglicht auch die<br />
kostengünstige Fer tigung kundenspezifischer<br />
Lösungen in kleinen<br />
Stückzahlen.<br />
Kontakt:<br />
Bürkert Fluid Control Systems,<br />
Bürkert Werke GmbH & Co. KG,<br />
Christian-Bürkert-Straße 13–17,<br />
D-74653 Ingelfingen,<br />
Tel. (07940) 10-91 111,<br />
Fax (079 40) 10-91 448,<br />
E-Mail: info@buerkert.de,<br />
www.buerkert.de<br />
Juli/August 2011<br />
762 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Edelstahldruckerhöhungsanlagen für Prozesswässer<br />
Hydromono CME und Hydro Twin CME von Grundfos<br />
Gerade in der industriellen <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
werden Druckerhöhungsanlagen<br />
benötigt, die<br />
korrosionsresistent sowie kompakt<br />
sind und sich leicht in Bussysteme<br />
(z. B. Profibus) integrieren lassen.<br />
Mit den neuen Hydromono CME<br />
und Hydro Twin CME Baureihen hat<br />
Grundfos zwei neue Druckerhöhungsanlagen<br />
im Programm, die<br />
auf Basis der neuen horizontalen<br />
Industriekreiselpumpe CME aufgebaut<br />
sind.<br />
Während die Hydromono CME<br />
eine drehzahlgeregelte vollautomatisch<br />
arbeitende Einzelpumpenanlage<br />
ist, werden für die Hydro Twin<br />
CME zwei Pumpen der Baureihe<br />
CME mit übergeordneter Druckerhöhungsanlagen-Regelkarte<br />
Platz<br />
sparend auf einer Edelstahlgrundplatte<br />
montiert. Beide Anlagentypen<br />
arbeiten nach der Regelungsart<br />
„Konstantdruck“, so dass der<br />
Netzdruck nach der Anlage trotz<br />
unterschiedlicher Abnahmemengen<br />
konstant bleibt. Dank der sanften<br />
Pumpenzu-/abschaltung gehören<br />
Druckschläge der Vergangenheit<br />
an. Mit der Grundfos CIU<br />
Schnittstelle lassen sich beide<br />
Anlagentypen in fast alle gängigen<br />
Leittechniksysteme (z. B. Profibus)<br />
einbinden. Selbstverständlich stehen<br />
bei beiden Anlagentypen auch<br />
traditionelle Ein-/Ausgänge zur Verfügung,<br />
mit denen diverse Anlagenzustandsmeldungen<br />
weitergeleitet<br />
werden können oder beispielsweise<br />
der Sollwert von der Ferne verändert<br />
werden kann.<br />
Beide Anlagentypen sind mit<br />
drehzahlgeregelten Grundfos MGE<br />
Motoren ausgestattet, bei denen<br />
die Pumpenkennlinien in der Software<br />
abgespeichert sind. Somit<br />
kennt die Pumpe stets den aktuellen<br />
Betriebspunkt der Anlage und<br />
kann die Pumpen optimal regeln.<br />
Auf diese Weise wird ein Höchstmaß<br />
an Energieeffizienz sichergestellt.<br />
Dank gleichzeitiger Frequenz- und<br />
Spannungsanpassung (Grundfos<br />
FluxControl) des integrierten Frequenzumformers<br />
wird neben dem<br />
hohen FU-Wirkungsgrad auch ein<br />
Höchstmaß an EMV Sicherheit<br />
erreicht, welches speziell für <strong>Wasser</strong>aufbereitungssysteme<br />
in der<br />
Medizintechnik gefordert wird.<br />
Hydromono CME<br />
Mit bis zu 7m 3 /h bei 5 bar Konstantdruck<br />
ist die Hydromono CME ideal<br />
für die Förderung von Prozess- oder<br />
Rohwasser für die Umkehrosmose<br />
geeignet. Durch zwei Materialausführungen<br />
(1.4301 oder<br />
1.4401) eignet sich die Anlage für<br />
Brauchwässer bis hin zu Prozesswässern<br />
mit geringer Restleitfähigkeit.<br />
Durch den neu konstruierten<br />
5-Wege Edelstahlverteilerblock mit<br />
integriertem Rückflussverhinderer<br />
konnte die Bauform der Anlage sehr<br />
kompakt ausgeführt werden. Ein<br />
0-16 bar Edelstahlmanometer, Edelstahldrucksensor<br />
und ein 2 L Vollmembranausdehnungsgefäß<br />
mit<br />
Edelstahlanschluss komplettieren<br />
den hydraulischen Aufbau.<br />
Die Basisbedienung, wie Start/<br />
Stopp oder Solldruckeinstellung,<br />
erfolgt einfach und unkompliziert<br />
über die Bedientasten am Motor.<br />
Weitergehende Parametrierung<br />
und Datenabfrage (z. B. Tastensperre,<br />
Klartextfehlermeldungen<br />
mit Zeitstempel) erfolgt mit der<br />
Grundfos Fernbedienung R100.<br />
Mit dem integrierten Trockenlaufschutz<br />
überwacht sich die<br />
Hydromono CME selbst, da ständig<br />
eine Betriebspunktüberwachung<br />
über das in der Pumpe abgespeicherte<br />
Pumpenkennfeld erfolgt.<br />
Dadurch werden externe Trockenlaufüberwachungseinrichtungen<br />
überflüssig.<br />
Hydro Twin CME.<br />
Hydro Twin CME<br />
Mit dem, auf den ersten Blick etwas<br />
ungewöhnlichen mechanischen<br />
Aufbau, konnte die Grundfläche<br />
gegenüber einer traditionell aufgebauten<br />
Mehrpumpendruckerhöhungsanlage<br />
deutlich reduziert<br />
werden. Gerade bei <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
in Containern spielt<br />
Kompaktheit eine wichtige Rolle.<br />
Durch die beiden 360 ° drehbaren<br />
Edelstahlanschlussverteiler kann<br />
der Saug- und Druckabgang in jede<br />
gewünschte Anschlussposition ge -<br />
dreht werden.<br />
Bei der Hydro Twin erfolgt die<br />
Bedienung genauso wie bei der<br />
Hydromono CME, sodass bei beiden<br />
Anlagen eine unkomplizierte Bedienung<br />
sichergestellt ist.<br />
Da für beide Anlagentypen identische<br />
Pumpenmodelle verwendet<br />
werden, erreicht die Hydro Twin<br />
CME einen maximalen Volumenstrom<br />
von 14 m 3 /h bei 5 bar Konstantdruck<br />
über die gesamte<br />
Pumpenkennlinie.<br />
Kontakt:<br />
GRUNDFOS GMBH,<br />
Schlüterstraße 33,<br />
D-40699 Erkrath,<br />
Tel. (0211) 92969-0,<br />
Fax (0211) 92969-3699,<br />
www.grundfos.de<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 763
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Kontakt:<br />
BIBUS GmbH,<br />
Hansjörg Kistler,<br />
Lise-Meitner-Ring 13,<br />
D-89231 Neu-Ulm,<br />
Tel. (0731) 20769-613,<br />
Fax (0731) 20769-620,<br />
E-Mail: ki@bibus.de<br />
www.bibus.de<br />
Reproduzierbar<br />
Die Durchflusswerte der neuen<br />
CKD Drosselrückschlagventilserie<br />
DSC lassen sich dank der Einstellskala<br />
ganz einfach reproduzieren.<br />
Dadurch verringert man bei mehrfacher<br />
identischer Einstellung die<br />
Arbeitszeit erheblich. Außerdem hat<br />
man eine einfache und ablesbare<br />
Kontrolle des eingestellten Wertes.<br />
Die Drossel überzeugt durch die<br />
linearen Durchflusswerte. Die CKD-<br />
Serie ist in den Größen R 1/8-1/2“<br />
und für die Schlauchgrößen 4-12<br />
mm erhältlich.<br />
CAD-Daten erhältlich<br />
Katalog erhältlich<br />
Schutz vor Ablagerungen bei der Umkehrosmose<br />
durch Kohlendioxid<br />
Die <strong>Wasser</strong>werke in Deutschland betreiben teilweise einen erheblichen Aufwand, um allen Einwohnern qualitativ<br />
hochwertiges Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört unter anderem die Verringerung des<br />
Härtegrades durch Membranverfahren wie Nanofiltration und Umkehrosmose. Um die Membranoberflächen<br />
vor Ablagerungen zu schützen, kommt gelöstes Kohlendioxid zum Einsatz. Dadurch halten die Membranen<br />
länger, die zudosierte Menge weiterer chemischer Zusatzstoffe kann geringer ausfallen, das Konzentratwasser<br />
wird nicht belastet – also ein Plus für Wirtschaftlichkeit und Umwelt.<br />
Zu hartes <strong>Wasser</strong> führt zur Verkalkung<br />
z. B. von Haushaltsgeräten<br />
und erhöht so den Verbrauch von<br />
Wasch- und Spülmitteln, es beeinträchtigt<br />
Geschmack und Aussehen<br />
dafür empfindlicher Speisen und<br />
Getränke und verursacht Ablagerungen<br />
und Inkrustierungen in den<br />
wasserführenden Rohrleitungen.<br />
Von den Vorteilen durch den Einsatz<br />
von Kohlendioxid profitiert jetzt<br />
auch das <strong>Wasser</strong>werk Aistaig in<br />
Oberndorf im Landkreis Rottweil am<br />
oberen Neckar. Der Zweckverband<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgungsgruppe Kleiner<br />
Heuberg versorgt über das im<br />
Oktober 2010 sanierte und erweiterte<br />
<strong>Wasser</strong>werk 27 Gemeinden mit<br />
insgesamt rund 32 560 Einwohnern<br />
Der CO 2 -Tank im <strong>Wasser</strong>werk Aistag.<br />
mit Trinkwasser. Durch die von der<br />
dreher & stetter Ingenieurgesellschaft<br />
mbH aus Empfingen geplante<br />
Erweiterung konnte die Aufbereitungsleistung<br />
um etwa 35 % auf<br />
rund 1,35 Mio. Kubikmeter pro Jahr<br />
erhöht werden. Die neue Aufbereitungsanlage<br />
im <strong>Wasser</strong>werk Aistaig<br />
senkt mit Hilfe von Membranverfahren<br />
den Härtegrad des Trinkwassers<br />
von 21 °dH auf 12 °dH. Dabei werden<br />
die Härtebildner Calcium und Magnesium<br />
durch die Membranmodule<br />
wirkungsvoll zurückgehalten. Zu -<br />
sätzlich reduzieren sie die Konzentrationen<br />
an Sulfat und Nitrat sowie<br />
die mikrobiologische Belastung des<br />
Trinkwassers.<br />
Entscheidend für die Effizienz der<br />
Membranfiltration ist dabei der<br />
Schutz der Membranoberflächen vor<br />
Ablagerungen vor allem von Calciumcarbonat<br />
und Calciumsulfat. Solche<br />
Ablagerungen (engl. Scaling)<br />
können die Membranen verblocken.<br />
Die Zugabe von gelöstem Kohlendioxid<br />
verhindert dies und verlängert<br />
so die Standzeiten der Membranmodule.<br />
Gleichzeitig verringert sich die<br />
Bedarfsmenge für das zweite „Antiscalant“<br />
(Phosphonat). Diese Effekte<br />
verbessern die Wirtschaftlichkeit der<br />
Aufbereitung nachhaltig.<br />
Da gelöstes Kohlendioxid ein<br />
natürlicher <strong>Wasser</strong>bestandteil ist,<br />
wird die Umwelt beim Entsorgen<br />
des Konzentratwassers nicht zusätzlich<br />
belastet. Andere Zusatzstoffe<br />
wie Polyacrylate, Polyphosphate<br />
usw., die ebenfalls als Antiscalants<br />
zum Einsatz kommen, sind hier eher<br />
kritisch zu bewerten.<br />
Air Liquide liefert das Gas sowie<br />
das entsprechende Equipment<br />
(Regelschrank und CS-Düsen für die<br />
Dosiertechnik) bedarfsgerecht. Da<br />
das <strong>Wasser</strong>werk Aistaig in einem<br />
Wohngebiet liegt, wurde als Besonderheit<br />
der 10-Tonnen-Vorratsbehälter<br />
für das Kohlendioxid in einer<br />
Grube mit entsprechender Überwachungstechnik<br />
installiert.<br />
Kontakt:<br />
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH,<br />
Dipl.-Phys. Berit Franz,<br />
Hans-Günther-Sohl-Straße 5,<br />
D-40235 Düsseldorf,<br />
Tel. (0211) 6699-278,<br />
Fax (0211) 6699-4888,<br />
E-Mail: berit.franz@airliquide.com,<br />
www.airliquide.de<br />
Juli/August 2011<br />
764 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Impressum<br />
INFORMATION<br />
Das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Die technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>versorgung, Gewässerschutz,<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung und <strong>Abwasser</strong>technik.<br />
Organschaften:<br />
Zeitschrift des DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
des Bundesverbandes der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e. V. (BDEW),<br />
der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.<br />
(figawa),<br />
der DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
(ÖVGW),<br />
des Fachverbandes der Gas- und Wärme versorgungsunternehmen,<br />
Österreich,<br />
der Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein (AWBR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke e. V. (ARW),<br />
der Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr (AWWR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)<br />
Herausgeber:<br />
Dr.-Ing. Rolf Albus, Gaswärme Institiut e.V., Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Ruhrverband, Essen<br />
Dipl.-Ing. Heiko Fastje, EWE Netz GmbH, Oldenburg<br />
Prof. Dr. Fritz Frimmel, Engler-Bunte-Institut, Universität (TH) Karlsruhe<br />
Prof. Dr. -Ing. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart (federführend <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>)<br />
Prof. Dr. Winfried Hoch, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Klaus Homann (federführend Gas|Erdgas),<br />
Thyssengas GmbH, Dortmund<br />
Dipl.-Ing. Jost Körte, RMG Messtechnik GmbH, Butzbach<br />
Prof. Dr. Matthias Krause, Stadtwerke Halle, Halle<br />
Dipl.-Ing. Klaus Küsel, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau<br />
GmbH, Erkrath<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
Stuttgart<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert, EBI, Karlsruhe<br />
Dr. Karl Roth, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Hans Sailer, Wiener <strong>Wasser</strong>werke, Wien<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR<br />
BauAss. Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Aggerverband, Gummersbach<br />
Dr.-Ing. Walter Thielen, DVGW e. V., Bonn<br />
Dr. Anke Tuschek, BDEW e. V., Berlin<br />
Martin Weyand, BDEW e. V., Berlin<br />
Redaktion:<br />
Hauptschriftleitung (verantwortlich):<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München,<br />
Tel. (0 89) 4 50 51-3 18, Fax (0 89) 4 50 51-3 23,<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
Redaktionsbüro im Verlag:<br />
Sieglinde Balzereit, Tel. (0 89) 4 50 51-2 22,<br />
Fax (0 89) 4 50 51-3 23, e-mail: balzereit@oiv.de<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Jan-Ulrich Arnold, Technische Unternehmens -<br />
beratungs GmbH, Bergisch Gladbach<br />
Prof Dr. med. Konrad Botzenhart, Hygiene Institut der Uni Tübingen,<br />
Tübingen<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Wolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr<br />
München, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Abfalltechnik, Neubiberg<br />
Dr. rer. nat. Klaus Hagen, Krüger WABAG GmbH, Bayreuth<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW GmbH, Mülheim/Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, TU Berlin, Berlin<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Reinhold Krumnack, DVGW, Bonn<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. Karl Morschhäuser, FIGAWA, Köln<br />
Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Bieske und Partner GmbH, Lohmar<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Universität Hannover<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doering, Hannover<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl, Techn. Universität Dresden, Dresden<br />
Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann, DVGW-Forschungsstelle TUHH,<br />
Hamburg<br />
Verlag:<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145,<br />
D-81671 München, Tel. (089) 450 51-0, Fax (089) 450 51-207,<br />
Internet: http://www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Carsten Augsburger, Jürgen Franke, Hans-Joachim Jauch<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Essen,<br />
Tel. (0201) 82002-35 e-mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Mediaberatung:<br />
Inge Matos Feliz, im Verlag,<br />
Tel. (089) 45051-228, Fax (089) 45051-207,<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Anzeigenverwaltung:<br />
Brigitte Krawzcyk, im Verlag,<br />
Tel. (089) 450 51-226, Fax (089) 450 51-300,<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 61.<br />
Bezugsbedingungen:<br />
„<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>“ erscheint monatlich<br />
(Doppelausgabe Juli/August). Mit regelmäßiger Verlegerbeilage<br />
„R+S – Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach“ (jeden 2. Monat).<br />
Jahres-Inhaltsverzeichnis im Dezemberheft.<br />
Jahresabonnementpreis:<br />
Inland: € 360,– (€ 330,– + € 30,– Versandspesen)<br />
Ausland: € 365,– (€ 330,– + € 35,– Versandspesen)<br />
Einzelheft: € 37,– + Versandspesen<br />
ePaper als PDF € 330,–, Einzelausgabe: € 37,–<br />
Heft und ePaper € 429,–<br />
(Versand Deutschland: € 30,–, Versand Ausland: € 35,–)<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Studentenpreis: 50 % Ermäßigung gegen Nachweis.<br />
Bestellungen über jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag.<br />
Abonnements-Kündigung 8 Wochen zum Ende des Kalenderjahres.<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen:<br />
Leserservice <strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Postfach 91 61<br />
D-97091 Würzburg<br />
Tel. +49 (0) 931 / 4170-1615, Fax +49 (0) 931 / 4170-492<br />
e-mail: leserservice@oldenbourg.de<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen<br />
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages<br />
strafbar. Mit Namen gezeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt<br />
der Meinung der Redaktion.<br />
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH<br />
Ostring 13, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
© 1858 Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München<br />
Printed in Germany<br />
Juli/August 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 765
INFORMATION Termine<br />
23. Hamburger Kolloquium zur <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
31.08.–01.09.2011, Hamburg-Harburg<br />
GFEU e.V., Eißendorfer Straße 42, 21073 Hamburg, Frau Petersen, Tel. (040) 42878-3207, Fax (040) 42878-2684,<br />
E-Mail: e.petersen@tuhh.de, g.becker@tuhh.de,<br />
http://www.tu-harburg.de/t3resources/aww/Veranstaltungen/Programm_<strong>Abwasser</strong>kolloquium_2011.pdf<br />
Innovative Vertriebsprodukte mit Smart Meter und Smart Home<br />
06.09.2011, Duisburg<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
29. Bochumer Workshop Siedlungswasserwirtschaft – Werterhalt und Erneuerung von <strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
08.09.2011, Bochum<br />
Ruhr-Universität Bochum, Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik, Prof. Dr.-Ing. M. Wichern, Gebäude IA 01/147,<br />
44780 Bochum, Tel. (0234) 32-23049, Fax (0234) 32-14503, E-Mail: siwawi@tub.de, www.rub.de/siwawi<br />
Praxisnahe Projektierung in der Kanalsanierung – Die neuen Technischen Regeln und ihre Folgen für die<br />
Beteiligten – VOB-C-DIN 18326 und ZTV<br />
14.09.2011, Mannheim<br />
Verband zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e.V., Viktoriastraße 28, 68165 Mannheim,<br />
www.sanierungs-berater.de<br />
Druckprüfung von <strong>Wasser</strong>rohrleitungen<br />
21.09.2011, Gera<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH, figawa Service GmbH, Marienburger Straße 15,<br />
50968 Köln, Tel. (0221) 37658–20, Fax (0221) 37658–62, E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung – Verlängerung zur GW 331<br />
22.09.2011, Nürnberg<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH, figawa Service GmbH, Marienburger Straße 15,<br />
50968 Köln, Tel. (0221) 37658–20, Fax (0221) 37658–62, E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
Schwerer Korrosionsschutz – Erstausführung und Instandsetzung<br />
29.–30.9.2011, Frankfurt/Main<br />
GfKORR – Gesellschaft für Korrosionsschutz e.V., Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt/Main,<br />
Tel. (069) 7564-360, E-Mail: gfkorr@dechema.de, www.gfkorr.de<br />
6. Deutsches Symposium für die grabenlose Leitungserneuerung<br />
06.10.2011, Siegen<br />
Universität Siegen, Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät, Department Bauingenieurwesen,<br />
Dipl.-Ing. Alexander Krüger, Paul-Bonatz-Straße 9-11, 57068 Siegen, Tel. (0271) 740-2186, Fax (0271) 740-3112,<br />
E-Mail: sgl@uni-siegen.de, www.sgl.uni-siegen.de<br />
acqua alta 2011<br />
11.–13.10.2011, Hamburg<br />
Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tel. (040) 3569-2081, Fax (040) 3250-9244,<br />
E-Mail: alta09@interplan.de, www.acqua-alta.de<br />
Neue Trinkwasserverordnung<br />
18.10.2011, Mainz<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
Rechtssichere Trinkwasserkommunikation<br />
19.10.2011, Köln<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
10. <strong>Wasser</strong>wirtschaftliche Jahrestagung<br />
07.–08.11.2011, Berlin<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
Juli/August 2011<br />
766 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Einkaufsberater<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser.de/einkaufsberater<br />
Ansprechpartnerin für den<br />
Eintrag Ihres Unternehmens<br />
Inge Matos Feliz<br />
Telefon: 0 89/4 50 51-228<br />
Telefax: 0 89/4 50 51-207<br />
E-Mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Die technisch-wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung
Armaturen<br />
Brunnenservice<br />
Absperrarmaturen<br />
Automatisierung<br />
Prozessleitsysteme<br />
Armaturen<br />
Chemikalien<br />
Be- und Entlüftungsrohre
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Schraubenverdichter<br />
Leckortung<br />
Fernwirktechnik<br />
Korrosionsschutz<br />
Aktiver Korrosionsschutz<br />
Kompressoren<br />
Regenwasser-Behandlung,<br />
-Versickerung, -Rückhaltung<br />
Drehkolbengebläse<br />
Drehkolbenverdichter<br />
Rohrhalterungen und<br />
Stützen<br />
Passiver Korrosionsschutz<br />
Rohrhalterungen
Rohrleitungen<br />
Kunststoffrohrsysteme<br />
Schachtabdeckungen<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Biologische <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Smart Metering<br />
Chemische <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
Kunststoffschweißtechnik<br />
Filtermaterialien<br />
von Anthrazit bis Zeolith<br />
Umform- und<br />
Befestigungstechnik<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung
<strong>Wasser</strong>verteilung und<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
Rohrdurchführungen<br />
Rohrleitungs- und Kanalbau<br />
Übersetzungen<br />
Sonderbauwerke<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Ihr direkter Draht zum Fachmarkt<br />
Inge Matos Feliz<br />
Tel. 089 / 4 50 51-228<br />
Fax 089 / 4 50 51-207<br />
matos.feliz@oiv.de
Beratende Ingenieure (für das <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>fach)<br />
Ing. Büro CJD Ihr Partner für <strong>Wasser</strong>wirtschaft und<br />
Denecken Heide 9 Prozesstechnik<br />
30900 Wedemark Beratung / Planung / Bauüberwachung /<br />
www.ibcjd.de Projektleitung<br />
+49 5130 6078 0 Prozessleitsysteme<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Grundwasserbehandlung<br />
Kanalsanierung<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Schmutz-/Regenwasserableitung<br />
<strong>Wasser</strong>gefährdende Stoffe<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />
Regenerative Energien<br />
Rockenhausen<br />
Erfurt<br />
igr AG<br />
Luitpoldstraße 60 a<br />
67806 Rockenhausen<br />
Tel.: +49 (0)6361 919-0<br />
Fax: +49 (0)6361 919-100<br />
Baden-Airpark<br />
Leipzig<br />
Darmstadt l Freiburg l Homberg l Mainz<br />
Offenburg l Waldesch b. Koblenz<br />
Berlin<br />
Lichtenstein<br />
Bitburg<br />
Zagreb<br />
E-Mail: info@igr.de<br />
Internet: www.igr.de<br />
Herzogenaurach<br />
Niederstetten<br />
• Beratung<br />
• Planung<br />
• Bauüberwachung<br />
• Betreuung<br />
• Projektmanagement<br />
Beratende Ingenieure für:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
Telefon 0511/284690<br />
Telefax 0511/813786<br />
30159 Hannover<br />
Kurt-Schumacher-Str. 32<br />
• Beratung<br />
• Gutachten<br />
• Planung<br />
• Bauleitung<br />
info@scheffel-planung.de<br />
www.scheffel-planung.de<br />
<strong>Wasser</strong> Abfall Energie Infrastruktur<br />
UNGER ingenieure l Julius-Reiber-Str. 19 l 64293 Darmstadt<br />
www.unger-ingenieure.de<br />
DVGW-zertifizierte Unternehmen<br />
Die STREICHER Gruppe steht für Innovation und Qualität. Mit knapp 3.000 Mitarbeitern werden<br />
anspruchsvolle Projekte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene durchgeführt.<br />
Die Zertifizierungen der STREICHER Gruppe umfassen:<br />
DIN EN ISO 9001 GW 11 G 468-1 WHG § 19 I<br />
DIN EN ISO 14001 GW 301: G1: st, ge, pe G 493-1 AD 2000 HPO<br />
SCC** W1: st, ge, gfk, pe, az, ku G 493-2 DIN EN ISO 3834-2<br />
OHSAS 18001 GN2: B W 120 DIN 18800-7 Klasse E<br />
FW 601: FW 1: st, ku<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA, Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Schwaigerbreite 17 Tel.: +49(0)991 330-231 rlb@streicher.de<br />
94469 Deggendorf Fax: +49(0)991 330-266 www.streicher.de<br />
Das derzeit gültige Verzeichnis der Rohrleitungs-Bauunternehmen<br />
mit DVGW-Zertifikat kann im Internet unter<br />
www.dvgw.de in der Rubrik „Zertifizierung/Verzeichnisse“<br />
heruntergeladen werden.
Stellenanzeigen<br />
<strong>Wasser</strong> aus der Tiefe des Bodensees – kühl, klar und in bester Qualität<br />
Der Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung mit Sitz in Stuttgart versorgt als Körperschaft des öffentlichen<br />
Rechts seine 181 Mitglieder (Städte, Gemeinden und andere Zweckverbände) mit insgesamt etwa<br />
vier Millionen Einwohnern mit Trinkwasser bester Qualität aus dem Bodensee. Hierzu betreibt die Bodensee-<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung <strong>Wasser</strong>gewinnungs- und <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen mit einer Kapazität von etwa 9.000<br />
Litern pro Sekunde, ein etwa 1.700 km langes System großkalibriger Leitungen bis an den Nordrand Baden-<br />
Württembergs incl. einer halben Million Kubikmeter Behälterinhalt und diversen Pumpwerken. Mit jährlichen<br />
<strong>Wasser</strong>lieferungen von bis zu 140 Millionen Kubikmetern ist die Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung das größte<br />
Fernwasserversorgungsunternehmen in Deutschland. Gut gepflegte Anlagen, eine hohe Versorgungssicherheit,<br />
beste Trinkwasserqualität, hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und effizientes<br />
Handeln zeichnen den Verband aus.<br />
Zum 1. Oktober 2012 ist die Position des/der<br />
Technischen Geschäftsführers/in<br />
wegen Erreichen der Altersgrenze des derzeitigen Stelleninhabers neu zu besetzen.<br />
Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer verantwortet der/die Technische Geschäftsführer/in die<br />
Leitung des Unternehmens. Zusätzlich zu den laufenden Geschäften stellen sich die beiden Geschäftsführer<br />
den strategischen Herausforderungen der Zukunft, die sich aus den Anforderungen z. B. an die <strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
die <strong>Wasser</strong>qualität, die Unternehmensorganisation und durch das kommunalwirtschaftliche Umfeld<br />
ergeben.<br />
Sie sind Ingenieur/in oder Naturwissenschaftler/in mit einem wissenschaftlichen Hochschulabschluss und<br />
verfügen über mehrjährige Führungserfahrung in einem vergleichbaren versorgungswirtschaftlich orientierten<br />
Unternehmen, über die Fähigkeit strategischen Denkens und über Gestaltungs- und Innovationsfähigkeit<br />
technischer Anlagen. Sie sind gegenüber Kollegen und Verbandsmitgliedern kooperativ und arbeiten gern mit<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, die Sie im Sinne eines modernen Führungsstils motivieren.<br />
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!<br />
Die Bestellung ist anlässlich der Verbandsversammlung der Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung im November 2011<br />
auf acht Jahre vorgesehen; eine Wiederbestellung ist möglich. Die Anstellung erfolgt als Beamter/Beamtin auf<br />
Zeit nach B 4 oder mit einem Sondervertrag.<br />
Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 9. September 2011 an den Verbandsvorsitzenden,<br />
Herrn Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
Hauptstraße 163, 70563 Stuttgart oder an vorsitzender@zvbwv.de.<br />
Nähere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Tel. 0711/973-2222.
Energie Textil Elektro<br />
Medienerzeugnisse<br />
Die BG ETEM ist eine der größten gewerblichen Berufs -<br />
genos senschaften in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung beraten und<br />
betreuen wir ca. 3,6 Mio. Versicherte in rund 237.000 Mitgliedsbetrieben<br />
bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und<br />
Berufskrankheiten.<br />
Unterstützen Sie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz!<br />
Für den Außendienst unserer Präventionsabteilung suchen wir für die<br />
Fachkompetenz Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
DIPLOM-INGENIEURE/INNEN<br />
der Fachrichtungen Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Elektrotechnik<br />
oder eines vergleichbaren Studienganges mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss.<br />
Ihre Aufgabe ist die Beratung und Unterstützung unserer Mitgliedsunternehmen<br />
in allen Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und<br />
des Gesundheitsschutzes. Bei Problemen und Fragen stehen Sie<br />
den Mitgliedsunternehmen partnerschaftlich zur Seite und erarbeiten<br />
gemeinsam Lösungen. Sie setzen sich für die Einhaltung der geforderten<br />
Sicherheitsstandards durch die von Ihnen betreuten Unternehmen<br />
ein. Darüber hinaus schulen Sie Unternehmer/innen und<br />
deren Mitarbeiter/innen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.<br />
Ihr Wohnort sollte in Ihrem zukünftigen Einsatzbereich in den Großräumen<br />
Berlin/Magdeburg, München, Braunschweig, Schwerin/Ham -<br />
burg/Rostock, Stuttgart/Freiburg oder Würzburg/Frankfurt liegen.<br />
Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und waren im Anschluss<br />
mindestens drei Jahre bevorzugt in einem Unternehmen der<br />
Versorgungswirtschaft tätig. Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative und<br />
-verantwortung, gute Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit<br />
aus. Sie können komplexe Zusammenhänge verständlich und überzeugend<br />
darstellen und zeigen in der Zusammenarbeit mit Anderen<br />
Teamgeist und die richtige Balance zwischen Kooperations- und Konfliktfähigkeit.<br />
Sicheres und souveränes Auftreten runden Ihr Profil ab.<br />
Mit einer umfassenden zweijährigen Ausbildung zur Aufsichtsperson<br />
bereiten wir Sie auf Ihre zukünftige Tätigkeit vor.<br />
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsbereich mit einer<br />
qualifikations- und leistungsgerechten Vergütung nach den für<br />
Bundesbeamte geltenden Bestimmungen.<br />
Wir verfolgen das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen<br />
und freuen uns daher besonders über deren Bewerbungen.<br />
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung<br />
bevorzugt berücksichtigt.<br />
Fragen zu Ihrem künftigen Aufgabengebiet beantwortet Ihnen Dipl.-<br />
Ing. Thomas Gindler, Tel. 0211 9335-4257.<br />
Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.bgetem.de.<br />
Sie sind interessiert? Dann senden Sie uns schriftlich oder elektronisch<br />
Ihre aussagekräftige Bewerbung.<br />
BG ETEM<br />
Dieter Wirges (Personalabteilung)<br />
Auf’m Hennekamp 74<br />
40225 Düsseldorf<br />
0211/9335-4371<br />
Wirges.Dieter@bgetem.de<br />
Gestalten Sie mit uns<br />
die Zukunft!<br />
Für unseren Unternehmensbereich <strong>Wasser</strong> und kommunale Beziehungen<br />
am Standort Freiburg suchen wir zum nächstmöglichen<br />
Zeitpunkt einen<br />
Bauingenieur (m/w)<br />
Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft/Umwelt-/<br />
Verfahrenstechnik<br />
Die Aufgabe:<br />
Sie sind in dieser Position für die Erstellung von Konzepten im Bereich<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung verantwortlich und übernehmen auch die<br />
Bauherrenfunktion. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind:<br />
> Planungen bis zur HOAI-Leistungsphase 4 (Neubau- und Instandhaltungsprojekte)<br />
> Asset-Management-Aufgaben<br />
> Ansprechpartner für Kommunen und Kunden<br />
Die Anforderungen:<br />
> Erfolgreich abgeschlossenes Ingenieursstudium (Uni/FH/BA – Bauingenieurwesen<br />
oder vergleichbar)<br />
> Mehrjährige Berufserfahrung, insbesondere in Planung und Bau von<br />
Anlagen der <strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
> Sie wissen, wie man Projekte erfolgreich steuert und waren idealerweise<br />
bereits als Projektleiter tätig<br />
> Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office-Programmen<br />
> Strukturierte Arbeitsweise, ziel- und ergebnisorientiertes Vorgehen,<br />
unternehmerisches Denken<br />
> Sie arbeiten gerne aktiv im Team mit und sind zuverlässig und qualitätsbewusst<br />
> Fahrerlaubnis der Klasse B<br />
Das Angebot:<br />
> Eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum<br />
> Mitarbeit in einem erfolgreichen, motivierten Team<br />
> Leistungsgerechte Vergütung sowie flexible Arbeitszeitregelungen<br />
> Bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung in einem sich dynamisch<br />
verändernden Umfeld<br />
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige<br />
Bewerbung (Anschreiben, vollständiger Lebenslauf,<br />
Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit<br />
schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 26.08.2011.<br />
Für Rückfragen und Online-Bewerbungen erreichen Sie uns unter<br />
bewerbungen@badenova.de. Bitte beachten Sie in diesem Fall die<br />
Hinweise auf badenova.de.<br />
badenova AG & Co. KG, Personalmanagement<br />
Herrn Christian Weyers, PER-1, Tullastraße 61, 79108 Freiburg<br />
www.badenova.de
Wir suchen<br />
kaufmännische Betriebsleiterin/<br />
kaufmännischen Betriebsleiter<br />
für den Stadtentwässerungsbetrieb<br />
(BesGr B 2 BBesO oder vergleichbare Vergütung)<br />
Der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf wird als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung<br />
ohne Rechtspersönlichkeit in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt. Wesentliche Aufgaben des Stadtentwässerungsbetriebes<br />
sind die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb der öffentlichen <strong>Abwasser</strong>anlagen. Dazu gehören u.a. ein über 1.500<br />
km langes Kanalnetz mit Pumpstationen und Regenbeckenanlagen sowie zwei Klärwerke. Alle technischen und kaufmännischen Belange<br />
inklusive der Kalkulation und Rechnungslegung der <strong>Abwasser</strong>gebühren werden ganzheitlich von der Betriebsleitung des Stadtentwässerungsbetriebes<br />
und den ca. 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Die Betriebsleitung besteht aus einer/einem<br />
technischen und einer/einem kaufmännischen Betriebsleiterin/Betriebsleiter, die ihre Aufgaben kollegial als Doppelspitze ausführen.<br />
Erster Betriebsleiter gemäß Betriebssatzung ist der technische Betriebsleiter.<br />
Die kaufmännische Betriebsleitung nimmt die Leitung des Rechnungswesens wahr und ist eigenverantwortlich zuständig für alle<br />
kaufmännischen Geschäftsfelder.<br />
Ihre Aufgaben u.a.:<br />
• Aufstellung und Überwachung des Wirtschaftsplanes sowie die Aufstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des<br />
Betriebsabschlusses<br />
• Erarbeitung und Umsetzung von Kostenzielen mit den Kosten-/Leistungsbereichen und Steuerung der Zielplanungsprozesse<br />
• gebührenrechtliche Beurteilung (Kommunalabgabengesetz), Gebühren- und Entgeltkalkulation, Gebührenerhebungsverfahren<br />
(Abgabenordnung)<br />
• Rechtsangelegenheiten und Vertragswesen<br />
• Personalwirtschaft und Personalverantwortung.<br />
Ihr Profil:<br />
• abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft und umfassende fachliche Kenntnisse bezogen auf den künftigen Aufgabenbereich<br />
sowie Führungskompetenz/-fähigkeit (mehrjährige Leitungserfahrung in vergleichbarer Position sowie Erfahrungen im Bereich Verund<br />
Entsorgung wären wünschenswert)<br />
• fundierte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten<br />
• gute Kenntnisse in der EDV-gestützen Arbeit<br />
• ausgeprägtes technisches Verständnis<br />
• Team- und Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, sicheres Auftreten und Organisationsgeschick<br />
• Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und Befähigung zur Führung und Motivation mit hoher sozialer Kompetenz.<br />
Die Einstellung erfolgt unbefristet im Arbeitsverhältnis. Da es sich um eine über die höchste Entgeltgruppe des Tarifvertrages für den<br />
öffentlichen Dienst (TVöD) hinausgehende Bewertung handelt, ist der Abschluss eines außertariflichen Arbeitsvertrages erforderlich.<br />
Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen ist eine Einstellung im Beamtenverhältnis möglich.<br />
Die Stadtverwaltung Düsseldorf verfolgt offensiv das Ziel zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von<br />
Frauen werden ausdrücklich begrüßt. Auswahlentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW.<br />
Die Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt die berufliche Integration nach dem SGB IX ernst. Bewerbungen von Schwerbehinderten<br />
und Gleichgestellten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.<br />
Richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 15.09.2011 an die Stadtverwaltung, Amt 10/622, Kennziffer 67/00/01/11/01,<br />
40200 Düsseldorf, E-Mail: personalwirtschaft@duesseldorf.de. E-Mail-Bewerbungen können auf eigenes Risiko als PDF-Datei übersandt<br />
werden.* Ansprechpartner: Herr Benner, Telefon (0211) 89-2 11 63, Willi-Becker-Allee 8, Zimmer 1204.<br />
* Hinweis zum Datenschutz: Bewerbungsunterlagen, die per einfacher E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei übersandt werden, sind auf dem Postweg<br />
gegen unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt.
Wir gehören zu den großen überregionalen Trägern der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Als Körperschaft<br />
des öffentlichen Rechts planen, bauen und betreiben wir<br />
Kläranlagen und Talsperren im Einzugsgebiet der Ruhr.<br />
Für unsere Planungsabteilung in Essen suchen wir zum<br />
nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine<br />
Diplom-Ingenieur/-in Bauwesen<br />
Fachrichtung <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
(Kennwort: PA/Bau-Ing.)<br />
zur Bearbeitung anspruchsvoller stadthydrologischer<br />
Planungsaufgaben beim Ruhrverband.<br />
Aufgaben:<br />
Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit gehören die Aufstellung<br />
von Integralen Entwässerungsplanungen einschließlich<br />
einer umfassenden Kalibrierung der hierzu erforderlichen<br />
Niederschlags-/Abfluss-Modelle sowie die Betreuung von<br />
Messkampagnen innerhalb des Ruhreinzugsgebietes.<br />
Das führende Fachorgan<br />
für <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong><br />
Informieren Sie sich regelmäßig über alle technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S -<br />
Recht und Steuern im Gas und <strong>Wasser</strong>fach.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Voraussetzungen für diese Tätigkeit:<br />
– Abgeschlossenes Bauingenieursstudium, Fachrichtung<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
– Mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert<br />
– Erfahrung im Umgang mit hydrologischen<br />
Niederschlags-/Abfluss-Modellen<br />
– Erfahrung in der Aus- und Bewertung von Abflussmesskampagnen<br />
in der Kanalisation<br />
– Erfahrung in der Planung von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen<br />
– Sicherer Umgang mit den MS Office-Produkten,<br />
insbesondere Access und Excel<br />
– Sicherer Umgang mit geografischen Informationssystemen<br />
(ArcGIS)<br />
– Teamfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Kundenorientierung<br />
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen<br />
sind erwünscht. Ebenso werden Bewerbungen von Frauen<br />
ausdrücklich erbeten. Diese werden bei gleicher Eignung<br />
bevorzugt berücksichtigt.<br />
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, eine dem Aufgabengebiet<br />
entsprechende leistungsgerechte Vergütung sowie<br />
attraktive Sozialleistungen. Eine Teilzeitbeschäftigung ist<br />
grundsätzlich möglich.<br />
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien<br />
richten Sie bitte bis zwei Wochen nach Bekanntgabe<br />
dieser Ausschreibung unter Angabe des Kennwortes<br />
an den<br />
Ruhrverband<br />
Zentralbereich Personal und Organisation<br />
Kronprinzenstraße 37<br />
45128 Essen<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
Seite<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 689<br />
acqua alta 2011, Hamburg Messe, Hamburg 681<br />
AQUATECH AMSTERDAM 2011, Amsterdam, Niederlande 699<br />
Aquadosil <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Essen 700<br />
BK Giulini GmbH, Ludwigshafen 665<br />
Diringer & Scheidel Rohrsanierung, Mannheim 667<br />
9. Münchner Runde 2011, Ingenieurbüro Dörschel, Inning/Ammersee 677<br />
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar 675<br />
DWA Landesverband Bayern, München<br />
Beilage<br />
EMDE Industrie-Technik GmbH, Nentershausen 653<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 685<br />
Hölscher <strong>Wasser</strong>bau GmbH, Haren 685<br />
IWA Specialist Conferences (RWTH Aachen) 703<br />
Kamstrup A/S, Mannheim 659<br />
KRYSCHI <strong>Wasser</strong>hygiene, Kaarst 705<br />
Sigmund Lindner GmbH, Warmensteinach 711<br />
<strong>REHAU</strong> AG + Co., Erlangen<br />
Titelseite<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 663<br />
Sensus GmbH Ludwigshafen, Ludwigshafen 669<br />
Siemens AG, Nürnberg<br />
Beilage<br />
Tracto-Technik GmbH & Co. KG, Lennestadt 673<br />
Einkaufsberater / Fachmarkt 767–772<br />
Stellenmarkt<br />
badenova AG & Co.KG, Freiburg 774<br />
BG ETEM, Düsseldorf 774<br />
Landeshauptstadt Düsseldorf, Düsseldorf 775<br />
Ruhrverband Essen, Essen 776<br />
Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung, Stuttgart-Vaihingen 773<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
3-Monats-<strong>Vorschau</strong> 2011<br />
Ausgabe September 2011 Oktober 2011 November 2011<br />
Erscheinungstermin:<br />
Anzeigenschluss:<br />
15.09.2011<br />
22.08.2011<br />
17.10.2011<br />
23.09.2011<br />
15.11.2011<br />
25.10.2011<br />
Themenschwerpunkt<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Produkte und Verfahren<br />
• Regenwassernutzung<br />
• Entwässerungssysteme<br />
• Misch- und Trennkanalisation<br />
• Dezentrale Regenwasserbehandlung<br />
• Regenwasserspeicherung und<br />
-versickerung<br />
• Reinigungssysteme für Straßenabläufe,<br />
Metalldachfilter, Filtersysteme<br />
Trinkwasseraufbereitung und Hygiene<br />
Aufgaben und Verfahren<br />
• Partikelentfernung, Entfernung<br />
organischer Stoffe<br />
• Entsäuerung, Enthärtung<br />
• Flockung und Flockungsmittel<br />
• Adsorptions-Verfahren<br />
• Membrantechnik, Ultrafiltration<br />
• Desinfektion: Chlorung, Ozonung, UV-<br />
Bestrahlung<br />
Messen – Steuern – Regeln<br />
Automatisierung in <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
• Messtechnik<br />
• Steuerungstechnik<br />
• Regeltechnik<br />
• Fernwirktechnik<br />
• Leitsysteme<br />
• Sicherheitstechnik<br />
• Störfall-Management<br />
Fachmessen/<br />
Fachtagungen/<br />
Veranstaltung<br />
(mit erhöhter Auflage<br />
und zusätzlicher<br />
Verbreitung)<br />
DWA-Bundestagung, Berlin –<br />
26.09.–27.09.2011<br />
6th IWA Specialised Membrane Technology<br />
conference for Water and Wastewater<br />
Treatment, Aachen – 03.10.–07.10.2011<br />
SHKG, Leipzig – 12.10.–14.10.2011<br />
Kommunale 2011, Nürnberg –<br />
19.10.–20.10.2011<br />
DWA-Landesverbandstagung Baden-Württemberg,<br />
Fellbach – 20.10.–21.10.2011<br />
DWA-Landesverbandstagung Bayern mit<br />
Fachausstellung, Würzburg –<br />
26.10.–27.10.2011<br />
AQUA Ukraine – Intern. <strong>Wasser</strong> Forum, Kiew<br />
(Ukraine) – November 2011<br />
SPS/IPS/Drives, Nürnberg –<br />
23.11.–25.11.2010<br />
DWA-Bundestagung, Bonn –<br />
24.11.–25.11.2010<br />
Änderungen vorbehalten
WISSEN<br />
für die<br />
ZUKUNFT<br />
OLDENBOURG INDUSTRIEVERLAG GMBH<br />
VULKAN-VERLAG GMBH