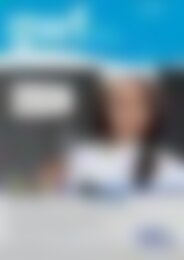gwf Wasser/Abwasser Wo sich Wasser wohl fühlt (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
6/2011<br />
Jahrgang 152<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
3R + <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
im Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
3R International erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine 3R (12 Ausgaben) und<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> (12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
Als Heft für 528,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
Als ePaper (PDF-Datei) für 528,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
Als Heft für 264,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
Als ePaper (PDF-Datei) für 264,- pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 <strong>Wo</strong>chen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert <strong>sich</strong> der Bezug um<br />
ein Jahr. Die <strong>sich</strong>ere und pünktliche Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,–<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice 3R<br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Datum, Unterschrift<br />
PAGWFW0211<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice 3R, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
STANDPUNKT<br />
Aus dem Labor ans Licht der Öffentlichkeit<br />
Längst ist klar geworden, dass es nicht<br />
ausreicht, <strong>sich</strong> auf Erworbenem auszuruhen<br />
oder – schlimmer noch – <strong>Wo</strong>hlstand<br />
gedankenlos auf Kosten kommender<br />
Generationen zu genießen. So viel ist <strong>sich</strong>er:<br />
Die Bedeutung eines Standorts wird von seiner<br />
Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit<br />
ge prägt – von der Fähigkeit, mit Ressourcen<br />
effizient und mit der Umwelt schonend umzugehen,<br />
ohne dabei auf HighTech zu verzichten.<br />
Der Rohstoff dafür ist Wissen, erarbeitet in<br />
zahlreichen Forschungseinrichtungen und<br />
Entwicklungsabteilungen, Universitäten und<br />
Hochschulen. Dort beschäftigen <strong>sich</strong> die besten<br />
Köpfe eines Landes mit der Aufgabe,<br />
Methoden und Technologien zu erarbeiten,<br />
um aktuelle Probleme zu lösen und den künftigen<br />
Herausforderungen gewachsen zu sein.<br />
Gerade im <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>fach sind<br />
weltweit gewaltige Anstrengungen erforderlich,<br />
um flächendeckend für sauberes Trinkwasser<br />
und eine nachhaltige <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
zu sorgen. Dazu bedarf es weitergehender<br />
Grundlagenforschung sowie zahlreicher<br />
couragierter Forschungsprojekte, die<br />
bei der Entwicklung angepasster Technologien<br />
auf die jeweiligen geografischen und klimatischen<br />
Gegebenheiten achten, aber auch<br />
auf soziale und politische Einflussfaktoren eingehen.<br />
Um den derzeitigen Stand von Wissenschaft<br />
und Forschung aufzuzeigen und wegweisende<br />
Projekte vorzustellen, ist es unerlässlich,<br />
darüber zu berichten. Aufgabe der<br />
Fachmedien ist es, objektiv und sachlich zu<br />
informieren, den Wissenspool weiter zu füllen<br />
und gut aufbereitet zugänglich zu machen.<br />
Dabei ist es zweitrangig, ob dies in gedruckter<br />
oder elektronischer Form geschieht. Je nach<br />
Zweck und Zielgruppe lässt <strong>sich</strong> heutzutage<br />
das passende Werkzeug ganz flexibel für den<br />
jeweiligen Leser oder Nutzer finden: In Form<br />
von Zeitschrift oder Buch genauso wie auf<br />
DVD, online via Internet oder als App. Von entscheidender<br />
Bedeutung ist der Inhalt. Denn<br />
vor allem auf hieb- und stichfeste Informationen<br />
kommt es an. Gerade in unserer Zeit mit<br />
riesigen Datenmengen aus oft nicht nachvollziehbaren<br />
Quellen, in der manche Zeitgenossen<br />
„Copy-and-Paste“ für ein lässliches Kavaliersdelikt<br />
halten, ist absolute Seriosität bei<br />
wissenschaftlichen Veröffentlichungen oberstes<br />
Gebot.<br />
Deshalb wurde bei der technisch-wissenschaftlichen<br />
Fachzeitschrift <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | Ab -<br />
wasser vor nunmehr dreieinhalb Jahren ein<br />
Peer-Review-Verfahren eingeführt, bei dem<br />
eingereichte Beiträge ein anonymes Begutachtungsverfahren<br />
durchlaufen: Manuskripte<br />
werden in der Regel zwei Gutachtern (Referees)<br />
aus dem jeweils betreffenden Fachgebiet<br />
vorgelegt. Bei nicht einstimmigem Ergebnis<br />
wird ein dritter Gutachter hinzugezogen.<br />
Das Verfahren dient zur Sicherung eines<br />
hohen Standards der wissenschaftlichen<br />
Fachbeiträge unserer Zeitschrift – und zu -<br />
gleich als <strong>sich</strong>tbares Qualitäts-Instrument für<br />
Leserschaft und Autoren.<br />
Im Dienst der Wissenschaft richte ich also<br />
meinen Wunsch und meine Bitte an Wissenschaftler,<br />
Ingenieure und Studierende des<br />
<strong>Wasser</strong>fachs: Berichten Sie über Ihre spannenden<br />
Forschungsvorhaben und Projekte in<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>. Denn die Fachöffentlichkeit<br />
hat hohes Interesse am neuesten<br />
Stand von Wissenschaft und Forschung. Holen<br />
Sie <strong>sich</strong> einfach unser Autorenmerkblatt<br />
unter: www.oldenbourg-industrieverlag.de/<br />
autorenhinweis/autorenhinweise_<strong>gwf</strong>-wa.pdf<br />
Ihre<br />
Christine Ziegler<br />
Hauptschriftleitung <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 539
INHALT<br />
Mit einem neu entwickelten<br />
Probenahme-<br />
und Analyseverfahren<br />
können<br />
Arzneimittelwirkstoffe,<br />
Röntgenkontrastmittel<br />
oder<br />
Moschusverbindungen<br />
effizient in der<br />
<strong>Abwasser</strong>kanalisation<br />
nachgewiesen<br />
und einem Eintragspfad<br />
zugeordnet<br />
werden.<br />
Ab Seite 622<br />
Auf einer Podiumsdiskussion anlässlich der „Grünen<br />
<strong>Wo</strong>che 2011“ in Berlin wurde über das Thema „Nahrungsmittelproduktion<br />
und Gewässerschutz“ intensiv diskutiert.<br />
Ab Seite 630<br />
Fachberichte<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
606 A. Richter und A. Gamisch<br />
Das Eingruppierungsrecht der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
The Legal Classification in Water Management<br />
Regenwasserbehandlung<br />
618 F. Sieker<br />
Plädoyer für die Aufhebung des<br />
ATV-Arbeitsblattes A 128<br />
The Technical Rule ATV A 128 Should be<br />
Cancelled<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
622 R. Murzen und C. Zehle<br />
Probenahme- und Analyseverfahren<br />
zur kostengünstigen Überwachung<br />
von Arzneimittelwirkstoffen im<br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Sampling and Analytical Procedure for the<br />
Cost-effective Control of Pharmaceuticals in<br />
Wastewater<br />
Tagungsbericht<br />
630 N. Geiler<br />
Nahrungsmittelproduktion und<br />
Gewässerschutz – Podiumsdiskussion<br />
„Landwirtschaft am Fluss –<br />
Gewässerschutz in der kommenden<br />
Agrarreform“ am 25. Januar 2011<br />
in Berlin<br />
Food Production and Water Conservation –<br />
Presentation and Discussion “Farming the River<br />
– Water Conservation in the Oncoming<br />
Agriculture”<br />
634 A. Bäumer<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft im Wandel<br />
Water Management in the Light of Change<br />
Interview<br />
544 Dienstleistungskonzessionen im <strong>Wasser</strong>und<br />
<strong>Abwasser</strong>bereich – Pro und Kontra –<br />
Interview mit Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender<br />
der Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
Thema<br />
548 Notwasser – Schnelle Hilfe in Katastrophengebieten<br />
Juni 2011<br />
540 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INHALT<br />
Im Interview sprach der Vorstandsvorsitzende der Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe, Jörg Simon, über Dienstleistungskonzessionen<br />
im <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>bereich.<br />
(Bild: <strong>Wasser</strong> Berlin) Ab Seite 544<br />
Welche Maßnahmen in Katastrophensituationen zur Notversorgung mit Trinkwasser<br />
(Bild: THW) ergriffen werden können, lesen Sie ab Seite 548<br />
Fokus<br />
Trinkwasserbehälter<br />
551 4. Kolloquium der S.I.T.W. 2011 zur Trinkwasserspeicherung<br />
552 Trinkwasserspeichersysteme aus PE 100<br />
Wickelrohr<br />
557 Sanierung von Trinkwasserspeichern –<br />
Behältersanierung mit einem dem Behälterneubau<br />
gleichwertigen Ergebnis<br />
560 Multifuktionaler Wärmespeicher aus<br />
Edelstahl<br />
562 Zwangsbelüftung von <strong>Wasser</strong>kammern zur<br />
Kondensat-Minimierung<br />
563 Füllstandmessung in einem Trinkwasserspeicher<br />
564 Neun Millionen Euro für ein Herzstück der<br />
Stuttgarter Trinkwasserversorgung – Einweihung<br />
des Hochbehälters Mühlbach<br />
566 Hochbehälter Ohlerkirchweg – eine der<br />
<strong>Wasser</strong>adern Möchengladbachs<br />
568 Instandsetzung eines Ludwigsburger Trinkwasser-Reservoirs<br />
570 <strong>Wo</strong>hnen und arbeiten im <strong>Wasser</strong>turm –<br />
Sanierung des denkmalgeschützten<br />
<strong>Wasser</strong>turms in Erding<br />
572 Wahrzeichen mit Tradition: Der Neue<br />
<strong>Wasser</strong>turm in Dessau-Roßlau<br />
574 Ferienhaus am Stiel – Plöner <strong>Wasser</strong>turm<br />
Nachrichten<br />
Branche<br />
578 „Private <strong>Abwasser</strong>leitungen gehören in die<br />
öffentliche Hand“<br />
578 Neue Runde im Prozessbenchmarking<br />
<strong>Wasser</strong>werke<br />
579 Mehr Verbraucherschutz durch Änderung<br />
der Trinkwasserverordnung<br />
580 Güte<strong>sich</strong>erung Kanalbau und Fremdüberwachung<br />
Kanalbau der Zertifizierung<br />
Bau e.V.<br />
580 IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> gewinnt zwei neue<br />
Gesellschafter<br />
582 VDMA: Deutsche <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
– Getragen von der Welle des Aufschwungs<br />
584 Phosphor-Recycling macht Fortschritte –<br />
Wegweisendes Umweltprojekt in Bayern<br />
585 Beim Hopfenbau Zeit, Energie und <strong>Wasser</strong><br />
sparen – DBU stiftet rund 318000 Euro<br />
586 Leitgedanke „Carbon Footprint“ – Carix®-<br />
Verfahren, Nanofiltration und Umkehrosmose<br />
im Vergleich<br />
588 Neue Lern-DVD „Wer Wie <strong>Wasser</strong> –<br />
Inter aktive Lernspiele für Kinder“<br />
588 Ratgeber „Virtuelles <strong>Wasser</strong> – Weniger<br />
<strong>Wasser</strong> im Einkaufskorb“<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 541
INHALT<br />
Im Fokus dieser<br />
Ausgabe stehen Bau<br />
und Sanierung von<br />
Trinkwasserbehältern<br />
sowie die Nutzung<br />
und Umnutzung<br />
historischer<br />
<strong>Wasser</strong>türme.<br />
Ab Seite 551<br />
Ein neues Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor<br />
aus <strong>Abwasser</strong> wird in einer Pilotanlage Klärwerk Neuburg<br />
in Bayern getestet. Ab Seite 584<br />
589 Flint Bautenschutz GmbH und Partner<br />
spenden für Trinkwasser – Aktion der Trinkwasserbehälter-Sanierer<br />
für das THW<br />
590 Berkefeld-Technik auf der Biennale – Mobile<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage als Kunstobjekt<br />
in Venedig<br />
Veranstaltungen<br />
591 Internationale Geothermiekonferenz:<br />
Freiburg für drei Tage Zentrum der<br />
Geothermie branche<br />
592 acqua alta 2011 – 11. bis 13. Oktober 2001<br />
in Hamburg<br />
Forschung und Entwicklung<br />
593 Leopoldina richtet Empfehlungen an die<br />
G8-Staats- und Regierungschefs<br />
594 Zehn Jahre WHO-Kollaborationszentrum an<br />
der Uni Bonn<br />
595 Giftige Zwerge in der Umwelt? – Nanomaterialien<br />
können aquatische Ökosysteme<br />
gefährden<br />
596 <strong>Wasser</strong> für die Mongolei – Neu entwickelte<br />
Software und Messsysteme helfen beim<br />
Aufspüren von Schwachstellen<br />
597 Lanthan belastet Rhein mit Konzentra tionen<br />
bis zum 46-Fachen des natürlichen Wertes<br />
598 Vatikan: Forschergruppe warnt vor<br />
Gletscherschmelze<br />
Leute<br />
599 Höchste Auszeichnung des VDI für<br />
Professor Hans-Jörg Bullinger<br />
599 Gotthard Graß neuer Hauptgeschäftsführer<br />
der figawa e.V.<br />
Vereine, Verbände, Organisationen<br />
600 wat im neuen Gewand<br />
602 figawa und rbv erneuern Vereinbarung<br />
603 DVGW-Studienpreis <strong>Wasser</strong> verliehen<br />
603 DVGW entwickelt neues Kernkennzahlensystem<br />
für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Recht und Regelwerk<br />
604 DVGW-Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
604 DVGW-Regelwerk Gas/<strong>Wasser</strong><br />
605 DVGW-Regelwerk Plus: online überzeugend<br />
605 DWA-Vorhabensbeschreibung<br />
Praxis<br />
638 Wirtschaftliche <strong>Abwasser</strong> lösung für die Verbandsgemeinde<br />
Kirchberg/Hunsrück<br />
640 Umleitung eines Baches mit NS-Pumpen –<br />
Einzigartige Lösung für <strong>Wasser</strong>haltung<br />
Juni 2011<br />
542 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INHALT<br />
Neue Untersuchung:<br />
Können Nanomaterialien<br />
aquatische Ökosysteme<br />
gefährden?<br />
Seite 595<br />
Produkte und Verfahren<br />
642 Nachweis von Bakterien in<br />
Trink- und Brauchwasser mittels<br />
der ScanVIT-Technologie<br />
643 Ultraschall-<strong>Wasser</strong>zähler<br />
MULTICAL ® 21 misst nicht nur<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
644 Aerzen erweitert neue Drehkolbenverdichter-Baureihe<br />
645 UV-Desinfektionssystem<br />
ermöglicht Forschungszentrum<br />
Erfüllung strenger<br />
<strong>Abwasser</strong>vorschriften<br />
Information<br />
617, 633 Buchbesprechungen<br />
647 Impressum<br />
648 Termine<br />
Recht und Steuern<br />
Recht und Steuern im Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>fach, Ausgabe 5/6, 2011<br />
Dieses Heft enthält folgende Beilage:<br />
– Siemens AG, Nürnberg<br />
Mit Edelstahl<br />
perfekt<br />
ausgerüstet...<br />
... und dauerhaft <strong>sich</strong>er<br />
Schächte sind erforderlich, um in<br />
Bauwerke für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
einsteigen zu können.<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> im Juli/August 2011<br />
u.a. mit diesen Fachbeiträgen:<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände und Gewässerschutz – neue Lösungsansätze<br />
Wir liefern Bauteile aus Edelstahl,<br />
die Schächte dauerhaft <strong>sich</strong>er<br />
machen.<br />
Metazoen in der Trinkwasserversorgung – Abundanzen, Verteilungsmuster<br />
und deren Ursachen<br />
Der Einfluss moderner Haushaltsgeräte auf den Trinkwasserbedarf der<br />
Haushalte<br />
Erscheinungstermin: 16.8.2011<br />
Anzeigenschluss: 26.7.2011<br />
info@huber.de<br />
www.huber.de<br />
WASTE WATER Solutions<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 543
INTERVIEW<br />
Dienstleistungskonzessionen im <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>bereich – Pro und Kontra<br />
Ausschreiben oder nicht ausschreiben, das ist hier die Frage<br />
Die Europäische Kommission arbeitet an einer Gesetzesinitiative zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen,<br />
die auch die öffentliche Daseinsvorsorge im Bereich der <strong>Wasser</strong>wirtschaft berührt. Nach vier Monaten<br />
Konsultationen definierte die Kommission am 13. April im „Single Market Act“ 50 Vorschläge für ein grünes<br />
und integratives Wirtschaftswachstum in Europa. Interview mit Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender der Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe.<br />
<strong>gwf</strong>: Herr Simon, ein euro päischer<br />
Rechtsakt beschäftigt die deutsche<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft, der die Vergabe<br />
von Dienstleistungskonzessionen neu<br />
regeln soll. Zur wat + <strong>Wasser</strong> Berlin<br />
International 2011 haben Sie die Position<br />
der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
dargelegt. Was ist der Kern der<br />
Debatte?<br />
Jörg Simon: In der Tat ist es im<br />
„Europa der Regionen“ spannend,<br />
einen konsensfähigen Rahmen für<br />
die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen<br />
zu definieren. Mit der<br />
Rechtsetzungsinitiative zu Dienstleistungskonzessionen<br />
hat die EU-<br />
Kommission selbst aktuell für weiteren<br />
Diskussionsstoff gesorgt. Die<br />
Europäische Gemeinschaft hat <strong>sich</strong><br />
in ihrer Gründungsphase mit Verträgen<br />
und Ab<strong>sich</strong>tserklärungen auf<br />
einen guten Gestaltungsrahmen<br />
verständigt, um den EU-Binnenmarkt<br />
kontinuierlich zu entwickeln<br />
und voran zu treiben. Aktuell sieht<br />
es eher so aus, als ob man mit der<br />
angestrebten Modernisierung des<br />
öffentlichen Wettbewerbs- und<br />
Vergaberechts gleichzeitig be -<br />
währte Grundsätze für Dienstleistungen<br />
der Daseinsvorsorge mit<br />
dem Bad ausschütten wollte.<br />
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jörg Simon, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe,<br />
Vorstandsvorsitzender. © Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
<strong>gwf</strong>: Was befeuert die Diskussion um<br />
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,<br />
die als wirtschaftlicher Faktor<br />
und nicht nur in bewegten Zeiten für<br />
Kontinuität sorgen? Weshalb treffen<br />
hier so unterschiedliche Positionen<br />
aufeinander?<br />
Jörg Simon: Die EU-Kommission hat<br />
in den letzten Jahren die europaweite<br />
Diskussion entfacht. Sie kritisiert<br />
das Eigenleben der Dienstleistungskonzessionen<br />
und möchte es<br />
in einem Euro-Gesetzeswerk or -<br />
dentlich verankern. Zwar findet <strong>sich</strong><br />
bereits im Gründungsvertrag der<br />
Europäischen Gemeinschaft ein<br />
Hinweis auf Konzessionen, die werden<br />
aber nicht weiter beschrieben.<br />
Auch in der Richtlinie über öffentliche<br />
Dienstleistungsaufträge aus<br />
dem Jahre 1992 findet <strong>sich</strong> keine<br />
Definition zu Dienstleistungskonzessionen.<br />
Aber, wie das im Leben<br />
so ist, es haben <strong>sich</strong> im Markt – und<br />
ungeachtet der in Rede stehenden<br />
Regelungslücken – lebensfähige<br />
weil alltagstüchtige private Unternehmensmodelle<br />
für Dienstleistungskonzessionen<br />
etabliert.<br />
Sollte nun ein Vergabeverfahren<br />
etabliert werden, das mit der Elle<br />
einer EU-Vergabekoordinations- oder<br />
Sektorenrichtlinie neu vermessen<br />
wäre, dann wirkte <strong>sich</strong> das auch auf<br />
bestehende Konzessionsverträge<br />
aus. Sie verstehen, dass Verun<strong>sich</strong>erung<br />
in der Diskussion besonders<br />
bei den Kommunen mitschwingt. In<br />
Deutschland wären damit auch<br />
unmittelbar die bestehenden Konzessionsverträge<br />
betroffen.<br />
<strong>gwf</strong>: Ist es nicht so, dass <strong>sich</strong><br />
EU-Regelwerke ändern, ähnlich wie<br />
<strong>sich</strong> der Stellenwert von Dienstleistungskonzessionen<br />
als Wirtschaftsfaktor<br />
gewandelt hat?<br />
Jörg Simon: Analysiert man das<br />
Thema Dienstleistungskonzessionen,<br />
offenbart <strong>sich</strong> sehr schnell<br />
das Konfliktpotential, das zwischen<br />
wettbewerbsrechtlichen Fragen<br />
und den Gestaltungspotenzialen<br />
vorhandener Regelungen liegt, die<br />
den EU-Binnenmarkt entwickeln.<br />
An den Dienstleistungskonzessionen<br />
wird das offen<strong>sich</strong>tlich. Sie<br />
unterliegen dem Vertrag über die<br />
Arbeitsweise der EU (AEUV) und<br />
sind – anders als Dienstleistungs-<br />
Juni 2011<br />
544 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INTERVIEW<br />
aufträge und Baukonzessionen –<br />
vom Anwendungsbereich des EU-<br />
Vergaberechts ausgenommen.<br />
<strong>gwf</strong>: Was sind aus Ihrer Sicht die<br />
grundsätzlichen Treiber der Debatte?<br />
Jörg Simon: Liberalisierung, Privatisierung<br />
und Modernisierung der<br />
<strong>Wasser</strong>märkte – seit Ende der 90er<br />
Jahre beschäftigen diese Themen<br />
zunehmend auch die deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Immerhin reden wir<br />
allein in Deutschland von rund 6200<br />
<strong>Wasser</strong>ver- und 6900 <strong>Abwasser</strong>entsorgungsunternehmen.<br />
Und es ist<br />
noch gar nicht mal so lange her, dass<br />
die Branche auch politisch Verantwortung<br />
für eine nachhaltige <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
in Deutschland übernommen<br />
hat. Benchmarking, Verbändeerklärung<br />
und das Branchenbild<br />
2011 spiegeln diesen Ansatz.<br />
<strong>gwf</strong>: Was passiert derweil in Europa?<br />
Jörg Simon: Mit den EU-Verträgen<br />
und mit der Modernisierung des<br />
öffentlichen Auftragswesens will<br />
die Kommission den europäischen<br />
Binnenmarkt vollenden. Die EU will<br />
mehr Wettbewerb, ergo soll neuen<br />
Leistungen Zugang zum gemeinsamen<br />
Binnenmarkt verschafft werden.<br />
Der ordnungspolitische Rahmen,<br />
in dem das passieren soll, wird<br />
in den Mitgliedstaaten diskutiert.<br />
<strong>gwf</strong>: <strong>Wo</strong>gegen regt <strong>sich</strong> bei der deutsche<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft Widerspruch?<br />
Jörg Simon: Leistungen der Daseinsvorsorge<br />
– die <strong>Wasser</strong>dienstleistungen<br />
eingeschlossen – werden im<br />
Europäischen Kontext wie Dienstleistungen<br />
von allgemeinem wirtschaftlichem<br />
Interesse behandelt.<br />
Das widerspricht unter anderem der<br />
Europäischen <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
aus dem Jahr 2000. Die betont,<br />
dass <strong>Wasser</strong> keine übliche Handelsware<br />
ist. Der Lissabon-Vertrag von<br />
2009 stärkt erneut das Subsidiaritätsprinzip<br />
und verleiht regionalen<br />
und lokalen Behörden deutliches<br />
Ge wicht für die Daseinsvorsorge.<br />
Auch das Votum des EU-Parlaments<br />
vom 18. Mai 2010 kann als ein klares<br />
Signal für die Entscheidungshoheit<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft in Deutschland<br />
Über 60 % der <strong>Wasser</strong>abgabe<br />
erfolgt durch privatrechtlich<br />
organisierte Unternehmen<br />
Überwiegend auf Basis von<br />
Konzessionsverträgen<br />
Konzessionäre häufig ganz oder<br />
teilweise in öffentlich- rechtlicher<br />
Hand (Stadtwerke)<br />
Viele Konzessionsvergaben als<br />
Inhouse- Geschäft, überwiegend<br />
Stadtwerke mit privaten<br />
Gesellschaftern<br />
Private Unternehmensformen sind<br />
in Deutschland etabliert<br />
der Kommunen und Regionen über<br />
die Organisation der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
angesehen werden.<br />
<strong>gwf</strong>: Also wäre doch klar, wer das<br />
Sagen in diesem Punkt hat, oder?<br />
Jörg Simon: Das jetzige EU-Recht<br />
und die EuGH-Urteile reichen nach<br />
unserer Einschätzung aus, um<br />
Dienstleistungskonzessionen zwischen<br />
den Partnern, Konzessionsgeber<br />
und Konzessionär, praktisch<br />
umzusetzen. Das Parlament benennt<br />
mit den Prämissen Ver einfachung,<br />
Straffung und Flexibilität deutlich<br />
seine Vorstellungen an ein künftiges<br />
Vergabeverfahren. Es sagt auch, dass<br />
die EU-Kommission den Nachweis<br />
für die Notwendigkeit einer der artigen<br />
Initiative vorlegen müsse.<br />
Unternehmensformen<br />
der öffentlichen <strong>Wasser</strong>wirtschaft in Deutschland<br />
Eigengesellschaften<br />
AG/GmbH<br />
15 %<br />
Regiebetriebe<br />
1 %<br />
ÖPP-Modelle<br />
AG/GmbH<br />
17 %<br />
Öffentliche<br />
Gesellschaften<br />
AG/GmbH<br />
10 %<br />
<strong>Wasser</strong>- und<br />
Bodenverbände<br />
5 %<br />
Sonstige<br />
privatrechtliche<br />
Gesellschaften<br />
19 %<br />
Unternehmensformen der öffentlichen <strong>Wasser</strong>wirtschaft in Deutschland.<br />
<strong>gwf</strong>: Das EU-Grünbuch vom 27.<br />
Januar 2011 regte Konsultationen<br />
innerhalb der Mitgliedstaaten an,<br />
um die im „Single-Market-Act“ vom<br />
27. Oktober 2010 vorgeschlagenen<br />
50 „policy proposals“ zu evaluieren.<br />
Was soll erreicht werden?<br />
Jörg Simon: Das Grünbuch der EU-<br />
Kommission ist, wenn Sie so wollen,<br />
eine Toolbox, wie Vorschriften, Instrumente<br />
und Methoden im öffentlichen<br />
Auftragswesen zu modernisieren<br />
sind. Ziel ist ein „flexibles und<br />
benutzerfreundliches Instrumentarium“,<br />
das Behörden und Lieferanten<br />
in Europa eine „transparente<br />
und wettbewerblich organisierte<br />
Auftragsvergabe so leicht wie möglich<br />
macht“, so der Anspruch der<br />
Kommission.<br />
<strong>gwf</strong>: Bis zum 18. April 2011 war Gelegenheit<br />
für Kommentare. Hat <strong>sich</strong> die<br />
deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft mit den<br />
Vorgaben befasst?<br />
Jörg Simon: Ja, sehr intensiv. Am<br />
30. Juni 2011 wird auf einer Kon -<br />
ferenz die Reform des öffentlichen<br />
Auftragswesens erörtert, was dann in<br />
geeignete Legislativvorschläge münden<br />
soll. In diesem Zusammenhang<br />
möchte ich beispielhaft für die Branche<br />
das BDEW-Rechtsgutachten vom<br />
Juni 2010 nennen: „Zu den gemeinschaftsrechtlichen<br />
Vorgaben bei der<br />
Vergabe von Dienstleistungskonzessionen<br />
im Trinkwasserbereich.“ An<br />
den dort getroffenen Aussagen hat<br />
<strong>sich</strong> auch aktuell nichts geändert. Die<br />
deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft hält eine<br />
Gesetzgebungsinitiative der EU für<br />
eine neue Ausschreibungspflicht<br />
von Dienstleistungskonzessionen im<br />
Trinkwasserbereich für nicht erforderlich.<br />
Deutschland steht mit seiner<br />
Meinung in Europa nicht alleine da.<br />
<strong>gwf</strong>: Was sagt die Politik zu diesem<br />
Thema?<br />
Jörg Simon: Es gibt Positionen,<br />
die als Unterstützung der Branche<br />
Zweckverbände<br />
17 %<br />
Eigenbetriebe<br />
9 %<br />
Anstalt<br />
öffentlichen Rechts<br />
7 %<br />
Quelle: BDEW, 2009<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 545
INTERVIEW<br />
Dienstleistungskonzessionen: Pro<br />
gewertet werden können. So hat<br />
<strong>sich</strong> der Deutsche Bundesrat am<br />
17. Februar 2011 gegen einen Regelungsvorschlag<br />
zu Dienstleistungskonzessionen<br />
ausgesprochen. Er<br />
sieht keine Notwendigkeit für einen<br />
Rechtsetzungsakt auf europäischer<br />
Ebene. Es seien keine zusätzlichen<br />
Wettbewerbsanreize er<strong>sich</strong>tlich,<br />
man fürchtet um die bisherigen<br />
Gestaltungsspielräume der Mitgliedstaaten.<br />
In der gleichen Sitzung<br />
lehnt der Bundesrat auch die Vorschläge<br />
im „Single-Market-Act“ ab.<br />
<strong>gwf</strong>: Vom Vorhaben der EU-Kommission<br />
sind ja quasi alle Bereiche der<br />
Daseinsvorsorge betroffen. In der Auflistung<br />
finden <strong>sich</strong> auch die Ausbildung<br />
von Medizinern und Juristen?<br />
Jörg Simon: Die EU-Kommission<br />
sieht in Dienstleistungen der<br />
Daseinsvorsorge ein hohes und<br />
wachstumsintensives Marktpotenzial.<br />
17 Prozent des europäischen<br />
Bruttoinlandsprodukts (BIP) sollen<br />
auf das öffentliche Auftragswesen<br />
entfallen. Legt man das EU-BIP 2010<br />
mit 12 Billionen € zugrunde, sprechen<br />
wir immerhin von rund zwei<br />
Billionen €. Aus Sicht des Marktes<br />
sind das natürlich beeindruckende<br />
Werte, die <strong>sich</strong> jedoch an der Bedeutung<br />
öffentlicher Aufgaben messen<br />
lassen müssen.<br />
§ Weiterer Ausbau des EU-Binnenmarktes durch weitere<br />
Umsetzung der Grundsätze<br />
§ EuGH-Urteile weisen in diese Richtung<br />
§ Gleichbehandlungsgrundsatz<br />
§ Transparenz<br />
§ Verhältnismäßigkeitsgrundsatz<br />
Gründe für einen erweiterten EU-Rechtsrahmen<br />
„Dienstleistungskonzessionen“.<br />
<strong>gwf</strong>: Was bedeutet das für Deutschland?<br />
Jörg Simon: In Deutschland hat <strong>sich</strong><br />
auf kommunaler Ebene eine pluralistische<br />
Kultur öffentlich-privater Partnerschaften<br />
etabliert. Die unternehmerischen<br />
Modelle für die Daseinsvorsorge<br />
von <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong><br />
stärkt die Gestaltungs- und Handlungsfreiheit<br />
der Kommunen. Der<br />
Erfolg drückt <strong>sich</strong> in privatrechtlich<br />
organisierten Unternehmensformen<br />
aus, die auf Konzes sionsverträgen<br />
beruhen und heute immerhin 60<br />
Prozent des gesamten Trinkwasseraufkommens<br />
in Deutschland liefern.<br />
Für die <strong>Abwasser</strong>seite gibt es keine<br />
offiziellen entsprechenden Zahlen.<br />
Tendenziell dürften diese niedriger<br />
liegen, da diese Leistung eher in<br />
öffentlich-recht licher Organisationsform<br />
erbracht wird.<br />
<strong>gwf</strong>: Was ist das Besondere einer<br />
Dienstleistungskonzession?<br />
Jörg Simon: Wir reden über ein<br />
Modell, bei dem staatliche und<br />
kommunale Einrichtungen Aufgaben<br />
der Daseinsvorsorge an private<br />
Unternehmen übertragen. Hier wird<br />
also keine einzelne, abgegrenzte<br />
Leistung oder Lieferung beauftragt.<br />
Vielmehr überträgt eine öffentliche<br />
Einrichtung im Rahmen ihres<br />
Gestaltungsspielraumes einem privaten<br />
Unternehmen die ausschließlichen<br />
Nutzungsrechte, verbunden<br />
mit dem Betriebsrisiko. Für die<br />
Gewährung des Nutzungsrechtes<br />
erhält der Konzessionsgeber vom<br />
Konzessionär in aller Regel eine<br />
Konzessionsabgabe.<br />
<strong>gwf</strong>: Private, am Markt operierende<br />
Unternehmen übernehmen Aufgaben<br />
der Daseinsvorsorge und erbringen<br />
Leistungen für die öffentliche Hand?<br />
Jörg Simon: Richtig. Die Dienstleistungskonzession<br />
ist ein Begriff der<br />
EU. Nicht zu verwechseln mit einer<br />
Konzession im Sinne einer Genehmigung<br />
für die Ausübung beispielsweise<br />
eines Gewerbes für Personenbeförderung.<br />
Trotz fehlender Definition<br />
und Rechtsrahmen hat <strong>sich</strong><br />
diese Form in gegenseitiger Übereinstimmung<br />
von öffentlichen und<br />
privaten Marktpartnern über die<br />
Zeit entwickeln können. Und nicht<br />
nur in Deutschland.<br />
<strong>gwf</strong>: <strong>Wo</strong> ist denn eine vergaberechtliche<br />
Abgrenzung zwischen einem<br />
öffentlichen Auftrag und einer Dienstleistungskonzession<br />
zu ziehen? In beiden<br />
Fällen handelt es <strong>sich</strong> doch um<br />
öffentliche Aufträge …<br />
Jörg Simon: Einen öffentlichen Auftrag<br />
erteilt der öffentliche Auftraggeber<br />
über eine vorher bestimmte Leistung<br />
oder Lieferung, für die er vorher<br />
ein Entgelt vereinbart hat. Hier sind<br />
die Rahmenbedingungen des EU-<br />
Vergabeverfahrens anzuwenden.<br />
Eine Dienstleistungskonzession<br />
hingegen überträgt eine umfassende<br />
öffentliche Aufgabe an ein<br />
privates Unternehmen. Also das<br />
ausschließliche Nutzungsrecht an<br />
der Erbringung einer Aufgabe für<br />
die Daseinsvorsorge.<br />
<strong>gwf</strong>: Wie wird ein Konzessionsnehmer<br />
denn bezahlt?<br />
Jörg Simon: In der Regel bezahlt der<br />
Konzessionsgeber den Konzessionär<br />
nicht unmittelbar. Bedingt durch<br />
sein ausschließliches Nutzungsrecht<br />
kann der Konzessionär seine Leistungen<br />
Dritten in Rechnung stellen.<br />
Andererseits übernimmt er mit dem<br />
Nutzungsrecht die Betriebsrisiken<br />
wie Nutzungsausfälle, Marktrisiken<br />
und ist für die Umsetzung von<br />
Umwelt- und Sicherheitsstandards<br />
verantwortlich.<br />
Werden dennoch, und im Einzelfall<br />
ist das auch möglich, Ausgleichszahlungen<br />
durch den Konzessionsgeber<br />
vereinbart, ist zu prüfen, ob<br />
die ein Entgelt darstellen und ein<br />
öffentlicher Auftrag vorliegt. In<br />
diesem Fall würde das Vergaberecht<br />
Anwendung finden.<br />
<strong>gwf</strong>: Welche Position bezieht die<br />
europäische Rechtsprechung?<br />
Jörg Simon: Der EuGH hat hierzu<br />
eine Reihe von Grundsatzurteilen<br />
gesprochen und <strong>sich</strong> dabei auf<br />
Grundsätze im Gemeinschaftsrecht<br />
bezogen: Gleichbehandlungs- und<br />
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,<br />
Transparenz und gegenseitige<br />
Anerkennung. Und der EuGH hat<br />
die Kommission quasi zum Handeln<br />
aufgefordert. Mit der EU-Richtlinie<br />
über die Koordinierung der Verfahren<br />
zur Vergabe öffentlicher Bau-,<br />
Juni 2011<br />
546 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INTERVIEW<br />
Liefer- und Dienstleistungsaufträge<br />
aus dem Jahr 2004 hat die Kommission<br />
wesentliche Anforderungen<br />
aus dem Gemeinschaftsrecht und<br />
der EuGH-Rechtsprechung an das<br />
Vergaberecht bereits aufgegriffen.<br />
<strong>gwf</strong>: Europa hat jetzt 20 Jahre Markterfahrung<br />
im Umgang mit Instrumenten<br />
der EU-Rahmenbedingungen<br />
hinter <strong>sich</strong>. In Öffentlich-Privaten<br />
Partnerschaften sind lebensfähige<br />
Unternehmensformen entstanden,<br />
die ohne Reglementierung durch das<br />
öffentliche Ausschreibungs- und Vergaberecht<br />
auskommen. <strong>Wo</strong>rauf<br />
begründet <strong>sich</strong> der fast schon körperlich<br />
zu spürende Handlungsbedarf<br />
der EU-Kommission?<br />
Jörg Simon: Die EU-Kommission<br />
entwickelte bereits 2005 im Grünbuch<br />
zu ÖPP weitergehende Ansätze<br />
zu Vergabebestimmungen, was die<br />
Bildung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften<br />
und auch Konzessionen<br />
tangierte. Demnach sollten Konzessions-,<br />
Lizenz- oder sonstige ausschließliche<br />
Verträge zwischen<br />
Kommunen und Ver sorgern – die<br />
Dienstleistungskon zessionen – ausschreibungspflichtig<br />
sein.<br />
Weiterhin sollte bei neu<br />
gegründeten gemischtwirtschaftlichen<br />
Unternehmen die Auswahl<br />
des privaten Partners, der <strong>sich</strong><br />
be teiligt, ausschreibungspflichtig<br />
werden. Im Übrigen soll der öffentliche<br />
Auftraggeber, der <strong>sich</strong> selbst<br />
bei einem neu gegründeten<br />
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen<br />
beteiligt, verpflichtet sein, die<br />
Auftragsvergabe an dieses Unternehmen<br />
auszuschreiben. Die Praxis<br />
hat in dieser Zeit gezeigt, dass <strong>sich</strong><br />
dieser Rechtsrahmen für Konzessionen<br />
nicht bewährt hat. Das EU-Parlament<br />
hat <strong>sich</strong> 2010 hierzu geäußert.<br />
<strong>gwf</strong>: Kommen wir wieder zurück nach<br />
Deutschland. Wird Ausschreibungspflicht<br />
von Dienstleistungskonzessionen<br />
im europäischen Recht verankert,<br />
wie sähen die Konsequenzen für die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft aus?<br />
Jörg Simon: Anstelle eines Mehrwertes<br />
sehe ich erst einmal bei allen<br />
Fazit<br />
§ Die ordnungspolitische Diskussion bleibt uns in 2011 und 2012 erhalten<br />
§ Modell der <strong>Wasser</strong>wirtschaft in Deutschland ist erfolgreich<br />
§ Gestaltungsfreiheit in der jetzigen Form sollte erhalten bleiben,<br />
Handlungsfreiheit der Kommunen soll nicht beschränkt werden<br />
F<br />
Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft spricht <strong>sich</strong> aus diesen<br />
Gründen gegen die geplante Ausschreibungspflicht<br />
von Dienstleistungskonzessionen aus.<br />
Beteiligten einen Mehraufwand, der<br />
mit dieser Verrechtlichung einhergeht.<br />
Für kommunale Unternehmen<br />
bedeutet Ausschreibungspflicht<br />
auch die Möglichkeit des Scheiterns,<br />
eine Konzession zu verlieren<br />
und im schlimmsten Fall das Ende<br />
der geschäftlichen Tätigkeit. Denn<br />
das Kommunalwirtschaftsrecht verwehrt<br />
ihnen eine andere wirtschaftliche<br />
Tätigkeit, der freie Markt bleibt<br />
einem kommunalen Unternehmen<br />
verschlossen. Insolvenz wäre die<br />
Folge und dieses Risiko geht zu Lasten<br />
der Öffentlichkeit.<br />
<strong>gwf</strong>: Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft lehnt eine<br />
Ausschreibungspflicht ab?<br />
Jörg Simon: Ja, aus verschiedenen<br />
Gründen. Erstens sind die Konsequenzen<br />
einer Ausschreibungspflicht<br />
meines Erachtens ein<br />
er heblicher Stolperstein, der in der<br />
Auseinandersetzung mit der EU-<br />
Kommission unbedingt diskutiert<br />
werden muss. Zweitens ist die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
aus formalen Gründen<br />
ablehnend eingestellt, da Dienstleistungskonzessionen<br />
per se keine<br />
öffentlichen Aufträge sind, die ausgeschrieben<br />
werden müssten. Drittens<br />
steht eine Ausschreibungspflicht<br />
für Konzessionen der Frage<br />
des Eigentums an Verteilungsnetzen<br />
und <strong>Wasser</strong>werken entgegen,<br />
die <strong>sich</strong> in der Regel in kommunaler<br />
Hand befinden.<br />
<strong>gwf</strong>: Ist das eine typisch deutsche<br />
Sicht?<br />
Jörg Simon: Nein, gegenüber der<br />
EU-Kommission haben viele Mitgliedstaaten<br />
vorgetragen, dass Notwendigkeiten<br />
und Vorteile eines<br />
gesetzlichen Rahmens für eine<br />
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie<br />
nicht erkennbar dargelegt seien.<br />
Ebenso bestünden unklare Regelungen<br />
und Rechtsun<strong>sich</strong>erheiten<br />
für Auftraggeber und Bieter. Nachlesen<br />
lässt <strong>sich</strong> das auch im „Rühle-<br />
Bericht zur angestrebten Reform<br />
des öffentlichen Vergabewesen“<br />
vom 10. Mai 2010 an das europäische<br />
Parlament: „Ein Vorschlag für<br />
einen Rechtsakt über DLK wäre<br />
dann gerechtfertigt…, wenn durch<br />
ihn Verzerrungen beim Funktionieren<br />
des Binnenmarktes abgestellt<br />
werden sollen … die bisher noch<br />
nicht festgestellt worden sind.“<br />
<strong>gwf</strong>: Wann werden wir einen konsensfähigen<br />
Entwurf aus Brüssel<br />
sehen?<br />
Jörg Simon: Ungeachtet des<br />
Votums des EU-Parlamentes und<br />
der von vielen EU-Mitgliedstaaten<br />
vorgetragenen Vorbehalte sieht die<br />
EU-Kommission weiter Handlungsbedarf<br />
und hat <strong>sich</strong> selbst ein ehrgeiziges<br />
Zeitfenster für 2011 für die<br />
Vorlage eines Richtlinienentwurfs<br />
gesetzt. Wie es aussieht, können wir<br />
bis Mitte des Jahres mit einem Entwurf<br />
rechnen. Was ebenfalls <strong>sich</strong>er<br />
ist, dass uns die Debatte in diesem<br />
und auch im kommenden Jahr noch<br />
begleiten wird.<br />
Herr Simon, wir danken Ihnen für das<br />
Gespräch.<br />
Quellennachweis:<br />
Folien entnommen aus dem Vortrag<br />
„Dienstleistungskonzessionen im <strong>Wasser</strong>und<br />
<strong>Abwasser</strong>bereich – Pro und Kontra –"<br />
vom 3. Mai 2011 anlässlich des Kongresses<br />
wat + WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
2011.<br />
Gründe<br />
gegen einen<br />
erweiterten<br />
EU-Rechtsrahmen<br />
„Dienstleistungskonzessionen“.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 547
THEMA<br />
Notwasser<br />
Bei Naturkatastrophen wie Erdbeben,<br />
Vulkanausbrüchen oder<br />
Tsunami wird in der Regel die Trinkwasserversorgung<br />
zerstört, weshalb<br />
schnell eine Notlage bei der Bereitstellung<br />
von sauberem und von<br />
Krankheitserregern freiem Trinkwasser<br />
entsteht. Die Möglichkeit,<br />
das <strong>Wasser</strong> abzukochen und auf<br />
diese Weise die krankmachenden<br />
Mikroben abzutöten, ist bei Katastrophen<br />
eingeschränkt.<br />
Erste Hilfe leisten Chlortabletten<br />
[1], die meistens aus Natriumdichlorisocyanurat<br />
bestehen und so bemessen<br />
sind, dass eine Tablette zur<br />
Desinfektion von zehn Liter <strong>Wasser</strong><br />
ausreicht. Um <strong>sich</strong>er zu stellen, dass<br />
das <strong>Wasser</strong> keine Giftstoffe enthält,<br />
prüft man vor der Desinfektion, ob<br />
Lebewesen wie Algen, Protozoen<br />
oder <strong>Wasser</strong>flöhe vorhanden sind.<br />
Mit Chlortabletten desinfiziertes<br />
<strong>Wasser</strong> hilft zum Überleben, aber<br />
gut schmecken tut es nicht und ist<br />
deshalb nur eine kurzfristige<br />
Lösung. Es gibt zahlreiche andere<br />
Möglichkeiten zur Aufbereitung<br />
von <strong>Wasser</strong>, wobei wir zwischen<br />
kleinen individuellen Maßnahmen<br />
In einer der sogenannten <strong>Wasser</strong>blasen können bis zu 1000 Liter<br />
Trinkwasser aufbewahrt werden. Quelle: THW<br />
für einzelne oder wenige Personen<br />
und größeren Vorrichtungen für<br />
Gruppen, Krankenstationen, Camps<br />
und ganze Dörfer unterscheiden<br />
wollen. Einige kleine Lösungen werden<br />
von der Freizeitindustrie bereitgestellt,<br />
so beispielsweise für Hochseeschiffer<br />
ein Osmose-Beutel [2],<br />
der aus einer semipermeablen, nur<br />
für <strong>Wasser</strong>moleküle durchlässigen<br />
Membran besteht, und im Inneren<br />
Nährsalze und Energiespender enthält.<br />
Gemäß dem osmotischen<br />
Gesetz werden selbst aus Meerwasser<br />
<strong>Wasser</strong>moleküle durch die Membran<br />
in den Innenraum das Beutels<br />
diffundieren, dort Nährsalze und<br />
Energiespender lösen und ein Energiegetränk<br />
erzeugen. Solche Os -<br />
mose-Beutel sind in Katastrophenfällen<br />
sehr hilfreich.<br />
Andere Beispiele für kleine<br />
Lösungen aus dem Freizeitbereich<br />
sind <strong>Wasser</strong>filterflaschen und Keramikfilter,<br />
die für Globetrotter und<br />
Rucksacktouristen angeboten werden.<br />
<strong>Wasser</strong>filterflaschen [3] bestehen<br />
aus einem flexiblen Kunststoff<br />
und besitzen einen Filter, der Aktivkohle<br />
und Hohlfasermembranen<br />
enthält. Das unreine <strong>Wasser</strong> gießt<br />
man durch eine Einfüllöffnung in<br />
die Flasche und verschließt sie.<br />
Indem man die Flasche von Hand<br />
zusammendrückt, wird gereinigtes<br />
<strong>Wasser</strong> durch den Filter gepresst.<br />
Bei den Keramikfiltern [4] wird<br />
mit Hilfe einer von Hand betriebenen<br />
Pumpvorrichtung unreines<br />
<strong>Wasser</strong> über einen Vorfilter angesaugt,<br />
durch den Keramikfilter ge -<br />
presst und dabei gereinigt. Solche<br />
Filter kann man über einen langen<br />
Zeitraum verwenden, wenn man sie<br />
gelegentlich mit einem Desinfektionsmittel<br />
behandelt.<br />
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert<br />
das „Krisenfass“ [4b], das,<br />
ob<strong>wohl</strong> deutlich größer als <strong>Wasser</strong>filterflaschen,<br />
so gestaltet ist, dass<br />
es in Katastrophengebieten aus<br />
Hubschraubern abgeworfen werden<br />
kann. Das „Krisenfass“ enthält<br />
zentral einen Filter aus gesinterter<br />
Aktivkohle und Kapillarmembranen.<br />
Nachdem man bis zu 30 Liter<br />
Schmutzwasser eingefüllt hat, wird<br />
das Fass verschlossen. Mit der in das<br />
Fass eingebauten Handpumpe er -<br />
zeugt man im Inneren einen Überdruck,<br />
der das <strong>Wasser</strong> durch den Filter<br />
nach außen drückt, wo es <strong>sich</strong> als<br />
Trinkwasser aus einem Schlauch mit<br />
Zapfhahn entnehmen lässt.<br />
Im Vergleich mit den Hilfsbedürftigen<br />
bei Naturkatastrophen<br />
sind die meisten der etwa eine Milliarde<br />
Menschen, die in einer permanenten<br />
Katastrophe ohne Zugang<br />
zu sauberem <strong>Wasser</strong> leben, schlechter<br />
dran. So viele Menschen können<br />
nicht über Spendengelder dauerhaft<br />
mit Osmose-Beuteln, <strong>Wasser</strong>filterflaschen<br />
und Keramikfiltern<br />
versorgt werden. Dieser Mangel<br />
führte jedoch zu einer genialen<br />
Innovation, die unter dem Namen<br />
„SODIS“ (Solar Water Disinfection)<br />
[5] in sonnenreichen Gegenden zur<br />
Anwendung kommt und die desinfizierende<br />
Wirkung der im Sonnenlicht<br />
vorhandenen ultravioletten<br />
Strahlung nutzt. Unreines, mikro-<br />
Juni 2011<br />
548 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
THEMA<br />
biell verschmutztes <strong>Wasser</strong> wird in<br />
Flaschen gefüllt und diese in horizontaler<br />
Lage sechs Stunden lang in<br />
direktes Sonnenlicht gelegt. Durch<br />
diese Behandlung lassen <strong>sich</strong> Erreger<br />
von Durchfallerkrankungen und<br />
Cholera abtöten. Geeignet sind PET-<br />
Flaschen, die für UV-Licht besser<br />
durchlässig sind als Glasflaschen.<br />
Diese Technik wurde von Professor<br />
Aftim Acra in Beirut entdeckt und in<br />
der Schweiz von dem <strong>Wasser</strong>forschungsinstitut<br />
Eawag zur Anwendungsreife<br />
gebracht.<br />
Ein anderes interessantes „lowcost“<br />
Produkt wurde von der Hilfsorganisation<br />
„Potters for Peace“ [6]<br />
ins Leben gerufen. Hierbei handelt<br />
es <strong>sich</strong> um einen keramischen <strong>Wasser</strong>filter,<br />
der vor Ort unter Einbindung<br />
von lokalen Töpfern aus einem<br />
Brei von Ton und Sägespänen – oder<br />
einem anderen biologischen Material<br />
wie beispielsweise zerkleinerten<br />
Getreidespelzen – zu einem Topf<br />
gepresst und dann bei 860 Grad<br />
Celsius gebrannt wird. Beim Brennen<br />
zersetzt <strong>sich</strong> das organische<br />
Material und zurück bleibt ein feinporiger<br />
Tontopf, der nach einer<br />
Behandlung mit kolloidalem Silber<br />
zu einem funktionsfähigen Filter<br />
wird, in dem Krankheitserreger<br />
zurückgehalten und abgetötet werden.<br />
Vorteilhaft ist, dass man diese<br />
Art von <strong>Wasser</strong>filter weitgehend aus<br />
lokalen Grundstoffen mit relativ<br />
geringen Investitionskosten in in -<br />
dustriellem Maßstab lokal herstellen<br />
kann und somit die Wertschöpfung<br />
in der Region behält.<br />
Für Einzelpersonen und kleine<br />
Gruppen geeignet ist ein neues, mit<br />
dem Namen „Lifestraw“ [7] bezeichnetes<br />
tragbares <strong>Wasser</strong>reinigungssystem.<br />
Die Vorrichtung besteht aus<br />
einem Einfülltrichter mit Grobfilter,<br />
einem 1,5 Meter langen Schlauch<br />
und einem 30 Zentimeter langen<br />
Kunststoffgehäuse, in dem <strong>sich</strong> zur<br />
Ultrafiltration geeignete Kunststoffmembranen<br />
befinden. Den Einfülltrichter<br />
befestigt man in etwa zwei<br />
Meter Höhe an einer Wand.<br />
Schmutzwasser wird in den Trichter<br />
gefüllt, fließt durch den Schlauch<br />
nach unten in den Ultrafilter, wird<br />
dort von Viren, Bakterien und anderen<br />
Krankheitserregern befreit und<br />
verlässt den Filter als reines Trinkwasser.<br />
Die Ultrafiltration erfolgt<br />
hier ohne eine zusätzliche Pumpe<br />
allein durch den hydrostatischen<br />
Druck von 150 bis 200 Hektopascal.<br />
Membranverfahren sind die<br />
Grundlage von weiteren Vorrichtungen<br />
zur Aufbereitung von Notwasser.<br />
So enthält eine unter dem<br />
Namen „<strong>Wasser</strong>rucksack Paul“ [8]<br />
bekannte Vorrichtung eine Membranfläche,<br />
mit der etwa 1200 Liter<br />
<strong>Wasser</strong> pro Tag gefiltert werden<br />
können. Bei einem Gewicht von<br />
20 Kilogramm lässt <strong>sich</strong> der <strong>Wasser</strong>rucksack<br />
leicht an Orte des Bedarfs<br />
transportieren und kann dort das<br />
Überleben von etwa 200 Personen<br />
<strong>sich</strong>ern.<br />
Ein Problem bei der Membranfiltration<br />
ist die Nachverkeimung. Ob -<br />
<strong>wohl</strong> diese Filter bis zu 99,999999<br />
Prozent der Mikroorganismen zu -<br />
rückhalten, passieren doch einige<br />
wenige die Filtermembran und können<br />
<strong>sich</strong> nach dem Filter ansiedeln<br />
und vermehren, wobei organische<br />
Moleküle, die ebenfalls durch die<br />
Membran ins reine <strong>Wasser</strong> gelangen,<br />
als Nahrung dienen. Je nach<br />
Beschaffenheit des Schmutzwassers<br />
können auf der Reinseite der Filter<br />
innerhalb von wenigen Tagen Biofilme<br />
entstehen, aus denen bei <strong>Wasser</strong>fluss<br />
Keime abgeschwemmt werden.<br />
Zur Lösung dieses Problems<br />
kann man die Filtersysteme sporadisch,<br />
zum Beispiel einmal täglich<br />
mit Chlortabletten entkeimen, oder<br />
man desinfiziert kontinuierlich,<br />
indem man eine schwer lösliche<br />
und nur langsam Chlor frei setzende<br />
Substanz wie Trichlorisocyanursäure<br />
[9] in den Filter gibt. Auch die<br />
kontinuierliche Desinfektion mit<br />
einem so genannten N-Halamin-<br />
Polymer [10], das <strong>sich</strong> an andere<br />
Polymere wie Polystyrol koppeln<br />
lässt, wurde beschrieben. N-Halamin-Polymere<br />
werden in einer Kartusche<br />
verpackt angeboten und<br />
können in dieser Form mit dem Ausgang<br />
eines Membranfiltermoduls<br />
Trinkwasseraufbereitungsanlage in einem<br />
Katastrophengebiet. Quelle: THW<br />
verbunden werden. Eine andere<br />
Möglichkeit, die Nachverkeimung<br />
zu überwinden, beruht auf einer<br />
Lösung von <strong>Wasser</strong>stoffperoxid und<br />
Silberionen [11], die mit Hilfe einer<br />
Venturi-Vorrichtung in kleiner Konzentration<br />
dem <strong>Wasser</strong> zudosiert<br />
werden kann. Im Reinwassertank<br />
lässt <strong>sich</strong> die Keimvermehrung<br />
durch UV-Strahler unterbinden.<br />
Interessantes Know-how über<br />
Verfahren zur Herstellung von Notwasser<br />
erarbeitete das Militär. Nach<br />
dem Einheitsdosierplan der Bundeswehr<br />
[12] lässt <strong>sich</strong> verunreinigtes<br />
<strong>Wasser</strong> in drei Stufen reinigen.<br />
Dazu gibt man zu einem Kubikmeter<br />
Rohwasser im ersten Schritt<br />
240 Gramm Chlor in Form von Calciumhypochlorit<br />
oder Natriumdichlorisocyanurat<br />
und lässt das Chlor eine<br />
Stunde lang reagieren. Das so desinfizierte<br />
<strong>Wasser</strong> vermischt man mit<br />
800 Gramm Aktivkohle und erlaubt<br />
dieser eine Stunde zu wirken. Während<br />
dieser Zeit adsorbieren im<br />
<strong>Wasser</strong> vorhandene Schadstoffe<br />
sowie Chlor und chlorierte Produkte<br />
an die Aktivkohle. Dadurch wird<br />
auch der Geschmack des <strong>Wasser</strong>s<br />
verbessert. In der nachfolgenden<br />
dritten Stufe dosiert man 100<br />
Gramm dreiwertiges Eisen als Eisentrichlorid<br />
zu und wartet wieder eine<br />
Stunde, in deren Verlauf <strong>sich</strong> Flocken<br />
bilden und sedimentieren. Auf<br />
der Grundlage dieser chemischen<br />
Aufbereitung wurde das „Notwasserschrägschlauchverfahren“<br />
[13]<br />
<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 549
THEMA<br />
entwickelt: Ein zum Transport aufgerollter,<br />
beidseitig verschließbarer<br />
Folienschlauch enthält die zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
notwendigen Substanzen<br />
in Portionen verpackt. Am<br />
Ort des Bedarfs wird der Folienschlauch<br />
ausgerollt auf eine schräge<br />
Fläche gelegt, mit Rohwasser befüllt<br />
und dieses nach dem Einheitsdosierplan<br />
schrittweise behandelt.<br />
Nach erfolgter Reinigung kann man<br />
das <strong>Wasser</strong> über einen im Schrägschlauch<br />
vorhandenen Hahn mit<br />
vorgeschaltetem Filter entnehmen.<br />
Die bislang beschriebenen Verfahren<br />
kommen ohne elektrische<br />
Energie aus und arbeiten mit hydrostatischem<br />
Druck oder allenfalls mit<br />
einer Handpumpe. Es gibt auch Vorrichtungen,<br />
die so<strong>wohl</strong> mit einer<br />
manuellen Pumpe als auch, wenn es<br />
die Infrastruktur erlaubt, mit einer<br />
Elektropumpe betrieben werden<br />
können. Ein auf diesem dualen Prinzip<br />
beruhender und erfolgreich<br />
angewandter Feldfilter [14] mit<br />
einer Reinigungsleistung von bis zu<br />
500 Liter pro Stunde umfasst neben<br />
der Rohwasserpumpe eine Sicherheits-Chlorung<br />
und Keramikfilterkerzen.<br />
Andere Systeme zur Aufbereitung<br />
von Notwasser arbeiten mit<br />
einer regenerativen Energiequelle.<br />
Eine einfache solarbetriebene <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
ist unter dem<br />
Namen Blue Spring [15] bekannt.<br />
Das von einer Person tragbare System<br />
besteht neben dem Photovoltaikpaneel<br />
aus einem feinen Vorfilter<br />
und einem Umkehrosmosemodul.<br />
Damit können unter<br />
tro pischer Sonne in acht Stunden<br />
225 Liter Trinkwasser hergestellt<br />
werden. Aufwändiger gestaltet und<br />
erheblich größer und teurer ist die<br />
mit regenerativer Energie betriebene<br />
mobile <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage<br />
„mobile cube“ [16]. Mehrere<br />
Photovoltaikpaneele oder alternativ<br />
ein Windkraftrad erzeugen eine<br />
elektrische Leistung von etwa<br />
einem Kilowatt. Die gewonnene<br />
Energie wird in Batterien gespeichert<br />
und dient in erster Linie zur<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung. Pro Tag lassen <strong>sich</strong><br />
bis zu 20 Kubikmeter Trinkwasser<br />
herstellen und damit 4000 Menschen<br />
versorgen. Die Anlage<br />
um fasst eine elektrische Energierückgewinnungspumpe,<br />
die das<br />
Schmutzwasser durch einen automatisch<br />
rückspülbaren Vorfilter und<br />
ein Umkehrosmose-System drückt.<br />
Das gereinigte <strong>Wasser</strong> fließt in einen<br />
Speichertank, wo es mit UV-Licht<br />
keimfrei gehalten wird. Da überschüssige,<br />
nicht für die <strong>Wasser</strong>reinigung<br />
benötigte Energie zum Beispiel<br />
für Beleuchtung und Television<br />
oder zum Aufladen von Mobiltelefonen<br />
bereit steht, bietet diese<br />
Anlage zusätzlichen Nutzen.<br />
Bei ähnlich großen Anlagen im<br />
Leistungsbereich von 20 bis 30<br />
Kubikmeter pro Tag dient ein<br />
Dieselgenerator als Energiequelle.<br />
Die aus mehreren Reinigungs komponenten<br />
bestehenden Anlagen<br />
sind meistens in einen Container<br />
eingebaut und auf einen mobilen<br />
Untersatz montiert. Eine relativ<br />
einfache Anlage [17] besteht aus<br />
einem Beutelfilter als Vorfilter,<br />
Vorchlorung, Umkehrosmose und<br />
Nachchlorung. Aufwändigere An -<br />
lagen [18] ergänzen diese Kom ponenten<br />
durch einen oder mehrere<br />
rückspülbare Vorfilter, einen Aktivkohlefilter<br />
und, vor der Umkehrosmose,<br />
eine Feinstfiltration wie<br />
Mikro- oder Ultrafiltration.<br />
Im Unterschied zu den oben<br />
beschriebenen kleinen und relativ<br />
preiswerten Vorrichtungen, die in<br />
großen Stückzahlen an die be -<br />
troffene Bevölkerung verteilt werden,<br />
geht man bei den teuren An -<br />
lagen so vor, dass man sie in die<br />
Obhut von Hilfsorganisationen<br />
stellt und sie mindestens am Anfang<br />
durch deren geschultes Personal<br />
betreibt.<br />
Literatur<br />
[1] http://www.chemicalbook.com<br />
http://www.membrane-engineering.de<br />
– Bezugsquelle für kleine<br />
Chlortabletten<br />
[2] http://www.htiwater.com –<br />
HydroPack forward osmosis<br />
[3] http://www.911water.com/Personal-<br />
Portable-Water-Filter-Bottle-p/<br />
pfwb.htm<br />
http://www.ecoflowater.com –<br />
Ecoflo 260z Flip Top Filter Water<br />
Bottle<br />
[4] http://www.katadyn.com –<br />
Katadyn Pocket Filter<br />
http://www.aquatechnology.net/<br />
portableceramicfilters.html<br />
http://www.lifesaversystems.com<br />
[4.b] http://www.carbonit.de – Krisenfaß<br />
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/SODIS<br />
http://www.safewatersystems.com/<br />
solar_water_pasteurizers<br />
[6] http://www.pottersforpeace.org<br />
[7] http://www.vestergaard-frandsen.<br />
com/lifestraw<br />
Patentanmeldung WO 2008/110165<br />
A1<br />
[8] http://www.wasserrucksack.de<br />
[9] http://de.wikipedia.org/wiki/<br />
Trichlorisocyanursäure<br />
[10] http://www.halopure.com –<br />
Bacteriostatic Water Cartridge<br />
Patent US 6162452 A<br />
Patent US 006969769 B2<br />
[11] http://www.hungerbach.de<br />
Patent DE 3645266 C2<br />
[12] Hinterberger, J.: Experimentelle<br />
Untersuchungen zur Trinkwasseraufbereitung<br />
nach dem Einheitsdosierplan<br />
(EDP) unter besonderer<br />
Berück<strong>sich</strong>tigung biologisch<br />
belasteter Wässer. Vortrag 1995.<br />
[13] Offenlegungsschrift DE 10 2005 023<br />
678 A1<br />
[14] http://www.elga-berkefeld.de –<br />
Feldfilter FF 500<br />
[15] http://www.bluspr.com/emergency_solar_water_purifier.html<br />
[16] http://www.mobilecube.ch<br />
[17] http://www.karcher-futuretech.com<br />
– Waterclean WTC 1000 CMG<br />
[18] http://www.gruenbeck.de –<br />
Mobile Trinkwasseraufbereitung für<br />
Katastrophenregionen<br />
Autor:<br />
Dr. Bernd Wurster,<br />
Steinbeis-Transferzentrum Umwelttechnik,<br />
Macairestraße 11,<br />
D-78467 Konstanz,<br />
Tel. (0 75 31) 18 95 59,<br />
Fax (07531) 458083,<br />
E-Mail stz190@stw.de,<br />
(eine operative Einheit von www.stw.de)<br />
Juni 2011<br />
550 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
4. Kolloquium der S.I.T.W. zur<br />
Trinkwasserspeicherung<br />
22. September 2011, Koblenz<br />
Welche Änderungen die ratifizierte<br />
Novellierung der Trinkwasserverordnung<br />
(TrinkwV 2001)<br />
für den Tagesbetrieb mit <strong>sich</strong> bringt,<br />
werden hochrangige Experten auf<br />
dem 4. Kolloquium der Trinkwasserspeicherung<br />
erläutern.<br />
Die jährliche Tagung findet in<br />
Kooperation mit DVGW und der<br />
Fachhochschule Koblenz, welche<br />
die Räumlichkeiten zur Verfügung<br />
stellt, statt.<br />
Mit bis zu 130 Teilnehmern hat<br />
<strong>sich</strong> die Veranstaltung zum beliebten<br />
Branchentreff entwickelt für<br />
<strong>Wasser</strong>meister und <strong>Wasser</strong>werksleiter,<br />
Planer von <strong>Wasser</strong>werken und<br />
Trinkwasseranlagen sowie Vertreter<br />
von Bauverwaltungen und Gesundheitsämtern<br />
in diesem Bereich.<br />
Das Besondere ist die Mischung<br />
aus hochkarätigen Vorträgen, dem<br />
durchgängigen Praxisbezug und<br />
viel Raum für den persönlichen<br />
Eckart Flint, 1. Vorsitzender der<br />
S.I.T.W. Foto: S.I.T.W.<br />
Erfahrungsaustausch. Impressionen<br />
einiger Teilnehmer der letzten Veranstaltung<br />
sind im separaten Kasten<br />
zu lesen.<br />
Impressionen der Teilnehmer vom 3. Kolloquium 2010<br />
Dipl.-Ing. Günter Geffert besuchte die Tagung im September 2010,<br />
um sein Fachwissen aufzufrischen sowie mit anderen Versorgern<br />
und Planern Erfahrungen auszutauschen. Der Anlagenplaner beim<br />
Versorger SWU Energie GmbH interessierte <strong>sich</strong> besonders für den<br />
Hygiene-Vortrag von Dr. Georg-Joachim Tuschewitzki: „Die Testmethoden<br />
waren sehr anschaulich erläutert.“ Diese erklärten einiges,<br />
beispielsweise wie die Zulassungen von Materialien zustande kommen,<br />
die in einem Trinkwasserbehälter eingesetzt werden.<br />
Für Dipl.-Ing. Martin Hoppe stand das Regelwerk im Fordergrund:<br />
„Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach lieferte Informationen aus erster<br />
Hand, wie den Überarbeitungsstand des DWGW-Arbeitsblattes<br />
W 312“, so der Abteilungsleiter Betrieb Netze und Anlagen EG/TW<br />
Mönchengladbach bei der NEW Netz GmbH. Zudem schätzt er die<br />
kompakte Darstellung der unterschiedlichen Blickwinkel, den die<br />
Beteiligten eines Projektes haben. „Das ist gerade das Besondere an<br />
dieser Veranstaltung: Nicht nur Theorie zu vermittelt zu bekommen,<br />
sondern auch viele praktische Erfahrungen.“<br />
Verschiedene Blickwinkel<br />
aufgezeigt<br />
Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach von<br />
der Fachhochschule Koblenz wird<br />
erneut die fachliche Leitung übernehmen<br />
und in gewohnt unterhaltsamer<br />
Weise auf häufige Anwendungsfragen<br />
bezüglich des DVGW-<br />
Regelwerks zu Sanierung und<br />
Instandhaltung von Behältern eingehen.<br />
Als weiteres Thema ist das Qualitätsmanagement<br />
für die Instandsetzung<br />
in der Trinkwasserspeicherung<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt W 316-1<br />
aus Sicht der ausführenden Firmen<br />
geplant. Außerdem wird der Maßnahmenkatalog<br />
für das Arbeiten in<br />
Trinkwasser-Schutzzonen vorgestellt.<br />
Zum Schluss folgt der übliche<br />
Praxisblock, der ausreichend Gelegenheit<br />
für Fragen aus dem Publikum<br />
sowie Live-Demonstrationen<br />
geben wird, wofür der Veranstaltungsort<br />
– das Prüflabor der Fachhochschule<br />
– beste Voraussetzungen<br />
bietet.<br />
Reich bemessene Pausen zwischen<br />
den Vorträgen erlauben einen<br />
ungezwungenen Austausch aller<br />
Beteiligten über Theorie und Praxis.<br />
Infos/Anmeldung:<br />
E-Mail: verwaltung@sitw.de,<br />
Tel. (05231) 96 09 18,<br />
Fax (05231) 661 02,<br />
www.sitw.de<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Grasstraße 11 • 45356 Essen<br />
Telefon (02 01) 8 61 48-60<br />
Telefax (02 01) 8 61 48-48<br />
www.aquadosil.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 551
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Trinkwasserspeichersysteme aus PE 100 Wickelrohr<br />
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel der Erde und durch nichts zu ersetzen. Es bildet die Grundlage<br />
allen Lebens auf der Erde. In Deutschland ist es zugleich das reinste und am meisten überwachte Lebensmittel.<br />
Trinkwasser wird ständig auf seine Qualität und Inhaltsstoffe überprüft. Der Verbrauch in Deutschland<br />
beträgt ~ 120 Liter pro Tag und Bundesbürger, welches einer Gesamtmenge von ungefähr 4 Milliarden Kubikmeter<br />
Jahresverbrauch entspricht. Da diese gewaltigen <strong>Wasser</strong>mengen nicht gleichmäßig über den Tag verteilt<br />
benötigt und aus den <strong>Wasser</strong>netzen entnommen werden, müssen die Verbrauchsspitzen und betrieblichen<br />
Stillstandzeiten bei der <strong>Wasser</strong>förderung durch zum Beispiel Trinkwasserspeicher abgedeckt werden.<br />
Normen und Richtlinien<br />
Die Qualität des Trinkwassers ist in<br />
der Trinkwasserverordnung gesetzlich<br />
geregelt. Wesentliche Grundlage<br />
der Trinkwasserverordnung ist<br />
ihr direkter Bezug zu den allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik<br />
wie z. B. den DVGW-Regelwerken<br />
und den DIN-Normen. Die harmonisierte<br />
europäische Norm DIN EN<br />
1508 „<strong>Wasser</strong>versorgung – Anforderungen<br />
an Systeme und Bestandteile<br />
der <strong>Wasser</strong>speicherung“ beinhaltet<br />
die normativen Grundlagen<br />
für das Speichern von Trinkwasser.<br />
Ergänzend hierzu spiegelt das<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 300 „<strong>Wasser</strong>speicherung<br />
– Planung, Bau, Betrieb<br />
und Instandhaltung von <strong>Wasser</strong>behältern<br />
in der Trinkwasserversorgung“<br />
detaillierte Festlegungen<br />
des aktuellen Kenntnisstands in<br />
Deutschland wider. Beide Regelwerke<br />
wurden ursprünglich für<br />
Speichersysteme aus dem Werkstoff<br />
Beton erstellt, gelten sinngemäß<br />
aber auch für Speichersysteme aus<br />
anderen Werkstoffen. Sie beab<strong>sich</strong>tigen<br />
nicht bestehende Behälter zu<br />
verändern um der Norm gerecht zu<br />
werden, sondern verstehen <strong>sich</strong><br />
vielmehr als „Hilfsmittel“ bei der<br />
Herstellung neuer <strong>Wasser</strong>speicher.<br />
Bild 1. Transport.<br />
Der Werkstoff Polyethylen<br />
Da Polyethylen seit vielen Jahrzehnten<br />
erfolgreich in der Gas- und<br />
Trinkwasserversorgung in Form von<br />
Rohren, Formteilen und Schachtbauwerken<br />
eingesetzt wird und<br />
auch bei der Sanierung von Trinkwasserbehältern<br />
<strong>sich</strong> ständig steigender<br />
Nachfrage erfreut, war es<br />
nur eine Frage der Zeit, bis auch<br />
beim Neubau von Trinkwasserspeichern<br />
die Nachfrage nach diesem<br />
Werkstoff aufkam. Die Vorteile des<br />
Polyethylen gegenüber Beton liegen<br />
in dem sehr hohen Widerstand<br />
gegen Chemikalien und äußere<br />
Umwelteinflüsse, dem geringen<br />
spezifischen Gewicht und dem<br />
dadurch einfachen Handling auf der<br />
Baustelle, der Möglichkeit der Vorfertigung<br />
von Großteilen in der<br />
Werkstatt und der damit zusammenhängenden<br />
schnellen Endfertigung<br />
vor Ort sowie der einfachen<br />
Reinigung der sehr glatten Oberflächen.<br />
Weitere Vorteile gegenüber<br />
anderen Werkstoffen, welche für<br />
den Bau von Trinkwasserspeichern<br />
eingesetzt werden sind z. B. die<br />
vergleichsweise einfache Verarbeitung,<br />
Erweiterungs- oder Änderungsmöglichkeiten<br />
und die Möglichkeit<br />
des Recyclings sofern der<br />
Trinkwasserspeicher irgendwann<br />
nicht mehr benötigt werden sollte.<br />
Die für den Bau von Trinkwasserspeichern<br />
eingesetzten PE 100 Rohstoffe<br />
sind vom DVGW und KRV für<br />
den Transport und die Speicherung<br />
von Trinkwasser zugelassen und<br />
entsprechen den Anforderungen<br />
des DVGW-Arbeitsblattes W 270<br />
„Vermehrung von Mikroorganismen<br />
auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich<br />
– Prüfung und Bewertung“.<br />
Des Weiteren besitzen die für<br />
den Bau eingesetzten Profilwickelrohre<br />
der FRANK & Krah Wickelrohrtechnik<br />
GmbH eine Allgemeine<br />
bauauf<strong>sich</strong>tliche Zulassung des<br />
DIBt, womit die grundlegenden<br />
Voraussetzungen zur Herstellung<br />
von Trinkwasserspeichern aus PE 100<br />
Wickelrohren erfüllt sind.<br />
Definition<br />
Trinkwasserspeicher<br />
Das Arbeitsblatt DVGW W 300<br />
definiert Trinkwasserspeicher als<br />
geschlossene Speicher für Trinkwasser,<br />
die <strong>Wasser</strong>kammern, Bedie-<br />
Juni 2011<br />
552 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
nungshaus und Betriebseinrichtungen<br />
umfasst, Zugangsmöglichkeiten<br />
bietet, Betriebsreserven vorhält,<br />
Druckstabilität gewährleistet und<br />
somit Verbrauchsschwankungen<br />
ausgleicht. Da die Regelwerke keine<br />
Einschränkungen bei der Gestaltung<br />
der Speicher machen, ergeben<br />
<strong>sich</strong> hierfür unzählig viele Möglichkeiten.<br />
Der Fantasie sind kaum<br />
Grenzen gesetzt. Nahezu alles ist<br />
möglich – das Ziel ist jedoch immer<br />
eine technisch einwandfreie, normgerechte<br />
Lösung, die wirtschaftlich<br />
sinnvoll ist. Bei Trinkwasserspeichersystemen,<br />
die aus PE 100 Wickelrohren<br />
hergestellt werden gilt zu<br />
beachten, dass der derzeit maximale<br />
Innendurchmesser 3500 mm<br />
beträgt. Die Speicherkapazität muss<br />
also durch entsprechende Rohrlängen<br />
realisiert werden, für die ausreichend<br />
Platz vorhanden sein muss.<br />
Ebenso muss der Transport der<br />
Rohre zur Baustelle berück<strong>sich</strong>tigt<br />
werden. Bei dem Bildmaterial handelt<br />
es <strong>sich</strong> um einen Trinkwasserspeicher<br />
mit einem Innendurchmesser<br />
von 3500 mm, welcher mit<br />
technischer Unterstützung der<br />
Frank GmbH vom Ingenieurbüro<br />
Kiendl & Moosbauer aus Deggendorf<br />
geplant wurde. Da die Zufahrtswege<br />
zu dem bestehenden Speicher,<br />
der auch weiterhin genutzt<br />
wird, sehr eng sind, musste die neue<br />
PE <strong>Wasser</strong>kammer in einzelnen Segmenten<br />
vor Ort gebracht werden.<br />
Dort wurde die Montage und der<br />
Anschluss an das bestehende<br />
Gebäude innerhalb nur einer <strong>Wo</strong>che<br />
realisiert (Bild 1 und 2). Nach der<br />
Inbetriebnahme des neuen PE 100<br />
Röhrenspeichers wird die zweite<br />
<strong>Wasser</strong>kammer mit HydroClick®<br />
Platten aus PE 100 saniert.<br />
Bild 2. Versetzen.<br />
Aufbau von<br />
Trinkwasserspeichern<br />
Üblicherweise bestehen Trinkwasserspeicher<br />
aus zwei getrennten<br />
<strong>Wasser</strong>kammern, um Inspektionen<br />
und Reinigungsintervalle durchführen<br />
zu können, ohne Einschränkungen<br />
bei der Trinkwasserversorgung<br />
hinnehmen zu müssen.<br />
In dem Planausschnitt (Bild 3) ist<br />
die linke (grün dar gestellte) <strong>Wasser</strong>kammer<br />
des Trinkwasserspeichers<br />
zu sehen, der aus PE 100 Wickelrohren<br />
neu hergestellt wurde. In der<br />
Mitte (rosa dargestellt) befindet <strong>sich</strong><br />
das Bedienhaus, in dem die Entsäuerungsanlage<br />
untergebracht ist.<br />
Rechts daneben (grau dargestellt)<br />
die zweite, gemauerte <strong>Wasser</strong>kammer,<br />
welche noch mit HydroClick®<br />
Platten aus PE 100 saniert wird. Die<br />
Rohrleitungen (Bild 4) der <strong>Wasser</strong>kammern<br />
werden durch das Bedienhaus<br />
geführt, damit die <strong>Wasser</strong>kammerwände<br />
jederzeit kontrolliert<br />
werden können. Das Bedienhaus<br />
sollte so ausgeführt werden, dass<br />
eine leichte Bedienung und Reinigung<br />
des Speichers möglich ist. Der<br />
Zugang zu den <strong>Wasser</strong>kammern<br />
muss <strong>sich</strong>er sein und einen einfachen<br />
Betrieb ermöglichen. Die Öff-<br />
<br />
Green Solutions<br />
Nachhaltige Lösungen für Energie- und Umwelttechnik. Energie umweltschonend zu produzieren und zu<br />
ver teilen ist eine große gesellschaftliche Herausforderung der Zukunft. Wir liefern Rohrleitungssysteme,<br />
die <strong>Wasser</strong>, <strong>Abwasser</strong> und Gas <strong>sich</strong>er und zuverlässig transportieren. Entdecken Sie, wie Kunst stoffe von<br />
SIMONA helfen können, Ihre Projekte zu realisieren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf 06752 14-0.<br />
www.simona.de
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Bild 3. Lageplan Tinkwasserspeicher in Langdorf.<br />
Bild 4. Teilsegment der PE 100 <strong>Wasser</strong>kammer.<br />
nungen hierfür müssen den geltenden<br />
UVV entsprechen und so groß<br />
sein, dass Materialien und Ausrüstungsgegenstände<br />
für Reparatur<br />
und Wartung durch sie transportiert<br />
werden können. Ebenso sind Einrichtungen<br />
für Probenahmen im<br />
Bedienhaus für jede Zu- und Entnahmeleitung<br />
sinnvoll, damit die<br />
Bedienung ohne ein Betreten der<br />
<strong>Wasser</strong>kammern möglich ist. Die<br />
Be- und Entlüftungseinrichtungen<br />
für die <strong>Wasser</strong>kammern und das<br />
Bedienhaus sind technisch voneinander<br />
zu trennen. Die <strong>Wasser</strong>kammern<br />
sind mit einem Bypass zur Verbindung<br />
des Zulaufs mit dem Ablauf<br />
zu versehen. Der Überlauf muss so<br />
gestaltet sein, dass ein freies Ablaufen<br />
von überschüssigem <strong>Wasser</strong><br />
möglich ist. Daher ist der Überlauf<br />
entsprechend zu dimensionieren<br />
und darf nicht mit einer Absperreinrichtung<br />
versehen werden. Zur Kontrolle<br />
der <strong>Wasser</strong>kammern sollte die<br />
Oberfläche des gespeicherten <strong>Wasser</strong>s<br />
vollständig leicht einsehbar<br />
sein. Hierzu ist es sinnvoll entsprechende<br />
Schaugläser zwischen<br />
Bedienhaus und <strong>Wasser</strong>kammern<br />
einzusetzen und gegebenenfalls<br />
Beleuchtungsmöglichkeiten in den<br />
<strong>Wasser</strong>kammern vorzusehen. Hierbei<br />
sind die VDE-Vorschriften für<br />
„Feuchte und nasse Räume“ zu<br />
berück<strong>sich</strong>tigen. Ebenso sind Blitzschutzeinrichtungen<br />
in Erwägung<br />
zu ziehen.<br />
Die <strong>Wasser</strong>kammer ist ein in <strong>sich</strong><br />
abgeschlossener Teil des Trinkwasserspeichers<br />
mit separaten Zulauf-,<br />
Entnahme-, Überlauf- und Entleerungseinrichtungen,<br />
die unabhängig<br />
von anderen <strong>Wasser</strong>kammern<br />
betrieben werden kann. Der Zugang<br />
zur <strong>Wasser</strong>kammer sollte in der<br />
Regel nicht im befüllten Zustand<br />
möglich sein, so dass eine Verunreinigung<br />
des Trinkwassers durch das<br />
Öffnen des Zugangs ausgeschlossen<br />
werden kann. In der Regel wird<br />
der Zugang zur <strong>Wasser</strong>kammer<br />
durch das Bedienungshaus realisiert,<br />
in dem auch die Hauptarmaturen,<br />
Pumpen sowie die Kontrollund<br />
Überwachungseinrichtungen<br />
untergebracht sind.<br />
Die Größe eines Trinkwasserspeichers<br />
wird von den Summenlinien<br />
des Zu- und Ablauf zuzüglich einer<br />
Betriebsreserve bestimmt. Bei <strong>Wasser</strong>speichern<br />
mit einem Tageshöchstbedarf<br />
von weniger als eintausend<br />
Kubikmetern beträgt der<br />
Nutzinhalt des <strong>Wasser</strong>speichers<br />
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 300<br />
fünfunddreißig Prozent des Tageshöchstbedarfs.<br />
Bei dem derzeit größtmöglichen<br />
Wickelrohrdurchmesser von<br />
DN 3500 mm beträgt das maximale<br />
Speichervolumen ungefähr<br />
9,2 Kubikmeter pro Meter. Bei zwei<br />
getrennten <strong>Wasser</strong>kammern mit<br />
jeweils 35 m Länge ergibt <strong>sich</strong> ein<br />
Speichervolumen von ~ 650 Kubikmetern<br />
Trinkwasser. Da <strong>sich</strong> <strong>Wasser</strong>tiefen<br />
bis 3,5 m zur Stabilisierung<br />
des <strong>Wasser</strong>drucks als sinnvoll erwiesen<br />
haben, stellen liegende PE 100<br />
Wickelrohre mit DN 3.500 eine sehr<br />
gute Alternative zu Werkstoffen wie<br />
z. B. Beton oder GFK dar.<br />
Hygienebestimmungen<br />
Beim Bau von <strong>Wasser</strong>kammern<br />
müssen die vom gespeicherten<br />
<strong>Wasser</strong> benetzten Oberflächen aus<br />
Materialien sein, die entsprechende<br />
Prüfungsanforderungen erfüllen.<br />
Besonders bei Zusatzstoffen, die bei<br />
Beton und Zementmörtel benötigt<br />
werden, muss geprüft werden, ob<br />
sie den Anforderungen an Trinkwasserspeicher<br />
entsprechen. Werden<br />
Kunststoffe verwendet, müssen<br />
diese den KTW-Empfehlungen entsprechen<br />
und deren Eignung in<br />
mikrobieller Hin<strong>sich</strong>t nach DVGW<br />
W 270 nachgewiesen sein.<br />
Um spätere Reinigungen zu<br />
erleichtern und das Bakterienwachstum<br />
zu vermeiden, müssen<br />
die Oberflächen der eingesetzten<br />
Materialien möglichst glatt und<br />
porenfrei sein. Bei PE 100 Rohren<br />
und Platten werden diese Forderungen<br />
erfüllt. Die mineralischen Werkstoffe<br />
Beton oder Zementmörtel<br />
müssen nachträglich hochwertig<br />
beschichtet oder ausgekleidet werden.<br />
Ebenso müssen korrosionsanfällige<br />
Metallteile entsprechend<br />
geschützt werden, um eine Kontamination<br />
des Trinkwassers zu vermeiden.<br />
Bei der Planung und dem Bau<br />
von <strong>Wasser</strong>kammern muss darauf<br />
geachtet werden, dass es in der<br />
<strong>Wasser</strong>kammer keine Zonen gibt,<br />
in denen das <strong>Wasser</strong> stagniert. Eine<br />
ständige Zirkulation des <strong>Wasser</strong>s<br />
vermeidet die Gefahr von Ablagerungen<br />
an den Wänden der <strong>Wasser</strong>-<br />
Juni 2011<br />
554 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
TAGUNG 26.-27. Oktober 2011, Würzburg<br />
DWA-LANDESVERBANDS-<br />
TAGUNG BAYERN<br />
Bild 5. 3D-Skizze.<br />
kammer. Oft genügt schon eine durch das einfallende<br />
<strong>Wasser</strong> erzeugte Strömung, um eine aus reichende<br />
Durchmischung und Umwälzung zu bewirken. Hierbei<br />
zeigen runde Behälter im Vergleich zu eckigen Behältern<br />
strömungstechnische Vorteile, da die benetzte<br />
Oberfläche bei gleichem Speichervolumen geringer ist<br />
und gleichmäßiger umströmt wird (Bild 5).<br />
Be- und Entlüftungseinrichtungen<br />
Um Luftbewegungen, die durch wechselnde <strong>Wasser</strong>stände<br />
hervorgerufen werden, zu ermöglichen, sind<br />
Lüftungseinrichtungen in den <strong>Wasser</strong>kammern notwendig.<br />
Diese Be- und Entlüftungsvorrichtungen kommen<br />
auch aus hygienischen und geschmacklichen<br />
Gründen zum Tragen. Ihre Dimensionierung richtet <strong>sich</strong><br />
nach dem abfließenden Volumenstrom bzw. der Obergrenze<br />
für die Luftgeschwindigkeit in den Lüftungseinrichtungen.<br />
Eine Ausstattung mit Filtern oder Sieben<br />
wird empfohlen, da die Vermeidung der Trinkwasserverunreinigung<br />
höchste Priorität besitzt. Aus diesem Grund<br />
sollten Öffnungen der <strong>Wasser</strong>kammer auch nicht oberhalb<br />
der freien <strong>Wasser</strong>oberfläche liegen. Bei zwei realisierten<br />
Vorlagebehältern, die bei den Stadtwerken Bühl<br />
eingesetzt wurden, waren sehr leistungsfähige Be- und<br />
Entlüftungsventile notwendig, da das Speichervolumen<br />
von insgesamt 100 m 3 dort pro Tag bis zu 25 mal umgeschlagen<br />
wird. Die Auslegung und Planung der gesamten<br />
Anlage wurde von dem Ingenieurbüro Eppler aus<br />
Bühl gemacht.<br />
Statische Auslegung<br />
Um die statische Tragfähigkeit der Speicher zu gewährleisten,<br />
die Einbindung der Speicher in die Landschaft<br />
zu erleichtern sowie die Instandhaltungskosten gering<br />
zu halten, sollte die Erdüberdeckung einen Meter nicht<br />
überschreiten. Bei der statischen Auslegung von <strong>Wasser</strong>behältern<br />
sind ständige und variable Einwirkungen<br />
zu berück<strong>sich</strong> tigen. Ständige Einwirkungen sind zum<br />
Beispiel Erdlasten, Druck durch Grundwasser, das Eigengewicht<br />
des Bauwerks sowie das Gewicht der betriebs-<br />
<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft im Blickpunkt<br />
– Daseinsvorsorge in Zeiten stetiger<br />
Veränderungen<br />
In das fränkische Weinland führt die diesjährige Tagung<br />
des DWA-Landesverbandes Bayern. Am 26. und 27.<br />
Oktober 2011 treffen <strong>sich</strong> Fachleute aus der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
im Congress Centrum in Würzburg.<br />
Das diesjährige Tagungsmotto verdeutlicht die zunehmenden<br />
Anforderungen und die immer schneller<br />
erscheinenden Veränderungen auch in diesem Bereich.<br />
Die Daseinsvorsorge – hier vor Allem das Reagieren auf<br />
den Klimawandel – rückt immer stärker in den Blickpunkt.<br />
In zwei parallel stattfindenden Seminarreihen<br />
betrachten wir Schwerpunktthemen aus den Bereichen<br />
Gewässer und <strong>Abwasser</strong>, u.a. Fremdwasserproblematik,<br />
Kanalsanierungen oder Hochwasserrisikomanagement.<br />
Neben den Vortragsreihen wird ein <strong>Wo</strong>rkshop zum Thema<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen mit dem Titel<br />
„2015 – <strong>Wo</strong> stehen wir? <strong>Wo</strong> wollen wir hin?“ angeboten.<br />
Begleitet wird die Tagung wiederum von einer Fachausstellung<br />
sowie zwei interessanten Fachexkursionen<br />
und einem attraktiven Rahmenprogramm.<br />
Weitere Informationen sowie Anmeldeunterlagen:<br />
DWA-Landesverband Bayern<br />
Friedenstraße 40 . 81671 München<br />
Tel: 089/233-62590 . Fax: 233-62595<br />
E-Mail: info@dwa-bayern.de<br />
Internet: www.dwa-bayern.de/<br />
Veranstaltungen/Tagung<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 555<br />
Fotos: Tourist-Information Würzburg
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
technischen Installationen. Zu den<br />
variablen Einwirkungen zählen zum<br />
Beispiel das Gewicht und der Druck<br />
des gespeicherten <strong>Wasser</strong>s, Schneelasten,<br />
Windlasten und Einwirkungen<br />
durch Wartungsarbeiten.<br />
Um die Einwirkungen durch<br />
anstehendes Grundwasser möglichst<br />
gering zu halten oder ganz zu<br />
vermeiden, sollten Drainagen in der<br />
Sohle und seitlich des Behälters eingebaut<br />
werden. Somit kann der<br />
<strong>Wasser</strong>behälter auf ausreichend<br />
tragfähigem Untergrund errichtet<br />
werden. Hierbei muss auch beachtet<br />
werden, dass der Untergrund<br />
nicht kontaminiert ist, so dass eine<br />
Verunreinigung des Trinkwassers<br />
durch Diffusion von giftigen Stoffen<br />
durch die Behälterwände ausgeschlossen<br />
werden kann. Gleiches<br />
gilt für das Auffüllmaterial.<br />
Inbetriebnahme<br />
Vor der Inbetriebnahme von Trinkwasserbehältern<br />
müssen eine<br />
Dichtheitsprüfung sowie eine Reinigung<br />
und Desinfektion des Speichers<br />
erfolgen. Die Dichtheitsprüfung<br />
gilt als bestanden, wenn kein<br />
<strong>sich</strong>tbarer <strong>Wasser</strong>austritt festgestellt<br />
wird und kein messbares<br />
Absinken des <strong>Wasser</strong>spiegels innerhalb<br />
einer Prüfzeit von 48 Stunden<br />
auftritt. Bei der Reinigung des Speichers<br />
ist die Verwendung von chemischen<br />
Reinigungsmitteln auf ein<br />
Mindestmaß zu beschränken. Sie<br />
dürfen die eingesetzten Werkstoffe<br />
des <strong>Wasser</strong>speichers nicht schädigen<br />
und sind vor ihrem Einsatz toxikologisch<br />
und trinkwasserhygienisch<br />
zu beurteilen. Da Polyethylen<br />
einen hervorragenden Widerstand<br />
gegen diese zur Reinigung eingesetzten<br />
Chemikalien aufweist, ist<br />
auch bei einer eventuellen Beschädigung<br />
der Innenoberfläche keine<br />
Einschränkung der Nutzbarkeit zu<br />
befürchten. Der Einsatz von Desinfektionsmitteln<br />
muss in Übereinstimmung<br />
mit den EU-Richtlinien<br />
sowie den nationalen und örtlichen<br />
Bestimmungen erfolgen. Empfehlungen<br />
hierzu werden in der DIN EN<br />
805 „Anforderungen an <strong>Wasser</strong>versorgungssysteme<br />
und deren Bauteile<br />
außerhalb von Gebäuden“<br />
gegeben. Des Weiteren beschreibt<br />
die Norm die zulässigen Desinfektionsverfahren<br />
von Rohrleitungen<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung, in deren<br />
Anlehnung auch die Trinkwasserspeicher<br />
desinfiziert werden können.<br />
Nach der Desinfektion muss<br />
die mikrobiologische Unbedenklichkeit<br />
nachgewiesen werden. Ist<br />
dies der Fall, sollten die desinfizierten<br />
Trinkwasserrohre oder Speicher<br />
so schnell wie möglich in Betrieb<br />
genommen werden, um eine<br />
erneute Verunreinigung auszuschließen.<br />
Fazit<br />
Polyethylen stellt beim Neubau von<br />
kleinen und mittelgroßen Trinkwasserspeichern<br />
eine sehr gute technische<br />
und wirtschaftliche Alternative<br />
zu den bisher eingesetzten Werkstoffen<br />
dar. Die Vorteile der Langlebigkeit,<br />
der sehr guten Chemikalienbeständigkeit,<br />
des geringen<br />
spezifischen Gewichts und die Möglichkeit<br />
der variablen Vorfertigung<br />
in der Werkstatt können in vielen<br />
Fällen zur Einsparung von Zeit und<br />
Geld führen. Nach dem erfolgreichen,<br />
jahrzehntelangen Einsatz des<br />
Rohstoffs bei Trinkwasserrohrleitungssystemen<br />
hält der DVGW<br />
zugelassene Rohstoff, durch die<br />
Möglichkeit Großrohre bis derzeit<br />
3,5 m im Durchmesser fertigen zu<br />
können, nun auch Einzug in neue<br />
Einsatzgebiete wie z. B. dem Neubau<br />
von Trinkwasserspeichern. So<br />
erschließen <strong>sich</strong> immer neue und<br />
durch die Innovation der Industrie<br />
bisher unbetrachtete Einsatzmöglichkeiten<br />
für den Werkstoff Polyethylen.<br />
Literatur<br />
Homepage des Umweltbundesamt,<br />
<strong>Wasser</strong>- und Gewässerschutz http://<br />
www.umweltbundesamt.de/wasserund-gewaesserschutz/index.htm<br />
DIN EN 1508 „<strong>Wasser</strong>versorgung – Anforderungen<br />
an Systeme und Bestandteile<br />
der <strong>Wasser</strong>speicherung“; Deutsche<br />
Fassung EN 1508:1998.<br />
DVGW Arbeitsblatt W 300: <strong>Wasser</strong>speicherung<br />
– Planung, Bau, Betrieb und<br />
Instandhaltung von <strong>Wasser</strong>behältern<br />
in der Trinkwasserversorgung,<br />
Juni 2005.<br />
Kunz, A.: Trinkwasser – unser höchstes Gut.<br />
Auskleidungen von Trinkwasserbehältern<br />
mit Polyethylen. <strong>gwf</strong>-<br />
<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 151 (2010) Nr. 5,<br />
S. 448-451.<br />
Kontakt:<br />
René Carbon,<br />
Produktmanager Versorgung,<br />
Tel. (06105) 4085-238,<br />
E-Mail: r.carbon@frank-gmbh.de<br />
Jochen Obermayer<br />
Technischer Außendienst,<br />
Tel. (06105) 4085-178,<br />
E-Mail: j.obermayer@frank-gmbh.de<br />
FRANK GmbH,<br />
Starkenburgstrasse 1,<br />
D-64546 Mörfelden-Walldorf<br />
Juni 2011<br />
556 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Sanierung von Trinkwasserspeichern –<br />
Sorgfalt und Erfahrung sind unabdingbar<br />
Behältersanierung mit einem dem Behälterneubau gleichwertigen Ergebnis<br />
TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft – der Schlüssel dazu!<br />
Zur Abdeckung von <strong>Wasser</strong>verbrauchsspitzen<br />
und betriebsbedingten<br />
Stillstandszeiten bei der<br />
<strong>Wasser</strong>förderung und Aufbereitung<br />
übernehmen Trinkwasserspeicher<br />
eine wichtige Funktion. Sie <strong>sich</strong>ern<br />
die Trinkwasserversorgung der Be -<br />
völkerung sowie der Industrie und<br />
Landwirtschaft und erfüllen in<br />
Bezug auf den Brandschutz eine<br />
wichtige Aufgabe. Deshalb und zur<br />
Gewährleistung der einwandfreien<br />
Versorgung mit keimfreiem Trinkwasser,<br />
sind höchste Anforderungen<br />
an deren Bau, Betrieb sowie<br />
Instandsetzung zu stellen.<br />
Aufgabe des Betreibers ist es, die<br />
langfristige Funktionsfähigkeit für<br />
eine durchschnittliche Nutzungsdauer<br />
von mindestens 50 Jahren<br />
ohne negative Beeinflussung der<br />
Trinkwasserqualität <strong>sich</strong>erzustellen.<br />
Um diese Anforderungen einhalten<br />
zu können, sind Komponenten wie<br />
Bauzustand, Verfärbungen, Dichtigkeit<br />
aber auch die Be- und Entlüftungsanlage<br />
turnusmäßig zu überprüfen<br />
und im Behälterbuch zu<br />
dokumentieren. Denn nur durch<br />
zeitnahes Erkennen von Gefährdungsquellen<br />
ist eine fachgerechte<br />
Instandhaltung unter vertretbaren<br />
finanziellen Aufwendungen möglich.<br />
Bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen<br />
sind besondere An -<br />
forderungen und Kriterien an<br />
die Oberflächenbeschaffenheit der<br />
Innenflächen zu beachten. Sanierungsziel<br />
bzw. der Sollzustand muss<br />
mindestens eine Rückführung des<br />
Behälters in den funktionsfähigen<br />
Zustand, besser aber eine zusätzliche<br />
Steigerung der Funktions<strong>sich</strong>erheit<br />
beinhalten. Dieser Sollzustand<br />
ist entsprechend den aktuellen<br />
Regelwerken zum Neubau von<br />
Trinkwasserbehältern um zusetzen.<br />
Für die von gespeichertem <strong>Wasser</strong><br />
benetzten Wand- und Sohlflächen<br />
müssen Materialien eingesetzt<br />
werden, die entsprechende Prüfanforderungen<br />
erfüllen. Das gespeicherte<br />
<strong>Wasser</strong> darf nicht negativ<br />
beeinflusst werden und muss den<br />
EU-Richtlinien oder EFTA-Vorschriften<br />
entsprechen. Beton- und Ze -<br />
mentmörtel erfüllen im Allgemeinen<br />
diese Auflagen. Besonderes<br />
Augenmerk ist jedoch auf den Einsatz<br />
von Zusatzmitteln zu lenken.<br />
Alle verwendeten Baustoffe und<br />
Bauhilfsstoffe (Fugenmaterial, Be -<br />
schichtungssysteme, Anstriche, In -<br />
jektionsharze usw.) müssen in mikrobieller<br />
Hin<strong>sich</strong>t geeignet sein.<br />
Die eingesetzten Materialien<br />
müssen einen möglichst geringen<br />
Anteil an wasserlöslichen<br />
und ausgasenden Stoffen besitzen,<br />
die sonst die <strong>Wasser</strong>qualität<br />
durch unerwünschte Abgabe<br />
negativ beeinflussen oder gar<br />
toxisch sind.<br />
Es darf keine Reaktion der eingesetzten<br />
Materialien mit den<br />
Einbauten der Speicher geben.<br />
Die eingesetzten Stoffe dürfen<br />
keinen Nährboden für Mikroorganismen<br />
bieten.<br />
Die Oberflächenbeschaffenheit<br />
muss eine hohe chemische<br />
Widerstandsfähigkeit gegenüber<br />
aggressiven Reinigungsmitteln<br />
aufweisen.<br />
Die Oberfläche sollte möglichst<br />
glatt sowie poren- und lunkerfrei<br />
sein, um gute Reinigungsergebnisse<br />
zu erzielen und Stagnation<br />
von <strong>Wasser</strong> in den Poren zu verhindern.<br />
Als wesentlicher erster Schritt<br />
muss der bauliche Zustand des<br />
Speicherbehälters untersucht und<br />
bewertet werden. Dazu muss neben<br />
Vorbereitung zur Sanierung eines<br />
Trinkwasserbehälters.<br />
<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 557
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Trinkwasserbehälter vor (oben)<br />
bzw. nach (Mitte und unten) der<br />
Sanierung.<br />
Der Kuppelbau in Ochtrup stellte<br />
besondere Anforderungen an die<br />
Tragwerksplanung. <br />
der betontechnologischen Begutachtung<br />
der Oberflächenbeschaffenheit<br />
sowie der Stand<strong>sich</strong>erheit<br />
durch erfahrene Betontechnologen<br />
bzw. Statiker, die Dichtigkeit eingehend<br />
untersucht werden. Hinzu<br />
kommen noch die Zustandsbewertung<br />
der Wärmedämmung und<br />
eventuell vorhandener Altbeschichtungen.<br />
Ein besonderes Augenmerk<br />
muss vor allem bei Trinkwasserbehältern<br />
älterer Baujahre auf den<br />
Denkmalschutz gelegt werden. Dieser<br />
erstreckt <strong>sich</strong> nicht ausschließlich<br />
auf den Behälter sondern<br />
durchaus auch auf Betriebs- bzw.<br />
Nebengebäude. Für die Überprüfung<br />
der rohrtechnischen und<br />
maschinellen Installationen wie<br />
Rohrleitungswerkstoffe, Korrosionsfortschritt<br />
aber auch die gesamte<br />
Be- und Entlüftungsanlage kommen<br />
Ingenieure des Maschinenund<br />
Anlagenbaus zum Einsatz.<br />
Erst mit einer präzisen und<br />
umfassenden Ist-Zustands-Erfassung<br />
aus betontechnologischer,<br />
rohr- und anlagentechnischer sowie<br />
hygienischer Sicht, kann anhand<br />
dessen eine Schadensdiagnose er -<br />
stellt werden. Auf dieser Grundlage<br />
kann dann ein Sanierungskonzept<br />
mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung<br />
unterschiedlicher Sanierungsverfahren<br />
aufgestellt werden.<br />
Heute erfolgt die Sanierung<br />
eines Trinkwasserbehälters in der<br />
Regel unter Aufrechterhaltung des<br />
laufenden Betriebes. Dies stellt<br />
schon in der Planungsphase bei der<br />
umfassenden Berück<strong>sich</strong>tigung der<br />
Zwischenbauzustände und Provisorien<br />
eine Herausforderung dar.<br />
Denn nur bei einer im Vorfeld allumfassenden<br />
Planung ist ein reibungsloser<br />
Bauablauf unter Sicherstellung<br />
der einwandfreien Trinkwasserversorgung<br />
möglich.<br />
Um den gewünschten (Soll-)<br />
Zustand zu erreichen, ist die erwartete<br />
Leistung hinreichend und<br />
erschöpfend zu beschreiben und<br />
vertraglich zu vereinbaren. Des Weiteren<br />
ist zu empfehlen, die Herstellung<br />
von Musterflächen zu vereinbaren,<br />
um die tatsächliche Ausführungsqualität<br />
frühzeitig erkennen<br />
und gegebenenfalls optimierend<br />
eingreifen zu können. Ausgewählte<br />
erfahrene Fachfirmen sollten im<br />
Rahmen einer Erstprüfung (Eigenkontrolle)<br />
Eignungsnachweise er -<br />
bringen. Darüber hinaus ist die Eignung<br />
anhand von weiteren Kriterien<br />
nachzuweisen, wie z. B. über<br />
die Herstellung von Probekörpern<br />
unter Baustellenbedingungen, über<br />
ausreichende Nachbehandlungsdauern<br />
und über Verwendung von<br />
Ausgangsstoffen gemäß DIN 1045<br />
und DVGW W 347.<br />
Die Nachweise des <strong>Wasser</strong>zementwertes<br />
auf der Baustelle, des<br />
Luftporengehaltes des Frischmörtels<br />
sowie der Porosität dienen<br />
ebenfalls zur Qualitäts<strong>sich</strong>erung.<br />
Bei Anlagen der Trinkwasserversorgung<br />
sind vor der Wiederinbetriebnahme<br />
die stufenweise Bauabnahme<br />
und die Reinigung und Desinfektion<br />
anzuordnen. Dies erfolgt<br />
nicht nur in Abstimmung mit dem<br />
Juni 2011<br />
558 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Betreiber sondern als Prüfstelle<br />
auch mit dem Gesundheitsamt.<br />
Aufgrund der komplexen Zu -<br />
sammenhänge zwischen Schadenserkennung<br />
und -ursache, Aufstellen<br />
eines Sanierungskonzeptes, Suche<br />
nach dem geeigneten Sanierungsverfahrens,<br />
Erstellen der Ausschreibungsunterlagen,<br />
Auswahl geeigneter<br />
Fachfirmen für die In standsetzung,<br />
Bauüberwachung so wie<br />
letztendlich Desinfektion und Wiederinbetriebnahme<br />
sind sachkundige<br />
Fachleute erforderlich, die entsprechende<br />
Erfahrungen über Planung,<br />
Bau und Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern haben. Nur<br />
durch deren Einsatz kann <strong>sich</strong>ergestellt<br />
werden, dass das Bauwerk<br />
nach erfolgter Sanierung dem gleichen<br />
Anforderungsprofil gerecht<br />
wird wie ein Behälterneubau.<br />
Durch die langjährige Erfahrung<br />
im Bereich des Behälterneubaus<br />
sowie der Sanierung und Instandsetzung<br />
deckt die Firma das komplette<br />
Leistungsspektrum der Planung,<br />
Baubegleitung und Qualitäts<strong>sich</strong>erung<br />
ab und kann damit eine<br />
einwandfreie Ausführung der Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen<br />
garantieren.<br />
Kontakt:<br />
TUTTAHS & MEYER<br />
Ingenieurgesellschaft für <strong>Wasser</strong>-,<br />
<strong>Abwasser</strong>- und Energiewirtschaft mbH,<br />
Bismarckstrasse 2-8,<br />
D-52066 Aachen,<br />
Tel. (0234) 33305-0,<br />
www.tuttahs-meyer.de<br />
Denkmalgeschütztes Bauwerk,<br />
Bochum-Stiepel.<br />
www.compounds.ch<br />
SUNAFLEX ® EPDM<br />
TRINKWASSERMISCHUNGEN<br />
HYGIENISCH UND PHYSIOLOGISCH EINWANDFREIE WERKSTOFFE<br />
Werkstoff T9640 T8184 T9673 T8165 T8193 T9635 T9643 T8157<br />
Härte Shore A 50 60 70 70 80 70 80 63<br />
Anwendung kalt kalt kalt kalt kalt heiss heiss isolierend<br />
Norm EN 681-1 EU <br />
KTW D1 / D2 D <br />
DVGW W-270 D1 / D2 D <br />
NF XP P 41-250-1/-2/-3 F <br />
WRC BS 6920 GB <br />
Ö-Norm B5014-1 D / E A <br />
USA-NSF* <br />
*Teilefreigabe<br />
Weitere Mischungen für Gas- und andere Anwendungen finden Sie auf unserer Homepage<br />
Compounds AG<br />
Barzloostrasse 1<br />
CH-8330 Pfäffikon ZH<br />
Telefon +41 44 953 34 00<br />
Telefax +41 44 953 34 01<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 559
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Multifunktionaler Wärmespeicher aus Edelstahl<br />
Bild 1. Zusammenbau des Segmentdaches vor Ort.<br />
(alle Fotos Hydro-Elektrik GmbH)<br />
D<br />
ie solarunterstützte Nahwärmeversorgung<br />
in Hamburg-Bramfeld<br />
(seit 1996 in Betrieb) war eines<br />
der ersten Pilotprojekte zur Langzeitwärmespeicherung<br />
in Deutschland.<br />
Das Herzstück der Anlage bil-<br />
Bild 2. Foamglasplatten zur Bodenisolierung.<br />
Bild 3. Fixierte Stützen für die Mantelfertigung.<br />
dete ein großvolumiger Warmwasserspeicher<br />
aus Beton mit einem<br />
Volumen von 4500 m³ in dem die<br />
Sommer-Solarwärme aus den Kollektoren<br />
der 128 Reihenhäuser für<br />
den Heizbetrieb im Winter zwischengespeichert<br />
werden sollte. Im<br />
Langzeitbetrieb zeigte <strong>sich</strong> allerdings,<br />
dass die in den Simulationsberechnungen<br />
vor Realisierung prognostizierten<br />
solaren Deckungsanteile<br />
am Gesamtwärmebedarf nicht<br />
erreicht wurden.<br />
Ursache hierfür waren u.a. geringere<br />
Nutzungsgrade der Solarsysteme<br />
(Kollektoren und Langzeitwärmespeicher).<br />
Insbesondere beim<br />
Speicher waren die Wärmeverluste<br />
bauartbedingt um den Faktor 4,5<br />
höher als erwartet [1].<br />
Aus diesem Grunde wurde im<br />
Rahmen einer Neukonzeption der<br />
Langzeit-Wärmespeicher aus Beton<br />
durch einen rundum isolierten<br />
Edelstahlbehälter ersetzt, wobei<br />
der Betonkörper des bisherigen<br />
Speichers als Bauwerkshülle für den<br />
Edelstahlbehälter herangezogen<br />
wurde. Der nun als multifunktionaler<br />
Wärmespeicher arbeitende Speicher<br />
ist seit Ende 2010 in Betrieb und<br />
kann eine Wärmeenergie bis zu rund<br />
16 x 10 8 kJ aufnehmen bzw. speichern.<br />
Als Teil des Nahwärmeverbundsystems<br />
soll der Speicher die<br />
Spitzenlast der Müllverbrennungsanlage<br />
Stapelfeld aufnehmen [2].<br />
Mit einem Durchmesser von<br />
23 m und einer Höhe von 9,9 m<br />
stellt dieser gigantische Behälter<br />
mit einem <strong>Wasser</strong>volumen von rund<br />
4100 m³ alle bisherigen von der<br />
Hydro-Elektrik GmbH erstellten<br />
Großbehälter buchstäblich in den<br />
Schatten.<br />
Der Umbau des Speichers stellte<br />
besondere Anforderungen und<br />
musste in einem engen Zeitrahmen<br />
unter erschwerten Bedingungen<br />
erfolgen. Nachdem der erdüberdeckte<br />
Behälter im Grundwasser<br />
steht, war während der ganzen Bauphase<br />
eine kontinuierliche Grundwasserhaltung<br />
erforderlich, um ein<br />
Aufschwimmen des Behälters zu<br />
vermeiden.<br />
Im ersten Bauabschnitt wurde<br />
nach Teilfreilegung des Behälters<br />
die Betondecke nebst Stützpfeilern<br />
rückgebaut und der konische Bo -<br />
den mit eisenhaltigem Füllmaterial<br />
aufgefüllt und mit einer horizontalen<br />
Betonbodenplatte abgeschlossen.<br />
Damit der Edelstahlbehälter in<br />
der Höhe untergebracht werden<br />
konn te, musste das runde Gebäude<br />
circa 4 m erhöht werden.<br />
Der Behälter stellte mit der Statik,<br />
der Fertigung und letztlich der<br />
Wärmeisolierung auch eine besondere<br />
Herausforderung an die Herstellerfirma<br />
dar. So musste die Fertigungseinrichtung<br />
erst an die neuen<br />
Anforderungen angepasst werden.<br />
Besondere Anforderungen stellte<br />
die Dachkonstruktion dar, welche in<br />
20 Großsegmente mit je circa 11 m<br />
Länge aufgeteilt wurde (Bild 1).<br />
Auch bei der Bodenkonstruktion<br />
wurde Neuland betreten. Um eine<br />
rundum hochwertige Behälterisolierung<br />
zu erreichen, musste der Edelstahlbehälter<br />
„schwimmend“ angeordnet<br />
werden, d. h. die Bodenplatte<br />
des Edelstahlbehälters liegt flächig<br />
auf einer durchgehenden 200 mm<br />
starken geschichteten Isolierung<br />
aus druckbeständigem Foamglas<br />
auf (Bild 2). Die Fertigung des Behältermantels<br />
erfolgte in der bewährten<br />
automatisierten Technik der<br />
HydroSystemTanks durch Abwicklung<br />
des Blechs direkt vom Coil und<br />
vollautomatischer patentierter Verschweißung<br />
(Bild 3). Allein für den<br />
Behältermantel waren rund 1000 m<br />
Schweißnaht erforderlich. Insgesamt<br />
waren bis zur Fertigstellung<br />
rund 44 000 kg Edelstahl des Werkstoffes<br />
Duplex W.-Nr. 1.4162 zu verbauen.<br />
Besonders erwähnenswert<br />
ist, dass es trotz dieser enormen<br />
Größe kaum zu Abweichungen im<br />
Terminplan gekommen ist und der<br />
Behälter termingerecht in Betrieb<br />
genommen werden konnte.<br />
Juni 2011<br />
560 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Die komplette Außenhaut des<br />
Behälters inkl. Behälterdach wurde<br />
nach der Fertigstellung mit einer<br />
200 mm starken Mineralwolleschicht<br />
isoliert (Bild 4).<br />
Nach Fertigstellung des Multifunktionsspeichers<br />
wurde das Bauzelt<br />
entfernt und das Betongebäude<br />
mit einer Holzdachkonstruktion<br />
dicht verschlossen. Das Holzdach<br />
wurde nochmals isoliert und als<br />
Gründach ausgebildet (Bild 5). Die<br />
Kosten für den Tankbau liegen bei<br />
rund 750 000 Euro, für die Wärmedämmung<br />
bei rund 200 000 Euro<br />
und für den Dachaufbau bei rund<br />
175 000 Euro. Beton- und Außenarbeiten<br />
sind nicht berück<strong>sich</strong>tigt.<br />
Holzdach mit Dachbegrünung<br />
Wärmespeicher<br />
Schotter mit Betondecke<br />
Kronsberg und Steinfurt-Borghorst,<br />
FKZ: 0329607Q.<br />
[2] Solarsiedlungen mit Langzeitwärmespeicher<br />
– Stand der Technik und<br />
Perspektiven, Dipl.-Ing. Mathias<br />
Schlosser, TU Braunschweig.<br />
Isolierung mit Foamglas<br />
Dachisolierung mit Mineralwolle<br />
Wanderhöhung<br />
neu<br />
Isolierung mit<br />
Mineralwolle<br />
alter Speicher<br />
Bild 4. Prinzipieller<br />
Aufbau<br />
des<br />
Multifunktionsspeichers.<br />
Literatur<br />
[1] Förderprogramm des BMU zu Forschung<br />
und Entwicklung im Bereich<br />
Niedertemperatur Solarthermie,<br />
Solarthermie2000plus: Wissenschaftliche<br />
Begleitung und Sonderuntersuchungen<br />
der solar unterstützten<br />
Nahwärmeversorgung<br />
Hamburg-Bramfeld, Hannover-<br />
Autor:<br />
Hydro-Elektrik GmbH,<br />
Manfred Brugger,<br />
Angelestraße 48/50,<br />
D-88214 Ravensburg,<br />
Tel. (0751) 6009-47,<br />
E-Mail: mb@hydrogroup.de,<br />
www.hydrogroup.de<br />
Bild 5. Außenan<strong>sich</strong>t des sanierten Wärmespeichers<br />
nach Fertigstellung.<br />
Trinkwasserbehälter<br />
In bewährter Wiedemanntechnik sanieren wir jedes Jahr nahezu<br />
100 Trinkwasserbehälter, seit 1947, Jahr für Jahr.<br />
Von der Zustandsanalyse, Beratung und Ausarbeitung des<br />
Sanierungs kon zeptes bis zur fix und fertigen Ausführung.<br />
Abdichtung<br />
Betoninstandsetzung<br />
Rissinjektion<br />
Stahlkorrosionsschutz<br />
Statische Verstärkung -CFK-Lamellen-<br />
Vergelung<br />
Spritzbeton / Spritzmörtel<br />
Mineralische Beschichtung<br />
> <strong>Wasser</strong>management ><br />
Unsere Fachleuchte sind für Sie da, rufen Sie an!<br />
Zentrale<br />
65189 Wiesbaden<br />
Weidenbornstr. 7-9<br />
Tel. 0611/7908-0<br />
Fax 0611/761185<br />
Niederlassung<br />
01159 Dresden<br />
Ebertplatz 7-9<br />
Tel. 0651/42441-0<br />
Fax 0351/42441-11<br />
WIEDEMANN<br />
Instandsetzung und Schutz von Betonbauwerken<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.wiedemann-gmbh.com<br />
Zertifiziert nach<br />
DIN EN ISO 9001:2008<br />
seit 1947<br />
Wir schließen Kreisläufe.<br />
REMONDIS Aqua ist seit über 25 Jahren kompetenter Partner<br />
für kommunales und industrielles <strong>Wasser</strong>management. Wir<br />
bieten unter anderem:<br />
Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigungs- und Frischwasseraufbereitungsanlagen<br />
Ganzheitliche Übernahme von <strong>Wasser</strong>- und Ableitungsnetzen<br />
Verfahrensentwicklung und -optimierung<br />
Lassen Sie <strong>sich</strong> beraten – rufen Sie an oder mailen Sie uns.<br />
REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG, Brunnenstr. 138, 44536 Lünen,<br />
Deutschland, Telefon: 02306 106-692, Telefax: 02306 106-699<br />
www.remondis-aqua.de, info@remondis-aqua.de<br />
Juni 2011<br />
AZ GWF-<strong>Wasser</strong>-<strong>Abwasser</strong>_86x123_V1.indd 1<br />
07.10.2009 10:27:22 Uhr<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 561
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Zwangsbelüftung von <strong>Wasser</strong>kammern<br />
zur Kondensat-Minimierung<br />
Erfahrungsbericht über den Neubau eines Trinkwasserspeichers mit zwei<br />
<strong>Wasser</strong>kammern und einem Volumen von insgesamt rund 500 Kubikmetern<br />
Dem Stand der Technik entsprechend<br />
hatte das beauftragte<br />
Planungsbüro eine Luftfilteranlage<br />
von HUBER, Typ L251 (Filterklasse<br />
H13 – wie für OP-Räume angewandt)<br />
vorgesehen. Zusätzlich verlegte<br />
man eine etwa 12 Meter lange<br />
Edelstahl-Luftleitung im Erdreich<br />
mit Kondensat-Abtauchung, um die<br />
Feuchtigkeit der Außenluft in der<br />
Verbindungsleitung vom Freien zur<br />
<strong>Wasser</strong>kammer zum Teil kondensieren<br />
zu können. Trotz guter Isolierung<br />
und ausreichender Überdeckung<br />
des Bau werkes musste der<br />
<strong>Wasser</strong>meister schon bald nach<br />
Inbetriebnahme des neuen HB feststellen,<br />
dass an der Decke in hohem<br />
Maße Kondensatbildung stattfand.<br />
Nun war schnell eine zuverlässige<br />
und kostengünstige Lösung zu<br />
finden. Die Huber SE machte den<br />
Luftfilter L251 mit Sicherheitsventil.<br />
Luftfilter L251 und Ventilator RRK 160 im Hochbehälter<br />
Utzenaich.<br />
Vorschlag, die Luftfilteranlage im<br />
ersten einfachen Schritt um einen<br />
Ventilator zu ergänzen, Abluftwege<br />
aus der <strong>Wasser</strong>kammer zu schaffen<br />
und somit eine Zwangsbelüftung<br />
der <strong>Wasser</strong>kammern herzustellen.<br />
Als zweiter Schritt wurde auch die<br />
Möglichkeit einer Umlufttrocknung<br />
mit Adsorptions-Luftentfeuchter<br />
und bedarfsgerechter Frischluftzufuhr<br />
(entsprechend der Atmung<br />
durch <strong>Wasser</strong>spiegelveränderung)<br />
erörtert, die in der Schieberkammer<br />
hätte installiert werden können.<br />
Man wollte jedoch zunächst versuchen,<br />
das Problem mit geringstem<br />
Investitions- und Betriebskostenaufwand<br />
zu lösen.<br />
Doch schon der erste Schritt<br />
brachte den gewünschten Erfolg:<br />
Zunächst wurde ein kostengünstiger<br />
150-mm-Axial-Rohreinschubventilator<br />
angeschafft, der zwar<br />
nicht für Dauerbetrieb geeignet<br />
war, dem aber vom Lieferanten dennoch<br />
ein bis zwei Jahre Lebensdauer<br />
bestätigt wurden. Dieser Ventilator<br />
wurde zwischen Luftfilter<br />
und <strong>Wasser</strong>kammer eingebaut und<br />
im Dauerbetrieb gefahren. Schon<br />
die geringe Druckerhöhung / Luftströmung,<br />
die mit dem Axialventilator<br />
geschafft wurde, reichte aus, um<br />
über die HUBER Luftfilteranlage<br />
L251 eine ausreichende Frisch-/<br />
Reinluftmenge zur Trockenlegung<br />
der <strong>Wasser</strong>kammern zu fördern.<br />
Als Ergebnis ließ <strong>sich</strong> bereits<br />
nach zwei <strong>Wo</strong>chen eine Verringerung<br />
des Kondensats in beiden <strong>Wasser</strong>kammern<br />
feststellen. Nach etwa<br />
zweieinhalb Jahren versagte der<br />
Axialventilator schließlich seinen<br />
Dienst und wurde vor Weihnachten<br />
2010 durch einen vor dem Luftfilter<br />
eingebauten und für Dauerbetrieb<br />
geeigneten Radialventilator ersetzt.<br />
Aufgrund des erfolgreichen Langzeitversuchs<br />
wurden auch andere<br />
alte und neue Hochbehälter des<br />
gleichen Verbandes mit Luftfilteranlagen<br />
und Ventilatoren ergänzt.<br />
Es zeigte <strong>sich</strong> überall das gleiche<br />
Bild. Die Decken und Gehwege der<br />
<strong>Wasser</strong>kammern wurden trocken.<br />
Nur bei ganz problematisch situierten<br />
und alten Bauwerken kam es an<br />
wenigen Tagen mit klimatisch<br />
ex trem ungünstigen Bedingungen<br />
noch zu einer geringfügigen Kondensatbildung,<br />
die <strong>sich</strong> aber mit<br />
Änderung des Wetters von selbst<br />
wieder auflöste. Man kann zwar mit<br />
zusätzlicher Lufttrocknung Kondensatfreiheit<br />
der <strong>Wasser</strong>kammerdecke<br />
an allen Tagen erreichen, jedoch<br />
steht das Mehr an Investitions- und<br />
Betriebskosten in keinem Verhältnis<br />
zu dem, was an Hygiene noch<br />
gewonnen werden könnte. HUBER<br />
kann Kunden und Planern eine<br />
erprobte Kombi nation an Luftfiltern<br />
samt dazu passenden Sicherheitsventilen<br />
für die Abluftleitung anbieten.<br />
Kondensatprobleme in <strong>Wasser</strong>kammern<br />
werden so minimiert und<br />
der hohe Hygienestandard, den ein<br />
Luftfilter der Klasse H13 ermöglicht,<br />
wird beibehalten.<br />
Kontakt:<br />
HUBER SE,<br />
Industriepark Erasbach A1,<br />
D-92334 Berching,<br />
Tel. (08462) 201-0,<br />
E-Mail.: info@huber.de<br />
www.huber.de<br />
Autor:<br />
Huber Edelstahl Vertriebs-GmbH,<br />
Gerhard Schellenberg,<br />
Praterweg 9,<br />
A-4820 Bad Ischl (Österreich),<br />
Tel. +43 (6132) 21 900,<br />
E-Mail: gerhard.schellenberg@huber.de,<br />
www.huber.de<br />
Juni 2011<br />
562 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Füllstandmessung in einem Trinkwasserspeicher<br />
In der kommunalen Trinkwasserversorgung<br />
dienen Hochbehälter<br />
als dezentrale <strong>Wasser</strong>speicher. Sie<br />
decken Spitzenlasten ab, überbrücken<br />
Störungen und stabilisieren<br />
den Druck im Rohrnetz. Das <strong>Wasser</strong><br />
wird dabei in zwei durch Ausgleichsrohre<br />
verbundenen Kammern<br />
gespeichert. Im Betrieb wird<br />
kontinuierlich <strong>Wasser</strong> entnommen<br />
und vom <strong>Wasser</strong>werk wieder aufgefüllt.<br />
Die Steuerung erfolgt traditionell<br />
über Schwimmer mit Schaltkontakten.<br />
Diese verursachen einen<br />
hohen Aufwand bei Wartung,<br />
Kammerreinigung und Ersatzteilbeschaffung.<br />
Deshalb besteht die Forderung<br />
nach einer wartungsfreien, redundanten<br />
Messtechnik und einer<br />
Automatisierung der Kammerreinigung.<br />
Zusätzlich sollten die Messdaten<br />
in die Zentrale übertragen<br />
werden und von einem Webserver<br />
abrufbar sein.<br />
Prozessdaten<br />
Medium:<br />
Behälter:<br />
Werkstoff:<br />
Höhe der Behälterkammern:<br />
Trinkwasser<br />
Hochbehälter<br />
Beton<br />
etwa 5 m<br />
dante Messungen – eine ist aktiv,<br />
auf die andere kann umgeschaltet<br />
werden – hat entscheidende wirtschaftliche<br />
Vorteile. So können<br />
beide Kammern zur regelmäßig<br />
erforderlichen Reinigung getrennt<br />
gefahren werden. Die Entleerung<br />
erfolgt automatisiert, die größte<br />
Menge des <strong>Wasser</strong>s kann ins Netz<br />
gegeben und nur ein kleiner Teil<br />
muss verworfen werden. Das bringt<br />
dem <strong>Wasser</strong>werk Vorteile durch<br />
<strong>Wasser</strong>ersparnis und geringeren<br />
Personal- und Zeitaufwand.<br />
Kontakt:<br />
VEGA Grieshaber KG,<br />
Am Hohenstein 113,<br />
D-77761 Schiltach,<br />
Tel. (07836) 50-0,<br />
Fax (07836) 50-201,<br />
E-Mail: info@de.vega.com,<br />
www.vega.com<br />
Trinkwasserspeicher<br />
im<br />
<strong>Wasser</strong>werk.<br />
Lösung<br />
Der Füllstand in den Kammern wird<br />
über zwei hydrostatische Druckmessumformer<br />
VEGABAR 52 mit<br />
keramischer Messzelle erfasst. Die<br />
Geräte mit Prozessanschluss G1½ A<br />
Anschluss werden direkt in den<br />
Grundablass der vorhandenen Standrohre<br />
geschraubt. Auswertgeräte<br />
VEGAMET 391 dienen zur Spannungsversorgung<br />
der Druckmessumformer,<br />
zur Messwertanzeige<br />
sowie zur Steuerung der Befüllung<br />
und Entnahme für die Kammern.<br />
Die Entscheidung für zwei redun-<br />
Nutzen<br />
Kein Serviceaufwand, da elektronische,<br />
wartungsfreie Messsysteme<br />
Hohe Verfügbarkeit dank redundanter<br />
Messung<br />
Geregelte Betriebsabläufe durch<br />
automatische Reinigungszyklen<br />
Wirtschaftlicher Umgang mit<br />
der Ressource <strong>Wasser</strong> dank<br />
verläss icher Messdaten<br />
Leichtere Einsatzplanung mit<br />
aktuellen Messdaten im Web<br />
Druckmessumformer<br />
VEGABAR 52.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 563
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Neun Millionen Euro für ein Herzstück der<br />
Stuttgarter Trinkwasserversorgung<br />
EnBW Regional AG weihte am 15. Mai 2011 den Hochbehälter Mühlbachhof ein<br />
Blick in eine<br />
Speicherkammer.<br />
Nach fast fünf Jahren sind der<br />
Neubau und mehrmonatige<br />
Testbetrieb des EnBW-Trinkwasserhochbehälters<br />
„Mühlbachhof“ beim<br />
Tennisclub TC Weissenhof auf dem<br />
Killesberg jetzt abgeschlossen.<br />
Durch die Erweiterung von zwei auf<br />
drei Kammern fasst der Behälter<br />
zukünftig 22 000 Kubikmeter <strong>Wasser</strong><br />
und versorgt rund 160 000 Stuttgarterinnen<br />
und Stuttgarter im Bereich<br />
der Innenstadt sowie in den Stadtteilen<br />
Killesberg, Feuerbach, Stuttgart-Nord<br />
und Bad Cannstatt mit<br />
Trinkwasser. Der Hochbehälter ist<br />
einer von acht so genannten<br />
Schwerpunktspeichern und nach<br />
dem Hochbehälter Hasenberg der<br />
zweitgrößte Behälter Stuttgarts.<br />
Damit ist er von zentraler Bedeutung<br />
für die <strong>Wasser</strong>versorgung der<br />
Stadt. Bei Bedarf kann der Hochbehälter<br />
Mühlbachhof sogar einen<br />
Großteil des gesamten Stadtgebietes<br />
mit Trinkwasser versorgen. Die<br />
EnBW Regional AG investierte neun<br />
Millionen Euro in den Bau des Behälters.<br />
„Mit der Modernisierung erhöhen<br />
wir nicht nur die Wirtschaftlichkeit<br />
der Anlage, sondern <strong>sich</strong>ern<br />
auch die hohe Trinkwasserqualität<br />
und eine zuverlässige <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
der Landeshauptstadt für<br />
Jahrzehnte“, sagt Steffen Ringwald,<br />
Leiter des EnBW-Regionalzentrums<br />
Außenan<strong>sich</strong>t des Trinkwasserbehälters Mühlbachhof.<br />
Stuttgart. „Der Hochbehälter Mühlbachhof<br />
ist Teil unserer langfristig<br />
angelegten Investitionsstrategie für<br />
die Stuttgarter Trinkwasserversorgung.<br />
Seit der Übernahme durch die<br />
EnBW Regional AG im Jahr 2003<br />
haben wir bis heute in die Stuttgarter<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung über 50 Millionen<br />
Euro investiert.“<br />
Moderner, größer, dichter<br />
1914 wurde der Hochbehälter<br />
Mühlbachhof mit einer Speicherkammer<br />
erstmals für die Stuttgarter<br />
Trinkwasserversorgung in Betrieb<br />
genommen. Er hatte nach dem Bau<br />
einer zweiten Kammer im Jahr 1926<br />
ein Fassungsvermögen von 18000<br />
Kubikmetern. Betontechnologische<br />
Untersuchungen ergaben, dass der<br />
Behälter nach rund 90 Jahren seine<br />
maximale Betriebsdauer erreicht<br />
hatte und ein Neubau notwendig<br />
wurde. Im Jahr 2006 startete die<br />
EnBW mit der Erneuerung des<br />
Behälters. Neben der zusätzlichen<br />
Kammer, die eine bessere Bewirtschaftung<br />
und den flexibleren Einsatz<br />
des Behälters ermöglicht,<br />
wurde auch der Rohrkeller komplett<br />
erneuert und modernste Prozessleittechnik<br />
installiert.<br />
Um die <strong>Wasser</strong>versorgung auch<br />
während der Bauzeit <strong>sich</strong>erzustellen<br />
und die Beeinträchtigungen für<br />
Anrainer so gering wie möglich zu<br />
halten, modernisierte die EnBW in<br />
mehreren Abschnitten. Mit dem so<br />
genannten „Zemdrain“- Schalungsverfahren<br />
kam eine moderne und<br />
Juni 2011<br />
564 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Beide Bilder<br />
links:<br />
An<strong>sich</strong>ten<br />
Rohrkeller<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
effiziente Bautechnik zum Einsatz.<br />
Dabei wird der Behälter schon während<br />
des Betonierens so dicht hergestellt,<br />
dass ein anschließendes<br />
Beschichten nicht mehr nötig ist<br />
und der Behälter dennoch extrem<br />
wasserundurchlässig ist. Die hohe<br />
Dichte des Betons sorgt so auch für<br />
eine längere Lebensdauer des Trinkwasserbehälters.<br />
1400 Tonnen Stahl<br />
und 10 000 Kubikmeter Beton sind<br />
größtenteils unterirdisch verbaut.<br />
Durch das höhere Speichervolumen<br />
ist der neue Behälter etwa 2,5 Meter<br />
höher als vorher.<br />
Eine besondere Herausforderung<br />
war die Tatsache, dass <strong>sich</strong> seit<br />
Jahrzehnten auf dem Behälter sechs<br />
Tennisplätze des Tennisclubs Weissenhof<br />
(TCW) befanden. Um den<br />
Trainings- und Spielbetrieb trotz<br />
Bauarbeiten zu gewährleisten, entstanden<br />
durch konstruktive Zusammenarbeit<br />
der Stadt, des Tennisclubs<br />
und der EnBW auf der an -<br />
deren Seite des Clubgeländes, im<br />
Bereich der ehemaligen Messeparkplätze,<br />
neue Flächen für den Tennisclub.<br />
„Wir danken dem TC Weissenhof<br />
sehr für die Offenheit und<br />
Kooperationsbereitschaft“, so Ringwald.<br />
„Auch dank der Unterstützung<br />
der weiteren Nachbarn wie der<br />
Mühlbachhof-Schule und dem Verein<br />
Aktion Vorschulerziehung Stuttgart/<br />
Kinderladen können wir daher<br />
heute sagen: Spiel, Satz und Sieg für<br />
ein wichtiges EnBW-Infrastrukturprojekt<br />
in der Stuttgarter <strong>Wasser</strong>versorgung.“<br />
Kontakt:<br />
EnBW Regional AG,<br />
Regionalzentrum Stuttgart,<br />
Hackstraße 31,<br />
D-70190 Stuttgart,<br />
www.enbw.com<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 565
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Hochbehälter Ohlerkirchweg ‒ eine der <strong>Wasser</strong>adern<br />
Mönchengladbachs<br />
Imposanter<br />
Zugang zum<br />
Arbeitsplatz: in<br />
15 m Höhe<br />
befand <strong>sich</strong> der<br />
Einstieg in die<br />
Kammer.<br />
© Wiedemann<br />
Rund 259000 Menschen in und<br />
um Mönchengladbach waschen,<br />
kochen oder baden täglich mit dem<br />
Trinkwasser der Niederrheinische<br />
Versorgung und Verkehr Aktiengesellschaft<br />
(NVV). Für die frische und<br />
saubere Versorgung sorgen sechs<br />
<strong>Wasser</strong>werke und acht Hochbehäl-<br />
parallel stattfinden, sondern wurden<br />
in zwei Abschnitten geteilt. So<br />
war jeweils eine Kammer intakt, um<br />
die Anwohner mit Trinkwasser zu<br />
versorgen.<br />
Zunächst behandelten die Wiedmann<br />
Fachleute den Untergrund<br />
mit Höchstdruckwasserstrahlung<br />
ton-Fertigteilen bestehende Decke.<br />
Oben auf kam ein abnehmbares<br />
Zugangsgebäude, um bei zukünftigen<br />
Sanierungen relativ bequem<br />
einsteigen zu können.<br />
Weniger waghalsig gestaltete<br />
<strong>sich</strong> die neue Dämmung der Fassade.<br />
Da die Behälter oberirdisch<br />
stehen, sind sie im Sommer hohen<br />
Temperaturen ausgesetzt. Erwärmt<br />
<strong>sich</strong> das <strong>Wasser</strong>, steigt die Gefahr,<br />
dass es Mikroorganismen verunreinigen.<br />
Daher ergänzten die Verarbeiter<br />
die ursprüngliche Isolationsschicht<br />
aus Glasfasermatten durch<br />
ein 6 cm starkes, modernes Wärmedämmverbundsystem.<br />
Somit ist ge -<br />
währleistet, dass auch im Hochsommer<br />
die <strong>Wasser</strong>temperatur im un -<br />
kritischen Bereich bleibt.<br />
ter. Damit es so bleibt, müssen die<br />
Reservoire regelmäßig gewartet,<br />
gepflegt und instand gesetzt werden.<br />
Von Februar 2010 bis März<br />
2011 waren die beiden Kammern<br />
des Trinkwasserbehälters Ohlerkirchweg<br />
an der Reihe.<br />
Schadensbild<br />
Wechselwirkungen zwischen Trinkwasser,<br />
Auskleidung und Untergrund<br />
setzten dem 1970/71 errichteten<br />
Betonbau schwer zu: Fehlstellen<br />
in der Beschichtung, Korrosion<br />
der Bewehrung und Absandungen<br />
zeigte die Innenbeschichtung. Auf<br />
dem Dach waren die Trapezbleche<br />
schadhaft, die Fassadenisolierung<br />
aus Glasfasermatten war porös.<br />
Sanierungsarbeiten<br />
Die Bedingungen waren außergewöhnlich<br />
anspruchsvoll: 17 m<br />
Wandhöhe, 9,5 m Deckenradius.<br />
Zudem konnten die Arbeiten nicht<br />
vor. Nachdem sie die Schadstellen<br />
saniert hatten, erhielten die Wände<br />
der 4000 m³ fassenden Kammern<br />
eine Spritzmörtelbeschichtung mit<br />
Microsilica vergütetem Trockenmörtel.<br />
Auf die jeweils 290 m² großen<br />
Bodenflächen kam ein ebenfalls mit<br />
Microsilica vergüteter Estrich.<br />
Die große Herausforderung lag<br />
in der ungewöhnlichen Höhe der<br />
Wände. Die Einstiegsluke in 15 m<br />
Höhe erschwerte die Instandsetzungsarbeiten.<br />
Jeder einzelne<br />
Schritt musste fein verzahnt mit der<br />
Materiallogistik ablaufen, um Leerlauf<br />
zu vermeiden und den engen<br />
Zeitplan einzuhalten.<br />
Auch die neue Dacheindeckung<br />
erforderte höchste Präzision: Zu -<br />
nächst baute man die vorhandene<br />
Eindeckung zurück, montierte je -<br />
weils zwei tonnenschwere und 20 m<br />
lange Stahlbeton-Fertigteil-Binder<br />
in schwindelnder Höhe und installierte<br />
die neue, aus 32 Spannbe -<br />
Fazit<br />
Eine Rundum-Erneuerung verwandelte<br />
den in die Jahre gekommenen<br />
Hochbehälter in eine hochmoderne<br />
Anlage gemäß den anerkannten<br />
Regeln der Technik. Die eingesetzten<br />
Materialien entsprechen den Anforderungen<br />
der DVGW-Arbeitsblätter<br />
W 300 und W 347. Die Qua lität von<br />
Materialien und Verarbeitung wurde<br />
während der gesamten Maßnahme<br />
eigen- und fremdüberwacht.<br />
Beteiligte Partner:<br />
Auftraggeber: Niederrheinische Versorgung<br />
und Verkehr AG (NVV AG)<br />
Planung, Bauwerksuntersuchung, Überwachung:<br />
H2U aqua.plan.Ing-GmbH<br />
Ausführung: Fritz Wiedemann und Sohn<br />
GmbH, Wiesbaden<br />
Autoren/Kontakt:<br />
Dipl. Ing. Niels Kessler,<br />
Dipl. Ing. Judith Hein,<br />
Fritz Wiedemann und Sohn GmbH,<br />
Weidenbornstraße 7–9,<br />
D-65189 Wiesbaden,<br />
Tel. (0611) 79080,<br />
Fax (0611) 761185,<br />
E-Mail: niels.kessler@wiedemann-gmbh.com<br />
Juni 2011<br />
566 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Endliches unendlich<br />
nutzbar machen.
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Instandsetzung eines Ludwigsburger<br />
Trinkwasser-Reservoirs<br />
Ein keltisches Fürstengrab gab dem Fürstenhügel bei<br />
Ludwigsburg seinen Namen. Heute steht dort ein<br />
<strong>Wasser</strong>turm aus Backstein.<br />
Die letzte Sanierungsmaßnahme lag bereits 33 Jahre<br />
zurück. Der Zustand des alten Betons ließ eine rein<br />
mineralische Instandsetzung nicht mehr zu.<br />
Bei archäologischen Ausgrabungen<br />
in Ludwigsburg bei Stuttgart<br />
entdeckte der Geologe und<br />
Naturforscher Oscar Friedrich von<br />
Fraas (1824 – 1897) ein reich ausgestattetes<br />
Fürstengrab aus keltischer<br />
Zeit. Diesem sensationellen Fund<br />
aus dem Jahr 1877 verdankt der Ort,<br />
auf dem <strong>sich</strong> der heutige Backstein-<br />
<strong>Wasser</strong>turm befindet, den schönen<br />
Namen Fürstenhügel.<br />
Mittlerweile befinden <strong>sich</strong> unter<br />
dem Erdreich des gleichnamigen<br />
Hügels keine Fürstengräber mehr,<br />
sondern eine andere Art von Schatz,<br />
der für die Versorgung der Bürger<br />
Ludwigsburgs von zentraler Bedeutung<br />
ist: Unter dem Turm lagern<br />
heute 10 000 Kubikmeter Trinkwasser<br />
in vier Trinkwasserhochbehältern<br />
aus Beton mit Anschüttung.<br />
Der <strong>Wasser</strong>turm selbst birgt eine<br />
weitere Trinkwasserkammer mit<br />
einem Fassungsvermögen von 2000<br />
Litern.<br />
Rund um den 1935 erbauten<br />
Turm wucherten seit Jahren wild<br />
wachsende Bäume, deren Wurzelwerk<br />
die abdichtende Bitumenschicht<br />
der <strong>Wasser</strong>behälter stark<br />
angegriffen hatte. Bereits 2009 wurden<br />
die Bäume deshalb gefällt und<br />
circa 4000 Kubikmeter Erdreich<br />
abgetragen. Nach Erneuerung der<br />
Bitumenschicht schüttete man<br />
erneut 90 Zentimeter Erde auf. Die<br />
Stadtwerke SWLB werden als Betreiber<br />
der Anlage künftig darauf achten,<br />
dass in diesem Bereich keine<br />
tief wurzelnden Pflanzen mehr<br />
wachsen können.<br />
Instandsetzung der<br />
Betonkammern<br />
Nach Abschluss der aufwändigen<br />
Abdichtungsmaßnahmen nahm<br />
man die Sanierung der Betonkammern<br />
in Angriff. Zwei der Behälter<br />
waren bereits 1927 in Betrieb<br />
genommen worden, zwei weitere<br />
wurden 1956 fertig gestellt. Die<br />
letzte Sanierungsmaßnahme lag<br />
bereits 33 Jahre zurück. Da der<br />
Zustand des alten Betons eine rein<br />
mineralische Instandsetzung nicht<br />
mehr zuließ, sollte eine Abdichtung<br />
mit Kunststoffdichtungsbahnen aus<br />
flexiblen Polyolefinen erfolgen.<br />
Die Sanierung betraf 6500 Quadratmeter<br />
Fläche und dauerte insgesamt<br />
zehn Monate. Ausführendes<br />
Unternehmen war die Firma Bauschutz<br />
GmbH aus dem nahe gelegenen<br />
Asperg. Zunächst wurden<br />
die beiden äußeren Behälter instand<br />
gesetzt, während die beiden anderen<br />
Kammern weiter in Betrieb<br />
waren. Die geleerten Kammern<br />
wurden durch Hochdruckstrahlen<br />
gereinigt, bevor die Betoninstandsetzung<br />
mit kunststoffmodifiziertem<br />
Betonersatz erfolgte.<br />
Die Bauschutz GmbH setzte bei<br />
dieser Instandsetzungsmaßnahme<br />
ausschließlich Produkte von Sika<br />
Deutschland ein: Als Betonersatz<br />
wurde der optimal haftende Reparaturmörtel<br />
Sika MonoTop-613 und<br />
anschließend SikaTop TW zur Egalisierung<br />
der Flächen eingesetzt.<br />
Durch seine Kunststoffmodifizierung<br />
ist der SikaTop-Mörtel nicht risseanfällig<br />
und daher speziell für die<br />
Anwendung in Trinkwasserbehältern<br />
geeignet. Als Oberflächenschutz<br />
folgte eine maschinell verarbeitete<br />
Beschichtung mit SikaTop Seal-207,<br />
einem besonders langlebigen Dünnschichtmörtel<br />
mit hoher Resistenz<br />
gegenüber hydrolytischer Korrosion.<br />
Beständige Abdichtung mit<br />
Kunststoffdichtungsbahnen<br />
Zur hygienischen Lagerung des<br />
Trinkwassers wurden die Kammern<br />
abschließend mit der strapazierfähigen<br />
Dichtungsbahn Sikaplan<br />
WT 4220 in einem hellblauen Farbton<br />
dauerhaft abgedichtet. Diese<br />
FPO-Dichtungsbahn schützt nicht<br />
nur den Beton vor Durchnässung,<br />
kalkaggressivem Angriff und Streu-<br />
Juni 2011<br />
568 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Als Betonersatz wurde der Reparaturmörtel Sika MonoTop-613 und<br />
anschließend SikaTop TW zur Egalisierung der Flächen eingesetzt, als<br />
Oberflächenschutz eine Beschichtung mit SikaTop Seal-207, einem besonders<br />
langlebigen Dünnschichtmörtel mit hoher Resistenz gegenüber hydrolytischer<br />
Korrosion.<br />
Hydro click<br />
Auskleidungssystem<br />
aus PE für Trink -<br />
wasserbehälter<br />
Auskleidungssysteme aus PE<br />
haben <strong>sich</strong> seit Jahrzehnten<br />
bewährt. Mit dem geprüften<br />
System Hydro click werden Trinkwasserbehälter<br />
dauerhaft dicht<br />
ausgekleidet:<br />
geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 270 und KTW-Leitlinie,<br />
geeignet für den Trinkwasserkontakt,<br />
physiologisch unbedenklich,<br />
Zur hygienischen Lagerung des Trinkwassers wurden die Kammern mit<br />
der strapazierfähigen Dichtungsbahn Sikaplan WT 4220 abgedichtet.<br />
hohe Lebensdauer,<br />
strömen im <strong>Wasser</strong>, sie bleibt auch<br />
bei kleineren Rissen im Bauwerk<br />
funktionsstabil und wasserdicht<br />
und ist zudem reinigungs- und wartungsfreundlich.<br />
Bilder:<br />
Sika Deutschland GmbH<br />
Kontakt:<br />
Sika Deutschland GmbH,<br />
Kornwestheimer Straße 103-107,<br />
D-70439 Stuttgart,<br />
Tel. (0711) 8009-0,<br />
Fax (0711) 8009-576,<br />
E-Mail: info@de.sika.com,<br />
www.sika.de<br />
wartungsfreundliche, glatte<br />
Oberfl äche,<br />
kein mikrobakterieller Bewuchs,<br />
keine Inkrustationen,<br />
einfache und <strong>sich</strong>ere Verlegung.<br />
FRANK GmbH Telefon + 49 6105 4085-0
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
<strong>Wo</strong>hnen und arbeiten im <strong>Wasser</strong>turm<br />
Der Ingenieur Martin Neumaier erfüllte <strong>sich</strong> mit der Sanierung des denkmalgeschützten<br />
<strong>Wasser</strong>turms in Erding einen Kindheitstraum<br />
<strong>Wasser</strong>turm vorher.<br />
Der Anfang der zentralen <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
in Erding wird<br />
in den Chroniken mit dem Jahr<br />
1860 vermerkt. Im Jahre 1890<br />
wurde das erste <strong>Wasser</strong>werk im<br />
Bereich des ehemaligen Schlachthofes<br />
(heute Metzgerei Schachtl)<br />
errichtet. Um die Versorgung mit<br />
ausreichendem Druck zu gewährleisten,<br />
wurde im Jahre 1913 dann<br />
das erste elektrisch-automatische<br />
<strong>Wasser</strong>werk erstellt. Die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
bestand aus einem von<br />
einer <strong>Wasser</strong>turbine betriebenen<br />
Pumpwerk, das direkt in das Rohrnetz<br />
förderte. Zum Ausgleich der<br />
schwankenden <strong>Wasser</strong>entnahme<br />
und als <strong>Wasser</strong>reserve wurde daraufhin<br />
im Jahre 1914 mit dem Bau<br />
des Erdinger <strong>Wasser</strong>turmes begonnen.<br />
Die Fertigstellung des Turmes<br />
mit einem Fassungsvermögen von<br />
216 m³ <strong>Wasser</strong> erfolgte am 20. Juni<br />
1915. Bis zur Inbetriebnahme des<br />
neuen fast 10 000 m³ fassenden<br />
Trinkwasserbehälter in Lupperg im<br />
Jahre 1982, diente der <strong>Wasser</strong>turm<br />
der Versorgung des Erdinger Stadtgebietes,<br />
einschließlich der zugehörigen<br />
Ortsteile und Teilen des<br />
Erdinger Fliegerhorstes.<br />
In den Jahren nach der Stilllegung<br />
erlebte der <strong>Wasser</strong>turm einen<br />
traurigen Verfall. Das Dach musste<br />
zweimal in dieser Zeit mit einem<br />
Schutznetz abgedeckt werden, um<br />
Unfälle durch herabfallende Dachziegel<br />
zu vermeiden. Leer stehend<br />
und mit undichtem Dach verfiel der<br />
<strong>Wasser</strong>turm in den darauf folgenden<br />
Jahren innen und außen mehr<br />
und mehr.<br />
Den Ingenieur Martin Neumaier,<br />
der schon als Kind von seinem Fenster<br />
aus direkten Blickkontakt mit<br />
dem <strong>Wasser</strong>turm hatte, betrübte<br />
der Zustand des verfallenden Bauwerkes<br />
und er bewarb <strong>sich</strong> darum,<br />
den <strong>Wasser</strong>turm zu kaufen. Mehrere<br />
Interessenten standen bereits auf<br />
der Warteliste, doch ange<strong>sich</strong>ts des<br />
desolaten Zustandes wollte von<br />
ihnen schließlich keiner das Risiko<br />
eingehen und Neumaier bekam<br />
den Zuschlag, den Turm für einen<br />
symbolischen Preis von 1 Euro pro<br />
Jahr zu mieten und dafür sämtlich<br />
Baukosten zu übernehmen.<br />
Unter Denkmalschutz<br />
Innerhalb der Erdinger Denkmälerlandschaft<br />
ist der <strong>Wasser</strong>turm das<br />
bislang einzige gelistete Industriedenkmal<br />
und bezeugt hin<strong>sich</strong>tlich<br />
der Stampfbetonkonstruktion mit<br />
Ziegelausfachungen beinahe exemplarisch<br />
die materialtechnische<br />
Innovation zu Beginn des 20. Jahrhunderts.<br />
Der Bau ist ein typischer Vertreter<br />
der rechteckigen <strong>Wasser</strong>türme<br />
mit oben auskragendem Turmkopf<br />
im Bereich der <strong>Wasser</strong>behälter.<br />
Diese Auskragung liegt darin<br />
begründet, dass die Behälteraußenwand<br />
zur direkten Lastabtragung<br />
auf den Turmschaft gelagert ist und<br />
dass zwischen Behälterwand und<br />
Turmaußenwand noch ein Luftraum<br />
zur Isolierung erforderlich war. Ein<br />
weiteres typisches Merkmal für die<br />
seinerzeitige Bauweise der <strong>Wasser</strong>türme<br />
ist der zentrale Durchstieg<br />
durch die Eisenbeton-<strong>Wasser</strong>kammern<br />
mit einem lichten Durchmesser<br />
von 1 m und dem Einstieg in die<br />
eigentlichen <strong>Wasser</strong>kammern vom<br />
Dachraum aus.<br />
Bei der ganzen Planung des Umund<br />
Ausbaus wurde sehr darauf<br />
geachtet, das ursprüngliche Erscheinungsbild<br />
des <strong>Wasser</strong>turmes zu<br />
erhalten. Nur bei der An<strong>sich</strong>t nach<br />
Westen, die ohnehin nur von wenigen<br />
Punkten in der Stadt aus einsehbar<br />
ist, durften in den oberen Stockwerken<br />
große Fenster eingebaut<br />
werden. Die vorhandenen Treppen,<br />
die nur vom Erdgeschoß bis ins<br />
dritte Obergeschoß führten, wurden<br />
soweit wie möglich erhalten und<br />
mussten nur jeweils im unteren Teil<br />
abgebaut und von einer 1/4-Wendelung<br />
in eine 1/2-Wendelung abgeändert<br />
werden. Das Treppengeländer<br />
wurde ebenfalls an allen möglichen<br />
Stellen erhalten und das neue<br />
Geländer wurde in den Abmessungen<br />
und der Form dem vorhandenen<br />
angepasst.<br />
Vom dritten Obergeschoß bis ins<br />
Dachgeschoß gab es im ursprünglichen<br />
Zustand nur eine etwa elf<br />
Meter hohe Steigleiter mit zentralem<br />
Durchstieg durch die <strong>Wasser</strong>behälter.<br />
Ein Teil der Steigleiter und die<br />
Bodenöffnung dieses Durchstiegs<br />
wurden im ursprünglichen Zustand<br />
erhalten und mit einer begehbaren<br />
Glasplatte abgedeckt, so dass von<br />
beiden Etagen der Durchstieg<br />
erkenn- und erklärbar ist. Vom Erdgeschoß<br />
bis zum Dachgeschoß<br />
wurden die Durchbrüche für den<br />
Juni 2011<br />
570 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Aufzug erstellt und als erste Baumaßnahme<br />
der Aufzugschacht<br />
betoniert, der eine lichte Höhe<br />
von Unter- bis Überfahrt von über<br />
25 Meter aufweist.<br />
Der Aufzugschacht dient jetzt<br />
gleichzeitig als zusätzliche Aussteifung<br />
und Auflager für die erforderlichen<br />
Unterzüge der neuen Decken<br />
in den oberen Stockwerken. Um<br />
die oberen Stockwerke überhaupt<br />
begehbar zu machen, mussten<br />
außerdem vom dritten Obergeschoß<br />
bis ins Dachgeschoß ebenfalls<br />
Durchbrüche durchgeführt<br />
und Treppen errichtet werden, die<br />
bis dahin nicht vorhanden waren.<br />
Für die Nutzung im Bereich der<br />
<strong>Wasser</strong>behälter mussten die <strong>Wasser</strong>tanks,<br />
die aus 110 Tonnen Stahlbeton<br />
bestanden, mühsam abgestemmt<br />
und beseitigt werden,<br />
wobei der für den Turm so typische<br />
Durchstieg durch die <strong>Wasser</strong>behälter<br />
erhalten blieb. Ein Original<br />
Wandstück der Behälterwand mit<br />
einer Originalrohrleitung wurde in<br />
diesem Bereich ebenfalls belassen.<br />
Für den Einbau der neuen Decken<br />
im Bereich des ehemaligen <strong>Wasser</strong>behälters<br />
und der großen Fenster<br />
an der Westfassade mussten Stützen<br />
aus Stahlbeton und Unterzüge<br />
so eingezogen werden, dass die vertikale<br />
Lastableitung wieder auf<br />
die Grundmauern des Turmschaftes<br />
geführt wurden, um ein stabiles<br />
statisches System zu erhalten. Erst<br />
danach war es möglich, die Außenmauern<br />
für den Einbau von Fenstern<br />
in die Westseite zu öffnen und<br />
die Glaselemente, die in der Größe<br />
der ursprünglichen Nischeneinfassung<br />
entsprechend, einzubauen.<br />
Um den <strong>Wasser</strong>turm auch energetisch<br />
zu sanieren, wurde ein Vollwärmeschutz<br />
über die gesamten<br />
Außenmauern angebracht, wobei<br />
sämtliche Vorsprünge, Nischen,<br />
Rundungen und Lisenen wie in der<br />
ursprünglichen Form übernommen<br />
wurden. Dass Schönberger Unternehmen<br />
Kern, das über langjährige<br />
Erfahrungen beim Einbau von Wärmedämmverbundsystemen<br />
(WDVS)<br />
verfügt, wurde mit der Sanierung<br />
der Fassade beauftragt. Außen am<br />
<strong>Wasser</strong>turm wurde das Wärmedämmverbundsystem<br />
NeoWall von<br />
Hasit mit einem sechs Millimeter<br />
starken Rillenputz und Silikonharzfassadenfarbe<br />
angewandt. Im<br />
Innenbereich wurden Wände und<br />
Decken komplett mit Hasit Renovierputz<br />
250, einer Gewebespachtelung,<br />
Hasit LITHIN Phantasieputz<br />
730 und Hasit SILIKAT Innenanstrich<br />
760 überarbeitet. Die Putzarbeiten<br />
im Innenbereich wie im Außenbereich<br />
wurden vollständig in Handarbeit<br />
erledigt.<br />
In den Originalplänen war im<br />
zweiten Obergeschoß ein Balkon<br />
eingezeichnet, der aber erst während<br />
der Umnutzung realisiert<br />
wurde. Hier wurde eine filigrane<br />
Konstruktion aus Stahl mit einem<br />
Gitterrost gewählt, die bei Sonnenlicht<br />
oftmals ein interessantes Schattenbild<br />
an die Turmwand wirft.<br />
Das aus Eisenbeton errichtete<br />
Zeltdach wurde innenseitig, bis zu<br />
einem neuen Zwischenboden mit<br />
Zugtreppe, nur ausgebessert und<br />
neu gestrichen aber ansonsten wie<br />
die Laterne, die über eine neue Zugtreppe<br />
erreichbar ist, im Originalzustand<br />
erhalten. Außenseitig wurde<br />
auf das Zeltdach eine Dampfsperre<br />
und eine Wärmedämmung aufgebracht<br />
und das Dach mit Biberschwanzdachplatten<br />
gedeckt, so<br />
dass auch hier das ursprüngliche<br />
Erscheinungsbild erhalten blieb.<br />
Da der <strong>Wasser</strong>turm bis zur Sanierung<br />
eigentlich nicht erschlossen<br />
war (sogar eine <strong>Wasser</strong>leitung<br />
fehlte!), mussten zusätzlich die<br />
Sparten Strom, Gas, <strong>Wasser</strong> und<br />
<strong>Abwasser</strong> herangeführt werden.<br />
Der Vollständigkeit halber seien<br />
noch die Außenanlagen erwähnt.<br />
Vor dem Turm wurde ein Wendehammer<br />
mit vier Stellplätzen befestigt,<br />
hinter dem Turm noch einmal<br />
zwei Stellplätze mit einer Doppelgarage.<br />
Eine weitläufige Gartenanlage<br />
mit altem Baumbestand wurde<br />
gärtnerisch saniert und nutzbar<br />
gemacht.<br />
<strong>Wasser</strong>turm nachher.<br />
Kontakt:<br />
Ingenieurbüro Neumaier,<br />
Am <strong>Wasser</strong>turm 8,<br />
D-85435 Erding<br />
Tel. (08122) 93377,<br />
Fax (08122) 93378,<br />
E-Mail: mailto:martin.neumaier@erdingerwasserturm.de,<br />
mailto:erdingerwasserturm@t-online.de,<br />
www.erdinger-wasserturm.de<br />
Kern Bau GmbH,<br />
Regener Straße 1,<br />
D-94513 Schönberg,<br />
Tel. (08554) 9613-0,<br />
Fax (08554) 9613-66,<br />
E-Mail info@kern-bau.de<br />
HASIT Trockenmörtel GmbH,<br />
Landshuter Straße 30,<br />
D-85356 Freising,<br />
Tel. (08161) 602-470,<br />
Fax (08161) 602-536,<br />
E-Mail: Angelika.Lubig@hasit.de,<br />
www.hasit.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 571
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Wahrzeichen mit Tradition: Der Neue <strong>Wasser</strong>turm<br />
in Dessau-Roßlau<br />
Verein engagiert <strong>sich</strong> für den Erhalt und Restaurierung des Denkmals<br />
Der Neue <strong>Wasser</strong>turm mit saniertem Dach und<br />
bereits abgenommenen Erkertürmen (2010).<br />
Der Neue <strong>Wasser</strong>turm nach seiner Erbauung.<br />
Schon 1615 gab es für die Stadt<br />
Dessau streckenweise eine <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
über bleierne und<br />
auch hölzerne Rohre, aber die meisten<br />
Dessauer mussten die öffentlichen<br />
Brunnen auf Straßen und Plätzen<br />
nutzen oder sie hatten einen<br />
eigenen Brunnen. Erst nach 1870<br />
wurde die Stadt durch ein umfassendes<br />
<strong>Wasser</strong>leitungsnetz versorgt.<br />
1875 wurde der Grundstein<br />
für den ersten Dessauer <strong>Wasser</strong>turm<br />
(Fassungsvermögen 600 m 3 ) gelegt,<br />
dessen <strong>Wasser</strong> aber stark eisenhaltig<br />
war.<br />
Nach neuen Bohrungen, die besseres<br />
<strong>Wasser</strong> liefern sollten, wurde<br />
1895 der Bau eines zweiten <strong>Wasser</strong>turmes<br />
beschlossen. Mit der Errichtung<br />
des Neuen <strong>Wasser</strong>turmes am<br />
Lutherplatz durch den Dessauer<br />
Stadtbaumeister und Architekten<br />
Paul Engel wurde im Juli 1896 be -<br />
gonnen. Die Fertigstellung erfolgte<br />
im Juni 1897. Dieser im Stil des<br />
Eklektizismus erbaute <strong>Wasser</strong>turm<br />
ist noch heute ein weithin <strong>sich</strong>tbares<br />
Wahrzeichen der Stadt.<br />
Im Gegensatz zu der in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft gelegenen<br />
Volksschule III, wegen ihrer Lage<br />
am Lutherplatz von den Dessauern<br />
auch „Lutherschule“ genannt, blieb<br />
der <strong>Wasser</strong>turm von den angloamerikanischen<br />
Luftangriffen vom<br />
7. März 1945 einigermaßen verschont,<br />
allerdings musste das Dach<br />
neu eingedeckt werden.<br />
Nachdem der <strong>Wasser</strong>turm für<br />
seinen ursprünglichen Zweck nicht<br />
mehr benötigt wurde, begann sein<br />
Verfall. Doch chronischer Mangel an<br />
finanziellen Mitteln, Material und<br />
Baukapazität verhinderte so<strong>wohl</strong><br />
die Realisierung jeglicher Erhaltungs-<br />
und Nutzungsmaßnahmen,<br />
glücklicherweise aber auch den<br />
Abriss des Bauwerkes. Beispielsweise<br />
waren im bestätigten Bebauungsplan<br />
Ende der 70-er Jahre<br />
so<strong>wohl</strong> der Alte <strong>Wasser</strong>turm an<br />
der Heidestraße, der dem sozialistischen<br />
<strong>Wo</strong>hnungsbau weichen<br />
soll te, als auch der Neue am Lutherplatz<br />
nicht mehr enthalten. Über die<br />
Fundamente des letzteren sollte<br />
eine 4-spurige Haupterschließungsstraße<br />
in Nord-Süd-Richtung führen.<br />
Der daraus resultierende Abriss<br />
des <strong>Wasser</strong>turmes löste schon zu<br />
dieser Zeit heftige Diskussionen um<br />
den Erhalt und die weitere Nutzung<br />
dieses Bauwerkes aus.<br />
Heute widmet <strong>sich</strong> der Verein zur<br />
„Förderung und Erhaltung des<br />
Neuen <strong>Wasser</strong>turmes e. V.“ dem<br />
Denkmal. Auf Initiative des Ge -<br />
schäftsführers der Stadtwerke Dessau,<br />
Hans Tobler, wurde der Verein<br />
am 26.10.2006 gegründet. Ziel ist<br />
es, den Neuen <strong>Wasser</strong>turm<br />
vor weiterem Zerfall zu<br />
schützen,<br />
äußerlich möglichst originalgetreu<br />
zu restaurieren und<br />
perspektivisch durch eine kostendeckende<br />
Nutzung dauerhaft<br />
zu erhalten.<br />
Unter dem Motto „10 Euro für<br />
einen Ziegel“ hat der Verein in<br />
Zusammenarbeit mit ansässigen<br />
Händlern im Jahr 2008 eine erste<br />
große Spendenaktion ins Leben<br />
gerufen. Fast 700 Spender beteiligten<br />
<strong>sich</strong> damals und erwarben dabei<br />
symbolisch fast 2500 Dachziegel.<br />
Nach diesem erfolgreichen Auftakt<br />
setzt <strong>sich</strong> die Aktion bis heute fort<br />
und leistete mit über 60 000 Euro<br />
einen wichtigen Beitrag zur bisherigen<br />
Sanierung des Neuen <strong>Wasser</strong>turms.<br />
Eine zusätzliche Spendenaktion<br />
widmet <strong>sich</strong> seit Ende 2010<br />
speziell dem Erhalt der Erkertürme.<br />
Ergänzend dazu bemüht <strong>sich</strong> der<br />
Verein stetig um weitere Förderer –<br />
und findet diese maßgebend auch<br />
Juni 2011<br />
572 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Blick in den<br />
Innenraum des<br />
Neuen <strong>Wasser</strong>turms.<br />
Der Neue <strong>Wasser</strong>turm vor der Dachsanierung (2007).<br />
Tabelle. Eckdaten.<br />
Ringfundament Sohlenbreite 3,00 m<br />
Höhe Gründungstiefe 3,20 m<br />
Turm<br />
63,50 m<br />
Kellerfußboden<br />
–2,70 m<br />
Auflager <strong>Wasser</strong>behälter (Kanzel) 26,00 m<br />
Traufe<br />
31,00 m<br />
Turmhelm mit Umgang<br />
45,00 m<br />
Turmdurchmesser innen außen<br />
Basis 17,00 m 22,00 m<br />
Schaft oben 16,50 m 18,00 m<br />
Kanzel (in der Mitte) 18,00 m 18,80 m<br />
Fassungsvermögen der <strong>Wasser</strong>behälter<br />
1100 m 3<br />
in Unternehmen aus der Region, die<br />
<strong>sich</strong> zum Teil über mehrere Jahre zu<br />
einem Engagement für das Denkmal<br />
verpflichtet haben.<br />
Unverzichtbar sind darüber hinaus<br />
auch finanzielle Mittel, die dem<br />
Verein bereits aus dem Förderprogramm<br />
zum Stadtumbau Ost, aber<br />
auch von Lotto Sachsen-Anhalt und<br />
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz<br />
gewährt wurden. Finanziert<br />
wurden von den Spenden und Fördermitteln<br />
bislang vor allem die<br />
Dach-Restauration sowie die damit<br />
verbundenen Kosten für Sicherungsmaßnahmen,<br />
Baustelleneinrichtung<br />
und die Rüstung.<br />
„Dies zeigt, was Kräftebündelung<br />
möglich macht. Jeder Betrag<br />
ist wichtig und trägt dazu bei, dass<br />
wir gemeinsam etwas bewegen<br />
können“, resümiert der Vereinsvorsitzende<br />
Hans Tobler. „Die nächsten<br />
Ziele rücken damit wieder ein Stück<br />
näher“ ergänzt Wilhelm Kleinschmidt,<br />
zweiter Vereinsvorsitzender.<br />
„Die Sanierung und Wiederaufstellung<br />
der vier Erkertürme sowie<br />
der Spitze haben wir fest im Blick.<br />
Für ein attraktives Erscheinungsbild<br />
des Denkmals haben diese Merkmale<br />
einen hohen Stellenwert.“<br />
Weitere Informationen:<br />
www.dvv-dessau.de<br />
Trinkwasserbehälter im Baukastensystem<br />
Kolberger Str. 13<br />
D-24589 Nortorf<br />
Tel.: +49 (0) 4392 / 9177-0<br />
Fax: +49 (0) 4392 / 5864<br />
EUROTANK GmbH service@eurotank.info
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
<strong>Wasser</strong>turm<br />
mit noch<br />
unverkleidetem<br />
Behälter<br />
im Jahr 1913.<br />
© Archiv<br />
Jens U. Schmidt<br />
Ferienhaus am Stiel<br />
Der Blick von hoch oben auf den<br />
Plöner See mit seinen kleinen,<br />
bewaldeten Inseln ist überwältigend.<br />
Seit dem 17. Dezember 1913<br />
kann man ihn genießen, denn an<br />
diesem Tag nahm der neue <strong>Wasser</strong>turm<br />
in Plön seinen Dienst auf.<br />
Anfangs war der Turm als Aus<strong>sich</strong>tsturm<br />
allen Interessierten zugänglich.<br />
Sie mussten allerdings viele Stufen<br />
erklimmen, um dann auf den<br />
rund um den Turm führenden Balkon<br />
etwa 30 m über dem Gelände zu<br />
treten. Rechnet man den Berg dazu,<br />
auf dem der Turm steht, so befindet<br />
man <strong>sich</strong> 70 m über dem See.<br />
Heute ist der Aufstieg weniger<br />
beschwerlich, da ein Fahrstuhl die<br />
ersten knapp 20 m überwindet.<br />
Dafür kommen nur noch Privilegierte<br />
in den Turm, nämlich alle, die<br />
den Turm als Ferienhaus mieten.<br />
Dafür genießen sie die Sicht aus<br />
dem Küchenfenster im Morgenlicht<br />
beim Frühstück, bei unterschiedlichen<br />
Wetterstimmungen am Tag<br />
und beim Sonnenuntergang, wenn<br />
sie den Blick mal vom Fernseher im<br />
gemütlichen <strong>Wo</strong>hnzimmer abwenden<br />
und aus einem der vielen Fenster<br />
schauen. Auch der Blick auf die<br />
kleine Stadt am Seeufer und das<br />
abends hell angestrahlte Schloss<br />
lohnt <strong>sich</strong>.<br />
Der <strong>Wasser</strong>turm hoch über dem Großen Plöner See.<br />
© Jens U. Schmidt<br />
Bier statt <strong>Wasser</strong><br />
Bevor es eine zentrale <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
gab, schöpfte die Plöner<br />
Bevölkerung ihr <strong>Wasser</strong> aus Brunnen<br />
und offenen Gewässern. Allerdings<br />
war die Qualität des <strong>Wasser</strong>s<br />
schon seit langer Zeit äußerst<br />
bedenklich. Im sandigen Boden versickerten<br />
alle Abwässer schnell und<br />
verunreinigten das Grundwasser so<br />
stark, dass es nur abgekocht trinkbar<br />
war. Eine Notlösung war das<br />
Bierbrauen. Die Plöner führen ihren<br />
Jahrhunderte lang ungewöhnlich<br />
hohen Bierverbrauch auf die Un -<br />
genießbarkeit des Brunnenwassers<br />
zurück.<br />
Am 11. April 1912 beschlossen<br />
die städtischen Kollegien, ein <strong>Wasser</strong>werk<br />
zu bauen. Das Maschinenhaus<br />
und drei Rohrbrunnen errichtete<br />
die Arnstädter Firma Paul<br />
Gockenbach auf dem Uferstreifen<br />
am Großen Plöner See. Der dazugehörige<br />
<strong>Wasser</strong>turm entstand nach<br />
dem Entwurf des Bremer Ingenieurs<br />
Carl Franke oberhalb vom <strong>Wasser</strong>werk<br />
auf dem Hohenberg. Ein<br />
Modell des Turms stand im Schaufenster<br />
des Kaufmanns Sisum, um<br />
die Vorfreude auf den Bau zu<br />
wecken. Das Plöner <strong>Wo</strong>chenblatt<br />
vom 25. April 1912 schrieb: „Durch<br />
eine in der Farbe wechselnde Materialzusammenstellung<br />
und eine einfache<br />
charakteristische Gliederung<br />
des ganzen Turmes soll ein zeitgemäßes<br />
und unser Landschaftsbild<br />
prägendes Bauwerk geschaffen<br />
werden, das auf der Volksfestkoppel<br />
lange Zeit ein Wahrzeichen unserer<br />
Stadt sein wird und von dessen Aus<strong>sich</strong>tsgalerie<br />
man einen herrlichen<br />
Blick über unsere seenreiche<br />
Gegend wird genießen können.“<br />
Vom Jugendstil geprägt<br />
Eine ansprechende bauliche Lösung<br />
war notwendig, denn Plön erhielt<br />
Ende des 19. Jahrhunderts wegen<br />
seiner landschaftlich attraktiven<br />
Lage zunehmend Bedeutung als<br />
Erholungsort. Es gab zahlreiche<br />
Aus flugslokale, eine Badeanstalt<br />
und Aus<strong>sich</strong>tstürme. Der Kontrast<br />
zwischen dem Turmschaft aus Zie-<br />
Juni 2011<br />
574 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Trinkwasserbehälter<br />
FOKUS<br />
Das gemütliche,<br />
runde<br />
<strong>Wo</strong>hnzimmer<br />
im <strong>Wasser</strong>behälter<br />
© Jens U. Schmidt<br />
Küche mit<br />
Fernblick<br />
© Jens U. Schmidt<br />
gelmauerwerk und dem schieferverblendeten<br />
Turmkopf ist einmalig.<br />
Insgesamt ist der Turm 42,45 m<br />
hoch. Im gut 11 m hohen Turmkopf<br />
finden wir den Intze–Behälter, er -<br />
kennbar am eingewölbten Boden.<br />
Er ist aus Stahlplatten genietet und<br />
heute noch im Turm erhalten. Früher<br />
führte eine Leiter durch einen<br />
Innenzylinder. Heute sind Teile des<br />
Bodens und der Wände entfernt, um<br />
einen Durchlass für die Wendeltreppe<br />
und die Fenster zu schaffen.<br />
Ein großes Ereignis, über das die<br />
Plöner <strong>Wo</strong>chenzeitung ausführlich<br />
berichtete, war die Funktionsprüfung<br />
in Anwesenheit des Bürgermeisters<br />
und der Baukommission<br />
am 1. November 1913. Zunächst<br />
verfolgten die Herren im Maschinenhaus,<br />
wie die Elektromotoren<br />
angelassen wurden und die Pumpen<br />
in Betrieb gingen. Dann bestiegen<br />
sie gemeinsam den <strong>Wasser</strong>turm<br />
und verfolgten den Anstieg des<br />
<strong>Wasser</strong>spiegels. Die zur vollständigen<br />
Füllung benötigten sechs<br />
Stunden harrten sie dort allerdings<br />
nicht aus. Der Behälter blieb fünf<br />
Tage gefüllt, um seine Dichtigkeit zu<br />
prüfen.<br />
Am 17. Dezember 1913 ging das<br />
<strong>Wasser</strong>werk dann mit einem Festakt<br />
in Betrieb. Die Feuerwehr nahm<br />
zwei Hydranten in Gebrauch und<br />
demonstrierte den <strong>Wasser</strong>druck.<br />
Die <strong>Wasser</strong>strahlen reichten bis zur<br />
Hälfte des Kirchturms, also 35 m<br />
hoch. Die Baukosten beliefen <strong>sich</strong><br />
auf 165 000 Mark.<br />
Bis 1974 war der <strong>Wasser</strong>turm in<br />
Betrieb, dann ersetzten ihn ein<br />
neuer Erdbehälter und moderne<br />
Pumpen. Die Schleswag, seit 1972<br />
verantwortlich für die <strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
stellte 1976 einen Abbruchantrag<br />
für den nicht mehr benötigten<br />
Turm. Dagegen aber wehrte <strong>sich</strong><br />
die Bevölkerung heftig und erhielt<br />
Unterstützung vom Landesdenkmalamt.<br />
Dr. Hans Utermöhl bescheinigte<br />
dem Bauwerk, dass es in die<br />
Reihe der eindrucksvollen technischen<br />
Kulturdenkmale einzureihen<br />
sei, die zum Stadtbild gehören und<br />
damit untrennbar verbunden sind.<br />
In seinem Gutachten bezeichnet er<br />
vor allem die elegante wie technisch<br />
saubere Holzkonstruktion der<br />
Turmhaube als kleines Kunstwerk.<br />
„Abschließend der Hauptgrund“,<br />
schreibt Utermöhl, „der m. E. gebieterisch<br />
die Erhaltung des Turmes in<br />
Bauzeichnung des Jugendstil-Baus von 1912.<br />
© Archiv Eisenack<br />
seiner jetzigen Gestalt fordert: Er<br />
wäre dann das erste bewusst vor<br />
seiner Zerstörung bewahrte technische<br />
Baudenkmal in Schleswig-<br />
Holstein überhaupt und damit eine<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 575
FOKUS<br />
Trinkwasserbehälter<br />
Stadt Plön und<br />
Schloss vom<br />
<strong>Wasser</strong>turm<br />
aus gesehen.<br />
© Jens U. Schmidt<br />
Jens U. Schmidt<br />
Der Autor, Dr. Jens U. Schmidt,<br />
hat bereits mehrere Bücher über<br />
<strong>Wasser</strong>türme veröffentlicht<br />
(www.wassertuerme.com), darunter<br />
ein Buch „<strong>Wasser</strong>türme<br />
in Schleswig-Holstein“ (ISBN<br />
978-3-939656-71-5)<br />
Der Turm kann gemietet werden<br />
unter http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/18489/<br />
neue Sehenswürdigkeit Plöns, worauf<br />
in ihren Prospekten hinzuweisen<br />
wäre.“<br />
Ein hohes Geschenk<br />
Dieser Appell hatte Wirkung, und so<br />
wurde der <strong>Wasser</strong>turm am 25. März<br />
1977 in das Denkmalbuch eingetragen.<br />
Damit durfte die Schleswag<br />
den Turm nicht abreißen und<br />
musste ihn sogar noch sanieren. Im<br />
Juli 1983 wollte sie den Turm endgültig<br />
loswerden und bot ihn als<br />
Geschenk demjenigen an, der zu -<br />
erst mit einem notariell vorbereiteten<br />
Vertrag in der Geschäftsstelle in<br />
Rendsburg erscheint. Der Journalist<br />
Eckard F. Eisenack hörte im Radio<br />
von dem Angebot, holte seine Frau<br />
von der Arbeit ab, fuhr an dem Bauwerk<br />
vorbei und fragte sie: „Willst<br />
Du den haben?“ Ihre ungläubige<br />
Antwort „Du bist <strong>wohl</strong> verrückt“ be -<br />
siegelte den Entschluss. Am nächsten<br />
Tag stand er um 11 Uhr mit dem<br />
Vertragsentwurf vor der Tür der<br />
Schleswag. Er war nur 15 Minuten<br />
schneller als die Mitglieder einer<br />
alternativen Kommune.<br />
Für den Umbau des Turms in<br />
eine <strong>Wo</strong>hnung „am Stiel mit Stil“,<br />
wie Eisenack sie nennt, bedurfte es<br />
der Phantasie des Plöner Architekten<br />
Bertram Steingräber. Da der<br />
Innendurchmesser des <strong>Wasser</strong>behälters<br />
nur knapp sieben Meter<br />
beträgt, der Durchmesser der<br />
Räume im Schaft sogar noch kleiner<br />
ist, liegen die Räume übereinander.<br />
57 Stufen verbinden die Eingangsetage<br />
mit Badezimmer und das<br />
Arbeitszimmer vier Etagen darüber.<br />
Dazwischen liegen das Schlafzimmer<br />
mit Duschbad, die Küche auf<br />
dem ehemaligen Tropfboden und<br />
das <strong>Wo</strong>hnzimmer im Behälterinneren.<br />
15 Jahre lang lebte Eisenack in<br />
seiner luftigen <strong>Wo</strong>hnung, dann zog<br />
es ihn nach Spanien, wo er heute<br />
den größten Teil des Jahres lebt.<br />
Seinen Turm vermietet er als Ferienwohnung.<br />
So können viele Menschen<br />
ausprobieren, wie es <strong>sich</strong> in<br />
einem <strong>Wasser</strong>turm lebt.<br />
Schließlich gibt es inzwischen<br />
zahlreiche dieser Bauwerke, die zu<br />
<strong>Wo</strong>hnungen umgebaut sind und<br />
viele, die auf so eine Nutzung hoffen.<br />
Dazu viele Menschen und Firmen,<br />
die einen Turm kaufen wollen.<br />
Über die umgenutzten Türme kann<br />
man meist nur lesen. Sicher ist der<br />
<strong>Wasser</strong>turm in Hamburg-Lokstedt<br />
eine der elegantesten Lösungen.<br />
Den einmaligen Blick auf die Stadtsilhouette<br />
Hamburgs mit Türmen<br />
und Hafenkränen genießen allerdings<br />
nur der ehemalige Zahnarzt<br />
und seine Frau, die den Turm einst<br />
umbauen ließen. Im Bad Segeberger<br />
<strong>Wasser</strong>turm finden wir eine<br />
<strong>Wo</strong>hnung, die den ganzen Turm<br />
einnimmt: über sieben Etagen, allerdings<br />
verbunden mit einem Fahrstuhl.<br />
Den Hamburg-Bergedorfer<br />
<strong>Wasser</strong>turm baute ein Hamburger<br />
Kaufmann zu einer <strong>Wo</strong>hnung um.<br />
Auf einen Fahrstuhl verzichtete er<br />
jedoch, so dass der Weg von der<br />
Küche im Erdgeschoss bis zum<br />
<strong>Wo</strong>hnzimmer im Turmkopf schon<br />
viel Puste erfordert.<br />
Kontakt:<br />
Archiv deutscher <strong>Wasser</strong>türme<br />
Dr. Jens U. Schmidt<br />
Abendrotweg 12<br />
12307 Berlin<br />
kontakt@wassertuerme.com<br />
www.wassertuerme.com<br />
Juni 2011<br />
576 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Empfohlen vom<br />
Fachmagazin<br />
Einsatz von Pulveraktivkohle<br />
zur weitergehenden Reinigung<br />
von kommunalem <strong>Abwasser</strong><br />
Verfahrenstechnische, betriebliche und ökonomische<br />
Aspekte bei der Entfernung von Spurenstoffen<br />
Dieses Fachbuch zur <strong>Abwasser</strong>behandlung berichtet ausführlich über<br />
Untersuchungen, wie mit Pulveraktivkohle organische Restverschmutzung<br />
im Ablauf kommunaler Kläranlagen verringert werden kann.<br />
Verschiedene Verfahrensvarianten der Pulveraktivkohleanwendung werden<br />
bezüglich ihrer Reinigungsleistung sowie betriebsrelevanter und ökonomischer<br />
Aspekte verglichen und Dimensionierungskriterien für die technische Umsetzung<br />
erarbeitet. Ingenieure der Siedlungswasserwirtschaft und Studenten erfahren im<br />
Hinblick auf die technische Umsetzung, welche Ausgabegröße einer adsorptiven<br />
Reinigungsstufe zu wählen ist, um einen ökonomisch und ökologisch sinnvollen<br />
Beitrag zur Verringerung des Frachteintrags von Mikroschadstoffen in Gewässer<br />
zu leisten.<br />
S. Metzger<br />
1. Aufl age 2010, 208 Seiten, Hardcover<br />
Oldenbourg-Industrieverlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Sofortanforderung per Fax: +49 (0) 201 / 820 02 - 34 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 <strong>Wo</strong>chen zur An<strong>sich</strong>t<br />
___ Ex. Einsatz von Pulveraktivkohle zur weitergehenden Reinigung<br />
von kommunalem <strong>Abwasser</strong><br />
1. Aufl age 2010 – ISBN: 978-3-8356-3231-8 für € 59,- (zzgl. Versand)<br />
Die bequeme und <strong>sich</strong>ere Bezahlung per Bankabbuchung wird<br />
mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei <strong>Wo</strong>chen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder<br />
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die<br />
Datum, Unterschrift<br />
PAEPRA2010<br />
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
„Private <strong>Abwasser</strong>leitungen gehören<br />
in die öffentliche Hand“<br />
Prof. Günthert:<br />
„Das ganze<br />
Netz bis ans<br />
Haus gehört in<br />
die öffentliche<br />
Hand!“<br />
Nach An<strong>sich</strong>t von Professor <strong>Wo</strong>lfgang<br />
Günthert gehören auch<br />
die privaten <strong>Abwasser</strong>leitungen in<br />
die öffentliche Hand. In der April-<br />
Ausgabe des „infodienst Grundstück<br />
und <strong>Wasser</strong>“ bezeichnet es Günthert<br />
in einem Interview als seine<br />
Zukunftsvision, dass das gesamte<br />
Kanalnetz bis ans Haus in die Hoheit<br />
der Netzbetreiber kommt. Günthert:<br />
„Ich glaube, dann hätten wir<br />
viel, viel weniger Probleme.“<br />
Prof. Günthert spricht <strong>sich</strong> zwar<br />
für dichte private <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
aus, befürchtet aber massive<br />
Bürger-Widerstände wegen der er -<br />
heblichen Sanierungskosten. Grundstücksanlagen<br />
seien daher eine<br />
„Zeitbombe“, die es zu entschärfen<br />
gilt. Er verrät in dem Interview, was<br />
Landes- und Kommunalpolitiker tun<br />
müssen, damit es nicht zum Bürgeraufstand<br />
kommt.<br />
Prof. Dr.-Ing. <strong>Wo</strong>lfgang Günthert<br />
lehrt Siedlungswasserwirtschaft an<br />
der Universität der Bundeswehr<br />
München und ist langjähriger<br />
Vorsitzender des Landesverbandes<br />
Bayern der Deutschen Vereinigung<br />
für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
Der „infodienst Grundstück und<br />
<strong>Wasser</strong>“ ist ein Branchendienst des<br />
Kommunalen Netzwerks Grundstücksentwässerung<br />
– KomNetGEW<br />
und erscheint monatlich.<br />
Den vollständigen <strong>Wo</strong>rtlaut des Interviews<br />
gibt es unter:<br />
www.ikt.de/interview/guenthert.pdf<br />
Neue Runde im Prozessbenchmarking <strong>Wasser</strong>werke<br />
Für September ist der Auftakt zu<br />
einer neuen Vergleichssrunde im<br />
Prozessbenchmarking <strong>Wasser</strong>werke<br />
geplant. Das vom IWW Zentrum<br />
<strong>Wasser</strong> (Mülheim) in Zusammenarbeit<br />
mit der aquabench GmbH<br />
(Köln) durchgeführte Projekt geht<br />
mittlerweile in sein viertes Erhebungsjahr.<br />
Grundlage für die Datenerhebung<br />
ist diesmal das Ge -<br />
schäftsjahr 2010.<br />
Aufbauend auf dem deutschlandweit<br />
anerkannten IWA-Kennzahlensystem<br />
werden im Prozessbenchmarking<br />
<strong>Wasser</strong>werke die<br />
technischen Aufgabengebiete <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
und -aufbereitung innerhalb einzelner<br />
<strong>Wasser</strong>werke analysiert und er -<br />
gänzt um die auf dem <strong>Wasser</strong>werksgelände<br />
befindlichen Reinwasserbehälter<br />
und Netzpumpen.<br />
Das zum Einsatz kommende<br />
Kennzahlensystem erlaubt eine de -<br />
taillierte Leistungsbewertung, be -<br />
zo gen auf die Kriterien Wirtschaftlichkeit,<br />
Qualität, Sicherheit und<br />
Nachhaltigkeit auf der Prozessebene.<br />
Unterschiedliche <strong>Wasser</strong>werke<br />
und Rahmenbedingungen<br />
werden im Projekt angemessen differenziert,<br />
indem naturräumliche<br />
Prägungen, Rohwasserarten und<br />
-qualitäten, der Aufbau und die<br />
Konzeption von Anlagen sowie die<br />
historische Entwicklung des Aufbereitungssystems<br />
in der Kennzahlenanalyse<br />
transparent gemacht<br />
und mit berück<strong>sich</strong>tigt werden.<br />
Neben einer Standortbestimmung<br />
der eingebrachten <strong>Wasser</strong>werke<br />
im Vergleich zu <strong>Wasser</strong>werken<br />
mit ähnlichen Aufgabenstellungen<br />
und dem Erkennen von<br />
Optimierungspotenzialen wird im<br />
Rahmen moderierter <strong>Wo</strong>rkshops ein<br />
Erfahrungsaustausch mit <strong>Wasser</strong>fachleuten<br />
durchgeführt. Dieses<br />
Netzwerkelement hat von Jahr zu<br />
Jahr mehr Gewicht bekommen und<br />
bietet den operativ Verantwortlichen<br />
eine Plattform zum detaillierten<br />
Austausch von Betriebserfahrungen.<br />
Die Teilnehmer erhalten als<br />
Er gebnis eine detaillierte technischbe<br />
triebswirtschaftliche Analyse ihrer<br />
<strong>Wasser</strong>werke, die neben dem fachlichen<br />
Austausch die Grundlage zur<br />
Optimierung der Prozesse und technischen<br />
Anlagen liefert. Die Prozessuntersuchungen<br />
sind zudem eine<br />
ideale Ergänzung zum Unternehmensbenchmarking<br />
(etwa bei Landesprojekten),<br />
bei denen der Blick<br />
auf das Gesamtunternehmen und<br />
nicht auf einzelne Prozesse in <strong>Wasser</strong>werken<br />
gerichtet ist.<br />
Die Projektlaufzeit beträgt neun<br />
Monate und endet mit der Versendung<br />
der individuellen Abschlussdokumentationen<br />
im Frühjahr 2012.<br />
Ansprechpartner:<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein /<br />
Dipl.-Kfm. Peter Lévai,<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für <strong>Wasser</strong> Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft<br />
mbH,<br />
Bereich Managementberatung,<br />
Moritzstraße 26,<br />
D-45476 Mülheim an der Ruhr,<br />
Tel. (0203) 40303-340 und -435,<br />
Fax (0203) 40303-82,<br />
E-Mail: a.hein@iww-online.de;<br />
p.levai@iww-online.de<br />
Juni 2011<br />
578 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Mehr Verbraucherschutz durch<br />
Änderung der Trinkwasserverordnung<br />
Das Bundesministerium für<br />
Gesundheit hat im Mai 2011 die<br />
Erste Verordnung zur Änderung der<br />
Trinkwasserverordnung verkündet.<br />
Die Trinkwasserverordnung aus dem<br />
Jahr 2001 musste in einigen Punkten<br />
an neuere Entwicklungen angepasst<br />
werden. Die geänderte Trinkwasserverordnung<br />
tritt am 1. No vember<br />
2011 in Kraft.<br />
Neben Klarstellungen und der<br />
Berück<strong>sich</strong>tigung der neuesten wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse ging es<br />
auch um Anpassung an europarechtliche<br />
Vorgaben sowie um Entbürokratisierung.<br />
Die Wahrung des hohen<br />
Qualitätsstandards des Trinkwassers<br />
in Deutschland ist und bleibt oberstes<br />
Ziel.<br />
Erstmalig wird innerhalb der Europäischen<br />
Union in einem Mitgliedstaat<br />
ein Grenzwert für Uran im Trinkwasser<br />
festgelegt. Mit 0,010 Milligramm<br />
(= 10 Mikrogramm) pro Liter<br />
ist der Uran-Grenzwert in Deutschland<br />
der weltweit schärfste und bietet<br />
allen Bevölkerungsgruppen – Säuglinge<br />
eingeschlossen – gesundheitliche<br />
Sicherheit vor möglichen Schädigungen<br />
durch Uran im Trinkwasser.<br />
Für den Grenzwert ist die chemische<br />
Toxizität von Uran maßgebend. Mit<br />
der Verordnung wird auch der Grenzwert<br />
für das Schwermetall Cadmium<br />
von 0,005 auf 0,003 Milligramm (= 3<br />
Mikrogramm) pro Liter Trinkwasser<br />
gesenkt.<br />
Ab Dezember 2013 gilt der schon<br />
seit 2001 vorgesehene verschärfte<br />
Blei-Grenzwert von 0,010 Milligramm<br />
(= 10 Mikrogramm) pro Liter Trinkwasser.<br />
Die Verordnung verpflichtet zeitgleich<br />
die Anlageninhaber die Verbraucherinnen<br />
und Verbraucher über<br />
das Vorhandensein von Blei als Werkstoff<br />
in der Trinkwasserverteilung zu<br />
informieren. Dies können Hausanschlussleitungen<br />
des <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmens<br />
aus Blei sein wie<br />
auch Trinkwasser-Installationen in<br />
Gebäuden, die insbesondere bei Altbauten<br />
Teile aus Blei enthalten können.<br />
Es gibt für den Parameter Legionellen<br />
umfassende neue Regelungen, die<br />
einen technischen Maßnahmenwert<br />
(100 Legionellen pro 100 Milliliter<br />
Trinkwasser) einführen und im<br />
Bedarfsfall eine Ortsbe<strong>sich</strong>tigung der<br />
betroffenen Trinkwasser-Installation<br />
und eine Gefährdungsanalyse vorschreiben.<br />
Damit wird den gesundheitlichen<br />
Gefahren, die mit Legionelleninfektionen<br />
verbunden sein können,<br />
Rechnung getragen.<br />
Für die Trinkwasser-Installation in<br />
Gebäuden fordern die neuen Vorschriften<br />
explizit den Einsatz von<br />
geeigneten Sicherungseinrichtungen<br />
beim Anschluss von Apparaten an die<br />
Trinkwasser-Installation (z. B. Zahnarztpraxen,<br />
Lebensmittelbetriebe)<br />
oder bei der Verbindung mit Nicht-<br />
Trinkwasser-Anlagen (z. B. <strong>Wasser</strong>-<br />
Nachspeisung von Heizungsanlagen).<br />
Bei Nichtbeachtung droht hier<br />
ein Bußgeld. Werden durch die Nichtbeachtung<br />
Krankheitserreger im<br />
Sinne des Infektionsschutzgesetzes<br />
verbreitet, kann dies sogar strafrechtlich<br />
verfolgt werden.<br />
Die geänderte Verordnung erhöht<br />
die Flexibilität der Gesundheitsämter<br />
bei der Überwachung des Trinkwassers<br />
aus Eigenversorgungsanlagen<br />
(sog. privaten „Hausbrunnen“). Dies<br />
gilt insbesondere für nicht gesundheitsrelevante<br />
Abweichungen von<br />
den Anforderungen. Für die Betreiber<br />
aller <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen wurden<br />
die Anzeigepflichten erheblich<br />
reduziert, was auch zu Entlastungen<br />
bei den zuständigen Gesundheitsämtern<br />
führen wird.<br />
Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung<br />
unter:<br />
www.bundesgesundheitsministerium.de<br />
Trinkwasserbehälter<br />
aus GFK<br />
Variable Durchmesser bis DN 3000<br />
Mit oder ohne integrierter Bedienund<br />
Schieberkammer<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
· 04720 Mochau<br />
· <br />
<br />
A Member of the<br />
Group<br />
Weitere Informationen unter www.amiantit.com<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 579
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong><br />
gewinnt zwei neue Gesellschafter<br />
Die Gesellschafterversammlung<br />
der IWW Rheinisch-Westfälisches<br />
Institut für <strong>Wasser</strong>forschung<br />
gGmbH hat zwei neue Gesellschafter<br />
aufgenommen: Stadtwerke EVB<br />
Huntetal GmbH (Diepholz) und<br />
WAG <strong>Wasser</strong>gewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft<br />
Nordeifel<br />
mbH (Roetgen). Zuvor hatten die<br />
Auf<strong>sich</strong>tsräte der beiden Unternehmen<br />
der Beteiligung zugestimmt.<br />
In seinem Jubiläumsjahr konnte da -<br />
mit das IWW zum 25-jährigen Bestehen<br />
seinen Gesellschafterkreis auf<br />
20 Unternehmen erweitern.<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> hat neben<br />
seinem Hauptstandort in Mülheim<br />
an der Ruhr zwei Regionalstandorte<br />
IWW-Nord (Diepholz, Niedersachsen)<br />
und IWW Rhein-Main (Biebesheim<br />
am Rhein, Hessen). IWW ist<br />
auch mit den ansässigen Hochschulen<br />
eng verbunden: An-Institut der<br />
Universität Duisburg-Essen und<br />
enge Koopera tionen mit der TU<br />
Dortmund und der TU Darmstadt.<br />
Mit beiden Unternehmen verbindet<br />
IWW eine langjährige Zu -<br />
sammenarbeit. Gemeinsam mit der<br />
WAG Nordeifel, der <strong>Wasser</strong>produktionstochter<br />
der STAWAG Aachen,<br />
und der enwor Herzogenrath, leistete<br />
IWW Pionierarbeit bei der<br />
Einführung der Membrantechnik<br />
in die Trinkwasseraufbereitung.<br />
Ge schäfts führer Walter Dautzenberg<br />
betont die fortdauernde technische<br />
Unterstützung nach dem<br />
Bau der größten Membrananlage in<br />
Deutsch land: „Mit unserem Beitritt<br />
möchten wir das Konzept eines<br />
unabhängigen Kompetenzzentrums<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung stärken. Wir<br />
haben bei der Entwicklung und<br />
fortlaufenden Optimierung unserer<br />
Aufbereitung sehr davon profitiert.“<br />
Gemeinsam mit den Stadtwerken<br />
Huntetal hatte IWW Zentrum<br />
<strong>Wasser</strong> bereits im Jahr 2004 die<br />
Laborgesellschaft IWW-Nord GmbH<br />
mit Sitz in Diepholz gegründet. Die<br />
langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
wollten die Stadtwerke<br />
jetzt auch mit ihrem weitergehenden<br />
Einstieg bei IWW vertiefen. Für<br />
den Geschäftsführer Waldemar<br />
Opalla bieten <strong>sich</strong> aus der Beteiligung<br />
neue Chancen für die Stadtwerke:<br />
„Wir sehen ein hohes Potenzial<br />
darin, die Kontakte und Synergien<br />
innerhalb des Kompetenznetzwerks<br />
von IWW zu nutzen“.<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> hat in den<br />
letzten fünf Jahren einen deutlichen<br />
Entwicklungsschub erlebt – die<br />
Umsätze der Forschung- und Beratungsleistungen<br />
konnten mit jetzt<br />
7 Mio. EUR jährlich mehr als verdoppelt<br />
werden. Die Erweiterung der<br />
Kompetenzfelder Managementberatung<br />
und <strong>Wasser</strong>netze neben<br />
den klassischen Institutsthemen<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcen, Technologie,<br />
Analytik und Hygiene haben zahlreiche<br />
neue Kunden im In- und Ausland<br />
ge bracht. Aus diesem Grund<br />
sind in den letzten Jahren mehrere<br />
neue Gesellschafter bei IWW eingetreten.<br />
Wie Dr. <strong>Wo</strong>lf Merkel, technischer<br />
Geschäftsführer des IWW ausführt:<br />
„Mit seinen Standorten in den<br />
drei Bundesländern NRW, Niedersachsen<br />
und Hessen ist die Nähe<br />
von IWW überzeugend – unsere<br />
regionalen Kenntnisse und schnellen<br />
Reaktionszeiten werden zunehmend<br />
geschätzt.“<br />
Landgericht Bonn verneint Gleichwertigkeit<br />
der Angebote<br />
Güte<strong>sich</strong>erung Kanalbau und Fremdüberwachung Kanalbau der Zertifizierung Bau e. V.<br />
Öffentliche Auftraggeber und<br />
Auftragnehmer haben mit der<br />
Güte<strong>sich</strong>erung Kanalbau differenzierte<br />
Anforderungen an die Qualifikation<br />
ausführender Unternehmen<br />
formuliert. Diese gemeinsam<br />
definierten Anforderungen haben<br />
Auftraggeber zur Grundlage ihrer<br />
Vergabe gemacht.<br />
Auftraggeber legen Wert auf<br />
Neutralität bei der Prüfung, ob<br />
Unternehmen diese Anforderungen<br />
erfüllen. Die Bewertung der Bietereignung<br />
stellt allerhöchste Ansprüche<br />
an die Unparteilichkeit der<br />
Organisation, die mit dieser Bewertung<br />
befasst ist. Daher sind so<strong>wohl</strong><br />
Auftraggeber als auch Auftragnehmer<br />
Mitglied in der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau. Es besteht damit<br />
ein grundlegender struktureller<br />
Unterschied zwischen der Güte<strong>sich</strong>erung<br />
RAL-GZ 961 und anderen<br />
Zertifizierungen in diesem Bereich.<br />
Die Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
hat Auftraggeber schriftlich über<br />
diese Unterschiede der Güte<strong>sich</strong>erung<br />
Kanalbau zur „Fremdüberwachung<br />
im Kanalbau“ der Zertifizierung<br />
Bau e. V. informiert. Die Zertifizierung<br />
Bau e. V. hatte daraufhin<br />
versucht, weite Teile dieses Schreibens<br />
gerichtlich untersagen zu lassen.<br />
Das Landgericht Bonn hat in<br />
der Verhandlung am 30. März 2011<br />
klargestellt, dass diese Klage zum<br />
Juni 2011<br />
580 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
weit überwiegenden Teil unbegründet ist und die Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau weiter darauf hinweisen darf,<br />
dass das Angebot der Zertifizierung Bau e. V. nicht<br />
gleichwertig der Güte<strong>sich</strong>erung RAL-GZ 961 ist.<br />
Nach An<strong>sich</strong>t des Gerichts konnte <strong>sich</strong> die Prüfung<br />
der Gleichwertigkeit von „Güte<strong>sich</strong>erung Kanalbau“ und<br />
„Fremdüberwachung im Kanalbau“ der Zertifizierung<br />
Bau e. V. darauf beschränken, ob die „Fremdüberwachung<br />
im Kanalbau“ in formaler Hin<strong>sich</strong>t den von RAL-<br />
GZ 961 vorgegebenen Strukturmerkmalen entspricht.<br />
Das Landgericht Bonn hat insoweit die Gleichwertigkeit<br />
der beiden Angebote verneint. Nach der Verhandlung ist<br />
die Gütegemeinschaft Kanalbau weiterhin nicht gehindert,<br />
wie folgt zu informieren: Das Angebot „Fremdüberwachung<br />
Kanalbau“ des Zertifizierung Bau e. V. ist nicht<br />
gleichwertig mit der Güte<strong>sich</strong>erung Kanalbau. Es erfüllt<br />
nicht die Anforderungen der Güte<strong>sich</strong>erung RAL-GZ 961.<br />
Dem ist so, weil das, was Auftraggeber wollen und<br />
mit Ihren Anforderungen an die Eignung und technische<br />
Leistungsfähigkeit voraussetzen, nicht erfüllt ist:<br />
Güte- und Prüfbestimmungen, beschlossen mit paritätischen<br />
Stimmen von Auftraggebern und Auftragnehmern,<br />
vom RAL anerkannter Güteausschuss. Dieser ist<br />
besetzt mit Vertretern der Auftraggeber und Auftragnehmer,<br />
vom Güteausschuss beauftragte Prüfingenieure.<br />
Dieses <strong>sich</strong>ert die einheitliche Qualität der Prüfungen,<br />
Vorlage aller Prüfberichte im Güteausschuss, mit<br />
transparenter und jederzeit nachvollziehbarer<br />
Beschlussfassung.<br />
Ebenfalls kann die Gütegemeinschaft Kanalbau weiter<br />
darauf hinweisen, dass es <strong>sich</strong> bei der von der Zertifizierung<br />
Bau e. V. angebotenen „Fremdüberwachung im<br />
Kanalbau“ um eine Prüfung und Überwachung von Lieferanten<br />
(Auftragnehmern) durch eine Organisation der<br />
Lieferanten (Auftragnehmer) handelt.<br />
In dem auf Vorschlag des Ge richts geschlossenen<br />
Vergleich hat <strong>sich</strong> der Güteschutz Kanalbau lediglich<br />
verpflichtet, die fehlende Gleichwertigkeit beider Systeme<br />
künftig nicht mit Hinweis auf DIN EN 1610, Nr. 15<br />
und Anhang C zu begründen. Das Gericht war der Auffassung,<br />
dass hierin keine zwingenden Anforderungen<br />
an Systeme zur Eignungsprüfung formuliert sind.<br />
<br />
<br />
Die Fachzeitschrift für<br />
Gasversorgung und<br />
Gaswirtschaft<br />
Jedes zweite Heft mit<br />
Sonderteil R+S<br />
Recht und Steuern im<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
Vom Fach fürs Fach<br />
Sichern Sie <strong>sich</strong> regelmäßig diese führende<br />
Publi kation. Lassen Sie <strong>sich</strong> Antworten geben auf<br />
alle Fragen zur Gewinnung, Erzeugung, Verteilung<br />
und Verwendung von Gas und Erdgas.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
<br />
<br />
2Hefte<br />
gratis<br />
zum<br />
Kennenlernen!<br />
✁<br />
<strong>gwf</strong> Gas/Erdgas erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Str. 145, 81671 München, GF: Hans-Joachim Jauch<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0)931 / 4170-492<br />
<br />
Ja, senden Sie mir die nächsten beiden Ausgaben des Fachmagazins <strong>gwf</strong> Gas/<br />
Erdgas gratis zu. Nur wenn ich überzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen<br />
nach Erhalt des zweiten Hefts schriftlich absage, bekomme ich <strong>gwf</strong> Gas/Erdgas<br />
für zunächst ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von € 165,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 15,- / Ausland: € 17,50) pro Halbjahr. Vorzugspreis für Schüler<br />
und Studenten (gegen Nachweis) € 82,50 zzgl. Versand pro Halbjahr.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.zert-bau.de<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
PAGWFW0111<br />
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei <strong>Wo</strong>chen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>gwf</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene<br />
Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag<br />
oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
VDMA: Deutsche <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik –<br />
Getragen von der Welle des Aufschwungs<br />
Die Hersteller und Lieferanten<br />
von Anlagen und Systemen zur<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung, <strong>Abwasser</strong>- und<br />
Schlammbehandlung berichten<br />
von einem erfolgreich verlaufenden<br />
Geschäftsjahr 2010. Die Unternehmen<br />
konnten, im Vergleich zum Vorjahr,<br />
ihre Exporte von Apparaten<br />
zum Filtrieren und Reinigen von<br />
<strong>Wasser</strong> von 602 Mio. Euro um mehr<br />
als 10 Prozent auf rund 664 Mio.<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
Deutsche Produktion Komponenten und Systeme zur<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung und <strong>Abwasser</strong>behandlung, 2009-2010 in<br />
Mio. Euro<br />
App. z Filtrieren od. Reinigen<br />
v <strong>Abwasser</strong> nicht chemisch<br />
App. z Filtrieren od. Reinigen<br />
v <strong>Abwasser</strong> auf chemischem<br />
Wege<br />
App. z Filtrieren od Reinigen v<br />
Trink- u Brauchwasser nicht<br />
chemisch<br />
App z Filtrieren od Reinigen v<br />
Trink- u Brauchwasser auf<br />
chemischem Wege<br />
Daten, Fakten zur <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
78,00<br />
73,00<br />
89,00<br />
85,00<br />
Euro steigern. Weltweit stärkste<br />
Exportmärkte waren Russland mit<br />
57 Mio. Euro vor China mit 55 Mio.<br />
Euro. In den EU-27 Staaten stieg der<br />
Export von 250 Mio. Euro in 2009<br />
um 12 Prozent auf rund 280 Mio.<br />
Euro in 2010. Stärkste Märkte in dieser<br />
Region waren Frankreich mit 37<br />
Mio. Euro, gefolgt von Spanien mit<br />
31 Mio. Euro.<br />
308,00<br />
325,00<br />
366,00<br />
363,00<br />
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00<br />
Umsätze Komponenten und Systeme zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung, 2005-2010 in Mio. Euro<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
950<br />
564<br />
1050<br />
604<br />
Daten, Fakten zur <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
1200<br />
560<br />
1300<br />
660<br />
2010<br />
2009<br />
Quelle: VDMA, Stat. Bundesamt, nationale Stat. Ämter<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Gesam tum satz Auslandsumsatz<br />
1350<br />
602<br />
1450<br />
664<br />
Quelle: VDMA, Stat. Bundesamt, nationale Stat. Ämter<br />
Produktion stabil –<br />
Umsatz legt zu<br />
Mit einem Volumen von 837 Mio.<br />
Euro (Produkte die in der amtlichen<br />
Statistik unter der Gütergruppe<br />
282912 erfasst sind, ohne Armaturen,<br />
Pumpen, MSR-Technik) konnte<br />
die Produktion von Komponenten<br />
und Systemen zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung in<br />
2010 nahezu an das Vorjahresergebnis<br />
von 850 Mio. Euro anknüpfen.<br />
Der Branchenumsatz, getragen<br />
vom Anlagenbau, legte im selben<br />
Zeitraum um mehr als 7 Prozent auf<br />
1,450 Mrd. Euro zu.<br />
„Die Geschäftserwartungen in<br />
diesem Jahr werden von der Mehrheit<br />
der VDMA-Unternehmen der<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik positiv<br />
eingeschätzt. Aufgrund der weltweit<br />
verschärften Situation bei der<br />
<strong>Wasser</strong>ver- und <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
werden <strong>sich</strong> den deutschen<br />
Unternehmen neue Absatzmärkte<br />
erschließen,“ so Richard Clemens,<br />
Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands<br />
Verfahrenstechnische Maschinen<br />
und Apparate. „Die deutschen<br />
Exporte der <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
legten in den ersten beiden<br />
Monaten 2011 bereits um mehr als<br />
10 Prozent zu. Die Kapazitäten der<br />
Unternehmen seien im 1. Halbjahr<br />
2011 bereits zu 90 Prozent ausgelastet,“<br />
so Clemens weiter.<br />
Wichtige Abnehmerbranchen<br />
Entsprechend einer aktuellen Um -<br />
frage des VDMA-Fachverbands Verfahrenstechnische<br />
Maschinen und<br />
Apparate im Februar 2011 verteilten<br />
<strong>sich</strong> die Aufträge für die Hersteller<br />
und Lieferanten von <strong>Wasser</strong>aufbereitungs-,<br />
<strong>Abwasser</strong>- und Schlammbehandlungsanlagen<br />
seit 1. Januar<br />
2010 auf die folgenden fünf wichtigsten<br />
Abnehmerbranchen: Öffentliche<br />
und private Ver- und Entsorger mit<br />
Juni 2011<br />
582 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
Die 10 wichtigsten Exportnationen der <strong>Wasser</strong>und<br />
<strong>Abwasser</strong>technik weltweit in Mio. Euro<br />
USA<br />
Deutschland<br />
704,30<br />
669,00<br />
663,50<br />
602,20<br />
China<br />
Italien<br />
171,10<br />
280,90<br />
274,10<br />
314,50<br />
Kanada<br />
Niederlande<br />
Vereinig. Königreich<br />
Frankreich<br />
Japan<br />
Spanien<br />
210,50<br />
185,20<br />
171,00<br />
154,20<br />
166,80<br />
137,60<br />
158,20<br />
189,60<br />
144,60<br />
106,90<br />
133,30<br />
131,00<br />
2010<br />
2009<br />
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00<br />
Basis: Warennummer 842121<br />
Quelle: VDMA, Stat. Bundesamt<br />
Daten, Fakten zur <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
30 Prozent, chemische, petrochemische<br />
und pharmazeutische Industrie mit 14 Prozent,<br />
die Nahrungs- und Genussmitteleinschließlich<br />
Getränkeindustrie mit 12<br />
Prozent, die Zellstoff- und Papierindustrie<br />
mit 7 Prozent sowie die metall be- und verarbeitende<br />
Industrie mit 6 Prozent.<br />
Optimierung der Prozesse<br />
verbessert Wirtschaftlichkeit<br />
Die Investitionen im öffentlichen Bereich<br />
konzentrierten <strong>sich</strong> im vergangenen Jahr<br />
auf die Erneuerung und Nachrüstung<br />
maschinentechnischer Komponenten auf<br />
Kläranlagen und Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung.<br />
Die Aufträge aus der Industrie<br />
resultierten weniger aus dem Bau neuer<br />
Produktionsstätten, sondern im Wesentlichen<br />
aus Investitionen in moderne Technologien<br />
zur Optimierung der Prozesswasserströme.<br />
„Mehr und mehr,“ so der Vorsitzende der<br />
VDMA-Fachabteilung <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik,<br />
Gottlieb Hupfer, „erwarten die<br />
Kunden heute energieeffiziente Anlagen<br />
mit geringem Betriebsmittelverbrauch. Die<br />
Möglichkeit der Wiederverwendung des<br />
aufbereiteten <strong>Wasser</strong>s senkt zudem die<br />
Kosten spürbar und verbessert somit das<br />
Betriebsergebnis,“ so Hupfer weiter.<br />
Kundenanfragen nahmen<br />
deutlich zu<br />
64 Prozent der Unternehmen konnten im<br />
2. Halbjahr 2010 eine Zu nahme der Kundenanfragen<br />
verzeichnen. 64 Prozent der<br />
Unternehmen rechnen im 1. Halbjahr 2011<br />
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit<br />
zunehmenden und 32 Prozent mit unveränderten<br />
Auftragseingängen.<br />
Positive Geschäfts entwicklung<br />
hält an<br />
Im vergangenen Jahr konnten noch 14<br />
Prozent der befragten Unternehmen eine<br />
Steigerung bei den Umsätzen verzeichnen<br />
und 50 Prozent zumindest das Niveau vom<br />
Vorjahr halten. Beim Geschäftsergebnis<br />
legten 32 Prozent der Unternehmen zu<br />
und weitere 36 Prozent der Befragten hielten<br />
ihr Geschäftsergebnis auf dem Niveau<br />
des Vorjahres.<br />
55 Prozent der befragten Unternehmen<br />
rechnen im 1. Halbjahr 2011 im Vergleich<br />
zum 1. Halbjahr 2010 mit Umsatzsteigerungen.<br />
Die weitere Umsetzung europäischer<br />
Vorgaben aus der „EU-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie“<br />
und der im Januar 2011 in<br />
Kraft getretenen „EU-Industrieemissionsrichtlinie“<br />
in den nationalen Gesetzeswerken<br />
der EU-Mitgliedsstaaten werden den<br />
Aufschwung in der <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik,<br />
so<strong>wohl</strong> im kommunalen als auch<br />
im industriellen Bereich, noch zusätzlich<br />
verstärken.<br />
Kontakt:<br />
VDMA, Verfahrenstechnische Maschinen<br />
und Apparate, Hans Birle, Lyoner Straße 18, D-60528<br />
Frankfurt (Main), E-Mail: hans.birle@vdma.org, www.<br />
vdma.org/verfahrenstechnik<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 583
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Phosphor-Recycling macht Fortschritte<br />
Wegweisendes Umweltprojekt in Bayern: technisch-wissenschaftliche Koordination an<br />
KIT-Pilotanlage geht in Betrieb<br />
Phosphor gehört zu den lebenswichtigen Elementen, ist endlich und nicht austauschbar. Die weltweit wirtschaftlich<br />
erschließbaren Reserven reichen noch circa 100 Jahre. Wissenschaftler am KIT haben nun ein Verfahren<br />
zur Rückgewinnung von Phosphor aus <strong>Abwasser</strong> weiterentwickelt, das die Stadt Neuburg in Bayern in<br />
einem Pilotprojekt im Klärwerk einsetzt. Im Mai 2011 ging die Anlage in Betrieb.<br />
In Händen des Kompetenzzentrums<br />
für Materialfeuchte (CMM)<br />
am KIT liegt die technisch-wissenschaftliche<br />
Koordination des Projekts,<br />
das im Frühjahr vergangenen<br />
Jahres startete. Nun geht es in seine<br />
dritte und entscheidende Phase.<br />
Die Labor- und Halbtechnikversuche<br />
waren erfolgreich: „Sie lassen<br />
für den Pilotzeitraum auf der Kläranlage<br />
ebenfalls einen erfolgreichen<br />
Betrieb erwarten“, sagt der Leiter<br />
des CMM, Dr. Rainer Schuhmann.<br />
Entscheidende Phase: Das am KIT weiterentwickelte Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnnung<br />
wird jetzt in einem Pilotprojekt erprobt. © CMM<br />
KIT<br />
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft<br />
des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes Baden-Württemberg.<br />
Es nimmt so<strong>wohl</strong> die Mission einer Universität als auch die<br />
Mission eines nationalen Forschungszentrums in der Helmholtz-<br />
Gemeinschaft wahr. Das KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck<br />
Forschung – Lehre – Innovation.<br />
Ziel des Projektes ist es, Phosphor<br />
teilweise aus <strong>Abwasser</strong> auszusondern<br />
und als wieder verwertbares<br />
Produkt einen Rohphosphat-Ersatzstoff<br />
zu generieren. Dazu haben die<br />
Forscher um Schuhmann das P-RoC-<br />
Verfahren (Phosphorus Recovery<br />
from waste and process water by<br />
Crystallisation) weiterentwickelt.<br />
Damit lässt <strong>sich</strong> in der <strong>Abwasser</strong>phase<br />
gelöstes Phosphat mittels<br />
Kristallisation an Calcium-Silicat-<br />
Hydrat-Phasen (CSH) als phosphathaltiges<br />
Produkt zurückgewinnen.<br />
Dieses einfache und effektive Prinzip,<br />
so erklärt Schuhmann, „liefert ein<br />
pflanzenverfügbares Produkt, das<br />
zum Beispiel ohne weitere Aufbereitung<br />
als Düngemittel einsetzbar ist.“<br />
Kooperationspartner im Projekt sind<br />
auch die Firma Cirkel GmbH & Co. KG<br />
aus Rheine und die Heidelberg-<br />
Cement AG.<br />
Läuft alles nach Plan, wird die<br />
Pilotphase in Neuburg in etwa in<br />
einem halben Jahr abgeschlossen<br />
sein. Danach erfolgt eine Evaluierung,<br />
die insbesondere auch Aufschluss<br />
geben soll über die Effizienz<br />
und die Wirtschaftlichkeit des<br />
P-RoC-Verfahrens. „Dann wird man<br />
wissen, ob 20, 30 oder noch mehr<br />
Prozent der jährlich anfallenden<br />
circa 30 Tonnen Phosphor aus dem<br />
Neuburger <strong>Abwasser</strong> zurückgewonnen<br />
werden können“, sagt Rainer<br />
Schuhmann. Eines sei jedoch schon<br />
jetzt <strong>sich</strong>er: „Die Qualität des recycelten<br />
Phosphors ist hervorragend,<br />
weil er vollständig pflanzenverfügbar<br />
ist und mehrere Pflanzennährstoffe<br />
zur Verfügung stellt.“<br />
Beurteilen wollen die Projektbeteiligten<br />
dann auch, ob <strong>sich</strong> mit<br />
der Phosphor-Rückgewinnung für<br />
Kommunen wie Neuburg eine lohnenswerte<br />
neue Einnahmequelle<br />
auftut. Immerhin stieg der Preis für<br />
die Tonne Phosphaterz an den Rohstoffbörsen<br />
von April 2007 bis<br />
August 2008 von 40 auf 430 US-<br />
Dollar pro Tonne. Aktuell liegt er bei<br />
120 US-Dollar pro Tonne.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.kit.edu<br />
Juni 2011<br />
584 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Optimale Hopfenbewässerung:<br />
Den Durst des Durstlöschers löschen<br />
Beim Hopfenanbau Zeit, Energie und <strong>Wasser</strong> sparen – DBU stiftet rund 318000 Euro<br />
Die frühsommerlichen Temperaturen locken in diesen Tagen viele Menschen in die Biergärten, um eine kühle<br />
„Hopfenkaltschale“ zu genießen. Was viele nicht wissen: Deutschland ist der weltweit größte Hopfenproduzent.<br />
Auf rund 18500 Hektar wird die wichtige Grundzutat für Bier angebaut. „Um Ertrags- und Qualitätsschwankungen<br />
abzufedern, werden Bewässerungssysteme oft nach Gefühl betrieben. Das führt zu überhöhtem<br />
Grundwasserverbrauch. Zudem werden Nährstoffe aus dem Boden ausgespült, wo sie eigentlich benötigt werden<br />
– und gelangen ins Grundwasser, wo man sie nicht haben will“, erläuterte Prof. Dr. Sebastian Peisl von der<br />
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) in Freising das Problem. Deshalb fördert die Deutsche Bundesstiftung<br />
Umwelt (DBU) nun ein Projekt zur Verbesserung des Bewässerungsmanagements an der HSWT mit<br />
rund 318000 Euro.<br />
ur Bewässerungssteuerung<br />
„Zbei Hopfen gibt es bisher<br />
kaum wissenschaftliche Untersuchungen,<br />
ob<strong>wohl</strong> es zunehmend<br />
bewässerte Flächen gibt. Verläuft<br />
das Projekt erfolgreich, kann mit<br />
geringem Arbeitsaufwand die <strong>Wasser</strong>menge<br />
zu jedem Entwicklungszeitpunkt<br />
des Hopfens optimal<br />
dosiert werden. Das spart <strong>Wasser</strong>,<br />
Energie und Zeit – und entlastet die<br />
Umwelt deutlich“, erklärte DBU-<br />
Generalsekretär Dr.-Ing. E.h. Fritz<br />
Brickwedde. Da die zu erwartenden<br />
Verbesserungsvorschläge für alle<br />
Systeme gelten würden, könnten<br />
100 Prozent aller Anbaubetriebe<br />
erreicht werden.<br />
„Hopfen wächst bis zu sieben<br />
Meter hoch und bildet ein sehr spezielles<br />
Wurzelsystem. Das erfordert<br />
andere Bewässerungsverfahren als<br />
bei den meisten anderen landwirtschaftlichen<br />
und gartenbaulichen<br />
Kulturen“, erklärte Peisl die Herausforderung<br />
des Projektes. „Wir wollen<br />
den genauen <strong>Wasser</strong>bedarf der<br />
Pflanze und die optimale Tropfsystemanordnung<br />
ermitteln, um die<br />
Erträge zu <strong>sich</strong>ern und zeitgleich<br />
die Umwelt zu schonen.“ Aus den<br />
gewonnenen Erkenntnissen werde<br />
man ein Computerprogramm für<br />
eine Pilotanlage entwickeln und sie<br />
unter Praxisbedingungen testen.<br />
Die HSWT und die daran angegliederte<br />
Forschungsanstalt für Gartenbau<br />
Weihenstephan, die einen<br />
Forschungsschwerpunkt für Bewässerungstechnik<br />
und -steuerung hat<br />
bearbeitet das Projekt zusammen<br />
mit dem Institut für Pflanzenbau<br />
und Pflanzenzüchtung – Arbeitsbereich<br />
Hopfen – der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft (LfL)<br />
in Freising. Die LFL kooperiert wiederum<br />
mit der privaten „Gesellschaft<br />
für Hopfenforschung“ –<br />
deren Mitglieder Brauereien, Hopfenhändler<br />
und Hopfenpflanzer<br />
sind. So sei die Verbreitung der<br />
Forschungsergebnisse ge<strong>sich</strong>ert,<br />
be tonte Peisl. Nach Projektende soll<br />
das neue Verfahren vom Projektpartner<br />
ATEF Euringer & Friedl aus<br />
Oberhartheim möglichst zur kommerziellen<br />
Marktreife gebracht werden.<br />
Zudem würden die für die Praxis<br />
relevanten Ergebnisse in einem<br />
„Bewässerungsleitfaden“ zusammengefasst<br />
und allen Hopfenbetrieben<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Kontakt:<br />
DBU,<br />
An der Bornau 2,<br />
D-49090 Osnabrück,<br />
Tel. (0541) 9633521,<br />
Fax (0541) 9633198,<br />
E-Mail: presse@dbu.de, www.dbu.de<br />
Zur Bewässerungssteuerung bei Hopfen gibt es<br />
bisher kaum wissenschaftliche Untersuchungen,<br />
ob<strong>wohl</strong> es zunehmend bewässerte Flächen gibt.<br />
Das nun von der DBU geförderte Projekt soll aufzeigen,<br />
wie man beim Anbau <strong>Wasser</strong>, Energie und Zeit<br />
sparen und damit die Umwelt deutlich entlasten<br />
kann. © piclease/Stenner, Clemens<br />
Ansprechpartner für Fragen zum Projekt:<br />
Prof. Dr. Sebastian Peisl,<br />
Tel. (08161) 713480,<br />
Fax (08161) 714417,<br />
E-Mail: sebastian.peisl@hswt.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 585
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Leitgedanke „Carbon Footprint“<br />
Bewertung der CO 2 -Emissionen in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung – Carix®-Verfahren, Nanofiltration<br />
und Umkehrosmose im Vergleich<br />
Bei der Auswahl der richtigen Verfahrenstechnologien<br />
und der<br />
Planung von <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
spielt die Bewertung der<br />
damit verbundenen Kohlendioxid<br />
(CO 2 )-Emissionen bei vielen Investitionsentscheidungen<br />
weltweit eine<br />
zunehmende Rolle. In öffentlichen<br />
Projekten beispielsweise in Großbritannien<br />
gehört eine Einschätzung<br />
der zu erwartenden Klimagas-Emissionen<br />
zum Standard jeder Ausschreibung.<br />
Auch in der Industrie<br />
haben <strong>sich</strong> zahlreiche global agierende<br />
Unternehmen – zum Beispiel<br />
in der Nahrungsmittelproduktion –<br />
eigene Ziele zur schrittweisen Verminderung<br />
ihrer Emissionen ge -<br />
setzt, über deren Erreichungsgrad<br />
kontinuierlich Bericht erstattet wird.<br />
Für andere Akteure steht neben<br />
dem nachhaltigen Umgang mit<br />
Bild 1. Die Carix ® -Anlage weist vor allem deshalb<br />
eine vorteilhafte CO 2 -Bilanz auf, weil hier im Rahmen<br />
des Verfahrens Kohlendioxid gebunden wird.<br />
Bild 2. Umkehrosmose, ein vielfach eingesetztes<br />
Verfahren zur <strong>Wasser</strong>entsalzung.<br />
natürlichen Ressourcen schon aus<br />
monetären Gründen die Verbesserung<br />
der Energie-Effizienz im Vordergrund.<br />
Auch dies wirkt <strong>sich</strong> positiv<br />
in der CO 2 -Bilanz aus. Krüger<br />
WABAG wie auch andere Gesellschaften<br />
aus der <strong>Wasser</strong>techniksparte<br />
von Veolia haben deshalb<br />
bereits 2009 damit begonnen, ihre<br />
Verfahren in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung systematisch<br />
nach den anfallenden<br />
Emissionen klimaschädlicher Gase<br />
über den gesamten Lebenszyklus<br />
hinweg zu bewerten.<br />
Neben CO 2 gehören vor allem<br />
Methan (CH 4 ) und Stickoxid (N 2 O)<br />
zu den wichtigsten Treibhausgas-<br />
Emissionen, die die Hauptursache<br />
der Klimaerwärmung darstellen.<br />
Fossile Energieträger als Hauptquelle<br />
anthropogener Treibhausgase<br />
stellen endliche Ressourcen<br />
dar, deren Preise entsprechend ihrer<br />
zunehmenden Knappheit kontinuierlich<br />
ansteigen. Deswegen wird<br />
eine zukunftsorientierte Strategie in<br />
jedem Unternehmen zur Verringerung<br />
der Energieabhängigkeit und<br />
damit zu Reduzierung der Umweltbeeinträchtigungen<br />
führen.<br />
Der Carbon Footprint (Kohlenstoff-Fußabdruck)<br />
ist die Gesamtheit<br />
an Treibhausgas-Emissionen,<br />
die direkt oder indirekt durch eine<br />
Person, ein Unternehmen, ein Produkt<br />
oder ein Ereignis verursacht<br />
werden. Dank der Gesamtbilanz für<br />
Kohlenstoff ist Krüger WABAG in der<br />
Lage, verschiedene Lösungen zur<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung zu ermitteln<br />
und mögliche Einsparmaßnahmen<br />
mit den damit verbundenen Kosten<br />
und Vorteilen aufzuzeigen, so auch<br />
bei Verfahren zur Teilentsalzung<br />
und Entfernung von Härtebildnern,<br />
Sulfat und Nitrat aus dem Trinkwasser.<br />
Untersucht wurden das<br />
CARIX®-Ionenaustausch-Verfahren,<br />
Nanofiltration und Umkehrosmose.<br />
Die Berechnung<br />
Die hier vorgenommene Untersuchung<br />
basiert auf den Werten einer<br />
in Betrieb befindlichen CARIX®-<br />
Anlage (Bild 1) mit den tatsächlich<br />
anfallenden Betriebskosten und Verbräuchen.<br />
Verglichen wird diese<br />
Anlage mit einer entsprechend analog<br />
ausgelegten Nanofiltration bzw.<br />
Umkehrosmose. Zentrale Maßzahl<br />
sind die CO 2 -Äquivalente (g CO 2 -e/<br />
m 3 Produktwasser), die während der<br />
gesamten Lebensdauer der CARIX ® -,<br />
Nanofiltration- und Umkehrosmoseanlagen<br />
entstehen (Bild 2). Dabei<br />
wurde in allen drei Fällen eine durchschnittliche<br />
Lebensdauer von 25<br />
Jahren zugrunde gelegt. Die Basisproduktionsmenge<br />
für jede Anlage<br />
beträgt 244 m 3 <strong>Wasser</strong> pro Stunde.<br />
Die Gesamtemissionen sind in<br />
drei Hauptkategorien unterteilt:<br />
Emissionen, die während des<br />
Betriebs der Anlage entstehen<br />
(Rohwasserbereitstellung,<br />
Stromverbrauch und Betriebsstoffe)<br />
Emissionen, die während des<br />
Anlagenbaus entstehen<br />
Emissionen, die dank des CO 2 -<br />
Verbrauchs vermieden<br />
werden<br />
Zur Berechnung der Emissionen<br />
beim Bau der Anlagen werden die<br />
Systeme in ihre Bestandteile zerlegt<br />
betrachtet. Die verschiedenen Rohmaterialen<br />
wie zum Beispiel Stahl,<br />
Aluminium und verschiedene<br />
Kunststoffarten werden quantifiziert<br />
und mit CO 2 -Emissionskoeffizienten<br />
multipliziert. Die dabei von Krüger<br />
WABAG bzw. Veolia Water Solutions<br />
& Technologies verwendeten Koeffizienten<br />
stammen aus mehreren<br />
international anerkannten Datenbanken.<br />
Die wichtigsten Faktoren<br />
für den Betrieb sind die eingesetzten<br />
Rohwassertypen, Energieverbrauch<br />
und Betriebsmittel.<br />
Juni 2011<br />
586 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Untersuchungsergebnis<br />
Mit 149 g CO 2 -e /m 3 hat die CARIX®-<br />
Anlage den geringsten Carbon<br />
Footp rint, was auf den vergleichsweise<br />
niedrigen Stromverbrauch<br />
und die Reduzierung von Emissionen<br />
durch das im <strong>Abwasser</strong> gebundene<br />
CO 2 zurückzuführen ist. Der<br />
Carbon Footprint der Nanofiltration-<br />
und Umkehrosmoseanlagen<br />
ist im Vergleich zu CARIX ® um 61 %<br />
bzw. 78 % höher und daher mit größeren<br />
Auswirkungen auf Klima und<br />
Umwelt sowie deutlich höheren<br />
Betriebskosten verbunden (Bild 3).<br />
Die CARIX® (Carbon Dioxide<br />
Regenerated Ion Exchangers)-<br />
Anlage besteht aus Ionenaustauscherfiltern,<br />
in denen die eigent liche<br />
Teilentsalzung und Entfernung von<br />
Härtebildnern, Sulfat und Nitrat<br />
stattfindet. Als Reaktionsprodukt<br />
entsteht Kohlensäure, die in <strong>Wasser</strong><br />
und CO 2 zerfällt. Das entstandene<br />
CO 2 wird im nachgeschalteten Reinwasserriesler<br />
durch Luftstrippung<br />
wieder aus dem <strong>Wasser</strong> entfernt. Zur<br />
Regeneration der Ionenaustauscherfilter<br />
wird anstelle von Chemikalien<br />
CO 2 aus der Rückgewinnung sowie<br />
aus einem CO 2 -Tank verwendet.<br />
Dadurch lassen <strong>sich</strong> erhöhte Salzmengen<br />
im <strong>Abwasser</strong> vermeiden.<br />
Das im Prozess eingesetzte CO 2 wird<br />
aus einem Abgas gewonnen, das als<br />
Abfallprodukt aus der Düngemittelherstellung<br />
(Ammoniak-Synthese)<br />
anfällt, und ansonsten in die Atmosphäre<br />
übergehen würde. Im Eluatentgaser<br />
wird CO 2 zu etwa 95 % aus<br />
dem Regenerierstrom zurückgewonnen.<br />
Der restliche Teil wird chemisch<br />
im <strong>Abwasser</strong> gebunden und<br />
gelangt in den Vorfluter (Bild 4).<br />
Eine wichtige Erkenntnis aus der<br />
Untersuchung: Bei allen drei An -<br />
lagen stammt der größte Anteil an<br />
Emissionen aus dem Stromverbrauch<br />
während des Anlagenbetriebs.<br />
Die Kategorie Rohwasserbereitstellung<br />
im Betrieb erfasst<br />
Emissionen, die mit dem Energieverbrauch<br />
in Folge der Erzeugung<br />
des zusätzlichen Rohwassers verbunden<br />
ist. Die während des Anlagenbaus<br />
entstandenen Emissionen<br />
sowie Emissionen, die auf die Produktion<br />
der Betriebsstoffe zurückzuführen<br />
sind, stellen nur einen<br />
geringen Anteil an den Gesamtemissionen<br />
dar. Die „vermiedenen<br />
Emissionen“ stellen den Teil der Klimagase<br />
dar, die gebunden und<br />
deren Abgang in die Atmosphäre<br />
verhindert wird.<br />
Weitere Informationen:<br />
E-Mail: krueger-wabag@<br />
veoliawater.com<br />
www.krueger-wabag.de<br />
DIN EN ISO<br />
9001:2000<br />
Zert.-Nr. 0727<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 587<br />
Bild 3. Funktionsschema.<br />
Bild 4. CO 2 -<br />
Emissionen<br />
per m 3 im<br />
Vergleich.
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Neue Lern-DVD „Wer Wie <strong>Wasser</strong> – Interaktive<br />
Lernspiele für Kinder“<br />
Die Lern-DVD für Kinder von acht<br />
bis zwölf Jahren bietet auf neuartige<br />
Weise Lernspiele, interaktive<br />
Elemente und Experimente zum<br />
Thema <strong>Wasser</strong>. Vier phantasie- und<br />
humorvoll illustrierte Wimmelbilder<br />
zeigen zahlreiche lustige kleine Alltagsszenen,<br />
hinter denen <strong>sich</strong> viel<br />
Spannendes entdecken lässt. Dort,<br />
wo <strong>sich</strong> beim Darüberfahren mit der<br />
Maus etwas bewegt und lustige Animationen<br />
ausgelöst werden, öffnen<br />
<strong>sich</strong> beim Klicken weitere Spielebenen:<br />
interaktive Filme, Animationssequenzen,<br />
Rätsel-, Puzzle- und<br />
Memo-Spiele, Tonsequenzen und<br />
gesprochene Erläuterungen, Experimente,<br />
Spiel- und Bastelanleitungen.<br />
Inhaltlich deckt die DVD die ganze<br />
Breite des Themas <strong>Wasser</strong> ab: Der<br />
<strong>Wasser</strong>kreislauf oder Phänomene<br />
wie der Auftrieb werden anschaulich<br />
erklärt, die Kinder lernen <strong>Wasser</strong> als<br />
Lebensraum für Pflanzen und Tiere<br />
kennen und erfahren etwas über<br />
<strong>Wasser</strong> im Alltag und den schonenden<br />
Umgang mit <strong>Wasser</strong>. Auch um<br />
Spiel und Spaß mit <strong>Wasser</strong> und das<br />
Erfahren von <strong>Wasser</strong> mit allen Sinnen<br />
geht es auf der DVD.<br />
„Wer Wie <strong>Wasser</strong>“ bietet nicht nur<br />
ein spannendes Spielerlebnis am PC,<br />
die DVD motiviert die Kinder über<br />
Experimentier- und Bastelanleitungen<br />
auch dazu, das Erlernte selbst<br />
auszuprobieren und zu erfahren. Für<br />
die Kinder macht das Suchen und<br />
Entdecken der Inhalte über die Wimmelbilder<br />
den besonderen Reiz der<br />
DVD aus. Damit Erwachsene die<br />
Lernspiele und anderen Inhalte<br />
leichter ausprobieren können, gibt<br />
es auf www.werwiewasser.de neben<br />
detaillierten Informationen zur DVD<br />
auch ein Demo-Video sowie mit<br />
Legende versehene Abbildungen<br />
der Wimmelbilder.<br />
Bezug:<br />
Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V.,<br />
www.vdg-online.de/shop,<br />
Preis: 14,80 € je Exemplar zzgl. Versandkosten<br />
Ratgeber „Virtuelles <strong>Wasser</strong> – Weniger <strong>Wasser</strong><br />
im Einkaufskorb“<br />
Das Thema virtuelles <strong>Wasser</strong> und<br />
die riesigen <strong>Wasser</strong>mengen, die<br />
bei der Produktion vieler Alltagsprodukte<br />
genutzt werden, stoßen in<br />
der Öffentlichkeit und den Medien<br />
nach wie vor auf großes Interesse,<br />
werfen jedoch beim Verbraucher<br />
häufig die Frage auf, wie er denn<br />
beim Einkauf auf wasserschonende<br />
Produkte achten kann. Hier einfache<br />
Antworten zu geben ist gar<br />
nicht so leicht, da die für die Produkte<br />
eingesetzte <strong>Wasser</strong>menge<br />
allein weniger entscheidend ist<br />
– anders als beispielsweise beim Klimaschutz,<br />
wo ein reduzierter Ausstoß<br />
von Kohlendioxid immer in<br />
gleicher Weise sinnvoll ist. Beim<br />
<strong>Wasser</strong> geht es dagegen vor allem<br />
darum, an den richtigen Hebeln<br />
anzusetzen und nicht nachhaltige<br />
<strong>Wasser</strong>nutzungen zu vermeiden.<br />
Der neue Ratgeber „„Virtuelles<br />
<strong>Wasser</strong> – Weniger <strong>Wasser</strong> im Einkaufskorb“<br />
erklärt, wobei es dabei<br />
vor allem ankommt und zeigt für<br />
wichtige Produktgruppen, wo es<br />
besonders sinnvoll und ohne Einbußen<br />
der Lebensqualität auch<br />
leicht möglich ist, das eigene Verhalten<br />
wasserbewusst zu ändern.<br />
Der Schwerpunkt liegt dabei auf<br />
den Lebensmitteln, aber auch<br />
Themen wie Ag ro-Sprit oder der<br />
besonders durstige Baumwollanbau<br />
werden behandelt. Das über<br />
die Beispiele deutlich gemachte<br />
Prinzip lässt <strong>sich</strong> auf viele andere<br />
Alltagsprodukte übertragen. Wie<br />
<strong>sich</strong> persönliche Verhaltensänderungen<br />
tatsächlich zahlenmäßig<br />
auswirken können, macht eine<br />
Über<strong>sich</strong>t am Ende der Broschüre<br />
deutlich, in der vorgerechnet wird,<br />
wie viel virtuelles <strong>Wasser</strong> <strong>sich</strong> bei<br />
einzelnen Produkten ohne Abstriche<br />
bei der Lebensqualität täglich<br />
einsparen lässt.<br />
Bezug:<br />
Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V.,<br />
www.vdg-online.de/shop,<br />
Preis: 3,80 € je Exemplar zzgl. Versandkosten<br />
Juni 2011<br />
588 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Flint Bautenschutz GmbH<br />
und Partner spenden<br />
für Trinkwasser<br />
THW freut <strong>sich</strong> über vorbildliche Aktion der<br />
Trinkwasserbehälter-Sanierer<br />
Wer auf eine Messe geht, will seine Leistungen darstellen,<br />
um ins Gespräch zu kommen. Dafür wird normalerweise<br />
viel Geld in Werbung investiert. Dass man mit dem<br />
Geld aber auch anderen helfen kann, beweist die Flint Bautenschutz<br />
GmbH aus Detmold. Das Unternehmen, das u. a.<br />
seit Jahrzehnten Trinkwasserbehälter saniert und technisch<br />
auf den neuesten Stand bringt, initiierte vor einigen Monaten<br />
die Spendenaktion „Trinkwasser heißt Leben“, bat<br />
Geschäftspartner um Unterstützung und konnte auf der<br />
<strong>Wasser</strong> Berlin 2011 die Summe 5090 Euro an die Fachgruppe<br />
Trinkwasserversorgung des Technischen Hilfswerks<br />
übergeben.<br />
Geschäftsführer Eckart Flint freut <strong>sich</strong> über die positive<br />
Resonanz auf seine Aktion. „Wenn man <strong>sich</strong> vergegenwärtigt,<br />
Das führende Fachorgan<br />
für <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong><br />
Informieren Sie <strong>sich</strong> regelmäßig über alle technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S -<br />
Recht und Steuern im Gas und <strong>Wasser</strong>fach.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Gerd Friedsam (links) und Swen Rehmsmeier (rechts)<br />
vom THW freuen <strong>sich</strong> über den Scheck der Flint Bautenschutz<br />
GmbH und ihrer Partner, überreicht von<br />
Geschäftsführer Eckart Flint (Mitte).<br />
wie viele Menschen in Katastrophengebieten sterben, weil<br />
ihnen sauberes Trinkwasser fehlt, ist es für ein Unternehmen<br />
wie uns nahe liegend zu helfen.“ Der THW-Landesbeauftragte<br />
für NRW, Gerd Friedsam, und der ehrenamtliche Leiter<br />
des THW-Ortsverbandes Lemgo, Swen Rehmsmeier, loben<br />
die Aktion als vorbildlich. Friedsam: „Das THW ist immer zur<br />
Stelle, wenn Menschen in Not geraten. Dabei denkt kaum<br />
jemand über die Finanzierung nach. Wir sind auf solche<br />
Spenden dringend angewiesen und hoffen auf Nachahmer.“<br />
Weitere Informationen:<br />
Flint Bautenschutz GmbH, Sichterheidestraße 31/33, D-32758 Detmold,<br />
Tel. (05231) 9609-0, Fax (05231) 66102, E-Mail: info@flint.de, www.flint.de<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Berkefeld-Technik auf der Biennale<br />
Mobile <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage als Kunstobjekt in Venedig<br />
Trinkwasser ist ein Thema, das die Menschen auf vielerlei Weise interessiert und berührt. Die Künstlerin Ayse<br />
Erkmen hat daher <strong>Wasser</strong> in den Mittelpunkt ihres Kunstprojekts gestellt, das im Rahmen des türkischen Beitrags<br />
zur diesjährigen Kunst-Biennale in Venedig gezeigt wird. Eine mobile <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage von<br />
Berkefeld bildet den Mittelpunkt ihrer Präsentation unter dem Titel „Plan B“. Durch die miteinander verbundenen<br />
Komponenten der Anlage wird in einem Ausstellungsraum <strong>Wasser</strong> aus dem Kanal aufbereitet.<br />
Von Juni bis November 2011<br />
fi ndet die 54. internationale<br />
Kunstausstellung in Venedig statt.<br />
Die renommierte türkische Künstlerin<br />
Ayse Erkmen wird dort eine <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage<br />
vom Typ<br />
BERU 4000/800 von Berkefeld für ihr<br />
Kunstobjekt einsetzen. Die nach<br />
einem von der Künstlerin definierten<br />
Schema eingefärbten Anlagenkomponenten<br />
sind für sechs<br />
Monate in einem 300 m² großen<br />
Raum in Betrieb. „Das ist ein sehr<br />
außergewöhnliches Projekt für uns.<br />
Wir freuen uns, dass wir mit unserer<br />
Technik diese faszinierende Idee<br />
von Ayse Erkmen unterstützen dürfen“,<br />
so Berkefeld Projektmanager<br />
Christoph von Helldorff. Die Anlage<br />
BERU 4000/800, die unter anderem<br />
bereits in den Hochwassergebieten<br />
in Sachsen eingesetzt wurde,<br />
besteht aus einer Vorfiltration mit<br />
rückspülbaren Scheibenfiltern, Ultrafiltration<br />
und Umkehrosmose und<br />
kann rund 4000 Liter Trinkwasser<br />
pro Stunde liefern.<br />
Bild 2. Ayse Erkmen zu Besuch in Celle für die<br />
Planung ihres Kunstprojekts in Venedig mit Projektmanager<br />
Christoph von Helldorff.<br />
Bild 1. So ist die Präsentation der Berkefeld Anlage in Venedig nach<br />
den Vorgaben der Künstlerin, Ayse Erkmen, geplant.<br />
www.wassertermine.de<br />
Ayse Erkmen wird mit der Anlage<br />
den Pavillon der Türkei gestalten.<br />
Nach der Filterung wird das Trinkwasser<br />
zurück in den Kanal gegeben.<br />
Mit dieser Installation unter<br />
dem Titel „Plan B“ will sie die komplexe<br />
Beziehung zwischen Stadt<br />
und <strong>Wasser</strong> inszenieren. Gleichzeitig<br />
soll so der <strong>Wasser</strong>kreislauf analog<br />
zum menschlichen Blutkreislauf<br />
dargestellt werden, wie die Künstlerin<br />
auf einer Pressekonferenz in<br />
Istanbul erklärte. Der Pavillon der<br />
Türkei auf der Biennale wird von der<br />
Istanbul Stiftung für Kunst und Kultur<br />
(IKSV) organisiert, gesponsert<br />
von FIAT, unter der Schirmherrschaft<br />
des Türkischen Außenministeriums<br />
und realisiert mit der Unterstützung<br />
des Promotions Fonds des<br />
Türkischen Ministerpräsidialamtes.<br />
Ayse Erkmen ist 1949 in Istanbul<br />
geboren und studierte an der staatlichen<br />
Kunstakademie Istanbul Bildhauerei.<br />
Dort machte sie 1977 den<br />
Abschluss im Fach Skulptur. 1993<br />
bekam sie ein Stipendium des Deutschen<br />
Akademischen Austauschdiensts<br />
in Berlin. Ihre Hauptaufmerksamkeit<br />
gilt heute Skulpturen,<br />
Objekten, Installationen und Interventionen.<br />
Berkefeld, ein Tochterunternehmen<br />
von Veolia Water Solutions &<br />
Technologies, entwickelt und produziert<br />
bereits seit Jahrzehnten<br />
mobile Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung,<br />
die von Hilfsorganisationen<br />
oder Militär weltweit eingesetzt<br />
werden. Mit den Anlagen werden<br />
beispielsweise Flüchtlinge oder<br />
Betroffene von Naturkatastrophen<br />
oder kriegerischen Auseinandersetzungen<br />
mit Trinkwasser versorgt.<br />
Unter anderem nach dem Erdbeben<br />
in Haiti oder nach der Flutkatastrophe<br />
in Pakistan kamen Berkefeld-<br />
Anlagen zum Einsatz.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.berkefeld.de<br />
Juni 2011<br />
590 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
NACHRICHTEN<br />
Internationale Geothermiekonferenz: Freiburg für<br />
drei Tage Zentrum der Geothermiebranche<br />
Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit: Über 250 Teilnehmer aus 17 Nationen verdeutlichen, dass die<br />
Potenziale der tiefen Geothermie auf großes Interesse stoßen. Schwerpunktthemen der IGC 2011 waren unter<br />
anderem EGS-Projekte, die Kostenreduktion bei Geothermie-Projekten und die Vorstellung des Erfahrungsberichts<br />
zur EEG–Novelle durch das Bundesumweltministerium.<br />
Mit Exkursionen zu Geothermieanlagen<br />
in der Schweiz und in<br />
Frankreich ist am 12. Mai 2011 die<br />
dreitägige 7. Internationale Geothermiekonferenz<br />
(IGC 2011) in Freiburg<br />
zu Ende gegangen. Über 250 Teilnehmer<br />
aus 17 Nationen hatten die<br />
Gelegenheit genutzt, um <strong>sich</strong> über<br />
aktuelle politische und technische<br />
Entwicklungen in der Geothermiebranche<br />
zu informieren und mit<br />
Fachleuten die Perspektive der tiefen<br />
Geothermie in der zukünftigen Energieversorgung<br />
zu diskutieren. Damit<br />
ist die Anzahl der Teilnehmer gegenüber<br />
der Konferenz im Jahr 2010 um<br />
mehr als 10 Prozent gestiegen.<br />
„Diese Entwicklung und auch die<br />
Zunahme internationaler Vertreter<br />
zeigt, dass die tiefe Geothermie im<br />
Allgemeinen und die Entwicklungen<br />
in Deutschland im Besonderen von<br />
wachsendem Interesse sind“, so Dr.<br />
Jochen Schneider, Geschäftsführer<br />
des Veranstalters Enerchange. Mehr<br />
und mehr etabliere <strong>sich</strong> die IGC als<br />
Plattform für den Austausch der<br />
internationalen Geothermie branche.<br />
Einer der Schwerpunkte des ersten<br />
Konferenztages war die Umsetzung<br />
von EGS-Projekten – von Projekten<br />
also, in denen die Erde in<br />
3000 bis etwa 5000 Metern Tiefe<br />
als Wärmetauscher genutzt wird.<br />
Hierzu werden mit Hilfe von <strong>Wasser</strong>druck<br />
Wegsamkeiten im Untergrund<br />
geschaffen, in denen <strong>sich</strong> das<br />
<strong>Wasser</strong> während der Zirkulation<br />
zwischen zwei Tiefenbohrungen er -<br />
hitzt. Diese Technologie wurde bislang<br />
nur im Rahmen von Demonstrationsprojekten<br />
erprobt, hat nach<br />
Meinung der vortragenden Experten<br />
aber große Potenziale für die<br />
zukünftige Energieerzeugung. „Im<br />
Hinblick auf die verstärkte Nutzung<br />
heimischer erneuerbarer Energieträger<br />
ist die Nutzung und Weiterentwicklung<br />
der EGS-Technologie<br />
ein Muss“, so Dr. Ernst Huenges vom<br />
Geoforschungszentrum in Potsdam<br />
in seinem Vortrag.<br />
Am Nachmittag des ersten Tages<br />
standen <strong>Wo</strong>rkshops zur Öffentlichkeitsarbeit,<br />
der Pumpentechnologie,<br />
Geothermieprojekten weltweit<br />
und der Anwendung GeotIS auf<br />
dem Programm.<br />
Der zweite Konferenztag widmete<br />
<strong>sich</strong> in verschiedenen Diskussionsforen<br />
den aktuellen technischen,<br />
finanziellen und politischen Herausforderungen<br />
der Geothermie. Einen<br />
Schwerpunkt bildete zum Beispiel<br />
das Forum „Kostenreduktion und<br />
Effizienzsteigerung“. Hier stellte<br />
unter anderem Guillaume Becquin<br />
von General Electric die Forschungen<br />
des Konzerns zu hocheffizienten<br />
Arbeitsmitteln und passenden Kreisprozessen<br />
in geothermischen Stromerzeugungsanlagen<br />
vor. Sein Fazit:<br />
„Eine Leistungssteigerung um 30 bis<br />
50 Prozent ist möglich“. Auch der<br />
Umgang mit seismischen Ereignissen,<br />
die durch Geothermieprojekte<br />
ausgelöst werden, war ein zentrales<br />
Thema des zweiten Konferenztags.<br />
„Wichtig hier ist ein Reak tionsplan,<br />
der auf Basis eines mikroseismischen<br />
Überwachungssystems klare Vorgaben<br />
macht, wie auf seismische Ereignisse<br />
in der Region des geothermischen<br />
Reservoirs reagiert wird“,<br />
erläuterte hierzu Dr. Stefan Baisch,<br />
Geschäftsführer des Unternehmens<br />
Q-con aus Bad Berg zabern im Forum<br />
„Seismizität“. Nicht zuletzt stellte<br />
Cornelia Viertl vom Bundesumweltministerium<br />
die neuen Pläne des<br />
BMU zur Vergütung von Geothermiestrom<br />
im Rahmen des EEG vor.<br />
Sie machte deutlich, dass das BMU<br />
die Potenziale der Geothermie für<br />
die Stromerzeugung anerkennt und<br />
deshalb eine Erhöhung der Grundvergütung<br />
sowie einen Bohrkostenzuschuss<br />
vorschlägt.<br />
Eine Vielzahl von Unternehmen<br />
aus dem In- und Ausland nutzte die<br />
Konferenz, um ihre Produkte und<br />
Dienstleistungen der Fachöffentlichkeit<br />
zu demonstrieren. Aussteller<br />
und Sponsor der Konferenz war<br />
zum Beispiel das französische Un -<br />
ternehmen Cryostar, das <strong>sich</strong> auf die<br />
Entwicklung hocheffizienter Wärmetauschersysteme<br />
spezialisiert hat<br />
und sie unter anderem in Geothermiekraftwerken<br />
einsetzt.<br />
Großen Anklang findet jedes<br />
Jahr auch das attraktive Rahmenprogramm<br />
der Konferenz. Neben<br />
der Opening Lounge am ersten<br />
Abend trafen <strong>sich</strong> die Teilnehmer<br />
am zweiten Tag im Rahmen des<br />
Business Dinners, um in entspannter<br />
Atmosphäre Networking zu<br />
betreiben.<br />
Veranstaltet wird die Internationale<br />
Geothermiekonferenz von der<br />
Agentur Enerchange. Die Freiburg<br />
Wirtschaft Touristik und Messe<br />
GmbH & Co. KG als Wirtschaftsförderungs-<br />
und Marketinggesellschaft<br />
der Stadt Freiburg ist Mitveranstalter<br />
der Konferenz. Schirmherr ist das<br />
Bundesumweltministerium, Unterstützer<br />
die European Association of<br />
Geoscientists & Engineers (EAGE). Als<br />
Kooperationspartner konnten unter<br />
anderem die Deutsche Energie-<br />
Agentur (dena), die International<br />
Geothermal Association (IGA), das<br />
Wirtschaftsforum Geothermie, die<br />
schweizerische Vereinigung für Geothermie<br />
und der GtV-Bundesverband<br />
Geothermie gewonnen werden.<br />
Weitere<br />
Informationen:<br />
www.geothermiekonferenz.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 591
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
acqua alta 2011<br />
11. bis 13. Oktober 2011 in Hamburg, Congress Center Hamburg<br />
Flutmodell<br />
TU Hamburg-<br />
Harburg.<br />
Bild: Stephan<br />
Wallocha<br />
Der globale Klimawandel und die<br />
Folgen für den Hochwasserschutz<br />
an Küsten und im Binnenland<br />
ist das zentrale Thema der Fachmesse-<br />
und Kongressveranstaltung<br />
acqua alta. Im Fokus des umfassenden<br />
Kongressprogramms stehen die<br />
verschiedenen Anpassungsstrategien<br />
in Deutschland und anderen<br />
Ländern, neue Handlungsansätze<br />
und konkrete Maßnahmen. Mit rund<br />
70 Referenten aus 10 Nationen bietet<br />
die Fachmesse ein internationales<br />
Forum für intensiven Austausch<br />
zwischen Wissenschaftlern, Wirtschaftsexperten,<br />
Politikern so wie<br />
Vertretern von Kommunen.<br />
Anpassungsstrategien auf<br />
internationaler Ebene<br />
Extreme Wetterereignisse sind Konsequenzen<br />
des Klimawandels. Die<br />
Anpassungsversuche daran und der<br />
Umgang mit Hochwasser, Starkregen<br />
oder auch <strong>Wasser</strong>mangel<br />
über fachliche und regionale Grenzen<br />
hinweg wird während des dreitägigen<br />
Kongresses in Hamburg<br />
von Experten ausführlich dargestellt.<br />
Verschiedene Beiträge zeigen<br />
auf, welche Konzepte Metropolen<br />
wie Kopenhagen oder Rotterdam<br />
prüfen, um die Konsequenzen von<br />
Überflutungen für Stadt und Hafen<br />
abmildern zu können. Im Binnenland<br />
sind die Folgen des Klimawandels<br />
als Starkregen spürbar, daneben<br />
kann es auch in Nordeuropa<br />
Perioden der Trockenheit und <strong>Wasser</strong>knappheit<br />
geben. Konzepte für<br />
bessere Entwässerung sind daher<br />
künftig ebenso gefragt wie Ressourcenmanagement<br />
– nicht zuletzt<br />
auch für den industriellen Bedarf.<br />
Ansätze und Projekte in<br />
Deutschland<br />
Die Anpassungsstrategie für Deutschland<br />
und die Unterstützung des<br />
Bundes für entsprechende Maßnahmen<br />
in Regionen und Kommunen<br />
stehen ebenfalls auf dem Programm.<br />
Eines der geförderten Projekte<br />
ist beispielsweise Klimzug-<br />
Nord, das konkrete Ansätze für die<br />
Metropolregion Hamburg, in der<br />
rund 4,2 Millionen Einwohner leben,<br />
entwickeln soll. Schwerpunkte des<br />
Projekts liegen auf der künftigen<br />
Stadt- und Raumentwicklung, auch<br />
im Hinblick auf einen höheren<br />
Bedarf an Entwässerung und Re -<br />
genwassermanagement.<br />
Vorhersagen und<br />
Frühwarnung<br />
Voraussetzung für die Planung von<br />
Schutz- und Anpassungsmaßnahmen<br />
sind realistische Prognosen<br />
über regionale Auswirkungen des<br />
Klimawandels. Welche Schwierigkeiten<br />
Fachleute bei solchen Aussagen<br />
sehen, wird im Kongress<br />
ebenso dargestellt wie die Möglichkeit,<br />
<strong>sich</strong> durch den Vergleich von<br />
diversen vorliegenden Einzelergebnissen<br />
inzwischen ein besseres Bild<br />
machen zu können. Auch <strong>Wasser</strong>standvorhersagen<br />
bei Sturmfluten<br />
wie bei extrem niedrigen Abflussmengen<br />
sind sehr wichtig. Für die<br />
Schifffahrt sind sie geradezu ein<br />
wirtschaftlicher Faktor. Experten<br />
zeigen die Chancen und die Problematik<br />
verlässlicher Prognosen auf.<br />
Bauliche Schutzmaßnahmen<br />
Wesentliche Mittel zum Schutz vor<br />
Überflutung sind nach wie vor bauliche<br />
Maßnahmen. Ein Beispiel dafür<br />
sind die Konsequenzen, die Sachsen<br />
aus dem verheerenden Hochwasser<br />
von 2002 gezogen hat. Dazu gehört<br />
außer dem Neubau und Ausbau von<br />
Deichen in urbanen Gebieten auch<br />
der Bau von fünf großen Hochwasserrückhaltebecken<br />
im Erzgebirge.<br />
Ein Vortrag fasst die wesentlichen<br />
Erkenntnisse aus dem Prozess der<br />
zeitgleichen Planung, Genehmigung<br />
und Realisierung dieses Großprojektes<br />
zusammen. In weiteren<br />
Fachbeiträgen kommen innovative<br />
Verfahren zur Deichsanierung und<br />
Stabilisierung an Küsten und Flüssen<br />
zur Sprache, ebenso die Hochwasserschutz-Planung<br />
beim Bau<br />
des Tiefwasserhafens JadeWeser-<br />
Port bei Wilhelmshaven. Speziell um<br />
mobile Hochwasserschutzsysteme<br />
geht es bei einem Seminar, das der<br />
BWK – Bund der Ingenieure für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Abfallwirtschaft und<br />
Kulturbau auf der acqua alta veranstaltet.<br />
Bauen am <strong>Wasser</strong><br />
Die architektonischen Gestaltungsstrategien<br />
in Uferbereichen sind<br />
ebenfalls ein Thema des Kongresses,<br />
außerdem geht es um den städteplanerischen<br />
Umgang mit Deichen<br />
und Überflutungsflächen in<br />
Siedlungen. Hier soll das Zusammenspiel<br />
von baulichen Schutzmaßnahmen,<br />
die der Sicherheit dienen,<br />
und der Gestaltung eines<br />
attraktiven Lebensraums für die<br />
Bewohner aufgezeigt werden. Wie<br />
man mit schwimmenden Bauten<br />
das <strong>Wo</strong>hnen in Überflutungsgebieten<br />
attraktiv macht, zeigen Beispiele<br />
aus Hamburg und den Niederlanden.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.acqua-alta.de<br />
Juni 2011<br />
592 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Forschung und Entwicklung<br />
NACHRICHTEN<br />
Leopoldina richtet Empfehlungen an die<br />
G8-Staats- und Regierungschefs<br />
Die Leopoldina hatte gemeinsam mit den nationalen Wissenschaftsakademien der G8-Staaten im Vorfeld des<br />
G8-Gipfeltreffens am 26. und 27. Mai in Deauville (Frankreich) der Staats- und Regierungschefs zwei Stellungnahmen<br />
erarbeitet. Die darin enthaltenen Empfehlungen wurden den beteiligten Regierungen übergeben.<br />
In einer Stellungnahme zum Thema<br />
„Bildung in einer globalisierten<br />
Welt“ fordern die Akademien die<br />
Regierungen auf, gezielt in eine<br />
Infrastruktur zur weltweiten Verbreitung<br />
des wissenschaftlichen<br />
Wissens zu investieren. Eine weitere<br />
Stellungnahme zum Thema „<strong>Wasser</strong><br />
und Gesundheit“ empfiehlt neben<br />
dem Zugang zu sauberem Trinkwasser<br />
dringend die sanitäre Versorgung<br />
der Weltbevölkerung weiterzuentwickeln,<br />
um die Menschen vor<br />
schweren Krankheiten und Epidemien<br />
zu schützen.<br />
Die Wissenschaftsakademien<br />
le gen dar, dass Fortschritt und<br />
globale Entwicklung auf wissenschaftlichen<br />
und technologischen<br />
Er kennt nissen beruhen. Sie empfehlen<br />
daher, gezielt in Bildung zu<br />
investieren, um eine Globalisierung<br />
im Bereich des Wissens zu erreichen.<br />
Das Ziel dabei müsse es sein, alle<br />
Menschen zu vollwertigen Partnern<br />
der Wissenschaft zu machen. Skepsis<br />
und unbegründete Ängste neuen<br />
Technologien gegenüber würden<br />
somit vermieden werden; Menschen<br />
könnten aber auch deren Risiken<br />
besser einschätzen lernen. Dieser<br />
Herausforderung müsse man in<br />
dreifacher Weise gezielt begegnen:<br />
verbesserte wissenschaftliche Bildung<br />
der breiten Öffentlichkeit, in<br />
Schulen sowie an Universitäten und<br />
außeruniversitären Einrichtungen.<br />
Die Wissenschaftsakademien<br />
empfehlen den Staats- und Regierungschefs,<br />
die Regierungen der<br />
Entwicklungsländer dabei zu unterstützen,<br />
eine funktionierende Infrastruktur<br />
für Bildung zu entwickeln<br />
und diese zu unterhalten. Gefördert<br />
werden sollten internationale<br />
Kooperationen, die neue Wege im<br />
Bereich des e-learnings schaffen,<br />
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina –<br />
Nationale Akademie der Wissenschaften in Halle an der Saale.<br />
sowie eine Politik des freien<br />
Zugangs zu wissenschaftlicher Literatur<br />
und zu wissenschaftlichen<br />
Datenbanken. Wichtig sei es darüber<br />
hinaus, dass die neuesten<br />
Erkenntnisse aus der Hirnforschung<br />
und den Kognitionswissenschaften<br />
tatsächlich genutzt werden, um<br />
bessere Lehr- und Lernprogramme<br />
zu entwickeln. Ebenso müsse ein<br />
Netzwerk aus kooperierenden Forschungszentren<br />
für verschiedene<br />
innovative Bildungsthemen ge -<br />
schaffen werden. Bestehende er -<br />
folgreiche Programme, die Wissenschaftler<br />
und breite Öffentlichkeit,<br />
Journalisten und Entscheidungsträger<br />
aus verschiedenen Bereichen<br />
zusammenbringen, sollten weiter<br />
ausgebaut werden, so die Akademien<br />
in ihrer Stellungnahme zum<br />
Thema Bildung.<br />
Ausgehend von der Tatsache,<br />
dass in den vergangenen zehn Jahren<br />
durch hohe Investitionen für<br />
über eine Milliarde Menschen auf<br />
der Welt erstmals ein Zugang zu<br />
sauberem Trinkwasser geschaffen<br />
werden konnte, machen die Wissenschaftsakademien<br />
in ihrer Stellungnahme<br />
zum Thema „<strong>Wasser</strong> und<br />
Gesundheit“ darauf aufmerksam,<br />
dass im selben Zeitraum zu wenig<br />
für die sanitäre Versorgung dieser<br />
Menschen getan worden ist. Rund<br />
40 Prozent der Weltbevölkerung<br />
haben heute noch keinen Zugang<br />
zu einer angemessenen Sanitärversorgung.<br />
20 Prozent der Weltbevölkerung<br />
steht gar keine an ein<br />
<strong>Abwasser</strong>system angeschlossene<br />
Toilette zur Verfügung, so dass<br />
zusätzlich 300 Millionen Tonnen<br />
unbehandelter Exkremente jährlich<br />
wichtige Trinkwasserressourcen verunreinigen.<br />
Die Akademien weisen<br />
darauf hin, dass weltweit mehr Kinder<br />
unter fünf Jahren an Durchfal-<br />
<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 593
NACHRICHTEN<br />
Forschung und Entwicklung<br />
lerkrankungen (Diarrhoe) sterben<br />
als an AIDS, Malaria und Masern<br />
zusammen. Diese Erkrankungen<br />
gehen meistenteils auf unsauberes<br />
<strong>Wasser</strong>, eine schlechte sanitäre Versorgung<br />
und mangelhafte Hygiene<br />
zurück.<br />
Die Akademien fordern die Politiker<br />
auf, den Zugang zu Trinkwasser<br />
und die Sanitärversorgung gemäß<br />
den Milleniumszielen der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) als<br />
eine Einheit zu betrachten. Die<br />
G8-Staaten sollten <strong>sich</strong> dafür einsetzen,<br />
dass überall auf der Welt neben<br />
einer akzeptablen Qualität des Trinkwassers<br />
eine grundlegende Sanitärversorgung<br />
<strong>sich</strong>ergestellt wird.<br />
Dabei sollte neben einer Unterstützung<br />
in technischen Belangen auch<br />
die Ausbildung von Technikern vor<br />
Ort gehören, die Unterstützung von<br />
Forschern, die Mittel gegen Krankheitserreger<br />
im <strong>Wasser</strong> entwickeln,<br />
und ebenso Initiativen im Bereich<br />
des capacity building vor Ort, um<br />
das Bewusstsein für verbesserte<br />
Hygiene-Standards zu entwickeln.<br />
Bereits seit dem Gipfeltreffen der<br />
Staats- und Regierungschefs im Jahr<br />
2005 im schottischen Gleneagles<br />
erarbeiten die nationalen Akademien<br />
der G8-Staaten – Kanada,<br />
Frankreich, Deutschland, Italien,<br />
Japan, Russland, Großbritannien<br />
und die USA – jedes Jahr gemeinsame<br />
wissenschaftsbasierte Stellungnahmen<br />
zu globalen, gesellschaftsrelevanten<br />
Themen, die die<br />
Regierungen bei ihren Verhandlungen<br />
bei den jährlichen G8-Gipfeln<br />
unterstützen sollen. Die diesjährigen<br />
Erklärungen wurden bei einer<br />
Konferenz der Akademienvertreter<br />
am 24. und 25. März 2011 in Paris<br />
vorbereitet. Beteiligt waren neben<br />
den G8-Wissenschaftsakademien<br />
auch die Akademien Südafrikas,<br />
Brasiliens, Indiens, Mexikos und des<br />
Senegal. Deutschland wird in diesem<br />
Kreis der Wissenschaftsakademien<br />
stets durch die Nationalakademie<br />
Leopoldina vertreten.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.leopoldina.org/de/politik/<br />
empfehlungen-und-stellungnahmen/<br />
g8-statemen... - die Stellungnahmen<br />
Zehn Jahre WHO-Kollaborationszentrum<br />
an der Uni Bonn<br />
Das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn feierte am 4. Mai 2011, sein<br />
10-jähriges Bestehen als WHO-Kollaborationszentrum für <strong>Wasser</strong>management und Risikokommunikation zur<br />
Förderung der Gesundheit.<br />
Am 3. Mai 2001 ernannte die<br />
Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO das Institut für Hygiene und<br />
Öffentliche Gesundheit der Universität<br />
Bonn (IHPH) zum Kooperationszentrum.<br />
Es ist derzeit eines<br />
von 31 deutschen Zentren, die für<br />
die Weltgesundheitsorganisation<br />
tätig sind.<br />
Schwerpunkte der Arbeit am<br />
IHPH sind die Bereiche <strong>Wasser</strong>hygiene<br />
und Sanitation. Das Zentrum<br />
arbeitet in verschiedenen Arbeitsgruppen<br />
zum Protokoll über <strong>Wasser</strong><br />
und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation<br />
und der Vereinten<br />
Nationen. Dieses Protokoll ist das<br />
erste international getroffene<br />
Abkommen, das <strong>sich</strong>eres Trinkwasser<br />
und eine angemessene Sanitärversorgung<br />
für jeden Menschen<br />
ermöglichen soll. Außerdem arbeitet<br />
das Institut an den WHO-Richtlinien<br />
für Trinkwasserqualität mit und<br />
unterstützt die Umsetzung des<br />
Water Safety Plan. Dieses Konzept<br />
sieht die Sicherstellung der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
von der Quelle bis zum<br />
Endverbraucher vor.<br />
Die Arbeit für die WHO umfasst<br />
auch Auslandseinsätze. Beispielsweise<br />
arbeiten Experten des IHPH in<br />
Zentralasien mit den WHO-Länderbüros<br />
zusammen. Das Kooperationszentrum<br />
hat <strong>sich</strong> zudem auf den<br />
Einsatz moderner Technik spezialisiert.<br />
Geographische Informationssysteme<br />
(GIS) werden zur Sicherung<br />
der Trinkwasserversorgung, bei der<br />
Aufklärung von wasserbedingten<br />
Krankheitsausbrüchen und auch bei<br />
der Verdeutlichung komplexer<br />
Sachverhalte eingesetzt.<br />
Der „Atlas on Water and Health“<br />
(www.waterandhealth.eu), den das<br />
Kollaborationszentrum entwickelt<br />
hat, bietet der Öffentlichkeit Informationen<br />
zu <strong>Wasser</strong> und Gesundheit<br />
in Form von Karten und Factsheets.<br />
Zusätzlich versendet das<br />
Institut den englischsprachigen<br />
Newsletter „Water & Risk“ (http://<br />
www.ihph.de/whoccnews.php).<br />
Kontakt:<br />
Dr. Andrea Rechenburg,<br />
Maria Leppin,<br />
Institut für Hygiene und Öffentliche<br />
Gesundheit der Universität Bonn,<br />
Tel. (0228) 287-19515,<br />
E-Mail: whocc@ukb.uni-bonn.de<br />
Juni 2011<br />
594 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Forschung und Entwicklung<br />
NACHRICHTEN<br />
Giftige Zwerge in der Umwelt?<br />
Nanomaterialien können aquatische Ökosysteme gefährden<br />
Die Zukunftserwartungen an die Nanotechnologie sind hoch. Sie bringt Materialien mit neuartigen Eigenschaften<br />
hervor, gilt als energiesparend und ressourcenschonend. Auf der anderen Seite stehen die Sorge um<br />
gesundheitliche Risiken für den Menschen und eine erhöhte Verbreitung der neuen nanopartikulären Produkte<br />
in der Umwelt. Da die meisten Produkte erst kurze Zeit im Umlauf sind, herrscht Unklarheit über die<br />
Langzeiteffekte. Um Risiken angemessen beurteilen zu können, müssen bestehende Richtlinien zur Prüfung<br />
von Chemikalien ergänzt und angepasst werden, so das Plädoyer der Forschergruppe „Aquatische Ökotoxikologie“<br />
um Prof. Jörg Oehlmann in der aktuellen Ausgabe von „Forschung Frankfurt“. Im Rahmen eines von<br />
der OECD geförderten Projekts überprüft seine Gruppe, welche Auswirkungen Nanopartikel aus Silber und<br />
Titandioxid auf wirbellose Tiere in aquatischen Ökosystemen haben.<br />
Mit steigenden Produktionsmengen<br />
gelangen nanoskalige<br />
Substanzen zunehmend in<br />
Oberflächengewässer: nanoskaliges<br />
Titandioxid aus Fassadenfarbe wird<br />
mit dem Regen in die Gewässer<br />
geschwemmt; Nanosilber aus<br />
Sportbekleidung löst <strong>sich</strong> beim<br />
Waschen aus den Textilien, ebenso<br />
gelangen Nanomaterialien aus Kosmetika<br />
und anderen Körperpflegeprodukten<br />
in die Umwelt. Während<br />
freie Nanopartikel meist größere<br />
Verbände bilden und <strong>sich</strong> bevorzugt<br />
im Sediment eines Gewässers<br />
absetzen, können speziell beschichtete<br />
Nanomaterialien als freie Partikel<br />
durch Strömungen weit im<br />
Gewässer verteilt werden. Es be -<br />
steht die Gefahr, dass im <strong>Wasser</strong><br />
lebende Organismen Nanopartikel<br />
über die Kiemen, die Körperoberfläche<br />
und die Nahrung aufnehmen.<br />
Hilfreich für die Einschätzung des<br />
Umweltrisikos von Nanomaterialien<br />
ist die Untersuchung wirbelloser<br />
Tiere. So genannte Schlüsselarten<br />
geben Auskunft über die Struktur<br />
und Funktion dieser Systeme. Ein<br />
Beispiel sind Daphnien (<strong>Wasser</strong>flöhe),<br />
die zahlreichen Fischarten als<br />
Beute dienen. „Wir konnten zeigen,<br />
dass einige nanopartikuläre Substanzen<br />
bereits in sehr niedrigen<br />
Konzentrationen auf <strong>Wasser</strong>flöhe<br />
toxisch wirken“, fasst Carolin Völker<br />
die Ergebnisse ihrer Untersuchung<br />
zusammen. Die Tiere wurden den<br />
Substanzen über einen Zeitraum<br />
von 48 Stunden ausgesetzt, die<br />
Chemikalien wurden dabei in verschiedenen<br />
Konzentra tionen dargeboten.<br />
Das Ergebnis: Nanoskaliges<br />
Titandioxid reicherte <strong>sich</strong> im Darm<br />
an, und auch der für die Nahrungsaufnahme<br />
essenzielle Filterapparat<br />
der Versuchstiere verklebte. Die Wirkung<br />
von Silbernanopartikeln war<br />
noch drastischer: Sie führte schon<br />
nach 24 Stunden zum Tod.<br />
Ein weiterer Schlüsselorganismus,<br />
die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke,<br />
produziert erheblich<br />
weniger Nachkommen, wenn<br />
sie vier <strong>Wo</strong>chen lang nanoskaligem<br />
Titandioxid oder Silber ausgesetzt<br />
ist. Bei <strong>Wasser</strong>flöhen führte eine<br />
dreiwöchige Behandlung mit nanoskaligem<br />
Titandioxid zu einem verminderten<br />
Wachstum und die<br />
Anzahl an Nachkommen fiel ebenfalls<br />
geringer aus.<br />
Um herauszufinden, ob nanopartikuläre<br />
Substanzen über die<br />
Nahrungskette weitergegeben werden,<br />
fütterten die Forscher ihre Versuchstiere<br />
mit Algen, die zuvor mit<br />
Titandioxidpartikeln behandelt worden<br />
waren. Im Elektronenmikroskop<br />
konnten sie sehen, dass die Partikel<br />
an den Algen haften blieben. Nach<br />
der Verfütterung reicherten <strong>sich</strong><br />
Titandioxidpartikel im Darm der<br />
Daphnien an. „Die Aufnahme über<br />
die Nahrung führte bei den Daphnien<br />
zu einer höheren Sterblichkeit,<br />
als wenn die Partikel über das <strong>Wasser</strong><br />
verabreicht wurden“, erläutert<br />
Völker. Der Nachwuchs, die im Versuch<br />
geborenen Jungtiere wurden<br />
ebenfalls auf ihre Fortpflanzungsleistung<br />
hin untersucht. Hier zeigte<br />
<strong>sich</strong>, dass nachkommende Generationen<br />
erheblich sensibler auf die<br />
Behandlung mit Silbernanopartikeln<br />
reagierten. „Das verdeutlicht, dass<br />
chronische Folgen nanopartikulärer<br />
Substanzen nicht in Kurzzeittests<br />
erfasst werden können“, folgert Jörg<br />
Oehlmann, „Für eine adäquate Risikobewertung<br />
von Nanomaterialien<br />
müssen daher unbedingt Versuche<br />
mit einem verlängerten Expositionszeitraum<br />
durchgeführt werden.“<br />
Informationen:<br />
Carolin Völker,<br />
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität,<br />
Bio-Campus Siesmayerstraße,<br />
Tel. (069) 798- 24900,<br />
E-Mail: c.voelker@bio.uni-frankfurt.de<br />
„Forschung Frankfurt“ 1/2011 im Internet<br />
unter www.forschung-frankfurt.<br />
uni-frankfurt.de/2011/index.html<br />
Kostenlose Bestellung der Printausgabe per<br />
Mail an: ott@pvw.uni-frankfurt.de<br />
Bei den<br />
Versuchstieren<br />
(<strong>Wasser</strong>flöhe),<br />
die mit<br />
Titandioxid<br />
behandelten<br />
Algen gefüttert<br />
wurden, zeigen<br />
<strong>sich</strong> Ablagerungen<br />
im<br />
Darm.<br />
© C. Völker<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 595
NACHRICHTEN<br />
Forschung und Entwicklung<br />
<strong>Wasser</strong> für die Mongolei<br />
In vielen Ländern der Welt ist sauberes <strong>Wasser</strong> ein rares Gut. Die Versorgung der Bevölkerung stellt die Behörden<br />
oft vor Probleme. In der Mongolei zeigt ein interdisziplinäres Forscherteam, wie <strong>sich</strong> die knappen Ressourcen<br />
effektiv nutzen lassen. Eigens entwickelte Software und Messsysteme helfen beim Aufspüren von<br />
Schwachstellen.<br />
Die Brunnen der Jurten von Darkhan sind oft nicht keimfrei.<br />
© Fraunhofer AST<br />
Die Mongolei ist ein Land der<br />
Gegensätze: im Sommer brütend<br />
heiß, im Winter eisig kalt; im<br />
Norden feucht, im Süden staubtrocken.<br />
In der Hauptstadt Ulaanbaatar<br />
lebt eine Million der drei Millionen<br />
Einwohner dicht gedrängt, während<br />
der Rest des riesigen Landes überwiegend<br />
von Nomaden mit ihrem<br />
Vieh genutzt wird. Eine flächendeckende<br />
Versorgung mit sauberem<br />
Trinkwasser ist schwierig: Wer sollte<br />
auf einer Fläche von 1,5 Millionen<br />
Quadratkilometern frost<strong>sich</strong>ere <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
verlegen? So nutzen<br />
die Menschen auf dem Land schon<br />
immer das <strong>Wasser</strong> aus den Flüssen<br />
oder aus Brunnen, die sie selbst graben.<br />
Doch diese traditionelle <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
stößt jetzt an ihre<br />
Grenzen: In den vergangenen Jahrzehnten<br />
wurden die Regenperioden<br />
während der Sommermonate, die<br />
die Grundwasserspeicher aufgefüllt<br />
haben, immer seltener. An ihre Stelle<br />
traten Unwetter mit sintflutartigen<br />
Regengüssen, die oberflächlich<br />
abfließen, weil sie keine Zeit haben,<br />
zu versickern. Gleichzeitig stieg der<br />
<strong>Wasser</strong>bedarf der schnell wachsenden<br />
Bevölkerung. „Die Trinkwasserversorgung<br />
wird immer schwieriger.<br />
Wenn man sie langfristig <strong>sich</strong>ern<br />
will, muss man sehr viele verschiedene<br />
Faktoren berück<strong>sich</strong>tigen und<br />
herausfinden, wie sie <strong>sich</strong> gegenseitig<br />
beeinflussen“, erklärt Dr. Buren<br />
Scharaw vom Fraunhofer-Anwendungszentrum<br />
Systemtechnik AST<br />
in Ilmenau. Der gebürtige Mongole<br />
arbeitet seit vier Jahren am Projekt<br />
MoMo – kurz für „Integriertes <strong>Wasser</strong>-Ressourcenmanagement<br />
in Zentralasien:<br />
Modellregion Mongolei“.<br />
Projektpartner sind die Universitäten<br />
Heidelberg und Kassel, die Bauhaus-Universität<br />
Weimar, das Helmholtz-Zentrum<br />
für Umweltforschung,<br />
das Leibniz-Institut für<br />
Gewässerökologie und Binnenfischerei<br />
sowie private Unternehmen.<br />
Die Modellregion, die die Forscher<br />
unter die Lupe genommen<br />
haben, sind das Einzugsgebiet des<br />
Flusses Kharaa und Darkhan, eine<br />
Stadt mit 100 000 Einwohnern.<br />
Seit Beginn des Projekts 2006 ist<br />
Scharaw mehrmals in seine frühere<br />
Heimat gereist: Er hat die <strong>Wasser</strong>qualität<br />
der öffentlichen und privaten<br />
Brunnen sowie des Verteilungsnetzes<br />
untersucht, den Energieverbrauch<br />
der Pumpen gemessen, die<br />
Effektivität des Klärwerks erforscht.<br />
Alle Daten wurden in am AST entwickelte<br />
Computermodelle einge -<br />
speist. „Mit unserer <strong>Wasser</strong>management-Lösung<br />
HydroDyn haben wir<br />
erstmals die Möglichkeit, so<strong>wohl</strong><br />
die Qualität als auch die Quantität<br />
der <strong>Wasser</strong>flüsse <strong>sich</strong>tbar zu ma -<br />
chen und eine künftige Entwicklung<br />
zu modellieren“, erläutert der<br />
Forscher. Der Status Quo ist verbesserungsfähig:<br />
Die <strong>Wasser</strong>pumpen<br />
benötigen viel Energie, die Leitungen<br />
sind marode, fast die Hälfte des<br />
Trinkwassers versickert auf dem<br />
Weg zum Verbraucher. Viele Jurten<br />
verfügen über eigene Brunnen, das<br />
<strong>Wasser</strong> ist jedoch häufig mit Keimen<br />
kontaminiert, die von Latrinen eingeschwemmt<br />
werden. Was also ist<br />
zu tun? „Nachdem wir Daten erfasst<br />
und Modelle erstellt haben, beginnen<br />
wir jetzt, ökonomisch und ökologisch<br />
sinnvolle Vorschläge zu erarbeiten“,<br />
sagt Scharaw. Sein Team hat<br />
hierfür eine Software entwickelt, die<br />
ermittelt, wie <strong>sich</strong> die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
energiesparend und nachhaltig<br />
<strong>sich</strong>ern lässt.<br />
Um die Verluste im Trinkwasserverteilungs-Netz<br />
zu minimieren, ha -<br />
ben die Fraunhofer-Forscher außerdem<br />
ein Messsystem entwickelt, mit<br />
dem <strong>sich</strong> Lecks orten lassen: Kleine<br />
Sensoren registrieren Druckabfall in<br />
den Leitungen, so lassen <strong>sich</strong> Löcher<br />
relativ genau lokalisieren. Ist die<br />
undichte Stelle ausgemacht, kann<br />
Juni 2011<br />
596 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Forschung und Entwicklung<br />
NACHRICHTEN<br />
der betroffene Leitungsabschnitt<br />
gezielt ausgebessert werden. Um<br />
die Schadstoffbelastung der Gewässer<br />
zu senken und die Effektivität<br />
des bisherigen Klärwerks zu steigern,<br />
bauen die MoMo-Forscher<br />
jetzt eine Versuchskläranlage, die<br />
Mikroorganismen in hoher Konzentration<br />
enthält: „Wir erwarten, dass<br />
diese Anlage auch in der kalten Jahreszeit,<br />
wenn die Aktivität der Mikroorganismen<br />
abnimmt, noch gute<br />
Ergebnisse liefert. Diese Resultate<br />
lassen <strong>sich</strong> dann auf eine künftige<br />
Anlage übertragen.“ In drei Jahren,<br />
wenn das MoMo-Projekt abgeschlossen<br />
ist, wollen die Experten<br />
der Verwaltung in Darkhan einen<br />
Maßnahmenkatalog vorlegen, der<br />
zeigt, wie <strong>sich</strong> die <strong>Wasser</strong>ver- und<br />
-entsorgung in Zukunft effizient<br />
und kostengünstig <strong>sich</strong>ern lässt.<br />
Einen seiner größten Erfolge sieht<br />
Scharaw darin, dass seine Ergebnisse<br />
die mongolischen Behörden<br />
bewogen haben, den Bergbau<br />
bereits in einigen Regionen des<br />
Kharaa-Einzugsgebiets zu stoppen:<br />
ein Gewinn, der weit über die Verbesserung<br />
des Trinkwassers von<br />
Darkhan hinausreicht.<br />
Kontakt:<br />
Dr. Buren Scharaw,<br />
Fraunhofer-Anwendungszentrum für<br />
Systemtechnik Ilmenau (IOSB),<br />
Am Vogelherd 50,<br />
D-98693 Ilmenau<br />
Tel. (03677) 461-121,<br />
Fax (03677) 461-100<br />
Lanthan belastet Rhein mit Konzentrationen bis<br />
zum 46-fachen des natürlichen Wertes<br />
Der Rhein ist von <strong>Wo</strong>rms flussabwärts<br />
über eine Länge von<br />
weit über 400 km mit dem Seltenen-<br />
Erden-Element Lanthan belastet. In<br />
Mainz liegt der gemessene Wert<br />
beim 46-fachen der natürlichen<br />
Konzentration, im Flussabschnitt<br />
Bonn-Leverkusen-Neuss bei mehr<br />
als dem 25-fachen. Dies ist das<br />
Ergebnis einer aktuellen Studie der<br />
Geochemiker Michael Bau und Serkan<br />
Kulaksiz von der Jacobs<br />
University (vergl. Umwelt-Fachzeitschrift<br />
Environment International<br />
DOI:10.1016/j.envint.2011.02.018).<br />
Damit ist der Rhein das erste Gewässer<br />
weltweit, in dem eine solche<br />
Kontamination beobachtet wurde.<br />
Die Lage der Einleitungsstelle<br />
bei <strong>Wo</strong>rms deutet darauf hin, dass<br />
das Lanthan aus der dortigen Produktion<br />
von chemischen Katalysatoren<br />
für Erdölraffinerien stammt,<br />
bei der das Seltenen-Erden-Element<br />
in das Industrieabwasser gerät. Eine<br />
grobe Abschätzung lässt vermuten,<br />
dass pro Jahr nahezu 1,5 Tonnen<br />
Lanthan verloren gehen und über<br />
den Rhein in den Ärmelkanal und<br />
letztlich in die Nordsee gelangen.<br />
Während die im Rheinwasser auftretenden<br />
Lanthanmengen als<br />
gesundheitlich unbedenklich gelten,<br />
liegen die extrem hohen Konzentrationen<br />
von bis zu 49 mg/kg<br />
Lanthan, die an der Einleitungsstelle<br />
gemessen wurden, oberhalb der<br />
Werte, für die bereits ökotoxikologische<br />
Effekte beobachtet wurden.<br />
Fragen zu der Studie beantwortet:<br />
Dr. Michael Bau,<br />
Professor of Geoscience,<br />
Jacobs University Bremen,<br />
Tel. (0421) 200-3564,<br />
E-Mail: m.bau@jacobs-university.de<br />
Lanthan bildet den Prototyp für die Lanthanoide, die<br />
Elemente 58–71. Wie diese ist es silbern und relativ<br />
weich. Wenn man es mit zu diesen zählt, dann ist es<br />
das reaktivste dieser Metalle und das mit dem größten<br />
Atomdurchmesser. Verwendet wird es meist als<br />
Legierungszusatz für Spezialanwendungen und in<br />
einigen Batterien. In der Natur kommt es stets<br />
gebunden vor.<br />
Quelle: http://jumk.de/mein-pse/lanthan.php<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 597
NACHRICHTEN<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Vatikan: Forschergruppe warnt vor<br />
Gletscherschmelze<br />
Eine Arbeitsgruppe von weltweit führenden Klimaforschern hat einen Bericht zum globalen Rückgang der<br />
Gletscher veröffentlicht. Darin betonen die Wissenschaftler die moralische Verpflichtung gegenüber der<br />
Gesellschaft zu einem angemessenen Umgang mit dem Klimawandel. Einer der Autoren ist der Klimaforscher<br />
Prof. Georg Kaser von der Universität Innsbruck.<br />
Univ.-Prof. Dr.<br />
Georg Kaser,<br />
Universität<br />
Innsbruck.<br />
Der Bericht “Fate of Mountain<br />
Glaciers in the Anthropocene”<br />
listet zahlreiche Beispiele von <strong>sich</strong><br />
zurückziehenden Gletschern rund<br />
um die Erde auf und verdeutlicht<br />
den Zusammenhang mit dem vom<br />
Menschen verursachten Klimawandel<br />
und der Luftverschmutzung. Die<br />
Gefährdung von Lebensräumen,<br />
deren <strong>Wasser</strong>versorgung von Gletschern<br />
und Schnee abhängig sind,<br />
verlangt nach unmittelbaren Maßnahmen<br />
zur Entschärfung der<br />
Effekte des Klimawandels und zur<br />
Anpassung an den Wandel.<br />
Die Gruppe wird von Nobelpreisträger<br />
Paul Crutzen, dem früheren<br />
Leiter des Europäischen Wetterdienstes,<br />
Lennart Bengtsson und<br />
Veerabhadran Ramanathan vom<br />
Scripps Research Institute geleitet.<br />
Ebenfalls Mitglied ist Nobelpreisträger<br />
und ehemaliger CERN-Direktor<br />
Carlo Rubbia. Unter den insgesamt<br />
24 Autorinnen und Autoren sind<br />
weiters Georg Kaser, Österreich,<br />
Hans Joachim Schellnhuber,<br />
Deutsch land, Wilfried Haeberli und<br />
Thomas Stocker, Schweiz, Lonnie<br />
Thompson aus den USA.<br />
Sofortige Maßnahmen<br />
notwendig<br />
„Der verbreitete Rückgang von<br />
Schnee und Eis auf den Gebirgsgletschern<br />
ist eines der <strong>sich</strong>tbarsten<br />
Zeichen für den globalen Klimawandel.<br />
Der Verlust vieler kleiner<br />
Gletscher im Himalaya ist sehr<br />
bestürzend für mich, weil diese<br />
Region als <strong>Wasser</strong>turm Asiens dient<br />
und so<strong>wohl</strong> die Treibhausgase als<br />
auch die Luftverschmutzung zum<br />
Abschmelzen der Gletscher beitragen“,<br />
sagt Ramanathan, der seit<br />
2004 Mitglied der Päpstlichen Akademie<br />
der Wissenschaften ist.<br />
Ob<strong>wohl</strong> Wissenschaftler gewöhnlich<br />
davon Abstand nehmen, konkrete<br />
Maßnahmen vorzuschlagen,<br />
sagt Ramanathan, berechtigten die<br />
Umstände weit reichende Vorschläge<br />
der Arbeitsgruppe. Die<br />
Autoren empfehlen drei Maßnahmen:<br />
die sofortige Reduktion des<br />
weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes,<br />
die Reduktion der Luftverschmutzung<br />
um 50 Prozent und<br />
Vorbereitungen auf die Veränderungen<br />
durch den Klimawandel.<br />
Bericht soll Aufmerksamkeit<br />
erhöhen<br />
„Die Gletscher rund um den Erdball<br />
verändern <strong>sich</strong> rasant und die Auswirkungen<br />
davon werden nachteilige<br />
sein, besonders in den hoch<br />
gelegenen Gebirgsregionen von<br />
Südamerika und Asien“, sagt Georg<br />
Kaser vom Institut für Meteorologie<br />
und Geophysik der Universität Innsbruck.<br />
„Unser Verständnis von den<br />
Veränderungen in diesen Regionen<br />
ist aber nach wie vor begrenzt. Es<br />
sind ambitionierte, gemeinsame<br />
Bemühungen notwendig, um auf<br />
diese Probleme zu reagieren. Mit<br />
diesem Bericht trägt die Päpstliche<br />
Akademie dazu bei, die Aufmerksamkeit<br />
dafür zu erhöhen.“<br />
„Gletscher sind eines der <strong>sich</strong>tbarsten<br />
Zeichen für den globalen<br />
Klimawandel“, sagt Lonnie Thompson.<br />
„Wir appellieren an alle Staaten,<br />
unverzüglich effektive und gerechte<br />
Maßnahmen zu entwickeln und einzuführen,<br />
um die Ursachen und die<br />
Folgen des Klimawandels für die<br />
Gesellschaft und Ökosysteme zu<br />
reduzieren. Denn wir leben alle im<br />
gleichen Haus. Indem wir jetzt im<br />
Geist von Gemeinsamkeit und differenzierter<br />
Verantwortlichkeit handeln,<br />
akzeptieren wir unsere Verantwortung<br />
für einander und für einen<br />
Planeten, der mit dem Geschenk<br />
des Lebens gesegnet ist.<br />
Die Autoren des Berichts trafen<br />
<strong>sich</strong> von 2. bis 4. April 2011 auf<br />
Einladung von Kanzler Marcelo<br />
Sanchez Sorondo in der Päpstlichen<br />
Akademie. Der Bericht wurde<br />
Anfang Mai veröffentlicht und<br />
wurde dem Papst vorgelegt.<br />
Der Titel des Berichts bezieht<br />
<strong>sich</strong> auf einen Begriff, den Nobelpreisträger<br />
Paul Crutzen geprägt<br />
hat. Mit Anthropozän bezeichnet er<br />
ein neues Erdzeitalter, das einsetzte,<br />
als der Einfluss des Menschen auf<br />
den Planeten zu einem entscheidenden<br />
Faktor für Umwelt und Klimawandel<br />
wurde.<br />
Kontakt:<br />
Prof. Georg Kaser,<br />
Institut für Meteorologie und Geophysik,<br />
Universität Innsbruck,<br />
Tel. +43 512 507 5457,<br />
E-Mail: Georg.Kaser@uibk.ac.at<br />
Dr. Christian Flatz,<br />
Büro für Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Universität Innsbruck,<br />
Tel. +43 512 507 32022,<br />
E-Mail: presse@uibk.ac.at<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/index.htm<br />
-<br />
Bericht “Fate of Mountain Glaciers in the<br />
Anthropocene”<br />
Juni 2011<br />
598 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Leute<br />
NACHRICHTEN<br />
Höchste Auszeichnung des VDI für<br />
Professor Hans-Jörg Bullinger<br />
Auf dem 25. Deutschen Ingenieurtag<br />
am 24. Mai wurde Prof.<br />
Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, Präsident<br />
der Fraunhofer-Gesellschaft,<br />
mit der Grashof-Denkmünze, der<br />
höchsten Auszeichnung des Vereins<br />
Deutscher Ingenieure geehrt. Der<br />
VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Bruno O.<br />
Braun würdigte Bullingers langjährige,<br />
herausragende Arbeit und<br />
seine Verdienste für das Ingenieurwesen.<br />
Er habe als Wissenschaftler,<br />
Hochschullehrer und Ideenmanager<br />
stets einen ganzheitlichen<br />
Ansatz bei der Behandlung von Problemen<br />
gefunden, begründete der<br />
VDI die Ehrung. Kennzeichen der<br />
Forschung von Prof. Hans-Jörg<br />
Bullinger sei die konsequente Ausrichtung<br />
auf den »Menschen als<br />
Maß der Technik«. Bei allen Bestrebungen,<br />
die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der deutschen Wirtschaft zu steigern,<br />
erkannte er frühzeitig die<br />
Bedeutung der menschengerechten<br />
Arbeitsgestaltung und setzte<br />
seine Forschungsergebnisse in die<br />
Praxis um. Er leistete hiermit einen<br />
erheblichen Beitrag zur Verbesserung<br />
der Arbeitsqualität in Deutschland.<br />
Prof. Bullinger wirkte als Vordenker<br />
und Initiator künftiger gesellschaftlicher<br />
Entwicklungen auch<br />
konkret bei der Gestaltung wichtiger<br />
Entscheidungen der Gegenwart<br />
mit. So hat er die öffentliche Diskussion<br />
der vergangenen Jahre über<br />
die Entwicklung der Industriegesellschaft<br />
hin zur Dienstleistungsgesellschaft<br />
entscheidend mitgeprägt. Als<br />
Brückenbauer zwischen Wissenschaft<br />
und Wirtschaft hat Hans-Jörg<br />
Bullinger in seiner Zeit als Institutsleiter<br />
des Fraunhofer-Instituts für<br />
Arbeitswirtschaft und Organisation<br />
IAO eine der führenden Institutionen<br />
für technische und prozessuale<br />
Innovationen in Europa aufgebaut.<br />
Auch sein Wirken als Fraunhofer-<br />
Präsident seit 2002 steht unter dem<br />
Zeichen der Vernetzung von Forschung<br />
mit Industrie und Politik.<br />
Gleichzeitig sieht er die Verantwortung<br />
für den Standort Deutschland<br />
und stößt immer wieder Aktivitäten<br />
an, um die Innovationsfähigkeit zu<br />
stärken und das Innovationstempo<br />
zu steigern. „Die Auszeichnung mit<br />
der Grashof-Denkmünze ist eine<br />
große Ehre und freut mich ganz<br />
besonders, denn auch wenn ich<br />
mittlerweile mehr als Technologieund<br />
Innovationsmanager agiere,<br />
habe ich in der Ingenieurwissenschaft<br />
meine berufliche Heimat“,<br />
freut <strong>sich</strong> Prof. Bullinger.<br />
Die Grashof-Denkmünze wurde<br />
1894 gestiftet zur Erinnerung an<br />
Franz Grashof, Professor der theoretischen<br />
Maschinenlehre an der<br />
Technischen Hochschule Karlsruhe.<br />
Grashof war Mitbegründer und erster<br />
Direktor des VDI. Die aus Gold<br />
geprägte Münze wird auf Beschluss<br />
des VDI-Präsidiums an Ingenieure<br />
verliehen, die hervorragende wissenschaftliche<br />
oder berufliche Leistungen<br />
auf technischem Gebiet<br />
erbracht haben.<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Hans-Jörg<br />
Bullinger.<br />
© Bernhard Huber/<br />
Fraunhofer<br />
Gotthard Graß neuer Hauptgeschäftsführer<br />
der figawa e.V.<br />
Am 2. Mai 2011 hat Dipl.-Wirtschafts-Ing.<br />
Gotthard Graß (53)<br />
die Hauptgeschäftsführung der<br />
Bundesvereinigung der Firmen im<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e.V. – figawa,<br />
Köln, übernommen. Mit rund 1000<br />
Mitgliedsunternehmen ist die<br />
figawa der mitgliederstärkste technisch-wissenschaftliche<br />
Verband<br />
von Hersteller- und Dienstleistungsunternehmen<br />
für die Gas- und <strong>Wasser</strong>technik<br />
und Rohrleitungsbau.<br />
Graß war von 1991 bis 2008 für<br />
den ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik-<br />
und Elektronikindustrie<br />
tätig, zwischen 2002 und 2008 war<br />
er Hauptgeschäftsführer des Verbandes.<br />
In dieser Funktion hat er<br />
unter anderem die strategische<br />
Ausrichtung maßgeblich mitgestaltet<br />
und Kernprojekte wie die Entwicklung<br />
des europaweit effizientesten<br />
Systems zur Elektrogeräteentsorgung,<br />
die Neuausrichtung<br />
der Hannover-Messe oder die Entwicklung<br />
so genannter Technologie-Roadmaps<br />
maßgeblich erarbeitet.<br />
In die Arbeit für die figawa bringt<br />
er zudem breite Erfahrungen als<br />
Unternehmensberater mit Schwerpunkten<br />
in den Bereichen Strategie,<br />
Innovationsprozesse, Kommunikation<br />
und Marketing von unternehmensbezogenen<br />
Dienstleistungen<br />
ein.<br />
Gotthard Graß.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 599
NACHRICHTEN<br />
Vereine, Verbände und Organisationen<br />
wat im neuen Gewand<br />
Alle relevanten Fachverbände der <strong>Wasser</strong>wirtschaft organisieren<br />
gemeinsamen Kongress wat + WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2011<br />
Alle Jahre wieder trifft <strong>sich</strong> die<br />
deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft auf<br />
der wat. Diesmal fand die Veranstaltung<br />
als „wat + WASSER BERLIN<br />
INTERNATIONAL 2011“ im Rahmen<br />
der europäischen Leitmesse für<br />
<strong>Wasser</strong>ver- und -entsorgung statt.<br />
Möglich wurde dies, indem <strong>sich</strong> alle<br />
relevanten Verbände unter Federführung<br />
des DVGW mit ihrem<br />
Know-how in einen gemeinsamen<br />
Kongress eingebracht haben.<br />
Zum Vorteil der Besucher. Denn<br />
entstanden ist eine einmalige Veranstaltung,<br />
wie es sie in dieser<br />
Breite und Aktualität in Deutschland<br />
bisher noch nicht gegeben hat.<br />
In der Zeit vom 2. bis 5. Mai berichteten<br />
über 120 hochkarätige Experten<br />
aus Forschung, Wirtschaft und<br />
Politik in 18 Themenblöcken über<br />
alles, was die <strong>Wasser</strong>wirtschaft zurzeit<br />
bewegt. Über 1500 Teilnehmer<br />
nahmen die Gelegenheit wahr, um<br />
eine Kombination aus Fachvorträgen<br />
und Diskussionen zu besuchen<br />
und Anregungen für ihr Tagesgeschäft<br />
mitzunehmen.<br />
Den Auftakt bildete am 2. Mai<br />
die offizielle Eröffnungsveranstaltung.<br />
In seinem Grußwort betonte<br />
Ministerialdirigent Dr. Fritz Holzwarth<br />
vom Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und Reaktor<strong>sich</strong>erheit,<br />
dass Kongress und Fachmesse<br />
eine wichtige Plattform sind,<br />
um leistungsfähige deutsche Technologien<br />
erfolgreich international<br />
einzusetzen. Daran, dass es hohen<br />
Bedarf gibt, ließ der Vertreter des<br />
BMU keinen Zweifel. Derzeit hätten<br />
rund 880 Millionen Menschen keinen<br />
direkten Zugang zu Trinkwasser.<br />
Ein weiterer Punkt, den er<br />
ansprach, war die Energieeffizienz.<br />
Hier sei Deutschland auf einem<br />
guten Weg, doch müsse man ange<strong>sich</strong>ts<br />
globaler Herausforderungen<br />
wie dem Klimawandel noch besser<br />
werden.<br />
Diskussionsrunde zu<br />
aktuellen <strong>Wasser</strong>themen<br />
Anschließend kamen Vertreter der<br />
Verbände in einer von FAZ-Wirtschaftsredakteur<br />
Andreas Mihm<br />
kurzweilig moderierten Diskussionsrunde<br />
zu <strong>Wo</strong>rt. Innerhalb eines<br />
breiten Themenspektrums wurde<br />
dargestellt, dass hin<strong>sich</strong>tlich der<br />
<strong>Wasser</strong>ver- und -entsorgung ein<br />
großer Konsens innerhalb der<br />
Bevölkerung bestehe. Deshalb sei<br />
die Situation auch nicht mit den<br />
kontroversen Diskussionen in der<br />
Energiewirtschaft zu vergleichen.<br />
Weiter wurde herausgestellt, dass<br />
die Regelsetzung des DVGW für<br />
einen hohen technischen Standard<br />
steht. Dies, wie auch die übrigen<br />
Aktivitäten der Branche, sei eine<br />
hervorragende Voraussetzung, um<br />
die gute internationale Position der<br />
deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft weiter<br />
auszubauen. Mit Blick auf neue Herausforderungen<br />
wie CO 2 -Einsparungen<br />
oder die vierte Reinigungsstufe<br />
ermahnten die Verbändevertreter,<br />
die Kosten im Auge zu behalten.<br />
Unabhängig von den zu erzielenden<br />
Resultaten müssten die Maßnahmen<br />
auch bezahlbar sein.<br />
Die weltweite <strong>Wasser</strong>situation<br />
beleuchtete Eric Heyman von DB-<br />
Research. In seinem Keynote-Vortrag<br />
bezeichnete er den Einsatz von<br />
<strong>Wasser</strong> in der Landwirtschaft, die<br />
zunehmende Urbanisierung und<br />
den Klimawandel als die wichtigsten<br />
Themen. <strong>Wasser</strong> gebe es zwar<br />
genug, um den jährlich um etwa<br />
drei Prozent steigenden Bedarf zu<br />
decken, doch seien die Vorkommen<br />
sehr unterschiedlich verteilt. Für<br />
den weiteren weltweiten Ausbau<br />
der <strong>Wasser</strong>ver- und -entsorgung<br />
komme es entscheidend darauf an,<br />
dass es kostendeckende Preise<br />
gebe. Subventionen würden dagegen<br />
Investoren abschrecken und<br />
die Verschwendung fördern. Den<br />
globalen jährlichen Investitionsbedarf<br />
in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft bezifferte<br />
er auf 400 bis 500 Milliarden<br />
Euro. Das ist der Umfang, in dem in<br />
den Ausbau der Infrastruktur investiert<br />
werden müsste. Tatsächlich<br />
lägen die Ausgaben aufgrund fehlender<br />
finanzieller Mittel aber deutlich<br />
darunter.<br />
Handlungsbedarf in<br />
Ost- und Zentralasien<br />
Peter Gammeltoft, Abteilungsleiter<br />
Direktion Umwelt in der Europäischen<br />
Kommission, unterstrich die<br />
zunehmende Bedeutung von <strong>Wasser</strong>.<br />
<strong>Wasser</strong> könne durch nichts<br />
anderes ersetzt werden. Dementsprechend<br />
sei es wichtig, Knowhow<br />
in unterentwickelte Länder zu<br />
liefern und Forschungsaktivitäten<br />
weiter mit Nachdruck voranzutreiben.<br />
Last but not least kam Anatolij<br />
A. Popov, Stellvertretender Minister<br />
für Regionalentwicklung der russischen<br />
Föderation, in der Eröffnungsveranstaltung<br />
zu <strong>Wo</strong>rt. Neben<br />
qualitativ hochwertigem Trinkwasser<br />
gebe es insbesondere in Ostund<br />
Zentralasien Regionen, in<br />
denen die Bevölkerung wenig für<br />
die <strong>Wasser</strong>versorgung bezahlen<br />
könne und die Anlagen vielfach veraltet<br />
seien. Eine Situation, die nach<br />
seinen <strong>Wo</strong>rten durch den Einsatz<br />
moderner effizienter Technologien<br />
und qualifiziertes Personal auf allen<br />
Ebenen verbessert werden solle.<br />
Den anschließenden Kongresspart<br />
mit seinen über 100 Referenten<br />
ausführlich wiederzugeben,<br />
ist im Rahmen dieses Berichtes<br />
nicht möglich. Alle Aspekte kann<br />
nur ein Tagungsband umfassend<br />
darstellen. Dennoch geben ausgesuchte<br />
Veranstaltungsblöcke – stellvertretend<br />
für den Gesamtkongress<br />
– die Vielfalt und die Qualität der<br />
Themen wieder. Ein Beispiel dafür<br />
sind die Vorträge zur Sicherheit in<br />
Juni 2011<br />
600 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Vereine, Verbände und Organisationen<br />
NACHRICHTEN<br />
der Trinkwasserversorgung. Um das<br />
Fazit gleich vorweg zu nehmen:<br />
Wenn <strong>sich</strong> alle an die technischen<br />
Regeln des DVGW hielten, gäbe es<br />
deutlich weniger Sanierungsbedarf,<br />
hieß es. Während die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
bis zum Hausanschluss in<br />
höchster Qualität erfolgt, können<br />
dagegen Probleme in der häuslichen<br />
Infrastruktur auftreten, beispielsweise<br />
durch eine Verkeimung<br />
des <strong>Wasser</strong>s. Die Ursachen dafür<br />
sind unterschiedlich. <strong>Wasser</strong>, das zu<br />
lange in der Leitung steht oder zu<br />
warm ist, ist besonders anfällig für<br />
die Bildung von Legionellen. Abhilfe<br />
können hier an den tatsächlichen<br />
Verbrauch angepasste Speichergrößen,<br />
regelmäßige Wartungsar beiten<br />
und die Einhaltung der Leitungstemperatur<br />
nach DVGW W 551<br />
schaffen. Für weiteren Handlungsbedarf<br />
sorgen eine über die Jahre<br />
veränderte <strong>Wo</strong>hnraumnutzung und<br />
Fehler bei der Installation. Laut<br />
einer Erhebung des <strong>Wasser</strong>hygiene-<br />
Experten Rainer Kryschi gehen<br />
37 Prozent von über 300 untersuchten<br />
Schäden auf eine falsche Planung<br />
zurück; in 33 Prozent waren<br />
die Installationsarbeiten schlecht<br />
durchgeführt.<br />
Armaturen <strong>sich</strong>ern hohe<br />
<strong>Wasser</strong>qualität<br />
Eine andere technische Komponente,<br />
die auf der Veranstaltung diskutiert<br />
wurde, waren Armaturen zur<br />
Sicherung der <strong>Wasser</strong>qualität im<br />
häuslichen Verteilbereich. Es wurde<br />
darauf hingewiesen, dass DIN 1717<br />
für den aktuellen Stand der Technik<br />
steht. Konkret verhindern die Armaturen,<br />
dass verunreinigtes <strong>Wasser</strong><br />
über Rückdrücke und Rücksaugen<br />
aus Geräten wie Spülmaschinen,<br />
Waschmaschinen oder Heizungsanlagen<br />
in den <strong>Wasser</strong>kreislauf<br />
gelangt. Ob<strong>wohl</strong> hier intensiv informiert<br />
und mit dem Handwerk<br />
gesprochen wird, sind laut Aussage<br />
der Fachleute immer wieder gravierende<br />
Mängel bei der Installation<br />
anzutreffen. Ist das „Kind dann in<br />
den Brunnen gefallen“, bleibt oftmals<br />
nur die Desinfektion des<br />
betroffen Verteilsystems. Im Kongress<br />
war man <strong>sich</strong> weitestgehend<br />
einig, dass dies aber nur eine vorübergehende<br />
Maßnahme sein kann.<br />
Grundsätzlich gelte es, die Desinfektion<br />
nur zur Gefahrenabwehr einzusetzen<br />
und nur so viel zu desinfizieren,<br />
wie wirklich erforderlich ist.<br />
Ein weiterer Kongressblock widmete<br />
<strong>sich</strong> dem vorgelagerten<br />
Gewässerschutz. Mit Blick auf die<br />
vierte Reinigungsstufe und den Eintrag<br />
von Medikamentenrückständen<br />
in den <strong>Abwasser</strong>kreislauf be -<br />
stehe noch erheblicher Forschungsbedarf,<br />
war auf der Veranstaltung zu<br />
hören. Auch gebe es zahlreiche<br />
offene Fragen, wer Verursacher sei<br />
und damit die Kosten zu tragen<br />
habe. Zwar stünden einzelne Bereiche<br />
wie Pharmaindustrie, Apotheken<br />
oder <strong>Wasser</strong>entsorgungsunternehmen<br />
besonders im Fokus, doch<br />
spreche vieles dafür, dass es letztendlich<br />
auf eine gesamtgesellschaftliche<br />
Verantwortung hinauslaufe.<br />
Thematisiert wurde auch das<br />
Verhältnis von Pflanzen- zu Gewässerschutz.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
wies Frieder Haakh vom<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart, darauf hin, dass<br />
die Belastungssituation durch Metaboliten<br />
im Trinkwasser unklar sei.<br />
Auch der rechtliche Rahmen, der<br />
einmal den Pflanzenschutz behandelt<br />
und zum anderen die Trinkwasserqualität<br />
regelt, helfe hier nicht<br />
weiter. Es handle <strong>sich</strong> um zwei<br />
unterschiedliche Rechtsbereiche,<br />
die nicht optimal aufeinander abgestimmt<br />
sind, machte der Experte<br />
deutlich. Dass das Thema weiter<br />
eng verfolgt werden muss, ergibt<br />
<strong>sich</strong> schon alleine aus der Menge<br />
der eingesetzten Pflanzenschutzmittel.<br />
So werden in Deutschland<br />
pro Jahr unter anderem 15 000 Tonnen<br />
Herbizide und 11 000 Fungizide<br />
eingesetzt. Um die aktuelle Situation<br />
zu verbessern, sollen rechtliche<br />
Lücken geschlossen, mehr Transparenz<br />
geschaffen und Probleme frühzeitig<br />
angegangen werden – beispielsweise<br />
durch den Aufbau einer<br />
Teilnehmer diskutieren lebhaft über die „Perspektiven<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft –Trends und Erwartungen<br />
für die nächsten zehn Jahre“.<br />
Rohwasser-Datenbank und die<br />
Ergänzung der Grundwasser-Verordnung.<br />
Sorgfalt bei „Eingriffen“<br />
in den Boden<br />
Darüber hinaus wurden „Eingriffe“<br />
in den Boden behandelt. Sie entstehen<br />
insbesondere bei der Geothermie,<br />
bei CCS und Bohrungen zur<br />
Förderung von Schiefergas. Michael<br />
Richter vom Aggerverband in Gummersbach<br />
betonte, dass Bohrungen<br />
über 100 Meter Tiefe nicht alleine<br />
nach dem Bergrecht geregelt sein<br />
dürfen. Zum übergeordneten<br />
Schutz des Trinkwassers sei auch die<br />
Berück<strong>sich</strong>tigung entsprechender<br />
wasserrechtlicher Vorschriften notwendig.<br />
Als Beispiel wurde die<br />
EUCCS-Richtlinie genannt. Sie sieht<br />
Erprobungen bis 2017 vor. Erst<br />
danach soll auf Basis der vorliegenden<br />
Erfahrungen entschieden werden,<br />
ob und wie es weitergeht.<br />
Das dritte Kongressbeispiel ist<br />
die Geothermie. Vor dem Hintergrund<br />
der zunehmenden Verbreitung<br />
ging es hier vor allem um die<br />
Qualität bei den Bohrungen und<br />
der anschließenden Installation der<br />
Erdsonden. Alleine für Baden-Württemberg<br />
wurden rund 22 000 Anlagen<br />
genannt. Bohren würden viele<br />
Firmen, hieß es, doch ob sie auch<br />
die notwendige Erfahrung für die<br />
jeweilige geologische Beschaffenheit<br />
haben, stehe auf einem anderen<br />
Blatt. Ein Qualitätskriterium<br />
ist derzeit das DVGW-Arbeitsblatt<br />
<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 601
NACHRICHTEN<br />
Vereine, Verbände und Organisationen<br />
W 120, das seit 20 Jahren den Standard<br />
für die Planung und den Bau in<br />
der <strong>Wasser</strong>gewinnung darstellt. Für<br />
noch mehr Qualität soll es künftig<br />
durch eine neue W 120, die aktuell<br />
im Umsetzungsprozess ist, abgelöst<br />
werden. Karl Heinz Stawiarski vom<br />
Bundesverband Wärmepumpen e.V.<br />
empfahl, bei der Planung die Bedingungen<br />
vor Ort genau zu berück<strong>sich</strong>tigen,<br />
nur hochwertige Komponenten<br />
einzusetzen und diese aufeinander<br />
abzustimmen sowie auf<br />
die exakte Ausführung der Bohrarbeiten<br />
und das anschließende Verpressen<br />
der Bohrlöcher zu achten.<br />
Zusätzlich sprach er <strong>sich</strong> für eine<br />
Anzeigepflicht für Sondenbohrungen<br />
aus. Ein Kollege brachte es auf<br />
den Punkt: „Wenn jemand im Grundwasser<br />
herumwühlt, muss das auch<br />
genehmigt sein.“ Leider sieht die<br />
Realität aber manchmal anders<br />
aus. Der teils erhebliche Zuwachs<br />
an Geothermie-Anlagen erschwere<br />
eine Abstimmung mit den zuständigen<br />
Stellen, wurde berichtet. Und<br />
wenn einmal eine Sonde fest<br />
zementiert im Erdreich ist, lassen<br />
<strong>sich</strong> Fehler bei der Bauausführung<br />
kaum nachweisen. Derzeit gibt es in<br />
Deutschland rund 400 000 Wärmepumpen,<br />
bis zum Jahr 2030 sollen<br />
es nach Aussage des Bundesverbandes<br />
Wärmepumpen über zwei<br />
Millionen sein.<br />
Der Kongress bot eine hohe<br />
fachliche Dichte an vier Tagen. Laut<br />
Aussage der Veranstalter ist es<br />
erklärtes Ziel des Kongresses „wat +<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
2011“, einen hohen Nutz- und Informationswert<br />
zu schaffen. Fragt man<br />
die Kongressteilnehmer nach ihren<br />
Eindrücken, so bekommt man fast<br />
durchgehend zur Antwort: Ziel<br />
erreicht.<br />
Dr. Susanne Hinz/Sabine Wächter<br />
figawa und rbv erneuern Vereinbarung<br />
rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann,<br />
rbv-Präsident Dipl.-Ing. Klaus Küsel, der Präsident<br />
der figawa Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank<br />
und figawa-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtschafts-<br />
Ing. Gotthard Graß (v.l.n.r.) bei der Unterzeichnung<br />
der neuen Vereinbarung, welche die Zusammenarbeit<br />
der Verbände zukünftig regelt.<br />
Am 2. Mai haben die Bundesvereinigung<br />
der Firmen im Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>fach e.V. (figawa) und<br />
der Rohrleitungsbauverband e.V.<br />
(rbv) ihre Zusammenarbeit vertraglich<br />
neu geregelt. Der Präsident der<br />
figawa, Prof. e.h. (RUS) Bernd<br />
H. Schwank und rbv-Präsident<br />
Dipl.-Ing. Klaus Küsel, unterzeichneten<br />
im Rahmen der WASSER BERLIN<br />
INTERNATIONAL 2011 eine neu ge -<br />
troffene Vereinbarung, welche die<br />
Zusammenarbeit der beiden namhaften<br />
Verbände zukünftig regelt.<br />
figawa und rbv arbeiten seit 1950<br />
eng zusammen. Der Rohrleitungsbauverband<br />
bildet die stärkste<br />
Gruppe innerhalb der figawa und<br />
repräsentiert die Fachgruppe Rohrleitungsbau,<br />
die <strong>sich</strong> satzungsgemäß<br />
mit den Medien Gas und<br />
<strong>Wasser</strong> beschäftigt. Details zur<br />
Verbands- und Geschäftsstellengemeinschaft<br />
wurden erstmals in einer<br />
Vereinbarung im Jahre 1962 festgeschrieben.<br />
In der in Berlin unterzeichneten<br />
Neufassung findet die<br />
Weiterentwicklung beider Vereine<br />
Berück<strong>sich</strong>tigung, insbesondere im<br />
Hinblick auf die Erweiterung des<br />
Themenspektrums beim rbv.<br />
Zu den wichtigsten gemeinsamen<br />
Grundsätzen zählt die Stärkung<br />
der einheitlichen Interessenvertretung<br />
der im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
tätigen Unternehmen in<br />
technisch-wissenschaftlichen Be -<br />
langen, zum Beispiel bei der Regelsetzung,<br />
im Prüf- und Zertifizierwesen,<br />
bei Forschung und Entwicklung<br />
und beim Austausch praktischer<br />
Erfahrungen. Mit der neuen<br />
Vereinbarung wird eine zeitgemäße<br />
und konstruktive Fortsetzung der<br />
traditionellen Zusammenarbeit si -<br />
chergestellt.<br />
Juni 2011<br />
602 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Vereine, Verbände und Organisationen<br />
NACHRICHTEN<br />
DVGW-Studienpreis <strong>Wasser</strong> verliehen<br />
Im Rahmen der wat + WASSER BERLIN vom 2. bis 5. Mai 2011 hat der DVGW den<br />
Studienpreis <strong>Wasser</strong> an drei Nachwuchsingenieure/Innen verliehen<br />
Jutta Plückers zeigt in ihrer an der<br />
Technischen Universität Hamburg-Harburg<br />
erstellten Diplomarbeit<br />
auf, wie im Betrieb und in der<br />
Planung von <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
der Energieverbrauch<br />
systematisch minimiert werden<br />
kann. Sie hat für vorgegebene<br />
Randbedingungen am Beispiel<br />
eines Grundwasserwerkes eine<br />
energieoptimierte <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
geplant und mit der bestehenden<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung verglichen.<br />
Als besonderes Einsparpotenzial<br />
identifizierte sie die <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
und -förderung neben<br />
weiteren Bereichen, die noch ein<br />
großes Potenzial zur Senkung des<br />
Stromverbrauchs aufweisen. Viele<br />
ihrer Anregungen wurden von dem<br />
betrachteten WVU bereits erfolgreich<br />
umgesetzt.<br />
Schwerpunkt der Bachelor-<br />
Arbeit von Stefan Orlik ist die Darstellung<br />
des Kenntnisstands zur<br />
Charakterisierung von im Trinkwasser<br />
enthaltenen Partikeln, die zur<br />
Bildung von Ablagerungen führen<br />
können. Im praktischen Teil seiner<br />
Arbeit charakterisierte Stefan Orlik<br />
die mit dem Trinkwasser transportierten<br />
Partikel durch eigene Untersuchungen.<br />
Sie mündet in einem<br />
Vergleich der verschiedenen Untersuchungsmethoden<br />
und liefert An -<br />
satzpunkte für die Weiterführung<br />
von erforderlichen Untersuchungen.<br />
Die Master-Arbeit von Juliane<br />
Bräker ist Teilprojekt eines BMBF-<br />
Verbundvorhabens, das die Entwicklung<br />
eines Online-Analysesystems<br />
zum schnellen Nachweis<br />
von Mikroorganismen aus wässrigen<br />
Matrices zum Ziel hat. Da<br />
bestimmte Mikroorganismen meist<br />
nur in geringen Konzentrationen<br />
z. B. im Oberflächenwasser vorkommen,<br />
bedarf es eines Konzentrationsschrittes,<br />
der idealerweise eine<br />
reproduzierbar hohe Wiederfindungsrate<br />
der gesuchten Mikroorganismen<br />
ermöglicht. Juliane Bräker<br />
leistet mit ihrer Arbeit einen<br />
wichtigen Beitrag zu einer schnellen,<br />
gut funktionierenden Anreicherung<br />
und einer möglichst vollständigen<br />
Wiederfindung. Die beschriebenen<br />
Filtrationsverfahren können<br />
eine effektive Anreicherung der<br />
Zielorganismen ermöglichen.<br />
Der DVGW-Studienpreis wird<br />
jährlich zur Förderung des Nachwuchses<br />
im Energie- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
für herausragende Diplom-,<br />
Master- oder Bachelor-Arbeiten verliehen.<br />
Der Studienpreis Gas und<br />
<strong>Wasser</strong> ist mit insgesamt 10000 Euro<br />
dotiert. Voraussetzung ist, dass die<br />
Arbeiten einen praktischen Bezug<br />
zu technisch-wissenschaftlichen<br />
Fragestellungen im Energie- und<br />
<strong>Wasser</strong>fach haben und mit „sehr<br />
gut“ bewertet worden sind.<br />
DVGW entwickelt neues Kernkennzahlensystem für<br />
die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Ausgehend von der Diskussion<br />
über angemessene <strong>Wasser</strong>preise<br />
und die Leistungsfähigkeit<br />
einer <strong>Wasser</strong>versorgung entwickelt<br />
der DVGW zurzeit ein Kernkennzahlensystem,<br />
um damit der Öffentlichkeit<br />
und der Politik ein einfaches<br />
und bundesweit nachvollziehbares<br />
Instrument an die Hand zu geben.<br />
Ziel ist es, mit diesem Kernkennzahlensystem<br />
zur Transparenz in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung beizutragen. Zu<br />
den fünf Säulen, die die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ausmachen – Qualität,<br />
Sicherheit, Kundenservice, Nachhaltigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit – werden<br />
jeweils drei bis vier Kernkennzahlen<br />
erarbeitet. Die Qualität der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung wird zum Beispiel<br />
anhand der „Trinkwasserqualität“<br />
(In wieviel Prozent der Fälle werden<br />
die gesetzlichen Vorgaben<br />
erfüllt?) und „<strong>Wasser</strong>verluste“ (Wie<br />
hoch sind die tatsächlichen <strong>Wasser</strong>verluste<br />
im Leitungsnetz?) beschrieben.<br />
Damit können <strong>sich</strong> Öffentlichkeit<br />
und Politik anhand einfach<br />
nachvollziehbarer und aussagekräftiger<br />
Kriterien über die zentralen<br />
Leistungsmerkmale der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
informieren.<br />
Der DVGW plädiert damit für<br />
eine differenzierte Sicht auf die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und möchte die teilweise<br />
zu beobachtende Fokussierung<br />
auf vereinfachende <strong>Wasser</strong>preisvergleiche<br />
ausweiten. Neben<br />
einem angemessenen Preis zählen<br />
eben auch das hohe Qualitäts- und<br />
Sicherheitsniveau der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
in Deutschland und die Nachhaltigkeit<br />
im Umgang mit der wertvollen<br />
Ressource <strong>Wasser</strong>.<br />
Bei der Auswahl und Definition<br />
geeigneter Kennzahlen strebt der<br />
DVGW einen breiten Konsens an.<br />
BDEW und VKU sind eng in die<br />
Arbeiten eingebunden.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 603
RECHT UND REGELWERK<br />
Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
W 575 Entwurf: Ermittlung von Widerstandsbeiwerten für Formund<br />
Verbindungsstücke in der Trinkwasser-Installation, 04/2011<br />
Prüfeinrichtung.<br />
1 <strong>Wasser</strong>eint ritt<br />
2 Regulierarmatur<br />
3 Temperaturmessgerät<br />
4 Durchflussmessgerät<br />
5 Druckmessarmatur<br />
Die DVGW-Prüfgrundlage W 575<br />
legt ein Verfahren zur Bestimmung<br />
von Widerstandsbeiwerten<br />
für Form- und Verbindungsstücke in<br />
Rohrleitungen der Trinkwasser-Installation<br />
mit dem Prüfmedium <strong>Wasser</strong><br />
fest.<br />
6 Messstrecke mit<br />
Form- oder Verbindungsstück<br />
7 <strong>Wasser</strong>austritt<br />
8 Differenzdruckmessgerät<br />
Die nach dieser Prüfgrundlage er -<br />
mittelten Widerstandsbeiwerte werden<br />
für die in der DIN 1988 Teil 300<br />
„Berechnung von Trinkwasser-Installationen“<br />
dargestellten Dimensionierungsverfahren<br />
verwendet.<br />
Die von den Herstellern der<br />
Form- und Verbindungsstücke an -<br />
gegebenen Widerstandsbeiwerte<br />
werden im Rahmen der Produktzertifizierung<br />
nach dieser Prüfgrundlage<br />
auf ihre Richtigkeit geprüft.<br />
Zur Bestimmung des Druckverlustes<br />
wird das Form- oder Verbindungsstück<br />
mit dem zugehörigen<br />
Systemrohr in die Prüfeinrichtung<br />
(s. Bild) eingebaut und je nach Art<br />
des Formstückes abgeprüft.<br />
Dieser Entwurf kann bis zum<br />
29.07.2011 kommentiert werden.<br />
Etwaige Einsprüche per E-Mail an<br />
meyer@dvgw.de<br />
Preis:<br />
€ 15,97 für Mitglieder;<br />
€ 21,29 für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Postfach 140151,<br />
D-53056 Bonn,<br />
Tel. (0228) 91 91-40,<br />
Fax (0228) 91 91-499,<br />
E-Mail: info@wvgw.de,<br />
www.wvgw.de<br />
Regelwerk Gas/<strong>Wasser</strong><br />
GW 9: Beurteilung der Korrosionsbelastungen von erdüberdeckten Rohrleitungen und<br />
Behältern aus unlegierten und niedrig legierten Eisenwerkstoffen in Böden, 05/2011<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde von<br />
einem Projektkreis im Technischen<br />
Komitee „Außenkorrosion“<br />
überarbeitet. Es dient als Grundlage<br />
für die Auswahl von Korrosionsschutzmaßnahmen,<br />
dem Feststellen<br />
des Ist-Zustandes und zur Aufklärung<br />
von Korrosionsschäden von<br />
Rohrleitungen und Behältern. Das<br />
Arbeitsblatt berück<strong>sich</strong>tigt die Verfahrensweise<br />
nach DIN EN 12501<br />
und beschreibt ergänzende Untersuchungsmethoden.<br />
Bei diesen Untersuchungsmethoden<br />
handelt es <strong>sich</strong> um neue<br />
Untersuchungsverfahren, welche<br />
trotz der bisherigen gesammelten<br />
Erkenntnisse weitere Praxiserfahrung<br />
benötigen. Die Praxiserfahrung<br />
wird bei der nächsten Überarbeitung<br />
des Arbeitsblattes Berück<strong>sich</strong>tigung<br />
finden.<br />
Eine Überarbeitung des Arbeitsblattes<br />
wurde notwendig, weil <strong>sich</strong><br />
die Korrosionsschutzsysteme bei<br />
Guss- und Stahlrohrleitungen sowie<br />
Stahlbehältern weiter entwickelt<br />
haben. In den letzten 15 Jahren wurden<br />
europäische Normen auf dem<br />
Gebiet Korrosionsschutz und Korrosionswahrscheinlichkeit<br />
in Böden<br />
erarbeitet. Europäische Produktnormen<br />
regeln den Korrosionsschutz<br />
von Rohren und Formstücken aus<br />
duktilem Gusseisen und Stahl.<br />
Dieses Arbeitsblatt ersetzt das<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 9:1986-03.<br />
Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 9:1986-03 wurden folgende<br />
Änderungen vorgenommen:<br />
Anpassung der Anforderungen<br />
an die nationale und europäische<br />
Normung<br />
Aufnahme neuerer Untersuchungsverfahren<br />
(Labor- und<br />
Feldmethoden)<br />
Preis:<br />
€ 24,80 für Mitglieder;<br />
€ 33,06 für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Postfach 140151,<br />
D-53056 Bonn,<br />
Tel. (0228) 91 91-40,<br />
Fax (0228) 91 91-499,<br />
E-Mail: info@wvgw.de,<br />
www.wvgw.de<br />
Juni 2011<br />
604 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
RECHT UND REGELWERK<br />
DVGW-Regelwerk Plus: online überzeugend<br />
Vorteile bei Suchfunktionen, Zusatzinformationen und Verfügbarkeit<br />
Mit der Online-Version seines<br />
Regelwerkes bietet der DVGW<br />
vielfältigen Zusatznutzen und un -<br />
eingeschränkte Verfügbarkeit via<br />
Internet: Mit dem DVGW-Regelwerk<br />
Plus erhält der Anwender nicht nur<br />
die DVGW-Regelwerke und die<br />
zugehörigen DIN-Normen tagesaktuell,<br />
sondern zusätzlich sinnvoll<br />
verknüpfte Daten wie DVGW-Rundschreiben,<br />
relevante Schulungstermine<br />
und Forschungsberichte,<br />
An sprechpartner und Fachinformationen<br />
von der Website. Komfortable<br />
Such- und Trefferfunktionen<br />
ge währleisten eine leichte Handhabung<br />
– und dies zeit- und ortsunabhängig.<br />
Demoversion unter:<br />
www.dvgw-regelwerk.de<br />
Weitere Informationen zu den<br />
Möglichkeiten des neuen Online-<br />
Regelwerkes gibt es bei der wvgw<br />
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
mbH, Bonn, Tel. (0228) 9191-40.<br />
Ebenso wie die Papier- und DVD-<br />
Version ist auch das DVGW-Regelwerk<br />
Plus in verschiedenen berufsspezifischen<br />
Modulen erhältlich<br />
und lässt <strong>sich</strong> daher ganz auf die<br />
speziellen Bedürfnisse des Nutzers<br />
einrichten. Zielgruppen sind alle<br />
Kunden des DVGW-Regelwerkes,<br />
Versorgungsunternehmen, Behörden,<br />
Installateure, Ingenieure, Planer,<br />
Architekten und Schornsteinfeger.<br />
Das DVGW-Regelwerk ist für<br />
alle Gas- und <strong>Wasser</strong>fachleute ein<br />
effizientes Arbeitsmittel, das jederzeit<br />
Arbeits- und Rechts<strong>sich</strong>erheit<br />
gewährleistet.<br />
Neben der Online-Version gibt<br />
es das DVGW-Regelwerk weiterhin<br />
als digitale Version auf DVD mit<br />
Volltextsuche und dreimonatigen<br />
Updates. Auch die Papier-Version ist<br />
weiterhin erhältlich.<br />
Regelwerkverzeichnis<br />
überarbeitet<br />
Auch das DVGW-Regelwerkverzeichnis<br />
auf den Internetseiten des<br />
DVGW wurde optimiert. Ab sofort<br />
kann <strong>sich</strong> der Benutzer Vorwort,<br />
Inhaltsverzeichnis und Geltungsbereich<br />
jeder einzelnen Regel anzeigen<br />
lassen, was die Auswahl erheblich<br />
erleichtert. Zusätzlich kann man<br />
<strong>sich</strong> in vielen Fällen Fachartikel, die<br />
zur Neuerscheinung der Regel veröffentlicht<br />
wurden, herunterladen.<br />
PDF-Einzeldownload<br />
jetzt neu<br />
Gelegentliche Nutzer, die nur einzelne<br />
Arbeitsblätter benötigen,<br />
können diese weiterhin über das<br />
DVGW-Regelwerkverzeichnis beziehen.<br />
Konnte bislang online nur eine<br />
Papierversion bestellt werden, so<br />
kann das gewünschte Regelwerk<br />
jetzt direkt über die wvgw Wirtschafts-<br />
und Verlagsgesellschaft Gas<br />
und <strong>Wasser</strong>, die das DVGW-Regelwerk<br />
vertreibt, bestellt, bezahlt und<br />
sofort als PDF-Datei herunter geladen<br />
werden.<br />
Vorhabensbeschreibung<br />
Erstellung eines Arbeitsblattes DWA-A 268 „Automatisierung der<br />
Stickstoffelimination beim Belebungsverfahren“<br />
In einem neu zu strukturierenden<br />
Arbeitsblatt DWA-A 268 „Automatisierung<br />
der Stickstoffelimination<br />
beim Belebungsverfahren“ sollen<br />
alle Aspekte zur „Automatisierung<br />
der Stickstoffelimination beim Belebungsverfahren“<br />
umfänglich zu -<br />
sam mengeführt werden. Dies ge -<br />
schieht durch Zusammenfassung<br />
und gemeinsame Überarbeitung<br />
der Merkblätter ATV-DVWK-Merkblätter<br />
M 265 „Regelung der Sauerstoffzufuhr<br />
beim Belebungsverfahren“<br />
(2000), ATV-DVWK-M 266 „Steuern<br />
und Regeln des Trockensubstanzgehaltes<br />
beim Belebungsverfahren“<br />
(1997) und des DWA-M 268<br />
„Steuerung und Regelung der Stickstoffelimination<br />
beim Belebungsverfahren“<br />
(2006).<br />
Im Rahmen der Bearbeitung ist<br />
neben der Integration von Teilen<br />
des ATV-DVWK-M 265 und des ATV-<br />
DVWK-M 266 auch die Ergänzung<br />
und Aktualisierung des DWA-M 268<br />
im Hinblick auf die einzusetzende<br />
Messtechnik und die Anwendung<br />
moderner Automatisierungskonzepte<br />
vorgesehen. Bezüglich der<br />
Verfahrenstechnik ist unter anderem<br />
die Prozesswasserbehandlung<br />
zu ergänzen.<br />
Das neue Arbeitsblatt wird im<br />
Fachausschuss KA-13 „Automatisierung<br />
von Kläranlagen“ unter der<br />
Leitung von Dr. Joachim Reichert<br />
(Berlin) erarbeitet. Mit der Fertigstellung<br />
ist 2012 zu rechnen.<br />
Anregungen zur Überarbeitung an:<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle,<br />
Dipl-Biol. Sabine Thaler,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-142,<br />
E-Mail: thaler@dwa.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 605
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Das Eingruppierungsrecht<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Personalwirtschaft, Tarifrecht, Eingruppierung, Mitbestimmung<br />
Achim Richter und Annett Gamisch<br />
Das Spannungsverhältnis zwischen Technik,<br />
Betriebswirtschaft und Recht gilt es jeden Tag zu<br />
meistern. Fehler können fatale Folgen haben. Der<br />
Jurist wusste es schon immer: „Eines Abends noch<br />
sehr späte gingen <strong>Wasser</strong>maus und Kröte einen steilen<br />
Berg hinan…“ [1] Diese Geschichte endet im <strong>Wasser</strong><br />
tragisch. Fehler bei der Rechtsanwendung des<br />
Tarifrechts der <strong>Wasser</strong>wirtschaft beschränken <strong>sich</strong><br />
demgegenüber regelmäßig auf wirtschaftliche Schäden.<br />
Gleich<strong>wohl</strong> ist das Dichterwort lehrreich: „Also,<br />
sag ich, ist es gut, Mehr als eine Kunst zu wissen.“<br />
Dementsprechend zeigt und erläutert der Aufsatz die<br />
wesentlichen Bausteine der Eingruppierung, die für<br />
die Führungsarbeit von Bedeutung sind.<br />
The Legal Classification in Water Management<br />
The strain between technics, business management<br />
and law in the water business management has to be<br />
solved every day. Mistakes may end in dramatic consequences.<br />
Errors in the application of the collective<br />
bargaining law in the water business mostly result in<br />
economic disadvantages. This article deals with the<br />
essential constructions of trade and grade, which are<br />
important for the leadership in the water business<br />
management.<br />
1. Der richtige Tarifvertrag<br />
Arbeits- und Tarifrecht ist ein Kostenrisiko. Führungskräfte<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft müssen <strong>sich</strong> deshalb auch<br />
mit diesem Thema auseinandersetzen. Fehler in der<br />
Personal- und Führungsarbeit können immerhin sehr<br />
teuer werden, was auch Kunden betreffen kann.<br />
Zunächst gilt es, den arbeits- und tarifrechtlichen<br />
Rahmen zu klären: Das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes<br />
differenziert <strong>sich</strong> zunehmend. Tarifgebundene<br />
Arbeitgeber können <strong>sich</strong> aber das Vergütungssystem<br />
nicht aussuchen. Die Rechtsprechung setzt Maßstäbe<br />
für die Anwendung der jeweiligen Tarifwerke: So gilt der<br />
(kostengünstigere) „Tarifvertrag für den öffentlichen<br />
Dienst“ in der Fassung der Vereinigung kommunaler<br />
Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) gem. § 1 Abs. 2 Buchstabe<br />
d) TVöD-VKA nicht für …<br />
„Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW<br />
gilt,<br />
sowie für … Arbeitnehmer, die in rechtlich selbständigen,<br />
dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden<br />
und dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des<br />
TV-WW/NW zuzuordnenden Betrieben mit in der Regel<br />
mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten …<br />
Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten auszuüben<br />
haben, welche dem fachlichen Geltungsbereich<br />
des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnen sind, …“<br />
Dieser Ausschluss des TVöD-VKA erfasst auch<br />
Betriebe, deren Betriebszweck in der Entsorgung von<br />
Abwässern besteht [2]. Als (teure) Spartenregelung geht<br />
der „Tarifvertrag Versorgungsbetriebe“ (TV-V) dem<br />
TVöD-VKA regelmäßig vor [3, Abschnitt 1, Rdnr. 1 ff.; 4].<br />
Der fachliche Geltungsbereich des TV-V wird in § 1<br />
Abs. 1 wie folgt gefasst:<br />
„… Versorgungsbetriebe sind solche Unternehmen, die<br />
nach Satzung oder Gesellschaftsvertrag Energie- und/oder<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung einschließlich zugehöriger Dienstleistungen<br />
betreiben, …“<br />
Der TV-V soll eine Antwort auf die Wettbewerbssituation<br />
in der Versorgungswirtschaft geben. Es werden nur<br />
diejenigen Betriebe aus dem Geltungsbereich herausgenommen,<br />
deren Wettbewerbssituation eine andere<br />
ist [5]. Einen Sonderfall stellt der „Tarifvertrag für die<br />
Arbeitnehmer/Innen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft in Nordrhein-<br />
Westfalen – TV-WW/NW“ dar. Dieser gilt gem. § 1 Abs. 1<br />
TV-WW/NW:<br />
„… für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer … in<br />
Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und Verbänden<br />
im Bereich der <strong>Wasser</strong>wirtschaft, die Mitglied des KAV NW<br />
sind, unabhängig von ihrer Rechtsform, wenn sie durch<br />
einen bezirklichen Überleitungstarifvertrag in den Geltungsbereich<br />
einbezogen wurden.“<br />
Die Versorgungswirtschaft hebt <strong>sich</strong> aus dem klassischen<br />
öffentlichen Dienst heraus: Zum einen durch<br />
Juni 2011<br />
606 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
innovative Tarifverträge, zum anderen durch ein höheres<br />
Vergütungsniveau als bei Bund, Ländern und Kommunen,<br />
was der Wettbewerbssituation geschuldet ist.<br />
Der TV-WW/NW war zunächst eine moderne Abwandlung<br />
des in die Jahre gekommenen Bundes-Angestelltentarifvertrages<br />
(BAT). Die vom TV-V später angeführte<br />
Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst hatte diesen<br />
auf Nordrhein-Westfalen beschränkten Tarifvertrag<br />
„rechtstechnisch“ abgehängt. Nunmehr folgt er grundsätzlich<br />
dem TVöD. Der TV-V war der Pate für den TVöD-<br />
VKA und die anderen, neuen Tarifverträge des öffentlichen<br />
Dienstes. Das heißt aber nicht, dass dieser Tarifvertrag<br />
in allen Belangen, insbesondere dem Eingruppierungsrecht,<br />
besonders gelungen und anwenderfreundlich<br />
ist.<br />
2. Die Tarife im Vergleich<br />
2.1 Arbeitsrecht und Eingruppierung<br />
Die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern werden im<br />
sog. Mantel eines Tarifwerkes geregelt. Der TV-WW/NW<br />
folgt tarifgeschichtlich bedingt den Vorgaben des BAT.<br />
Sehr umfangreiche und detaillierte Regelungen rückten<br />
diesen Tarifvertrag in die Nähe einer Verwaltungsvorschrift,<br />
in der „alles und jedes“ geregelt ist. Demgegenüber<br />
verfolgt der TV-V eine andere Technik: Kurze tarifliche<br />
Vorschriften knüpfen an das allgemeine Arbeitsrecht<br />
an, das als bekannt vorausgesetzt wird. Damit<br />
gleicht der TV-V den Tarifverträgen der Privatwirtschaft.<br />
Zugleich stellt diese Regelungstechnik hohe Anforderungen<br />
an den Anwender, insbesondere (technische)<br />
Führungskräfte. Denn das deutsche Arbeitsrecht ist<br />
nicht kodifiziert. An die Stelle eines „Arbeitsgesetzbuches“<br />
treten viele arbeitsrechtliche Einzelgesetze. Diese<br />
Atomisierung macht die Personal- und Führungsarbeit<br />
– gegenüber dem alten BAT – sehr anspruchsvoll. Diese<br />
Aussage gilt entsprechend für den TV-WW/NW n. F., der<br />
weniger dem TV-V und mehr dem TVöD-VKA gleicht.<br />
Hin<strong>sich</strong>tlich der Vergütung gilt für alle modernen<br />
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes ein dreistufig<br />
aufgebautes Entgeltsystem (Bild 1): Die vom Arbeitnehmer<br />
geschuldete Normalleistung wird über die Eingruppierung<br />
gem. § 5 TV-V bzw. §§ 13 ff. TV-WW/NW vergütet.<br />
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts<br />
gilt für die Normalleistung ein subjektiver<br />
Maßstab: „Der Arbeitnehmer muss tun, was er soll, und<br />
zwar so gut wie er kann“[6]. Als Anreiz muss gem. § 18<br />
TV-WW/NW bzw. kann gem. § 6 Abs. 5, 6 TV-V zusätzlich<br />
leistungsorientiertes Entgelt gezahlt werden.<br />
Der Arbeitgeber hat darüber hinaus das Recht,<br />
zusätzlich erfolgsorientiert zu bezahlen (vgl. § 6 Abs. 5<br />
TV-V). In jedem Fall ist das Mitbestimmungsrecht des<br />
Betriebs- bzw. Personalrats zu beachten (§ 99 Abs. 1<br />
BetrVG, siehe § 75 Abs. 1 BPersVG als Beispiel für das<br />
Personalvertretungsrecht der Länder).<br />
Dieser Beitrag beschränkt <strong>sich</strong> auf die Eingruppierung,<br />
mit der die geschuldete Tätigkeit widergespiegelt<br />
TV-WW/NW (§§13 ff.)<br />
muss muss kann<br />
TVöD-VKA (§§ 15 ff.) TV-V (§ 6)<br />
Bild 1. Dreistufiges Entgeltsystem.<br />
erfolgsabhängiges<br />
Entgelt<br />
Leistungsentgelt<br />
Tabellenentgelt<br />
und die sog. Normalleistung nach Maßgabe eines summarischen<br />
Bewertungsverfahrens [7] vergütet wird.<br />
So<strong>wohl</strong> § 5 TV-V als auch § 13 TV-WW/NW treffen für<br />
die Eingruppierung eine bindende und abschließende<br />
Regelung, die <strong>sich</strong> als summarische Arbeitsbewertung<br />
darstellt. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden,<br />
dass eine analytische Stellenbewertung, wie sie bei<br />
Beamten vorgenommen wird, im Geltungsbereich des<br />
BAT nicht anwendbar ist [8]. Diese Aussage gilt auch für<br />
den TV-V und TV-WW/NW.<br />
Die auf diesem Wege ermittelte Entgeltgruppe<br />
beschränkt das Weisungs- bzw. Direktionsrecht des<br />
Arbeitgebers gem. § 106 Gewerbeordnung (GewO)<br />
i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 2 TV-V: Vorgesetzte dürfen grundsätzlich<br />
nur, aber auch jede Tätigkeit anweisen, die von der<br />
Entgeltgruppe abgedeckt ist. Weitergehende Einschränkungen<br />
können <strong>sich</strong> aus dem jeweils maßgeblichen<br />
Berufs- und Sozialbild ergeben, Erweiterungen folgen<br />
bei Schwangeren aus dem Mutterschutzgesetz. Die<br />
Übertragung niederwertiger Tätigkeiten ist nur in sehr<br />
engen Grenzen möglich, höherwertige Tätigkeiten können<br />
gem. § 5 Abs. 3 TV-V bzw. § 15 TV-WW/NW unter<br />
bestimmten Voraussetzungen zeitweise übertragen<br />
werden [4, S. 196 ff.]. Bei allem gilt, dass für die Eingruppierung<br />
die Qualität und Quantität der Arbeitsleistung<br />
keine Rolle spielt. Diese Aussagen treffen so einheitlich<br />
für das Tarifrecht der <strong>Wasser</strong>wirtschaft zu.<br />
2.2 Entgelt und Eingruppierung<br />
Hin<strong>sich</strong>tlich der Struktur der Eingruppierungsvorschriften,<br />
abgebildet durch sog. Qualifikationsebenen,<br />
und der Vergütungshöhe bestehen aber Unterschiede<br />
(s. Tabelle 1).<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 607<br />
muss kann kann
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Tabelle 1. Qualifikationsebenen<br />
in den Eingruppierungsregeln<br />
Entgeltgruppen im…<br />
erfasste Qualifikationsebenen …TVöD-VKA … TV-V … TV-WW/NW<br />
Uni/M.A. 13–15 11–15 11–15<br />
FH/B.A. 9–12 9–11 9–11<br />
Fachwirte – 8–11 –<br />
Meister/Techniker 6–9 6–9 7–8<br />
Berufsausbildung und Zusatzkenntnisse<br />
– 7–8 6<br />
Berufsausbildung 5–8 5–6 5<br />
Un-/Angelernte 1–4 1–4 1–4<br />
Tabelle 3. Strukturunterschiede.<br />
Struktur § 5 TV-V § 13 TV-WW/NW<br />
Bewertungsverfahren summarisch summarisch<br />
Bewertungsgrundlage<br />
Tätigkeit<br />
(vergleichbar dem<br />
Arbeitsvorgang wie<br />
im BAT)<br />
Arbeitsergebnis<br />
(= Arbeitsvorgang wie<br />
im BAT)<br />
maßgeblicher Zeitanteil 50 %<br />
(Ausnahme: anderer<br />
Zeitanteil in der<br />
Anlage 1)<br />
Vorübergehende Übertragung<br />
höherwertiger Tätigkeiten<br />
möglich<br />
(§ 5 Abs. 3 TV-V)<br />
50 %<br />
(Ausnahme: anderer<br />
Zeitanteil in der<br />
Anlage 3)<br />
möglich<br />
(§ 15 TV-WW/NW)<br />
Diese Qualifikationsebenen führen zu folgenden<br />
Entgeltniveaus (s. Tabelle 2).<br />
Die Eingruppierung als ein wesentlicher Baustein der<br />
Bemessung des Arbeitsentgelts richtet <strong>sich</strong> nach § 5<br />
Abs. 1 TV-V bzw. §§ 13 ff. TV-WW/NW, die folgende<br />
Strukturen aufweisen (s. Tabelle 3).<br />
Auf diesem Wege wird geregelt, „wie“ die Eingruppierung<br />
erfolgt. Die Frage, „wo“ der Arbeitnehmer eingruppiert<br />
ist, folgt aus der jeweiligen Entgeltordnung,<br />
d. h. der Anlage 1 TV-V bzw. Anlage 3 TV-WW/NW).<br />
2.3 Tarifliche Grundlagen der Eingruppierung<br />
Beide Systeme folgen dem Grundsatz der Tarifautomatik<br />
und verwenden das sog. Baukastenprinzip.<br />
Der Grundsatz der Tarifautomatik besagt, dass der<br />
Mitarbeiter nicht eingruppiert „wird“, sondern eingruppiert<br />
„ist“. Es erfolgt also kein „Eingruppierungsakt“, vielmehr<br />
liegt eine „automatische“ Eingruppierung vor. Der<br />
Anspruch auf die tarifliche Mindesteingruppierung entsteht<br />
mit Übertragung der auszuübenden Tätigkeit an<br />
den Arbeitnehmer. Die Angabe der Entgeltgruppe im<br />
Arbeitsvertrag hat dementsprechend nur deklaratorischen<br />
(rechtserklärenden) Charakter. Man spricht in diesem<br />
Zusammenhang auch von einem „Akt der Rechtsanwendung“,<br />
mit dem die Äußerung einer Rechts an<strong>sich</strong>t<br />
durch den Arbeitgeber verbunden ist [10].<br />
Nach diesem Grundsatz gibt es keine falsche Eingruppierung;<br />
diese ist vielmehr stets korrekt. Es ist eine andere<br />
Frage, ob der Arbeitgeber das tarifgerechte Ergebnis<br />
Tabelle 2. Entgeltniveau des TVöD-VKA, TV-V und TV-WW/NW im Vergleich (Tabellenwerte TV-V gültig ab 01.01.2011; Tabellenwerte TVöD-VKA und<br />
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4<br />
TVöD-VKA<br />
TV-V<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TVöD-VKA<br />
TV-V<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TVöD-VKA<br />
TV-V<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TVöD-VKA<br />
15 3 723,88 € 4 357,87 € 5 144,78 € 4 131,64 € 4 852,08 € 5 346,37 € 4 283,45 € 5 306,91 € 5 547,96 € 4 825,66 € 5 739,48 €<br />
14 3 372,53 € 4 067,34 € 4 713,44 € 3 741,23 € 4 480,54 € 4 898,04 € 3 958,12 € 4 880,83 € 5 082,64 € 4 283,45 € 5 268,19 €<br />
13 3 109,02 € 3 809,11 € 4 323,50 € 3 448,44 € 4 196,48 € 4 504,32 € 3 632,80 € 4 570,92 € 4 685,18 € 3 990,64 € 4 938,92 €<br />
12 2 786,96 € 3 550,86 € 4 050,83 € 3 090,59 € 3 893,04 € 4 201,53 € 3 524,35 € 4 235,20 € 4 352,24 € 3 903,90 € 4 525,73 €<br />
11 2 689,35 € 3 324,88 € 3 452,12 € 2 982,16 € 3 641,24 € 3 661,24 € 3 199,03 € 3 918,85 € 3 798,75 € 3 524,35 € 4 157,76 €<br />
10 2 591,75 € 3 098,94 € 3 199,68 € 2 873,70 € 3 395,91 € 3 378,68 € 3 090,59 € 3 686,43 € 3 499,23 € 3 307,48 € 3 880,11 €<br />
9 2 289,21 € 2 905,24 € 2 969,86 € 2 537,53 € 3 163,49 € 3 120,58 € 2 667,67 € 3 415,29 € 3 226,08 € 3 014,68 € 3 589,60 €<br />
8 2 142,81 € 2 711,59 € 2 762,65 € 2 374,87 € 2 879,42 € 2 890,76 € 2 483,32 € 3 021,46 € 2 984,94 € 2 580,92 € 3 157,05 €<br />
7 2 006,18 € 2 517,89 € 2 547,80 € 2 223,05 € 2 672,83 € 2 646,23 € 2 364,03 € 2 808,42 € 2 728,43 € 2 472,47 € 2 905,24 €<br />
6 1 967,13 € 2 356,47 € 2 485,84 € 2 179,67 € 2 498,51 € 2 524,72 € 2 288,12 € 2 627,63 € 2 677,21 € 2 391,14 € 2 718,02 €<br />
5 1 884,71 € 2 195,09 € 2 381,12 € 2 087,51 € 2 330,66 € 2 418,35 € 2 190,52 € 2 446,88 € 2 564,28 € 2 293,55 € 2 530,80 €<br />
4 1 791,45 € 2 065,94 € 2 280,92 € 1 984,48 € 2 195,09 € 2 316,55 € 2 114,61 € 2 304,84 € 2 456,18 € 2 190,52 € 2 382,31 €<br />
3 1 762,19 € 1 936,84 € 2 185,05 € 1 951,94 € 2 040,13 € 2 219,12 € 2 006,18 € 2 124,05 € 2 352,74 € 2 092,93 € 2 195,09 €<br />
2 1 625,54 € 1 807,70 € 2 093,26 € 1 800,13 € 1 917,47 € 2 125,90 € 1 854,35 € 2 014,31 € 2 253,78 € 1 908,58 € 2 085,33 €<br />
1 – 1 614,03 € 2 005,48 € 1 448,79 € 1 614,03 € 2 036,69 € 1 474,81 € 1 614,03 € 2 113,72 € 1 507,35 € 1 614,03 €<br />
TV-V<br />
Juni 2011<br />
608 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
erkannt hat. Demzufolge sind folgende Aspekte ohne<br />
jede Bedeutung für die Eingruppierung [4, S. 16 ff.]:<br />
Angabe der Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag<br />
Ausgewiesene Stellen im Haushalts- oder Stellenplan<br />
Beschlüsse politischer Gremien<br />
Bewertungen von Stellenbewertungskommissionen<br />
Bewertungsergebnisse analytischer Bewertungsverfahren<br />
Einarbeitungszeit<br />
Eingruppierung vergleichbarer (früherer)<br />
Beschäftigter (Angestellte, Arbeiter, Beamte)<br />
Eingruppierungsrichtlinien einer Tarifvertragspartei<br />
Geschäftsverteilungspläne<br />
Qualität der geleisteten Arbeit<br />
Quantität der geleisteten Arbeit<br />
Schlüsselqualifikationen (z. B. Kontaktfähigkeit,<br />
Phantasie, Eigeninitiative, Verhandlungsgeschick)<br />
Stellenanzeigen und Ausschreibungstexte<br />
Stellenpläne<br />
Baukastenprinzip heißt in diesem Zusammenhang,<br />
dass die Tätigkeitsmerkmale grundsätzlich aufeinander<br />
aufbauen: je höher die Entgeltgruppe umso höher die<br />
Anforderungen.<br />
2.4 Personalwirtschaftliche Grundlage der<br />
Eingruppierung<br />
Grundlage der Eingruppierung aus personalwirtschaftlicher<br />
Sicht ist die Stellenbeschreibung. Als Stelle wird<br />
dabei die kleinste organisatorische Handlungs-, Dispositions-,<br />
Planungs-, Kontroll- und meist auch örtliche<br />
Einheit der Gesamtorganisation bezeichnet. Ihr<br />
sind ein oder mehrere Aufgaben zur Erfüllung übertragen.<br />
Die Stellenbeschreibung dokumentiert genau<br />
diese or ganisatorische Einheit (die Stelle) schriftlich im<br />
Hinblick auf<br />
Ziele<br />
Aufgaben<br />
hierarchische Eingliederung<br />
Kompetenzen<br />
Beziehungen zu anderen Stellen [11].<br />
Damit ist die Stellenbeschreibung eine ausschließlich<br />
stellenspezifische (= sachbezogene) und nicht<br />
mitarbeiterspezifische (= personenbezogene) Form<br />
der Dokumentation der Aufbau- und Ablauforganisation.<br />
Die Arbeit mit Stellenbeschreibungen ist in der<br />
Praxis umstritten. Kritiker bezeichnen sie als unnötig,<br />
behindernd, bürokratisch und kostenintensiv. Be -<br />
fürworter verweisen auf ihre zentrale Rolle als Organisations-<br />
und Führungsmittel und die Möglichkeit des<br />
selbständigen Arbeitens für den Stelleninhaber. Allen<br />
Diskussionen gemein ist ihre rein betriebswirtschaftlich<br />
bzw. arbeits- und organisationspsychologische Ausrichtung.<br />
Für Arbeitgeber der <strong>Wasser</strong>wirtschaft stellt <strong>sich</strong><br />
die Sinnfrage aufgrund der tarifvertraglichen Vorgaben<br />
zur Eingruppierung nicht [12].<br />
TV-WW/NW gültig ab 01.08.2011) [3, vor Kapitel A; 9].<br />
Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TVöD-VKA<br />
TV-V<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TVöD-VKA<br />
TV-V<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
TV-WW/<br />
NW<br />
5 749,47 € 5 237,73 € 6 139,76 € 5 951,09 € 5 508,84 € 6 507,74 € 6 152,66 € 6 354,19 € 6 555,79 € 6 757,36 € 6 941,95 €<br />
5 267,25 € 4 782,28 € 5 636,19 € 5 451,88 € 5 053,38 € 5 971,92 € 5 636,47 € 5 821,15 € 6 005,72 € 6 190,33 € 6 273,20 €<br />
4 866,02 € 4 489,48 € 5 222,99 € 5 046,85 € 4 695,53 € 5 455,42 € 5 227,71 € 5 408,54 € 5 589,40 € 5 664,74 € –<br />
4 502,97 € 4 391,89 € 4 809,82 € 4 653,66 € 4 608,77 € 5 009,82 € 4 804,38 € 4 955,08 € 5 105,76 € 5 201,88 € –<br />
3 936,25 € 3 996,08 € 4 357,87 € 4 073,79 € 4 212,96 € 4 525,73 € 4 211,28 € 4 348,82 € 4 486,34 € 4 623,86 € 4 644,57 €<br />
3 619,78 € 3 719,55 € 4 015,69 € 3 740,34 € 3 817,15 € 4 112,51 € 3 860,89 € 3 981,51 € 4 102,03 € 4 216,97 € –<br />
3 331,54 € 3 285,79 € 3 654,16 € 3 437,05 € 3 502,67 € 3 751,01 € 3 542,55 € 3 648,05 € 3 753,55 € 3 836,42 € --<br />
3 075,37 € 2 689,35 € 3 292,63 € 3 165,79 € 2 757,67 € 3 389,48 € 3 256,23 € 3 346,63 € 3 437,05 € 3 497,34 € --<br />
2 815,09 € 2 553,81 € 2 969,83 € 2 901,74 € 2 629,72 € 3 034,38 € 2 988,39 € 3 075,06 € 3 152,29 € 3 155,20 € –-<br />
2 719,19 € 2 461,63 € 2 769,67 € 2 822,73 € 2 532,13 € 2 814,86 € 2 867,01 € 2 912,05 € 2 957,78 € 3 011,20 € –<br />
2 604,43 € 2 369,46 € 2 582,45 € 2 703,53 € 2 423,68 € 2 666,36 € 2 745,93 € 2 788,98 € 2 832,74 € – –<br />
2 494,60 € 2 266,43 € 2 433,95 € 2 589,45 € 2 310,89 € 2 556,62 € 2 630,02 € 2 671,21 € 2 713,09 € – –<br />
2 389,53 € 2 158,00 € 2 240,28 € 2 480,27 € 2 217,64 € 2 337,10 € 2 519,07 € 2 558,51 € 2 598,60 € – –<br />
2 288,95 € 2 027,85 € 2 130,53 € 2 375,79 € 2 152,57 € 2 156,33 € 2 412,93 € 2 450,69 € 2 489,00 € – –<br />
2 146,68 € 1 537,70 € 1 614,03 € 2 180,17 € 1 615,78 € 1 614,03 € 2 214,19 € 2 248,73 € 2 283,85 € – –<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 609
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
2.5 Tarifvertragliche Vorgaben<br />
Dabei gehen TV-V und TV-WW/NW eigene Wege. Im<br />
TV-V trifft § 5 Abs. 1 TV-V diese für die Stellenbeschreibung<br />
maßgeblichen Regelungen:<br />
„(1) Der Arbeitnehmer ist entsprechend seiner mindestens<br />
zur Hälfte regelmäßig auszuübenden Tätigkeit in einer<br />
Entgeltgruppe nach Anlage 1 eingruppiert. Soweit in<br />
Anlage 1 ausdrücklich ein von Satz 1 abweichendes Maß<br />
bestimmt ist, gilt dieses.“<br />
Während der TV-WW/NW noch stärker an den Regelungen<br />
des BAT von 1975 haftet und in § 13 TV-WW/NW<br />
regelt:<br />
„(1) Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet <strong>sich</strong><br />
nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung<br />
(Anlage 3). Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der<br />
Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.<br />
(2) Die/Der Beschäftigte ist entsprechend seiner mindestens<br />
zur Hälfte regelmäßig auszuübenden Tätigkeit in<br />
einer Entgeltgruppe nach Anlage 3 eingruppiert. Diese<br />
Tätigkeit muss bei natürlicher Betrachtung zu einem<br />
abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. Eine Aufspaltung<br />
des Arbeitsergebnisses in einzelne, getrennt zu betrachtende<br />
Arbeitsschritte findet nicht statt. Soweit in Anlage 3<br />
ausdrücklich ein von Satz 1 abweichendes Maß bestimmt<br />
ist, gilt dieses.“<br />
Mit der Formulierung<br />
„Diese Tätigkeit muss bei natürlicher Betrachtung zu<br />
einem abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. Eine Aufspaltung<br />
des Arbeitsergebnisses in einzelne getrennt zu<br />
betrachtende Arbeitsschritte findet nicht statt.“<br />
übernimmt der TV-WW/NW die Kerndefinition zum<br />
Arbeitsvorgang aus dem BAT, ohne den Begriff selbst zu<br />
verwenden.<br />
Beide Tarifvorschriften machen Stellenbeschreibungen<br />
aus tarifvertraglicher Sicht erforderlich. Denn<br />
ohne die über<strong>sich</strong>tliche Darstellung der Tätigkeiten<br />
(TV-V) bzw. Arbeitsvorgänge (TV-WW/NW) und den<br />
diesen zugeordneten Zeitanteilen kann keine Eingruppierung<br />
ermittelt werden. Tarifliche Heraushebungsmerkmale<br />
wie z.B. Verantwortung können nur in<br />
Anschauung der konkreten Über- und Unterstellungsverhältnisse<br />
sowie der Entscheidungsrechte bewertet<br />
werden.<br />
3. Die Eingruppierung nach TV-V<br />
im Überblick<br />
3.1 Grundsatz 1: Die regelmäßig auszuübende<br />
Tätigkeit/en<br />
Grundlage der Eingruppierung ist gem. § 5 Abs. 1 TV-V<br />
die vom Arbeitnehmer zu leistende Arbeit. Mit der Eingruppierung<br />
in eine bestimmte Entgeltgruppe wird<br />
nicht die Qualifikation des Mitarbeiters vergütet, sondern<br />
ausschließlich die Schwierigkeit der übertragenen<br />
Tätigkeiten.<br />
Dabei sind für die Eingruppierung nur die vom<br />
Arbeitgeber übertragenen Tätigkeiten heranzuziehen,<br />
die der Arbeitnehmer regelmäßig auszuüben hat.<br />
Regelmäßig bedeutet, dass es <strong>sich</strong> um Tätigkeiten<br />
handelt, die <strong>sich</strong> ihrem Inhalt und ihrem Arbeitsablauf<br />
nach wiederholt anfallen. Der Rhythmus der Wiederholung<br />
ist nicht maßgeblich. Auch Schwankungen und<br />
Ausnahmen vom Arbeitsablauf sind möglich. Entscheidend<br />
ist die Gleichförmigkeit über eine bestimmte Zeit<br />
und damit eine gewisse Stetigkeit und Dauer [13]. Eingruppierungsrelevant<br />
sind damit nur Tätigkeiten, die<br />
dem Arbeitnehmer nicht im Rahmen des § 5 Abs. 3 TV-V<br />
und damit nur vorübergehend übertragen wurden.<br />
3.2 Grundsatz 2: Zeitanteil/e<br />
Aus diesen Tätigkeiten ist die Tätigkeit maßgeblich für<br />
die Eingruppierung, die mindestens 50 % der Gesamtarbeitszeit<br />
beansprucht. Von diesem Grundsatz kennen<br />
die Eingruppierungsregeln des TV-V nur eine Ausnahme:<br />
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 6.2<br />
„… mindestens zu einem Fünftel selbstständige Leistungen…“<br />
Problematisch werden die Fälle, in denen keine<br />
Tätigkeit die erforderlichen 50 % erreicht. In diesen<br />
Fällen bestimmt § 5 Abs. 1 Satz 3 TV-V:<br />
„Erreicht keine der vom Arbeitnehmer auszuübenden<br />
Tätigkeiten das … geforderte Maß, werden höherwertige<br />
Tätigkeiten zu den jeweils nächstniedrigeren Tätigkeiten<br />
hinzugerechnet.“<br />
Die tariflichen Regeln sind in Bezug auf das Beispiel<br />
(Tabelle 4) wie folgt anzuwenden: Die Tätigkeit mit der<br />
tariflich höchsten Wertigkeit ist die Tätigkeit 1. (Entgeltgruppe<br />
8). Die Tätigkeit 1. allein erreicht aber nicht den<br />
erforderlichen Zeitanteil von 50 %. Es fehlen noch 30 %.<br />
Gem. § 5 Abs. 1 Satz 3 TV-V sind diese der Tätigkeit mit<br />
der nächst niedrigeren Wertigkeit hinzuzurechnen. Hinzurechnen<br />
bedeutet, dass mit der Erfüllung der Anforderungen<br />
der Entgeltgruppe 8 gleichzeitig die Anforderungen<br />
der nächst niedrigeren Entgeltgruppe 7 übererfüllt<br />
sind. Damit sind die 20 % der Entgeltgruppe 8 zu<br />
den 20 % der Tätigkeit 2. (Entgeltgruppe 7) zu addieren.<br />
Die 50 % werden damit aber immer noch nicht erreicht,<br />
so dass noch die nächst niedrigere Tätigkeit hinzugenommen<br />
werden muss. Die nächst niedrigere Tätigkeit<br />
ist die Tätigkeit 3. Sie ist der Entgeltgruppe 6 zugeord-<br />
Tabelle 4. Eingruppierung bei Mischtätigkeiten.<br />
Tätigkeiten Zeitanteil tarifliche Wertigkeit<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
20 %<br />
20 %<br />
20 %<br />
40 %<br />
Entgeltgruppe 8<br />
Entgeltgruppe 7<br />
Entgeltgruppe 6<br />
Entgeltgruppe 5<br />
Gesamtbewertung Entgeltgruppe 6<br />
Juni 2011<br />
610 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
net. Aus zeitlicher Sicht werden erst mit Addition der<br />
Zeitanteile der Tätigkeiten 1. bis 3. (60 %), die mindestens<br />
erforderlichen 50 % für die Eingruppierung<br />
erreicht.<br />
3.3 Die Tätigkeitsmerkmale im Überblick<br />
Im Wesentlichen setzen <strong>sich</strong> die Tätigkeitsmerkmale aus<br />
fachkompetenzbezogenen (in Bild 6 grün gekennzeichnet)<br />
und entscheidungskompetenzbezogenen (in<br />
Bild 6 rot gekennzeichnet) Merkmalen zusammen,<br />
wobei immer erst eine bestimmte Stufe von Fachkompetenz<br />
erreicht werden muss (vgl. Tabelle 1) bevor die<br />
unterschiedlichen Abstufungen von Entscheidungskompetenz<br />
(selbständige Leistungen, besonders verantwortungsvolle<br />
Tätigkeiten…) eingruppierungsrelevant<br />
werden.<br />
Je höher die Entgeltgruppe, je höher die Anforderungen<br />
an Fach- bzw. Entscheidungskompetenz:<br />
So verlangen die Entgeltgruppen 2 bis 4 lediglich<br />
Fachkompetenzen, die unterhalb einer Berufsausbildung<br />
liegen. Ab Entgeltgruppe 5 wird Fachkompetenz<br />
auf dem Niveau einer im Hinblick auf die übertragene<br />
Tätigkeit einschlägigen Berufsausbildung gefordert, ab<br />
Entgeltgruppe 9 FH-Niveau und ab Entgeltgruppe 11<br />
wissenschaftliches Hochschulniveau [14]. Damit spielen<br />
ab Entgeltgruppe 5 die für die Tätigkeit qualifizierenden<br />
Berufsbilder für die Feststellung der Fachkompetenz<br />
eine elementare Rolle.<br />
3.4 Berufsbilder<br />
Berufsbilder beschreiben die Elemente eines Berufes im<br />
Hinblick auf:<br />
Vorbildung<br />
Ausbildung<br />
Tätigkeiten<br />
Aufstiegschancen<br />
Weiterbildungsformen<br />
Verdienstmöglichkeiten [15].<br />
Offizielle Informationen zu den Berufsbildern werden<br />
von der Bundesagentur für Arbeit in Zusammenarbeit<br />
mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung entwickelt<br />
und unter www.berufenet.arbeitsagentur.de<br />
veröffentlicht.<br />
Allerdings ist einschränkend zu vermerken, dass die<br />
Berufsbeschreibungen zu den Studienabschlüssen im<br />
Informationsportal der Bundesagentur für Arbeit nur<br />
die neuen Bachelorabschlüsse näher beschreiben,<br />
während die Berufsbilder der Masterabsolventen nur<br />
kurz im Rahmen der Berufsbilder auf Bachelorniveau<br />
erwähnt werden.<br />
Eine detaillierte Abgrenzung ist also nur mit weiterführenden<br />
Informationen zu den jeweils in Frage kommenden<br />
Studienrichtungen möglich. Über konkrete<br />
Studieninhalte informieren die einzelnen (Fach-)Hochschulen<br />
und Universitäten selbst. Diese können über<br />
www.studienwahl.de oder über www.hochschulkompass.de<br />
ermittelt werden.<br />
Die Bedeutung der Berufsbilder liegt darin, dass nur<br />
mit ihrer Hilfe objektive Aussagen zum Vorliegen „entsprechender<br />
Tätigkeiten“ – als dem zweiten Anforderungsmerkmal<br />
ab der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 5.1 –<br />
möglich sind [16].<br />
3.5 Oberbegriffe<br />
Die zu erfüllenden Anforderungen werden in jeder Entgeltgruppe<br />
durch allgemeine Obermerkmale (einfachste<br />
Tätigkeiten, eingehende fachliche Einarbeitung,<br />
gründliche Fachkenntnisse, selbständige Leistungen,<br />
etc.) abstrakt beschrieben. Ab Entgeltgruppe 5 bis Entgeltgruppe<br />
9 stehen dabei jeweils zwei Möglichkeiten<br />
zur Verfügung.<br />
Beispiel:<br />
In die Entgeltgruppe 9 sind Arbeitnehmer eingruppiert,<br />
deren Tätigkeit entweder:<br />
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 9.1<br />
„Arbeitnehmer, deren Tätigkeiten <strong>sich</strong> dadurch aus der<br />
Entgeltgruppe 8.2 herausheben, dass sie besonders verantwortungsvoll<br />
sind“<br />
oder<br />
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 9.2<br />
„Arbeitnehmer mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung<br />
und entsprechenden Tätigkeiten“<br />
erfordert.<br />
3.6 Beispielstätigkeiten<br />
Die Beispielstätigkeiten (siehe Beispiele in Bild 6) konkretisieren<br />
die bewusst abstrakt gehaltenen Oberbegriffe<br />
[3, Abschnitt 3, Rdnr. 1].<br />
Damit erfüllen sie zwei Funktionen: Zum einen sollen<br />
sie die abstrakten Oberbegriffe verdeutlichen und<br />
verständlich machen, in dem sie Maß und Richtung für<br />
die Auslegung des Oberbegriffs vorgeben [17]. Zum<br />
anderen erleichtern sie die Anwendung, da mit der<br />
Erfüllung einer Beispielstätigkeit automatisch die<br />
Anforderungen an den Oberbegriff der Entgeltgruppe<br />
erfüllt sind [18, 19]. Diese Beispiele können im TV-V<br />
durch landesbezirkliche Tarifverträge weiter ausgebaut<br />
werden. Der Landesbezirkliche Tarifvertrag NRW<br />
vom 6. Oktober 2003 zur Ergänzung der Anlage 1 (Entgeltgruppen)<br />
zum TV-V führt in den EG 1-9 TV-V weitere<br />
Tätigkeitsbeispiele auf [3, Abschnitt 3, Rdnr. 10.1<br />
ff.; 20].<br />
Damit haben Beispielstätigkeiten bei der Eingruppierung<br />
grundsätzlich Vorrang: Sie sind als Erstes zu<br />
prüfen.<br />
Auf die Oberbegriffe muss zum Einen zurückgegriffen,<br />
wenn die Beispiele ihrerseits unbestimmte Rechtsbegriffe<br />
enthalten, die nicht aus <strong>sich</strong> selbst heraus ausgelegt<br />
werden können, oder wenn dasselbe Tätigkeitsbeispiel<br />
in mehreren Entgeltgruppen auftaucht und so<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 611
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
EG FG 1 FG 2 FG 3 FG 4<br />
1 einfachste Tätigkeiten<br />
(Anwendung z. Zt. nur in NRW)<br />
2<br />
einfache Tätigkeiten<br />
Beispiele:<br />
2.1 Reinigen von Werkstätten<br />
und Labors<br />
2.2 einfache Bürotätigkeiten<br />
(Führen einfacher Listen,<br />
Mithilfe Postabfertigung,<br />
Registratur, Fotokopieren)<br />
2.3 Tätigkeiten als Bote<br />
3<br />
eingehende fachliche Einarbeitung<br />
Beispiele:<br />
3.1 Tätigkeiten als Messgehilfe<br />
3.2 Tätigkeiten als Zählerableser<br />
3.3 Tätigkeiten als Pförtner<br />
3.4 Tätigkeiten als Telefonist<br />
4<br />
gründliche Fachkenntnisse „sonstige AN“<br />
Beispiele:<br />
4.3.1 Verwaltung von Lagern und Magazinen<br />
4.3.2 Tätigkeiten als Fahrer von Kraftfahrzeugen<br />
4.3.3 Tätigkeiten als Schreibkraft<br />
4.3.4 Montagearbeiten in Netzen<br />
5 + abgeschlossene Ausbildung in einem<br />
anerkannten Ausbildungsberuf<br />
+ entsprechende Tätigkeiten<br />
gründliche und vielseitige<br />
Fachkenntnisse<br />
„sonstige AN“<br />
Beispiele:<br />
5.4.1 Bedienen und Überwachen von Kraftwerksmaschinen<br />
5.4.2 Tätigkeiten als Schaltwart<br />
5.4.3 Tätigkeiten als <strong>Wasser</strong>wart<br />
5.4 .4 Tätigkeiten als geprüfter Kesselwärter<br />
5.4.5 Fahrer von Kraftfahrzeugen mit mehr als 7,5 t zulässigem<br />
Gesamtgewicht<br />
5.4.6 Fahren und Bedienen von Spezialkraftfahrzeugen<br />
5.4.7 Montagearbeiten in Netzen<br />
5.4.8 Tätigkeiten als kaufmännischer Sachbearbeiter<br />
6 + AN der E 5.1<br />
+ besonders hochwertige oder<br />
besonders vielseitige Tätigkeiten<br />
+ gründliche und vielseitige<br />
Fachkenntnisse<br />
und<br />
+ selbständige Leistungen zu<br />
1/5<br />
„sonstige AN“<br />
Beispiele :<br />
6.4.1 Handwerks- und Industriemeister mit entsprechenden Tätigkeiten<br />
6.4.2 Staatlich geprüfte Techniker und entsprechende Tätigkeiten<br />
6.4.3 Technische Assistenten entsprechende Tätigkeiten<br />
7<br />
+ AN der E 6.1<br />
+ besondere Spezialkenntnisse<br />
+ gründliche und vielseitige<br />
Fachkenntnisse<br />
und<br />
+ selbständige Leistungen<br />
„sonstige AN“<br />
Beispiele:<br />
7.4.1 Handwerks- und Industriemeister mit fachlicher Auf<strong>sich</strong>t über<br />
Handwerker oder Facharbeiter<br />
7.4.2 Handwerks- und Industriemeister, die die Voraussetzungen der<br />
Ausbildereignungs- Verordnung erfüllen und in der Berufsausbildung<br />
entsprechend tätig sind<br />
7.4.3 Komplizierte Instandhaltungs-, Reparatur - und Überholungsarbeiten<br />
an Hochspannungs- und Hochleistungsschaltgeräten oder leittechnischen<br />
Anlagen von mind. 110 KV<br />
7.4.4 versorgungstechnische, vertragsrechtliche und<br />
energiewirtschaftliche Kundenberatung<br />
7.4.5 An- und Abfahren aller Kraftwerksanlagen und Eingreifen bei<br />
Störungen als Kraftwerker mit Kraftwerkerprüfung<br />
Juni 2011<br />
612 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
8<br />
Erhebliches Herausheben aus 7.1 durch<br />
Maß der Verantwortung<br />
+ gründliche, umfassende<br />
Fachk enntnisse<br />
und<br />
+ selbständige Leistungen<br />
9<br />
Herausheben aus E 8.2 durch<br />
besonders verantwortungsvolle Tätigkeit<br />
+ abgeschlossene FH-<br />
Ausbildung<br />
+ entspre chende Tätigkeiten<br />
10<br />
Herausheben aus E 9.1 oder E 9.2 durch<br />
besondere Schwierigkeit und Bedeutung<br />
„sonstige AN“<br />
Bild 6. Die Tätigkeitsmerkmale im Überblick.<br />
„sonstige AN“<br />
„sonstige AN“<br />
Beispiele:<br />
10.3.1 versorgungstechnische, vertragsrechtliche<br />
und energiewirtschaftliche Kundenberatung<br />
der Sonderabnehmer<br />
10.3.2 Kostenrechnungen, Kostenanalysen,<br />
Kalkulationen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />
10.3.3 Bearbeiten von schwierigen Aufgaben in<br />
der Finanz- /Anlagenbuchhaltung<br />
(Kontierungen, Wertberichtigungen und<br />
Abschreibungen) mit Jahresabschlussarbeiten<br />
(Bilanz, GuV)<br />
10.3.4<br />
10.3.5<br />
Alleinverantwortliche Überwachung von<br />
Energieerzeugungsanlagen<br />
Selbständiges Anfertigen, Ändern und<br />
Pflegen von DV-Programmen und DV-<br />
Programm bausteinen hohen<br />
Schwierigkeitsgrades<br />
Beispiele:<br />
8.4.1 Handwerks-und Industriemeister, die große Arbeitsstätten<br />
(Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) fachlich<br />
beauf<strong>sich</strong>tigen, in denen Handwerker oder Facharbeiter<br />
beschäftigt sind<br />
8.4.2<br />
8.4.3<br />
8.4.4<br />
8.4.5<br />
An- und Abfahren von Kraftwerksblöcken mit einer Leistung von<br />
mehr als 100 MW und Eingreifen bei Störungen als Kraftwerker mit<br />
Kraftwerkerprüfung<br />
Erstellen von Kostenangeboten und Bearbeiten von<br />
Versorgungsanfragen in mehreren Energiesparten<br />
Tätigkeiten als Bilanzbuchhalter<br />
Selbständiges Anfertigen, Ändern und Pflegen von DV-Programmen<br />
und DV-Programmbausteinen<br />
-<br />
Beispiele:<br />
9.4.1 Handwerks und Industriemeister, die ausdrücklich zu Leitern von<br />
großen Arbeitsstätten bestellt sind in denen Handwerker oder<br />
Facharbeiter beschäftigt sind<br />
9.4.2 Bau und Betrieb von Netzen einschließlich Personal- und<br />
Materialeinsatz<br />
9.4.3 Abschließende Bearbeitung und Zuordnung von aktivierungspflichtigen<br />
und nichtaktivierungspflichtigen Aufträgen und deren<br />
Weiterberechnung<br />
9.4.4 Abrechnung von schwierigen und speziellen Verträgen der<br />
Sonderabnehmer<br />
9.4.5 Selbständiges Anfertigen, Ändern und Pflegen von DV-Programmen<br />
und DV-Programmbausteinen mittleren Schwierigkeitsgrades<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 613
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
EG FG 1 FG 2 FG 3 FG 4<br />
Beispiele:<br />
11.4.1 Ermittlung von bereichsübergreifenden Vergleichszahlen, Soll-Ist-<br />
Vergleich und Abweichungsanalysen als Controller<br />
+ abgeschlossene wiss.<br />
Hochschulbildung<br />
+ entsprechende Tätigkeiten<br />
11<br />
11.4.2 Analysieren, Testen und Einführen von DV-Systemen und deren<br />
Wartung als DV-Organisator<br />
11.4.3 Analysieren, Planen, Implementieren und Kontrollieren von<br />
Beriebssystemen und Standardsoftware als Systemprogrammierer<br />
„sonstige AN“<br />
Erhebliches Herausheben aus<br />
E 10.1 durch Maß der<br />
Verantwortung<br />
Bauleitung von besonders schwierigen Neu- und Erweiterungsbauten-,<br />
Gas-, <strong>Wasser</strong>- oder Fernwärmenetzim Strom<br />
11.4.4<br />
Entwurf, Vortrassierung und Ausschreibung von Leitungs- und<br />
Tiefbauarbeiten im MS- und HS-Netz von besonderer Schwierigkeit<br />
11.4.5<br />
+ abgeschlossene wiss.<br />
Hochschulbildung<br />
+ einjährige einschlägige<br />
Berufsausübung<br />
+ entsprechende Tätigkeiten<br />
12<br />
„sonstige AN“<br />
„sonstige AN“<br />
Herausheben aus E 12.1 durch<br />
besondere Schwierigkeit und Bedeutung<br />
13<br />
„sonstige AN“<br />
Erhebliches Herausheben aus E 13.1<br />
durch Maß der Verantwortung<br />
14<br />
Bild 6. Die Tätigkeitsmerkmale im Überblick (Fortsetzung).<br />
15 Erhebliches Herausheben aus E 14.1 „sonstige AN“<br />
als Kriterium für eine bestimmte Entgeltgruppe ausscheidet<br />
[19], was im TV-V für die Beispiele 4.3.4 und<br />
5.4.7 (Montagearbeiten in Netzen…) zutrifft. Zum anderen<br />
soll durch die Beispielstätigkeiten nicht ausgeschlossen<br />
werden, dass nicht auch ein Oberbegriff einer<br />
höheren Entgeltgruppe erfüllt ist (Vorbemerkung Nr. 1<br />
Satz 3 TV-V).<br />
Zusammenfassend ist in der Praxis also zunächst zu<br />
prüfen, ob der Arbeitsinhalt einer Beispielstätigkeit entspricht<br />
und in einem zweiten Schritt, ob die Oberbegriffe<br />
einer darüber liegenden Entgeltgruppe erfüllt<br />
werden, was aufgrund der Strenge der Rechtsprechung<br />
zu den Oberbegriffen regelmäßig nicht der Fall sein<br />
wird.<br />
3.7 Heraushebungsmerkmale<br />
Die Eingruppierung im TV-V folgt dem o. g. Baukastenprinzip.<br />
An verschiedenen Stellen erfolgt darüber hinaus<br />
eine ausdrückliche Heraushebung durch sog. Heraushebungsmerkmale,<br />
die ein zusätzliches qualifizierendes<br />
Tätigkeitsmerkmal fordern [21].<br />
Beispiele: Heraushebungsmerkmale<br />
1. „Arbeitnehmer, deren Tätigkeiten <strong>sich</strong> durch das<br />
Maß ihrer Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe<br />
7.1 herausheben“<br />
(Entgeltgruppe 8, Fallgruppe 8.1)<br />
2. „Arbeitnehmer deren Tätigkeiten <strong>sich</strong> dadurch aus<br />
der Entgeltgruppe 8.2 herausheben, dass sie besonders<br />
verantwortungsvoll sind“<br />
(Entgeltgruppe 9, Fallgruppe 9.1)<br />
3. „Arbeitnehmer, deren Tätigkeiten <strong>sich</strong> durch besondere<br />
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe<br />
9.1 oder 9.2 herausheben“<br />
(Entgeltgruppe 10, Fallgruppe 10.1)<br />
Dementsprechend sind sie nur zu prüfen, wenn die<br />
zugrunde liegenden Tätigkeitsmerkmale erfüllt sind<br />
[22].<br />
3.8 (Keine) Entgeltgruppe 1 TV-V<br />
Mit der Entgeltgruppe 1 stellen die Tarifvertragsparteien<br />
die Rechtsgrundlage für eine sog. Leichtlohngruppe<br />
zur Verfügung, die Outsourcing (Fremdvergabe)<br />
verhindern und Insourcing (Wiederaufnehmen einer<br />
Leistung) ermöglichen soll [3, Abschnitt 3, Rdnr. 2].<br />
Allerdings sieht der TV-V, anders als der TVöD-VKA,<br />
keinen allgemein gültigen Katalog vor. Dieser muss vielmehr<br />
erst durch landesbezirkliche Tarifverträge vereinbart<br />
werden, was bislang nur im Landesbezirklichen<br />
Tarifvertrag NRW vom 06.10.2003 zur Ergänzung der<br />
Anlage 1 Entgeltgruppen zum TV-V erfolgt ist [3,<br />
Abschnitt 3, Rdnr. 10.1 ff.; 20].<br />
Ohne einen solchen ergänzenden landesbezirklichen<br />
Tarifvertrag darf in EG 1 TV-V nicht eingruppiert<br />
werden.<br />
Juni 2011<br />
614 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
4. Mitbestimmung<br />
Die korrekte Anwendung des Eingruppierungsrechts<br />
wird durch den Betriebs- bzw. Personalrat überwacht.<br />
Das gilt so<strong>wohl</strong> für die Rechtslage im Betriebsverfassungsgesetz<br />
[23] als auch für das Personalvertretungsrecht<br />
[24]. Das Mitbestimmungsrecht erstreckt <strong>sich</strong> auf<br />
die Eingruppierung, nicht aber auf die Stellenbeschreibung<br />
als Bewertungsgrundlage.<br />
Im Mitbestimmungsverfahren hat die Arbeitnehmervertretung<br />
ein Mitbeurteilungsrecht, ob der Arbeitgeber<br />
bzw. die Dienststellenleitung den „Akt der Rechtsanwendung“<br />
richtig vollzieht und die Tarifautomatik<br />
zutreffend anwendet. Deshalb ist die Mitbestimmung in<br />
den Fällen der Tarifautomatik gerade nicht ausgeschlossen,<br />
vielmehr wird die korrekte Anwendung im Rahmen<br />
der Mitbestimmung überwacht [25]. Weil das Betriebsverfassungs-<br />
bzw. Personalvertretungsrecht keine „Teileingruppierung“<br />
kennt, erstreckt <strong>sich</strong> das Mitbestimmungsrecht<br />
auf alle Aspekte, die im TV-V bzw. TV-WW/<br />
NW für die Bestimmung des Arbeitsentgelts ohne Leistungsbezug<br />
von Bedeutung sind. Das ist ein „Dreiklang“:<br />
Entgeltgruppe, Fallgruppe und Stufe.<br />
Eine Eingruppierung ist die Einordnung des einzelnen<br />
Arbeitnehmers in ein kollektives Entgeltschema<br />
[25, 26]. In der älteren Rechtsprechung wird in diesem<br />
Zusammenhang auf die „erstmalige“ Zuordnung der<br />
vertraglich vereinbarten Tätigkeit zu einem kollektiven<br />
Entgeltsystem abgestellt. Es wurde aber durch das<br />
Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass eine mitbestimmungspflichtige<br />
Eingruppierung auch vorliegt,<br />
wenn <strong>sich</strong> die Arbeitsaufgaben im Verlauf des Arbeitsverhältnisses<br />
wesentlich ändern, so dass eine neue Eingruppierung<br />
erforderlich wird [27]. Der Begriff der Eingruppierung<br />
umfasst aber auch die Bestimmung der<br />
Fallgruppe [28]. Das gilt unabhängig davon, ob das<br />
jeweilige Personalvertretungsgesetz eines Landes die<br />
Bestimmung der Fallgruppe ausdrücklich als Mitbestimmungstatbestand<br />
aufführt.<br />
Die Führungskraft muss so<strong>wohl</strong> die Entgeltgruppe<br />
als auch die Fallgruppe des Tarifbeschäftigten kennen,<br />
anderenfalls kann sie ihr Weisungs- bzw. Direktionsrecht<br />
gem. § 106 GewO i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 2 TV-V nicht rechts<strong>sich</strong>er<br />
ausüben. Die Übertragung anderer Tätigkeiten<br />
kann zu einer mitbestimmungspflichtigen Fallgruppenänderung<br />
oder vorübergehenden Übertragung<br />
höherwertigen Tätigkeiten führen. Die rechtswidrige<br />
Übertragung niederwertiger Tätigkeiten stellt eine klassische<br />
Mobbinghandlung dar.<br />
Die notwendigen Informationen erhält die Führungskraft<br />
aus einer tarifkonformen Stellenbeschreibung,<br />
die in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft vorgehalten werden<br />
muss. Stellenbeschreibungen unterliegen grundsätzlich<br />
nicht der Mitbestimmung des Betriebs- bzw. Personalrats,<br />
denn sie befassen <strong>sich</strong> nicht mit dem „Beschäftigten“<br />
bzw. „Arbeitnehmer“, sondern nur mit der „Stelle“.<br />
Sie sind weder mitbestimmungspflichtige Personalfragebögen<br />
noch Auswahlrichtlinien oder Entgeltgrundsätze.<br />
Deshalb darf der Arbeitgeber Stellenbeschreibungen<br />
jederzeit ändern. In diesem Zusammenhang darf<br />
dieser – ohne Beteiligung der Arbeitnehmervertretung<br />
– manuelle Zeitaufschreibungen anordnen [29].<br />
Eine Mitbestimmung sieht nur § 70 Abs. 1 Nr. 10<br />
LPVG MV vor.<br />
Unabhängig von der Rechtslage ist es gleich<strong>wohl</strong><br />
ratsam, die Arbeitnehmervertretung frühzeitig einzubinden,<br />
um Widerstände zu verringern. So kann es<br />
Vorteile bringen, Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen<br />
(teilweise) durch eine Stellenbewertungskommission<br />
durchführen zu lassen. Gerade bei<br />
komplizierten technischen Berufen sind Einzelbewerter<br />
möglicherweise überfordert. Wenn es um die flächendeckende<br />
Beschreibung und Bewertung der Verwaltung<br />
oder um Muster- beziehungsweise Schlüsselstellen<br />
geht, kann die Bewertung durch eine Gruppe die<br />
allgemeine Akzeptanz erhöhen. Anschließende Mitbestimmungsverfahren<br />
im Hinblick auf die Ein- oder<br />
Umgruppierung können dann vereinfacht und be -<br />
schleunigt werden, was Zeit und Geld spart [30, 31]. Bei<br />
diesem Verfahren ist der Betriebs- bzw. Personalrat „von<br />
Anfang an mit im Boot“, trägt dann aber zugleich – für<br />
alle Beschäftigten <strong>sich</strong>tbar – auch die Mitverantwortung,<br />
was nicht jedes Gremium wünscht und schätzt. Es<br />
taucht dann auch die Frage auf, „wer das Boot steuert“.<br />
Letztendlich spiegelt <strong>sich</strong> an dieser Stelle die Unternehmenskultur<br />
wider: Ist sie mehr auf Mit- oder auf Gegeneinander<br />
ausgerichtet und gehen die Betriebspartner<br />
tatsächlich vertrauensvoll miteinander um? Die Arbeit<br />
mit einer Stellenbewertungskommission ersetzt kein<br />
Mitbestimmungsverfahren hin<strong>sich</strong>tlich der Ein- oder<br />
Umgruppierung.<br />
5. Fazit<br />
Das Eingruppierungsrecht der <strong>Wasser</strong>wirtschaft hat <strong>sich</strong><br />
über die Spartentarifverträge TV-V und TV-WW/NW vom<br />
Tarifrecht des öffentlichen Dienstes abgespalten. Diese<br />
speziellen Vorschriften verdrängen regelmäßig den<br />
TVöD-VKA, der nur in seltenen Fällen Anwendung findet.<br />
Dementsprechend sind Analogien unzulässig [3,<br />
Abschnitt 3, Rdnr. 1 ff.]. Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft hat <strong>sich</strong><br />
vom Eingruppierungsrecht der Verwaltung vollständig<br />
emanzipiert. Ungeprüfte Analogien sind genauso verfehlt<br />
wie ein Ignorieren dieses Rechts. Erfolgreiche Führung<br />
setzt auch Kenntnisse des Eingruppierungsrechts<br />
voraus: „Also, sag ich, ist es gut, Mehr als eine Kunst zu<br />
wissen.“<br />
Literatur<br />
[1] Parodie einer Fabel von Dr. jur. Magnus Gottfried Lichtwer<br />
(1719-1783). fabuloes.blogspot.com/search/label/Lichtwer,<br />
31.05.2010.<br />
[2] Vgl. BAG 10.06.2009, 4 AZR 77/08, kostenloser Download<br />
unter www.bundesarbeitsgericht.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 615
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
[3] Herzberg, B. und Schlusen, R.: Tarifvertrag Versorgungsbetriebe,<br />
Köln 2010, Kapitel B (ISBN 978-3-472-04923-4).<br />
[4] Richter, A. und Gamisch, A.: Eingruppierung Tarifvertrag Versorgung,<br />
Regensburg/Berlin 2007 (ISBN 978-3-8029-1549-9).<br />
[5] Vgl. Hoffmann, M.: Der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-<br />
V) vom 5. Oktober 2000, ZTR 2001, S. 54 ff. Richter/Gamisch<br />
in: Effertz/Richter/Gamisch, Taschenbuch für den öffentlichen<br />
Dienst – Eingruppierung, Regensburg 2010, Komm IV.<br />
[6] Vgl. BAG 11.12.2003, NJW 2004, S. 2545, 2546.<br />
[7] Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden summarischer<br />
und analytischer Bewertungsverfahren siehe einführend<br />
Richter, A./Kaufmann, M.: Stellenbeschreibung – Mehr als<br />
ein Etikett. AuA 5/2005, S. 282 f.; vertiefend Scholz, C.: Personalmanagement,<br />
München 2000, S. 735 ff. (ISBN<br />
3800621827).<br />
[8] Vgl. BAG 15.02.1971, AP Nr. 38 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG<br />
14.08.1985, AP Nr. 109 zu §§ 22, 23 BAT 1975.<br />
[9] Effertz, J.: TVöD Tarifabschluss 2010 Kommunen, S. 10 (ISBN<br />
978-3-8029-8024-4); Entgelttabelle 2010 zum TV-WW/NW<br />
(nicht veröffentlicht).<br />
[10] Vgl. BAG 27.07.1993, AP Nr. 110 zu § 99 BetrVG 1972; BAG<br />
30.05.1990, AP Nr. 31 zu § 75 BPersVG.<br />
[11] Vgl. Knebel, H. und Schneider, H.: Die Stellenbeschreibung,<br />
Frankfurt a. M. 2006, S. 251 (ISBN 3-8005-7329-6).<br />
[12] Vgl. Richter, A. und Gamisch, A.: Stellenbeschreibung für den<br />
öffentlichen und kirchlichen Dienst, 3. Auflage Regensburg<br />
2009, S. 119 ff. (ISBN 978-3-8029-7489-2); Richter, A./<br />
Gamisch, A.: Stellenbeschreibung im öffentlichen Dienst,<br />
RiA 2006, S. 245 - 252; Richter, A./Kaufmann, M.: Stellenbeschreibung<br />
- Mehr als ein Etikett. AuA 7/2004. S. 25 - 28;<br />
Richter, A./Kaufmann, M.: Die Stellenbeschreibung im<br />
öffentlichen Dienst, AuA 2005, S. 282 - 286.<br />
[13] Vgl. BAG 05.11.1992, AP Nr. 1 zu § 2 MTB II SR 2a.<br />
[14] Zur Eingruppierung der neuen Bachelor- und Masterabschlüsse<br />
siehe Richter, A./Gamisch, A.: Die neuen Hochschulabschlüsse<br />
Bachelor und Master im Eingruppierungsrecht<br />
des öffentlichen Dienstes, RiA 2009, S. 97 ff.<br />
[15] Vgl. Brockhaus: Enzyklopädie, Mannheim 2003 (elektronische<br />
Ressource). Stichwort: Berufsbild.<br />
[16] Vgl. z. B. BAG 28.09.1994, AP Nr. 192 zu §§ 22, 23 BAT 1975.<br />
[17] Vgl. BAG 18.11.2004, AP Nr. 88 zu § 1 TVG Tarifverträge: Einzelhandel.<br />
[18] Vorbemerkung Nr. 1 Satz 2 der Anlage 1 zu § 5 TV-V.<br />
[19] Vgl. BAG 08.03.2006, 10 AZR 538/05, kostenloser Download<br />
unter www.bundesarbeitsgericht.de<br />
[20] Hofmann, H.: Tarifrecht im öffentlichen Dienst Eingruppierung<br />
von A-Z TVöD - V-L, Köln 2010, A 270, S. 7 ff. (ISBN 978-<br />
3-472-06288-2).<br />
[21] Vgl. Krasemann, K.: Das Eingruppierungsrecht des BAT/BAT-<br />
O, Frankfurt a. M. 2005, 7. Kapitel, Rdnr. 115 (ISBN 3-7663-<br />
2811-5).<br />
[22] Vgl. BAG 12.05.2004, AP Nr. 301 zu §§ 22, 23 BAT 1975.<br />
[23] Vgl. Fitting, K.: Betriebsverfassungsgesetz, 25. Auflage 2010,<br />
§ 99 Rdnr. 79 ff. (ISBN 978-3-8006-3712-6).<br />
[24] Vgl. Lenders, D. und Richter, A.: Die Personalvertretung, Köln<br />
2010, S. 98 ff. (ISBN 978-3-472-07475-5).<br />
[25] Vgl. BVerwG 25.06.2008, 6 P 15.08 zum LPVG BW.<br />
[26] Vgl. BAG 17.03.2005, AP Nr. 90 zu § 1 TVG Tarifverträge Einzelhandel.<br />
[27] Vgl. BVerwG 08.12.1999, AP Nr. 74 zu § 75 BPersVG.<br />
[28] Vgl. BAG 27.07.1993, AP Nr. 110 zu § 99 BetrVG 1972.<br />
[29] Vgl. BAG 19.04.2007, AP Nr. 77 zu § 611 BGB Direktionsrecht.<br />
[30] Vgl. Nickels, S., Repkewitz, U., Richter, A. und Gamisch, A.: Personalrecht<br />
A-Z, Köln 2010, Stichwort Stellenbewertungskommission<br />
(ISBN 978-3-472-00966-5).<br />
[31] Richter, A. und Gamisch, A.: Die Stellenbewertungskommission<br />
als Instrument der Eingruppierung, RiA 2007, S. 241 ff.<br />
Autoren<br />
Eingereicht: 28.01.2011<br />
Korrektur: 03.05.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Achim Richter M.A. M.A.<br />
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Studium der Rechtswissenschaft, Mediation,<br />
Personalentwicklung und Erwachsenenbildung; Trainerausbildung;<br />
langjährige Erfahrungen als Rechtsanwalt, Berater und Trainer im<br />
Arbeits- und Tarifrecht des öffentlichen Dienstes; Sozius der Kanzlei<br />
Brüggemann & Richter |<br />
E-Mail: richter@brueggemann-richter.de |<br />
Brüggemann & Richter |<br />
Rechtsanwälte |<br />
Waisenhausstraße 41 |<br />
D-41236 Mönchengladbach<br />
Annett Gamisch<br />
Diplom-Betriebswirtin (BA) für öffentliche Wirtschaft; langjährige<br />
Erfahrungen im Eingruppierungsrecht und in der Erstellung von Stellenbeschreibungen<br />
und -bewertungen für den öffentlichen Dienst;<br />
Geschäftsführerin des IPW – Institut für PersonalWirtschaft GmbH in<br />
Fulda, das den öffentlichen und kirchlichen Dienst schult und personalwirtschaftlich<br />
berät |<br />
E-Mail: a.gamisch@ipw-fulda.de |<br />
IPW – Institut für PersonalWirtschaft GmbH |<br />
An der Richthalle 6 |<br />
D-36037 Fulda<br />
Juni 2011<br />
616 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNG<br />
Buchbesprechung<br />
Handbuch des Deutschen <strong>Wasser</strong>rechts<br />
Neues Recht des Bundes und der Länder<br />
Herausgegeben von Heinrich Frhr. von Lersner,<br />
Konrad Berendes, Michael Reinhardt. Begründet<br />
von Alexander Wüsthoff und Walther Kumpf.<br />
Berlin, Bielefeld, München: Erich Schmidt Verlag<br />
2010. Loseblatt-Kommentar, 16064 S. in 8 Ordnern,<br />
Preis: 268,– €, ISBN 978-3-503-00011-1.<br />
In den über 50 Jahren seines Bestehens hat <strong>sich</strong> das<br />
Handbuch des Deutschen <strong>Wasser</strong>rechts einen<br />
führenden Platz als Standardwerk in der Fachwelt<br />
ge<strong>sich</strong>ert. Als ständiges Arbeitsmittel in der Praxis<br />
ist es ebenso anerkannt wie als Nachschlagewerk zu<br />
Spezialfragen. Das vielseitige Werk enthält Vorschriften<br />
und Verordnungen, die nicht leicht<br />
zugänglich sind.<br />
Die wichtigsten Vorteile, die dieses Werk bietet:<br />
Schneller Überblick über die komplexe Materie,<br />
die einzelnen Kommentierungen sind sehr<br />
ausführlich und gut verständlich<br />
Alle relevanten wasserrechtlichen Vorschriften<br />
des Bundes und der Länder stehen zur<br />
Ver fügung.<br />
Jedes Bundesland ist in diesem Werk mit einem<br />
Mitarbeiter vertreten, der <strong>sich</strong> speziell um die<br />
Vorschriften aus diesem Bundesland kümmert<br />
und <strong>sich</strong> hier besonders gut auskennt.<br />
Das Werk wird regelmäßig durch Nachlieferungen<br />
ergänzt und somit auf den neuesten<br />
Stand gebracht.<br />
Aktuelle Kommentierungen stehen zu folgenden<br />
Gesetzen zur Verfügung:<br />
<strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
<strong>Abwasser</strong>abgabengesetz<br />
Wasch- und Reinigungsmittelgesetz<br />
Bundeswasserstraßengesetz.<br />
Als „HDW“-Abonnent hat man einen kostenlosen<br />
Zugang zur Umweltrechtsdatenbank unter<br />
www.UMWELTdigital.de! Hier stehen zusätzlich<br />
laufend aktualisierte wasserrechtliche Normen zur<br />
Verfügung.<br />
Mit der aktuellen Ergänzungslieferung wird vom<br />
September 2010 der zweite Teil des Kurzkommentars<br />
von Konrad Berendes zum neuen WHG in<br />
das HDW aufgenommen (Kommentierung der<br />
§§ 40–106, Stichwortverzeichnis, Literaturverzeichnis).<br />
Damit liegt die Kommentierung vollständig<br />
vor. Der Kurzkommentar erscheint wortgleich<br />
auch als Buch in einem festen Einband.<br />
Bestellmöglichkeit online<br />
www.ESV.info/978 3 503 00011 1<br />
Zeitschrift KA – <strong>Abwasser</strong> · Abfall<br />
In der Ausgabe 6/2011 lesen Sie u. a. fol gende Bei träge:<br />
Dohmann/Schröder<br />
Thöle u. a.<br />
Thyen u. a.<br />
Hartwig/Rosenwinkel<br />
Veltmann u. a.<br />
Thamson/Tornow<br />
Remy u. a.<br />
Energie in der <strong>Abwasser</strong>entsorgung – Rückschau und Ausblick<br />
Energie- und CO 2 -Bilanz eines <strong>Wasser</strong>verbandes<br />
Energieinfrastruktur und Energiemangement auf dem Zentralklärwerk der<br />
Hansestadt Lübeck, sowie Bildung eines unternehmensweiten Bilanzkreises<br />
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energiebilanz einer Kläranlage am Beispiel<br />
der Kläranlage Rheda-Wiedenbrück<br />
Reduzierung des Energieverbrauchs großtechnischer Membranbelebungsanlagen<br />
Optimierung von <strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
Die Methodik der Ökobilanz zur ganzheitlichen Erfassung des Energieverbrauchs<br />
in der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 617
FACHBERICHTE Regenwasserbehandlung<br />
Plädoyer für die Aufhebung des<br />
ATV-Arbeitsblattes A 128<br />
– und für eine verfahrensoffene Behandlung des Problems der<br />
Mischsystemüberläufe<br />
Regenwasserbehandlung, Mischwasserbehandlung, ATV-Arbeitsblatt A 128,<br />
Regenüberlaufbecken, Alternativverfahren<br />
Friedhelm Sieker<br />
Das ATV-Arbeitsblatt A 128 [1] hat den Titel „Richtlinien<br />
für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen<br />
in Mischwasserkanälen“. Darunter<br />
wird im Wesentlichen die Bemessung und Gestaltung<br />
von Speicherräumen zur Reduzierung der<br />
Mischwasserüberläufe verstanden. Aufgrund der<br />
Dominanz dieses Arbeitsblattes in der Praxis konnten<br />
<strong>sich</strong> bisher andere Verfahren, die ebenfalls zur<br />
Behandlung des Problems beitragen können, nicht<br />
durchsetzen. Der vorliegende Beitrag sieht die mit<br />
dem Arbeitsblatt erreichten Ergebnisse als ungenügend<br />
an und fordert daher dazu auf, die Richtlinie<br />
aufzuheben und stattdessen die Behandlung des Problems<br />
der Mischwasserüberläufe für alle in Betracht<br />
kommenden Verfahren zu öffnen.<br />
The Technical Rule ATV A 128 Should be Cancelled<br />
The technical rule ATV A128 is setting the standard<br />
for combined sewer overflows (CSO) in Germany. As<br />
the rule is focussing on the design of storage tanks,<br />
other solutions for reducing the problems caused by<br />
CSO are usually not considered in practice. This<br />
paper is critically evaluating the effects of the application<br />
of the rule. In conclusion, a cancellation of the<br />
rule and a new standard open also for other technologies<br />
is suggested.<br />
1. Kritik des Arbeitsblattes<br />
Das Arbeitsblatt stammt aus dem Jahre 1992 und ist<br />
daher stark veraltet. Das neue <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
gibt in (WHG, § 57 (1), Nr. 1 in Bezug auf das Einleiten<br />
von <strong>Abwasser</strong> in Gewässer vor, den „Stand der Technik“<br />
anzuwenden. Was „Stand der Technik“ bedeutet, wird in<br />
§ 3 Nr. 11 und in der Anlage 1 des WHG, definiert. Das<br />
Arbeitsblatt A 128 [1], das bisher in den einzelnen Bundesländern<br />
entweder direkt oder indirekt allein maßgebend<br />
ist für die Begrenzung der Mischsystemüberläufe,<br />
ist inzwischen nahezu 20 Jahre alt und kann daher allein<br />
vom Alter her <strong>sich</strong>erlich nicht in Anspruch nehmen, den<br />
„Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren“ nach<br />
Definition des WHG darzustellen.<br />
Zur unübersehbaren Alterung des Arbeitsblattes<br />
kommt ein Umstand hinzu, der es als nicht länger verträglich<br />
mit dem WHG erscheinen lässt. Während es bei<br />
den Kläranlagenabläufen, über die ein Teil der Mischwasserabflüsse<br />
in die Gewässer gelangt, eine klare Trennung<br />
zwischen den Anforderungen an die notwendige<br />
Behandlung (betreffs zulässiger Restverschmutzung<br />
gemäß <strong>Abwasser</strong>verordnung) und den möglichen Verfahren,<br />
diese Anforderungen zu erreichen gibt, so dass<br />
verschiedene Verfahren zur Erreichung bestmöglicher<br />
Ablaufwerte zur Anwendung kommen können, sind im<br />
Arbeitsblatt A 128 diese beiden Aspekte miteinander<br />
verknüpft. Hier gibt es praktisch nur ein Verfahren, nämlich<br />
das der Bemessung und Anlage von Rückhalte volumina.<br />
Das Verfahren erhebt den Anspruch, mit dem<br />
Nachweis eines bestimmten Rückhaltevolumens die<br />
Anforderungen der zulässigen Belastung der Gewässer<br />
zu gewährleisten (A 128 (2): Ein wirkungsvoller Schutz<br />
der Gewässer und der Kläranlagen vor übermäßigen<br />
Belastungen ist zu erwarten, wenn die notwendige<br />
Regenwasserbehandlung nach Maßgabe dieser Richtlinien<br />
erfolgt). Ob <strong>sich</strong> durch andere Verfahren bzw. Verfahrenskombinationen<br />
bessere Ergebnisse bezüglich<br />
vergleichbarer Behandlungsmerkmale erzielen lassen,<br />
ist im Arbeitsblatt nicht enthalten, abgesehen von verbalen<br />
Hinweisen auf Abflussvermeidung und Abflussverminderung.<br />
Den Mangel, Ziele und Anforderungen<br />
für den Gewässerschutz explizit zu benennen und eine<br />
verfahrensoffene Behandlung des Problems der Mischsystemüberläufe<br />
zu ermöglichen, kann man als einen<br />
Juni 2011<br />
618 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Regenwasserbehandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
schwer wiegenden „Geburtsfehler“ des Arbeitsblattes<br />
bezeichnen.<br />
2. Auswirkungen des Arbeitsblattes<br />
In Deutschland gab es im Jahre 2007 nach [2] rund<br />
24 000 so genannte „Regenüberlaufbecken“, womit<br />
nach bisherigem Sprachgebrauch Becken in Mischwassersystemen<br />
gemeint sind, die bei Überlastung des Systems<br />
Mischwasser, also die Mischung aus Regen- und<br />
Schmutzwasser, in Gewässer einleiten. Die Bezeichnung<br />
„Regenüberlaufbecken“ beschönigt etwas die Tatsache,<br />
dass nicht nur ein Teil des im Allgemeinen relativ gering<br />
verschmutzten Regenwassers in Gewässer eingeleitet<br />
wird, sondern auch ein Teil des synchron abfließenden<br />
häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers, was<br />
eventuell durch die Ausspülung von schmutzwasserbürtigen<br />
Ablagerungen „angereichert“ ist. Es wäre also<br />
zutreffender, in Zukunft von „Mischwasserüberlaufbecken“<br />
statt von „Regenüberlaufbecken“ zu sprechen.<br />
Man kann davon ausgehen, dass die in Deutschland<br />
bisher gebauten Becken dieser Art im Allgemeinen<br />
unter Anwendung des Arbeitsblattes A 128 oder dessen<br />
Vorläufer bemessen und geplant worden sind. Ob und<br />
inwieweit in der angegebenen Anzahl auch so genannte<br />
Stauraumkanäle enthalten sind, ist der Statistik nicht zu<br />
entnehmen. Da diese jedoch ebenfalls nach [1] bemessen<br />
werden, kann man sie, falls nicht enthalten, gedanklich<br />
der Zahl von 24 000 Becken hinzu addieren.<br />
Die 24 000 Becken haben nach [2] ein Speichervolumen<br />
von rund 15 Mio. m 3 Speicherraum. Da es <strong>sich</strong> bei<br />
den Mischwasserüberlaufbecken und Stauraumkanälen<br />
in aller Regel um unterirdische Bauwerke mit aufwändiger<br />
Ausstattung für die Selbstreinigung handelt, ist<br />
der finanzielle Aufwand für die Investition entsprechend<br />
hoch und mit mindestens 1000 Euro pro m 3 Speichervolumen<br />
<strong>sich</strong>erlich nicht zu hoch angesetzt, so dass <strong>sich</strong><br />
die auf das Arbeitsblatt zu beziehenden Investitionen ‒<br />
auf den heutigen Preisindex bezogen – auf mindestens<br />
15 Milliarden Euro belaufen. Hinzu kommen die erheblichen<br />
Finanzierungs-, Abschreibungs- und Betriebskosten,<br />
so dass es <strong>sich</strong>, auf Mischsysteme bezogen, um<br />
einen Kostenkomplex handelt, der in der Größenordnung<br />
derer von Kläranlagen und Kanalnetzen liegt.<br />
3. Die Zielgröße des Arbeitsblattes ist aus<br />
heutiger Sicht in Frage zu stellen<br />
Unter den verschiedenen Möglichkeiten, in Bezug auf<br />
die zulässige Belastung der Gewässer durch verbleibende<br />
Mischwasserüberläufe Zielgrößen und Anforderungen<br />
zu definieren, hat man <strong>sich</strong> bei der Abfassung<br />
des Arbeitsblattes für die CSB-Jahresfracht entschieden.<br />
Darauf bezogen wurde ein Bezugslastfall entwickelt, der<br />
unter Berück<strong>sich</strong>tigung örtlich unterschiedlicher Verhältnisse<br />
letztlich auf ein Speichervolumen führt, dessen<br />
Wirkung darin besteht, einen Teil der Mischwasserabflüsse<br />
an den Mischwasserüberlaufpunkten zurückzuhalten<br />
und anschließend über die Kläranlage zu<br />
leiten. Was dennoch in Bezug auf die CSB-Jahresfracht<br />
als Belastung des Gewässers verbleibt, ist einerseits die<br />
CSB-Fracht der Überlaufereignisse des Speichervolumens<br />
und andererseits die niederschlagsbedingte CSB-<br />
Ablauffracht der Kläranlage. Das notwendige Speichervolumen<br />
wird nun so berechnet, dass die Summe der<br />
auf beiden Wegen in das Gewässer gelangenden CSB-<br />
Fracht kleiner oder gleich der CSB-Fracht der Regenabflüsse<br />
des betroffenen Gebietes ist. Mit dieser „Zielsetzungsgleichung“<br />
([1], Abschnitt 7.1.6) wird indirekt die<br />
zulässige CSB-Einleitungsfracht der Mischsysteme mit<br />
angenommenen CSB-Einleitungsfrachten der Trennsysteme<br />
gleichgesetzt. Dahinter steckt der Grundgedanke,<br />
dass man in Bezug auf die Zielgröße „CSB-Jahresfracht“<br />
eine Gleichstellung von Misch- und Trennsystemen herbeiführen<br />
wollte. Die jährliche CSB-Entlastungsfracht<br />
eines Trennsystems wird im Bezugslastfall mit 600 kg je<br />
ha abflusswirksame Fläche angenommen. Für Trennsysteme<br />
galt seinerzeit, dass deren Regenabflüsse ohne<br />
Behandlung in die Gewässer eingeleitet werden dürfen.<br />
Dieser Grundgedanke mag unter den Verhältnissen<br />
der Jahre, in denen das Arbeitsblatt erarbeitet wurde,<br />
verständlich erscheinen. Aus heutiger Sicht ergibt <strong>sich</strong><br />
daraus ein Problem, das die Anwendung des Arbeitsblattes<br />
A 128 unter Berück<strong>sich</strong>tigung der heutigen<br />
Gesetzeslage insgesamt fragwürdig macht. Nach § 54<br />
(1) Nr. 2 fällt Niederschlagswasser, das aus dem Bereich<br />
von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt<br />
abfließt, unter den Begriff „<strong>Abwasser</strong>“. Für die Einleitung<br />
von <strong>Abwasser</strong> in Gewässer werden jedoch nach WHG<br />
§ 57, (1) und (2) Bedingungen gestellt, die für das Erteilen<br />
einer Erlaubnis beachtet werden müssen. Dieses gilt<br />
also auch für die Einleitung von Niederschlagsabflüssen<br />
über Trennsysteme, d. h. von einer bedingungslosen<br />
Einleitung aus Trennsystemkanälen, wie sie dem<br />
Arbeitsblatt A 128 zugrunde liegt, kann nicht mehr ausgegangen<br />
werden. Mutmaßlich dürfte damit der Wert<br />
von 600 kg CSB je ha/a, der bisher als zulässig gesetzt<br />
wurde und dem Arbeitsblatt A 128 als zulässiger Wert<br />
für Mischwassereinleitungen zugrunde liegt, zukünftig<br />
nicht zu halten sein.<br />
4. Was wurde mit dem Arbeitsblatt<br />
bisher erreicht?<br />
Es kann nicht bestritten werden, dass durch die Herstellung<br />
und den Betrieb eines zusätzlichen Speicherraums<br />
von 15 Mio. m 3 in den Mischsystemen Deutschlands<br />
eine Verbesserung bezüglich der Mischsystem-Überlauf-Problematik<br />
eingetreten ist. Doch ist das Erreichte<br />
den bisherigen finanziellen Aufwand wert? Das als<br />
typisch anzusehende Berechnungsbeispiel im Arbeitsblatt<br />
A 128 (Abschnitt 11.2) weist aus, dass nach Ausführung<br />
des berechneten Speichervolumens von dessen<br />
Absetzwirkung abgesehen noch mehr als 40 % der<br />
Mischwasserabflüsse des Systems chemisch und bio-<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 619
FACHBERICHTE Regenwasserbehandlung<br />
logisch ungereinigt in das Gewässer eingeleitet werden.<br />
Wenn man unterstellt, dass auch ohne Speichervolumen,<br />
allein durch die Speicherwirkung des Kanalnetzes<br />
oberhalb eines „normalen“ Mischwasserüberlaufs, ein<br />
wesentlicher Teil der Mischwasserabflüsse zur Kläranlage<br />
gelangt, relativiert <strong>sich</strong> die erzielte Wirkung der<br />
Maßnahme „Mischwasserüberlaufbecken“ zusätzlich.<br />
Kann man mit dieser Wirkung zufrieden sein? Die Antwort<br />
kann aus heutiger Sicht nur lauten: Nein, das ist<br />
nicht zufrieden stellend! In den Niederlanden z. B. sehen<br />
die Regelungen nur einen Entlastungsanteil von maximal<br />
8 % im Jahr vor [3].<br />
Nach einer Veröffentlichung von Messergebnissen [4]<br />
laufen die nach den Vorgaben des Arbeitsblattes errichteten<br />
Becken etwa 45- bis 55-mal im Jahr über. Stellt<br />
man diese Zahlen den insgesamt rund 80 Regentagen<br />
im Jahr gegenüber, wie sie in Deutschland im Durchschnitt<br />
auftreten, und berück<strong>sich</strong>tigt ferner, dass nicht<br />
jeder Regentag dazu führt, dass Speichervolumen in<br />
Anspruch genommen werden muss, stellt <strong>sich</strong> die Frage,<br />
ob durch die Becken die Anzahl der Überlaufereignisse<br />
überhaupt signifikant verringert wird. Tatsächlich sind<br />
die flächenspezifischen Speichervolumina, die <strong>sich</strong> aus<br />
der Anwendung des Arbeitsblattes ergeben, viel zu<br />
gering, um selbst häufig auftretende Regenereignisse<br />
vollständig zurück zu halten. Im Durchschnitt liegt das<br />
flächenspezifische Volumen bei etwa 25 m 3 je ha abflusswirksame<br />
befestigte Fläche. Dieses entspricht einer<br />
Regenabflusshöhe von 2,5 mm. Rechnet man 1 mm für<br />
den permanenten Regenabfluss zur Kläranlage während<br />
des Einstauereignisses (entsprechend 1 l/s ha über rund<br />
3 h) hinzu und legt man ferner für die abflusswirksamen<br />
befestigten Flächen einen Abflussbeiwert von 0,7 zu -<br />
grunde, entspricht dieses einer Regenhöhe von etwa<br />
5 mm, d. h., bei allen zusammenhängenden Regenereignissen,<br />
deren Regensumme den Wert von 5 mm übersteigt,<br />
muss es zu einem Überlaufereignis kommen. Dass<br />
dieser Wert in Deutschland sehr häufig im Jahr erreicht<br />
oder überschritten wird, ist evident und bestätigt die<br />
Messungen an ausgeführten Objekten.<br />
Die Zahl der Überlaufereignisse ist ein herausragendes<br />
Merkmal zur Beurteilung der Wirksamkeit von Speicherräumen<br />
und eines alternativen Verfahrens, auf das<br />
im Folgenden noch eingegangen wird. Die Häufigkeit<br />
der Überlaufereignisse ist ein Maß für den Grad der<br />
Beeinträchtigungen der gewässerökologischen Zu -<br />
stände bzw. für die Dauer der Erholungsphasen. Hinzu<br />
kommt, dass <strong>sich</strong> die Überlaufhäufigkeit messtechnisch<br />
einfacher erfassen lässt, als z. B. die stofflichen Merkmale<br />
der Überlaufereignisse. Letztlich ist es ein Merkmal,<br />
das in der Öffentlichkeit als besonders prägnant<br />
aufgenommen wird bzw. vermittelt werden kann.<br />
5. Fazit der Beurteilung<br />
Zusammengefasst muss man bezüglich des bisher<br />
Erreichten feststellen: Die durch das Arbeitsblatt offen<strong>sich</strong>tlich<br />
als zulässig erachteten Entlastungsraten der<br />
chemisch und biologisch ungereinigten Mischwasserabflüsse<br />
von etwa 40 % und die damit zusammenhängenden<br />
Überlaufhäufigkeiten von 30–50 pro Jahr können<br />
nicht länger hingenommen werden. Diese „Großzügigkeit“<br />
hin<strong>sich</strong>tlich zulässiger Gewässerbelastungen<br />
steht in keinem Verhältnis zu den Anstrengungen, die<br />
z.B. bezüglich der Einhaltung der Restverschmutzung<br />
bei den Kläranlagen unternommen werden.<br />
Unter Bezug auf das WHG in dessen neuer Fassung<br />
kommt hinzu:<br />
Explizit enthält das Arbeitsblatt keine Zielgrößen<br />
und zahlenmäßigen Anforderungen, die einen Wirkungsvergleich<br />
und damit eine Anwendung verschiedener,<br />
nach dem Stand der Technik in Betracht<br />
kommender Verfahren (WHG, § 57 (1), Nr. 1) möglich<br />
machen.<br />
Die bisherige Bemessungsgrundlage des Verfahrens<br />
nach A 128, die davon ausgeht, dass Niederschlagsabflüsse<br />
aus Trennsystemkanälen unbehandelt in<br />
Gewässer eingeleitet werden können, ist unter<br />
Berück<strong>sich</strong>tigung des § 57 WHG nicht länger beizubehalten.<br />
Es bestehen daher zwingende Gründe, das Arbeitsblatt<br />
aufzuheben und nicht länger als ausreichende<br />
Erfüllung gewässerschutzlicher Zielsetzungen anzusehen.<br />
Die Aufhebung des Arbeitsblattes und ein <strong>sich</strong><br />
anschließender „richtlinienfreier“ Zeitraum sollte dazu<br />
genutzt werden, alle technisch möglichen Wege, mit<br />
denen die schädlichen Wirkungen von Mischwassereinleitungen<br />
zu vermindern sind, zu untersuchen und<br />
hin<strong>sich</strong>tlich ihrer speziellen Wirkung miteinander zu<br />
vergleichen. Auf die Notwendigkeit, die gesamte Themenstellung<br />
der Mischwasserbehandlung im DWA-<br />
Regelwerk zu überarbeiten, hat auch Prof. Schmitt, Leiter<br />
des Fachausschusses ES-2 Systembezogene Planung<br />
der DWA, auf Fachtagungen hingewiesen.<br />
6. Alternative Verfahren<br />
Einige der in Frage kommenden alternativen Verfahren<br />
sind schon heute bekannt und lediglich aufgrund der<br />
Dominanz des Arbeitsblattes A 128 bisher nicht als<br />
gleichberechtigte Verfahren anerkannt und eingesetzt<br />
worden. Dazu gehört zum Beispiel eine signifikante<br />
Erhöhung der Mischwasserzuflüsse zu den Kläranlagen<br />
über das nach A 128 angenommen Maß hinaus, wenn<br />
dieses seitens der Kläranlage möglich ist. Oder die Weiterentwicklung<br />
selbstreinigender Filter als zusätzliche<br />
Ausstattung der Mischwasserüberläufe.<br />
Die wichtigste Alternative zum bisher dominierenden<br />
Prinzip der „End-of-Pipe-Lösungen“ ist jedoch die<br />
Verminderung der Regenabflüsse innerhalb der Mischsysteme<br />
durch gezielte Abkoppelungsmaßnahmen, wo<br />
und wann immer <strong>sich</strong> die Gelegenheit dazu bietet. Zum<br />
letzteren liegt ein umfangreicher Arbeitsbericht der<br />
Juni 2011<br />
620 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Regenwasserbehandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
DWA [5] vor. Es ist auch damit zu rechnen, dass bei der<br />
entwässerungstechnischen Neuerschließung von Teilgebieten<br />
innerhalb bestehender Mischsysteme aufgrund<br />
der Vorgaben des WHG § 55 (2) das Prinzip der<br />
dezentralen Regenwasserbewirtschaftung verstärkt<br />
eingesetzt wird und dadurch die Niederschlagsabflüsse<br />
im Mischsystem sukzessive vermindert werden.<br />
Im Rahmen der Gremienarbeiten der DWA ist ein<br />
alternativer Weg, die Emissionen der Mischsysteme zu<br />
reduzieren, nämlich einen Teil der in Bestandsgebieten<br />
bisher an das Kanalnetz angeschlossenen Flächen<br />
„abzukoppeln“ und dezentral zu bewirtschaften, in<br />
zurückliegenden Jahren intensiv untersucht worden.<br />
Die Ergebnisse sind in [5] zusammengefasst und zeigen,<br />
dass die Emissionsfrachten im Vergleich zu den abgekoppelten<br />
Flächenanteilen deutlich überproportional<br />
reduziert werden. Man darf bei der Berechnung der<br />
Wirkung von Abkoppelungsmaßnahmen also nicht in<br />
den Fehler verfallen, beim Verfahren nach [1] nur die<br />
zugrunde liegenden Anschlussflächen zu reduzieren<br />
und ein entsprechend reduziertes Speichervolumen<br />
zugrunde zu legen. Der Weg über Abkoppelungsmaßnahmen<br />
ist also ein vollständig eigenständiger Weg und<br />
darf mit dem Verfahren nach [1] nicht verknüpft werden.<br />
Bei der Beurteilung der „Abkoppelungsmaßnahmen“<br />
als Mittel zur Reduzierung der Mischwasserentlastungen<br />
im Vergleich zu den Speichermaßnahmen nach [1]<br />
sind die positiven Nebenwirkungen auf die Hydraulik<br />
der Kanalnetze zu berück<strong>sich</strong>tigen. Die Verminderung<br />
der Spitzenabflüsse kann hydraulische Überlastungen<br />
auf vorgegebene Werte (DIN 752) vermindern und<br />
damit eine Vergrößerung der Abflussquerschnitte ersetzen.<br />
Bei notwendigen Sanierungen wird eine Verkleinerung<br />
der Abflussquerschnitte durch Inlining-Verfahren<br />
ermöglicht.<br />
Sollen Abkoppelungsmaßnahmen gezielt zur Verminderung<br />
von Mischwasserentlastungen eingesetzt<br />
werden, um bestimmte Anforderungen an zulässige<br />
Emissionen zu erfüllen, ist dazu der notwendige Umfang<br />
und der zeitliche Ablauf der Abkoppelungsmaßnahmen<br />
in einem „Abkoppelungsprogramm“ festzulegen, zu<br />
dem die Erarbeitung von Karten über das Abkoppelungspotenzial<br />
und die mögliche Bewirtschaftungsart<br />
gehört [5].<br />
Das Vorgehen und die Erfüllung des Abkoppelungsprogramms<br />
nach [5] ist ein über Jahre bis Jahrzehnte<br />
ablaufendes Verfahren, kann jedoch dementsprechend<br />
auch langfristig anzustrebende Ziele enthalten, die weit<br />
über die bisherige Zielsetzung des ATV-Arbeitsblattes<br />
A 128 hinausgehen. So erscheint es ohne weiteres möglich,<br />
als langfristiges Ziel für bestehende Mischsysteme<br />
Entlastungsraten nach niederländischem Vorbild anzustreben,<br />
also rund 10 % der Mischwasserabflüsse statt<br />
der bisher nach [1] üblichen rund 40 %. Bei den Überlaufzahlen<br />
erscheint eine Zielgröße von durchschnittlich<br />
5–10 Ereignissen möglich statt der bisherigen 45–55<br />
pro Jahr.<br />
Es wäre wünschenswert, wenn bei der dringend notwendigen<br />
Formulierung von bundesweit gültigen Zielen<br />
und Anforderungen an die Regen- und Mischwassereinleitungen<br />
in Gewässer, die nach § 23 WHG erforderlich<br />
sind, solche in die Zukunft reichenden Aspekte<br />
berück<strong>sich</strong>tigt würden.<br />
Literatur<br />
[1] Arbeitsblatt ATV-A 128: Richtlinien für die Bemessung und<br />
Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen,<br />
1992.<br />
[2] Statistisches Bundesamt (2004): Fachserie 19 Reihe 2.1,<br />
Umwelt, Öffentliche <strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>beseitigung.<br />
[3] Sieker, F., Koopmann, C., Mertsch, V., Sieker, H., Sommer, H.,<br />
Voorhove, J. und van Wieringen, H.: Vergleich der deutschen<br />
und niederländischen Standards, der Technik und der Kosten<br />
bei der Niederschlagswasserableitung und -behandlung.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> 140 (1999) Nr. 10, S. 684-692.<br />
[4] Brombach H.J. und Wöhrle C.: Gemessene Entlastungstätigkeit<br />
von Regenüberlaufbecken. Korrespondenz <strong>Abwasser</strong> 44<br />
(1997), Nr. 1.<br />
[5] DWA-Themen: Arbeitsbericht: Abkoppelungsmaßnahmen<br />
in der Stadtentwässerung, 2007.<br />
Eingereicht: 26.03.2011<br />
Korrektur: 29.04.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Autor<br />
Univ.-Prof. a.D. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker<br />
E-Mail: F. Sieker@t-online.de |<br />
Heinrich-Beensen-Straße 1 |<br />
D-30926 Seelze<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 621
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Probenahme- und Analyseverfahren<br />
zur kostengünstigen Überwachung von<br />
Arzneimittelwirkstoffen im <strong>Abwasser</strong><br />
Fachbeitrag zum vom BMWi geförderten Forschungsprojekt der<br />
GBA Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung, Probenahme, Analyseverfahren, Arzneimittelwirkstoffe,<br />
Personal-Care-Produkte, Röntgenkontrastmittel<br />
Ralf Murzen und Constance Zehle<br />
Im Rahmen eines vom BMWi geförderten Forschungsprojektes<br />
wurden von der GBA Gesellschaft für Bioanalytik<br />
Hamburg mbH Probenahme- und Analyseverfahren<br />
entwickelt und erprobt, die es ermöglichen,<br />
in der <strong>Abwasser</strong>kanalisation Arzneimittelwirkstoffe,<br />
Röntgenkontrastmittel sowie Moschusverbindungen<br />
effizient nachzuweisen und durch die Abbildung des<br />
Abflussgeschehens einem Eintragspfad zuzuordnen.<br />
Vorteil des Verfahrens ist der deutlich geringere<br />
Aufwand für die Probenahme. So<strong>wohl</strong> die Anreicherungstechnik<br />
als auch die mittlerweile marktfähigen<br />
Analysemethoden stehen nun als kostengünstige<br />
Dienstleistung zum Beispiel für die behördliche Überwachung<br />
oder für Entwässerungsbetriebe zur Verfügung.<br />
Sampling and Analytical Procedure for the Costeffective<br />
Control of Pharmaceuticals in Wastewater<br />
Within a research project, government-funded by<br />
BMWi (Federal Ministry of Economics and Technology),<br />
the GBA (Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg)<br />
developed and proved both methods of sampling<br />
and of analysis to demonstrate efficiently pharmaceuticals,<br />
x-ray contrast media and also musk<br />
compounds in wastewater systems and to show the<br />
way of their entries by mapping the effluent proceedings.<br />
Considerable less effort by sampling is an<br />
advantage of this method. The technology of enrichment<br />
as well as merchantable analysis methods are<br />
available as cost-effictive services for official monitoring<br />
by water authorities sewage plants.<br />
1. Einleitung<br />
Pharmakologisch wirksame Substanzen und Wirkstoffe<br />
aus Personal-Care-Produkten rücken aufgrund ihres<br />
Potenzials für die Gefährdung von Grund- und Oberflächengewässern<br />
sowie des Klärschlamms von kommunalen<br />
<strong>Abwasser</strong>anlagen immer mehr in das öffentliche<br />
Interesse. Ein Großteil der genannten Wirkstoffe<br />
gelangt über das <strong>Abwasser</strong> in die Umwelt. Der Eintrag<br />
dieser Substanzen über schadhafte Kanalsysteme, über<br />
Kläranlagenabläufe sowie über den Eintrag in Böden<br />
durch Klärschlammaufbringung ist somit von besonderer<br />
Bedeutung. Das Gesamtziel im Fokus: „Konzeption<br />
und Entwicklung von Analyseverfahren, die in der<br />
<strong>Abwasser</strong>kanalisation mittels Ausbildung von Biofilmen<br />
an spe ziellen Trägermaterialien eine anforderungsgerechte<br />
Analyse des Biofilms zum Nachweis von pharmakologisch<br />
wirksamen Substanzen in Arzneimitteln<br />
sowie von Personal-Care-Produkten ermöglichen sowie<br />
eine repräsentative Dokumentation des <strong>Abwasser</strong>geschehens<br />
und eine gezielte Ursachenforschung zum<br />
Eintrag dieser Stoffe gestatten.“ Das Untersuchungsspektrum:<br />
Die Auswahl von Leitparametern erfolgte<br />
aufgrund einer umfassenden Literaturstudie. Dabei<br />
wurden folgende Hauptkriterien zu Grunde gelegt: eine<br />
überdurchschnittlich hohe Verordnungs- bzw. Verbrauchsmenge<br />
in Deutschland; häufig bzw. hohe nachweisbare<br />
Konzentrationen in Gewässern und/oder ein<br />
nachteiliges Umweltverhalten (z. B. hohe Persistenz,<br />
Polarität, Lipophilie). Auswahl der Einzelsubstanzen:<br />
Arzneimittel gelangen mit den kommunalen Abwässern<br />
in die Kläranlagen und von dort aus in die Oberflächengewässer<br />
und in den Klärschlamm. Ein wichtiger Eintragspfad<br />
ins Grundwasser sind Leckagen in der Kanalisation.<br />
Arzneimittel folgender Gruppen wurden für<br />
die durchzuführenden Untersuchungen ausgewählt:<br />
Antirheumatika (Ibuprofen, Diclofenac), Lipidsenker<br />
(Clofibrinsäure, Bezafibrat), Antiepileptika (Carbamazepin),<br />
Betablocker (Metroprolol, Sotalol), Analketika<br />
(Phenazon, Propyphenazon), Antibiotika (Erythromycin,<br />
Sulfamethoxazol).<br />
Juni 2011<br />
622 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
Röntgenkontrastmittel (RKIM) gelangen vor allem<br />
über Krankenhausabwässer sowie mit dem Einsatz in<br />
Facharztpraxen über die Kanalisation in die Gewässer.<br />
Problematisch ist vor allem deren hohe biochemische<br />
Stabilität, die dazu führt, dass RKM nahezu ubiquitär in<br />
deutschen Gewässern auftreten. Hier wurde Iopamidol<br />
als Leitsubstanz ausgewählt.<br />
Personal-Care-Produkte z. B. (Moschusverbindungen):<br />
Insgesamt werden weltweit etwa 8000 t synthetische<br />
Moschusverbindungen pro Jahr produziert. Eingesetzt<br />
werden diese künstlichen Duftstoffe in Haushaltsreinigern,<br />
Kosmetika, Waschmitteln, Seifen, Shampoos,<br />
Parfüms, Räucherstäbchen u. s. w. Wegen seines hohen<br />
Preises wird Muscon, der Hauptbestandteil des natürlichen<br />
Moschusduftes, dabei häufig durch synthetische<br />
Moschusverbindungen ersetzt. Hierunter fallen die<br />
chemischen Verbindungsklassen „Nitromoschusverbindungen<br />
(NM)“ (alkylierte Nitrobenzole mit zwei oder<br />
drei Nitrogruppen) und „Polyzyklische Moschusverbindungen<br />
(PCM)“ (alkylierte Tetralin- oder Indansysteme).<br />
2. Auswahl und Konstruktion der<br />
Anreicherungskörper<br />
Die Ausbringung von Aufwuchskörpern zur Bildung von<br />
Biofilmen ist nicht neu. Zum Zeitpunkt der Antragstellung<br />
waren verschiedene Methoden bekannt. So wurde<br />
ein Anreicherungsbehälter zum Patent angemeldet.<br />
Dieser Behälter besteht aus einem gelochten Edelstahlzylinder,<br />
in dem verschiedene Füllkörper (z. B. Glasperlen<br />
oder verschiedene Granulate) eingebracht werden,<br />
an denen <strong>sich</strong> dann der Biofilm ausbilden soll. Andere<br />
Hersteller bieten mit Schaumstoff gefüllte Kunststoffzylinder<br />
an. Bei diesen Systemen soll <strong>sich</strong> an der Oberfläche<br />
der Schaumstofffüllung im Innern des Zylinders<br />
ein Biofilm ausbilden. Entscheidender Nachteil dieser<br />
Aufwuchskörper ist die mangelnde Praxistauglichkeit.<br />
Die <strong>Abwasser</strong>ströme kommunaler Kanalsysteme zeichnen<br />
<strong>sich</strong> unter anderem zum Teil durch hohe Fließgeschwindigkeiten<br />
und eine große Fracht an Festkörpern<br />
wie beispielsweise Toilettenpapier, Hygieneartikel und<br />
sonstige Feststoffe aus. Diese Umstände führen oftmals<br />
dazu, dass <strong>sich</strong> auf dem <strong>Abwasser</strong>strom aufschwimmende<br />
Feststoffe an den Aufwuchskörper ansammeln<br />
und ein Kontakt <strong>Abwasser</strong>-Anreicherungsfläche eingeschränkt<br />
bzw. unmöglich gemacht wird. In vielen Fällen<br />
ist zu beobachten, dass die Aufwuchskörper durch Verzopfungen<br />
so groß und schwer werden, dass sie vom<br />
Be festigungsseil abgerissen werden, was zu Aufstauungen<br />
im Kanal führen kann. Durch Verzopfungen wird die<br />
Kontaktfläche zwischen <strong>Abwasser</strong> und Anreicherungskörper<br />
mehr und mehr verringert, so dass schließlich<br />
kein Biofilm mehr ausgebildet werden kann.<br />
2.1 Anreicherungskörper der ersten Generation<br />
Um die vorstehend beschriebenen Mängel zu vermeiden,<br />
wurden Feldversuche mit verschiedenen<br />
Schwimm- und Tauchkörpern durchgeführt. Ziel dieser<br />
Vorversuche war es, die Praxistauglichkeit erstens<br />
bezüglich der Robustheit, also der Widerstandsfähigkeit<br />
gegenüber dem Einfluss des <strong>Abwasser</strong>stroms zu testen<br />
sowie zweitens die quantitative und qualitative Biofilmausbildung<br />
zu untersuchen.<br />
Mehrere Varianten verschiedener Testkörper wurden<br />
dem Praxistest unterzogen (Boje, Stromlinienkörper,<br />
„Aqua-Nudel“, Kunststoffnetz mit Füllkörper und Kunststoffscheiben),<br />
welche <strong>sich</strong> aus unterschiedlichsten<br />
Gründen als ungeeignet erwiesen.<br />
2.2 Anreicherungskörper der zweiten Generation<br />
Als Konsequenz aus den schlechten Erfahrungen mit<br />
den Aufwuchskörpern der ersten Generation wurden<br />
Oberflächen untersucht, die im <strong>Abwasser</strong>strom kein<br />
Hindernis für <strong>Abwasser</strong>inhaltsstoffe bilden. Im ersten<br />
Ansatz wurden Bündel aus Kunststoffseilen in einen<br />
<strong>Abwasser</strong>kanal gehängt. Vorteil dabei war, dass die im<br />
<strong>Abwasser</strong>strom frei hängenden einzelnen Seile den sie<br />
umfließenden Feststoffen „ausweichen“ und <strong>sich</strong> so<br />
keine Verzopfungen bilden können. Allerdings war die<br />
Ausbeute an Biofilm nicht so hoch, dass man nach einer<br />
<strong>Wo</strong>che Expositionsdauer ausreichende Mengen Probenmaterial<br />
hätte „ernten“ können.<br />
Parallel zu den GBA-Versuchen mit den verschiedenen<br />
Aufwuchskörpern veröffentlichten GENUIT und<br />
BLOCK einen Erfahrungsbericht mit Kunststofffolienstreifen,<br />
die normalerweise als Trägermaterialien für<br />
Tropfkörperanlagen eingesetzt werden. Hierbei handelt<br />
es <strong>sich</strong> um das Produkt SESSIL® der Firma Norddeutsche<br />
Seekabelwerke GmbH, Nordenham. SESSIL® ist ein in<br />
Tropfkörpern abgehängtes streifenförmiges Trägermaterial<br />
mit aufgespritztem und verstärkendem Kunststofffaden.<br />
In der Anwendung als Trägermaterial in<br />
Tropfkörperanlagen hat <strong>sich</strong> dieses Material bereits hin<strong>sich</strong>tlich<br />
der Ausbildung von Biofilm bewährt.<br />
Basierend auf den Erfahrungen der Stadt Bielefeld<br />
wurden umgehend eigene Versuche mit dem Produkt<br />
SESSIL® begonnen. Von den etwa zwei Meter langen<br />
Folienstreifen wurden etwa zehn Stück zu einem Bündel<br />
verknotet und mit einem Seil oder einer Kette, welche<br />
am Kanaldeckel oder an Eisenstiegen im Schacht befestigt<br />
wurden, in den Kanal gehängt. Personal muss dabei<br />
nicht in den <strong>Abwasser</strong>kanal einsteigen. Die Folienstreifen<br />
schwimmen auf dem <strong>Wasser</strong> auf und stellen kein<br />
Hindernis für im <strong>Abwasser</strong> befindliche Feststoffe dar. Das<br />
Material ist robust und zeigte gegenüber den verschiedenen<br />
Einflüssen des <strong>Abwasser</strong>stroms ideale Eigenschaften.<br />
Bei keinem der insgesamt sechs an unterschiedlichen<br />
Stellen exponierten Folienstreifenbündel<br />
waren Verstopfungen oder sonstige Ansammlungen<br />
von Feststoffen zu beobachten. Eine Ausbildung von<br />
Biofilm ließ <strong>sich</strong> bereits nach wenigen Tagen feststellen.<br />
Für den Routineeinsatz ist es wichtig, eine so kurz<br />
wie mögliche Expositionszeit für die Bildung aus-<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 623
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Bilder 1 bis 4.<br />
Bündel von Folienstreifen aus SESSIL ® verzopfen nicht,<br />
weil sie oben auf dem <strong>Abwasser</strong>strom schwimmen.<br />
So kann <strong>sich</strong> problemlos ausreichend Biofilm bilden.<br />
reichender Mengen an Biofilm zu kennen. Diese Mindestdauer<br />
ist die kürzeste Zeit, in der man das Abflussgeschehen<br />
an einer Entnahmestelle abbilden kann. Um<br />
die Geschwindigkeit zu dokumentieren, mit dem Biofilmwachstum<br />
auf den Anreicherungskörpern stattfindet,<br />
wurden zwei Folienstreifenbündel in zwei <strong>Abwasser</strong>sammler<br />
eingebracht. Anschließend wurde im<br />
Abstand von ein bis zwei Tagen jeweils vier Folienstreifen<br />
der Bündel abgeerntet und dann das Gewicht<br />
des Biofilms bestimmt. Nach einem Tag konnten 0,3 g<br />
bzw. 0,5 g Biofilm an den Sammlern bestimmt werden,<br />
am dritten Tag wurden 1,5 g bzw. 1,9 g Biofilmanreicherung<br />
festgestellt, am fünften Tag wurden 2,8 g bzw.<br />
3,2 g und am siebten Tag 5,5 g und 6,0 g „abgeerntet“<br />
( Bilder 1 bis 4).<br />
3. Probenahmeverfahren<br />
3.1 Probenaufarbeitung<br />
Für die Aufbereitung wurde eine aus dem Bereich der<br />
<strong>Abwasser</strong>-Analytik bekannte LC-MS/MS Methode im<br />
Rahmen von Laborversuchen an die hier vorhandene<br />
Biofilmmatrix angepasst. Die nach Abschluss der<br />
Methodenentwicklung ermittelten Verfahrenskenndaten<br />
lieferten im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit und<br />
Präzision zufriedenstellende Ergebnisse.<br />
Moschusverbindungen werden aus Proben unter<br />
Verwendung von internen deuterierten Standards mit<br />
Lösemitteln extrahiert und einem zweistufigen cleanup<br />
unterzogen. Die Messung erfolgt mittels GC-MS (EI).<br />
3.2 Probenkampagnen<br />
3.2.1 Untersuchungen im Zulauf der Kläranlage<br />
Hannover-Herrenhausen<br />
Nach der Validierung der Analysenmethoden wurden<br />
zum Einstieg in die praktische Anwendung zunächst<br />
<strong>Abwasser</strong>- und Sielhautproben im Zulauf der Kläranlage<br />
Hannover-Herrenhausen entnommen. In dieser Kläranlage<br />
wird ein Großteil des in Hannover anfallenden<br />
<strong>Abwasser</strong>s aufbereitet. Die Folienstreifenbündel wurden<br />
hierzu hinter dem Sandfang im <strong>Abwasser</strong>strom<br />
sieben Tage exponiert. Parallel dazu wurden mit den vor<br />
Ort vorhandenen automatischen <strong>Abwasser</strong>probenehmern<br />
pro Tag jeweils zwölf 2-h-Mischproben entnommen.<br />
Aus einigen Aliquoten dieser zwölf Einzelproben<br />
wurde jeweils eine Tagesmischprobe hergestellt und<br />
der Analytik zugeführt. Die Untersuchungen der Ab -<br />
wassertagesmischproben hatten den Zweck, eine<br />
Bestandsaufnahme im Hinblick auf Art und Menge der<br />
im <strong>Abwasser</strong> befindlichen Arzneimittelwirkstoffe durchzuführen.<br />
Im zweiten Schritt wurde die im gleichen<br />
Zeitraum „gewachsene“ Sielhaut untersucht und die<br />
hier ermittelten Konzentrationen denen im <strong>Abwasser</strong><br />
gegenüber gestellt. Diese Untersuchungen sollten Informationen<br />
über gegebenenfalls vorhandene Unterschiede<br />
im Anreicherungsverhalten oder sonstige<br />
Besonderheiten liefern. Insgesamt wurden vier solcher<br />
Kampagnen durchgeführt.<br />
Juni 2011<br />
624 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
3.2.2 Untersuchungen im Stadtgebiet<br />
von Hannover<br />
Basierend auf den Ergebnissen der Vorversuche wurden<br />
in Absprache mit Vertretern der Stadtentwässerung<br />
Hannover an insgesamt acht Entnahmestellen Feldversuche<br />
durchgeführt. Bei der Auswahl der Entnahmepunkte<br />
wurden neben Einzugsgebieten ohne Besonderheiten<br />
auch drei Probenahmestellen ausgewählt, bei<br />
denen im Vergleich zu den übrigen Stellen Unterschiede<br />
in der <strong>Abwasser</strong>beschaffenheit bezüglich der Konzentration<br />
der Zielsubstanzen zu erwarten waren. Für die<br />
Durchführung der Probenahmekampagnen wurden die<br />
Anreicherungskörper über einen Zeitraum von sieben<br />
Tagen im Kanal exponiert. Im Rahmen der zweiten Kampagne<br />
wurde zum Zeitpunkt der „Ernte“ jeweils eine<br />
<strong>Wasser</strong>probe als Stichprobe entnommen und ergänzend<br />
analysiert.<br />
4. Analyse-Ergebnisse<br />
4.1 Arzneimittel und Röntgenkontrastmittel<br />
(<strong>Abwasser</strong>proben Zulauf KA Herrenhausen)<br />
Mittels automatischem Probenehmer wurden in vier<br />
Zeiträumen jeweils eine <strong>Wo</strong>che lang von 12 2 h MP<br />
24 h-Mischproben gewonnen und anschließend gemäß<br />
den genannten Methoden analytisch untersucht.<br />
Die Ergebnisse der <strong>Abwasser</strong>untersuchungen mit<br />
Ausnahme des Röntgenkontrastmittels Iopamidol zeigen,<br />
dass die Schwankungsbreite der Konzentrationen<br />
im <strong>Wo</strong>chenverlauf sehr gering ausgeprägt ist. Exemplarisch<br />
hierfür steht die Tabelle 1 mit dem Wirkstoff Carbamazepin.<br />
Als Gründe sind die weit verbreitete Anwendung<br />
der hier untersuchten Wirkstoffe sowie das große<br />
Einzugsgebiet der Kläranlage zu vermuten. Im Zuge<br />
aller vier Kampagnen war eine drastische Abnahme<br />
des Wirkstoffes Iopamidol an den <strong>Wo</strong>chenenden zu<br />
Tabelle 1. Carbamazepin in μg/L im Zulauf der KA Herrenhausen.<br />
23.09.–30.09.09 15.11.–22.11.09 22.11.–29.11.09 26.01.–02.02.10<br />
24 h MP – Mi/ Do 2,20 1,20 1,10 1,10<br />
24 h MP – Do/ Fr 2,20 0,80 0,90 1,00<br />
24 h MP – Fr/ Sa 2,10 1,20 0,90 1,10<br />
24 h MP – Sa/ So 2,00 1,20 1,00 0,94<br />
24 h MP – So/ Mo 2,00 1,10 1,10 0,94<br />
24 h MP – Mo/ Di 2,10 1,10 1,00 1,10<br />
24 h MP – Di/ Mi 1,80 1,20 1,10 0,97<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 625
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Tabelle 2. Iopamidol in μg/L im Zulauf der KA Herrenhausen.<br />
23.09.–30.09.09 15.11.–22.11.09 22.11.–29.11.09 26.01.–02.02.10<br />
24 h MP – Mi/ Do 21,40 1,70 8,80 5,50<br />
24 h MP – Do/ Fr 18,70 < 0,10 7,80 4,60<br />
24 h MP – Fr/ Sa 20,30 1,90 1,80 4,60<br />
24 h MP – Sa/ So 2,60 0,70 3,10 2,10<br />
24 h MP – So/ Mo < 1,00 0,14 5,20 0,40<br />
24 h MP – Mo/ Di 13,00 1,38 0,82 5,40<br />
24 h MP – Di/ Mi 15,50 1,20 8,50 16,00<br />
µg/Kg bzw. µg/L<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Carbamazepine<br />
Diclofenac<br />
beobachten, was auf das reduzierte Emissionsgeschehen<br />
aus Arztpraxen und Krankenhäusern zurückzuführen<br />
ist (Tabelle 2). Das festgestellte stabile Konzentrationsniveau<br />
aller anderen Stoffe bot eine gute Voraussetzung<br />
zur Ermittlung des Anreicherungsverhaltens<br />
der einzelnen Wirkstoffe.<br />
4.2 Biofilmproben Zulauf KA Herrenhausen<br />
Parallel zu <strong>Abwasser</strong>mischproben wurden Biofilme<br />
jeweils eine <strong>Wo</strong>che lang im Ablauf des Sandfangs der<br />
Kläranlage Herrenhausen angereichert und anschließend<br />
analytisch untersucht. Die im Zulauf der Kläranlage<br />
Herrenhausen gefundenen Arzneimittelkonzentrationen<br />
sowie die Konzentrationen von Iopamidol<br />
(Röntgenkontrastmittel) sind nachfolgend (Bild 5) grafisch<br />
dargestellt.<br />
Für einige Arzneimittel, für die mehrere Positivbefunde<br />
im Biofilm respektive im <strong>Wasser</strong> vorlagen, sind die<br />
Verhältnisse der im Biofilm gefundenen Konzentrationen<br />
im Vergleich zu den Konzentrationen im <strong>Wasser</strong><br />
zusammengestellt (Anreicherungsfaktor). Es wird deutlich,<br />
dass für einige Substanzen (Diclofenac, Carbamazepin,<br />
Metoprolol) offen<strong>sich</strong>tlich eine stärkere Anreicherung<br />
stattfindet als für andere untersuchte Substanzen.<br />
Ibuprofen<br />
Iopamidol<br />
Metoprolol<br />
Sotalol<br />
Bezafibrat<br />
Clofibrinsäure<br />
Erythromycin<br />
Phenazon<br />
<strong>Wasser</strong><br />
Biofilm<br />
Bild 5. Mittelwerte der im Zulauf der KA Herrenhausen gefundenen<br />
Konzentrationen von Arznei- und Röntgenkontrastmitteln.<br />
Propyphenazon<br />
Sulfamethoxazol<br />
Beim Wirkstoff Carbamazepin ist so<strong>wohl</strong> eine Anreicherung<br />
als auch eine gute Proportionalität zu den im <strong>Wasser</strong><br />
gefundenen Konzentrationen festzustellen. Ähnliches<br />
gilt für die Wirkstoffe Diclofenac und Metoprolol,<br />
wobei bei Metoprolol der mit Abstand höchste Anreicherungseffekt<br />
auftritt. Generell kann festgestellt<br />
werden, dass alle Wirkstoffe mit Positivbefunden im<br />
<strong>Wasser</strong> auch im Biofilm quantifizierbar sind.<br />
4.3 Fettanreicherung<br />
Bei der Entnahme der Anreicherungskörper fiel auf, dass<br />
an den verschiedenen Probenahmestellen offen<strong>sich</strong>tlich<br />
eine unterschiedlich starke Fettanreicherung auf<br />
dem Trägermaterial stattgefunden hatte. Als Grund<br />
hierfür ist die <strong>Abwasser</strong>zusammensetzung anzusehen.<br />
So kam es beispielsweise im Übergabeschacht der MHH<br />
(Medizinische Hochschule Hannover) nur zu geringen<br />
Fettanreicherungen, während die Fettanreicherung am<br />
Trägermaterial im Schacht Eilenriede/Kleefeld sehr stark<br />
war. So wurden an den vier Stellen, an denen während<br />
der zweiten Probenahmekampagne (26.01.– 02.02.10)<br />
starke bis sehr starke Fettanreicherungen an den Anreicherungskörpern<br />
beobachtet wurden (Eilenriede/Kleefeld,<br />
Kreisel Karl-Wiechert-Allee, Im Othfelde/Daimlerstraße<br />
sowie Hebbelstraße/Stormstraße) deutlich<br />
erhöhte Konzentrationen von Carbamazepin, Ibuprofen,<br />
Metoprolol, Clofibrinsäure und Phenazon im Vergleich<br />
zu den übrigen fünf Probenahmestellen im Stadtgebiet<br />
gefunden. Aus den Ergebnissen der Biofilmuntersuchungen<br />
im Stadtgebiet lassen <strong>sich</strong> folgende Interpretationen<br />
und Schlussfolgerungen ableiten:<br />
Für alle Wirkstoffe kann ein ähnliches Anreicherungsverhalten<br />
wie im Zulauf der Kläranlage festgestellt<br />
werden.<br />
Für das Röntgenkontrastmittel Iopamidol konnte im<br />
Rahmen beider Kampagnen gezeigt werden, dass es<br />
punktuell im Stadtgebiet Hannover emittiert wird.<br />
So war dieses an der Stelle „Gewerbegebiet Vahrenheide“<br />
weder im <strong>Wasser</strong> noch im Biofilm nachweisbar.<br />
Im <strong>Abwasser</strong> der MHH wurden hingegen erhöhte<br />
Konzentrationen im <strong>Wasser</strong> und im Biofilm ermittelt.<br />
Aufgrund einer unterschiedlichen <strong>Abwasser</strong>zusammensetzung<br />
(z. B. hohe Fettgehalte) können die<br />
Juni 2011<br />
626 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
Anreicherungsfaktoren stark schwanken, demzufolge<br />
sind aufgrund der in den Biofilmen ermittelten<br />
Konzentrationen keine direkten Rückschlüsse auf<br />
<strong>Abwasser</strong>konzentrationen zulässig.<br />
Für den Wirkstoff Phenanzon war ein exorbitant<br />
hoher Anreicherungsfaktor zu beobachten, dessen<br />
Ursache nur im hohen Fettgehalt des <strong>Wasser</strong>s und<br />
des Biofilms vermutet werden kann. Hier besteht<br />
weiterer Untersuchungsbedarf.<br />
Ähnlich wie bei einigen Arzneimitteln wurde auch<br />
bei den beiden Moschusverbindungen HHCB und AHTN<br />
eine starke Neigung, <strong>sich</strong> in fetthaltigen Biofilmen anzureichern,<br />
festgestellt. Weiterhin zeigte <strong>sich</strong>, dass es im<br />
Vergleich zu den Arzneimitteln bei den Moschusverbindungen<br />
zu einer deutlich höheren Anreicherung im<br />
Biofilm kam (Bild 6).<br />
µg/Kg<br />
25 000<br />
20000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Eitenriede / Kleefeld Schacht 703<br />
KA Herrenhausen nach Sandfang<br />
<strong>Wo</strong>hngebiet Stahlkamp, Pumpwerk<br />
Im Othfelde / Daimlerstr., Schacht 139<br />
Kreisel Karl-Wiechert-Allee Bauwerk 105<br />
Laatzen Stadtgrenze, Schacht 113<br />
Gewerbegebiet Vahrenheide Zulauf Pumpwerk<br />
5. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Im Rahmen des Projektes konnten für alle ausgewählten<br />
Arzneimittelwirkstoffe und Personal-Care-Produkte<br />
(Moschusverbindungen) so<strong>wohl</strong> für <strong>Abwasser</strong> als auch<br />
für die Matrix Biofilm geeignete Analysemethoden entwickelt<br />
und validiert werden. Nach ausgiebigen Voruntersuchungen<br />
und Tests mit verschiedenen Aufwuchskörpern<br />
wurde im Projektzeitraum ein Verfahren<br />
publiziert, bei dessen Durchführung ein Trägermaterial<br />
für Tropfkörper eingesetzt wird (Folienstreifen). Dieses<br />
Material erwies <strong>sich</strong> auch im Rahmen der GBA Untersuchungen<br />
als das am besten geeignete Verfahren. Nachdem<br />
ein geeignetes Anreicherungsverfahren verfügbar<br />
war, wurden im Rahmen einer ersten Stufe Untersuchungen<br />
im Zulauf einer kommunalen Kläranlage<br />
durchgeführt. Im Rahmen dieser Erhebung wurde<br />
dokumentiert, dass für die Zielkomponenten ein<br />
Zusammenhang zwischen der Existenz im <strong>Abwasser</strong><br />
und der Anreicherung im Biofilm besteht.<br />
In der zweiten Stufe wurden die Untersuchungen auf<br />
acht Stellen im Stadtgebiet Hannover ausgedehnt.<br />
Dabei zeigte <strong>sich</strong> jedoch, dass <strong>sich</strong> aufgrund unterschiedlicher<br />
<strong>Abwasser</strong>zusammensetzung (fetthaltiges<br />
<strong>Abwasser</strong>) und daraus resultierender unterschiedlicher<br />
Wachstumsbedingungen für Bakterien in Bezug auf Art<br />
und Menge unterschiedliche Biofilme herausbilden. Aus<br />
diesem Grund waren keine direkten Rückschlüsse aus<br />
der Konzentration eines Wirkstoffes im Biofilm auf die<br />
Konzentration im <strong>Abwasser</strong> möglich.<br />
Andere Autoren haben in der Vergangenheit ähnliche<br />
Erfahrungen gemacht. Dennoch ist eine Lokalisierung<br />
von Eintragsquellen in <strong>Abwasser</strong>teilströmen für<br />
einzelne Substanzen durch den Vergleich mit unbelasteten<br />
Teilströmen möglich. Im Zuge dieses GBA Projektes<br />
zeigte <strong>sich</strong> dies insbesondere für den Wirkstoff Iopamidol,<br />
der im <strong>Abwasser</strong> der Medizinischen Hochschule<br />
Hannover (MHH) in erhöhter Konzentration, im restlichen<br />
Stadtgebiet reduziert und in einem rein gewerblich/<br />
industriell geprägten <strong>Abwasser</strong>teilstrom (Vahrenheide)<br />
nicht nachweisbar war.<br />
Im Rahmen einer möglichen Durchführung von<br />
Monitorings in Bezug auf Arzneimittelwirkstoffe und<br />
gegebenenfalls andere organische Schadstoffe wäre die<br />
hier eingesetzte Methode zur Gewinnung von Biofilmproben<br />
(wie bereits in einigen Städten in NRW für<br />
andere Substanzen praktiziert) als Dauerüberwachung<br />
denkbar. So könnten beispielsweise die im Rahmen dieses<br />
Projektes der GBA für die Analytik von Arzneimittelwirkstoffen<br />
erprobten Aufwuchskörper an markanten<br />
Stellen der Kannalisation permanent eingebracht und<br />
regelmäßig beprobt werden. Chemische Analytik wäre<br />
lediglich im Bedarfsfall beispielsweise bei Störfällen,<br />
Verdachtsfällen oder auffälligen Werten im Kläranlagenablauf<br />
bzw. im Klärschlamm notwendig. Entscheidender<br />
Vorteil hierbei wäre die Möglichkeit einer retrospektiven<br />
Betrachtung des Abflussgeschehens im Bezug auf<br />
den auffälligen Parameter und eine Rückverfolgbarkeit<br />
der vorhandenen Eintragsquelle.<br />
Im Ergebnis zeigt das Projekt ein kostengünstiges<br />
Überwachungsinstrument für Städte, Gemeinden, Ab -<br />
wasserverbände oder Gebietskörperschaften, denn da<br />
fast ausschließlich Analysekosten anfallen, ist der Aufwand<br />
für die Probenahme im Vergleich zum Aufwand<br />
für die chemische Analytik vernachlässigbar gering. Vor<br />
dem Hintergrund gesetzlicher Grundlagen (EU-WRRL,<br />
novellierte Klärschlammverordnung) werden praktikable<br />
Methoden zur Probenahme und Analyse in Zukunft<br />
immer mehr in den Fokus rücken.<br />
Literatur<br />
ISA, RWTH Aachen und IWW Abschlussberichte: „Senkung des<br />
Anteils organischer Spurenstoffe in der Ruhr durch zusätzliche<br />
Behandlungsstufen auf kommunalen Kläranlagen ‒ Gütebetrachtungen“<br />
Vergabe-Nr. 07/111.1 (IV-7-042 1 D 7) und<br />
Hebbelstr. / Stormstr. Schacht 151<br />
Galaxolid (HHCB)<br />
Tonalid (AHTN)<br />
MHH Übergabeschacht Stadtfelddamm<br />
Bild 6. Moschusverbindungen, wie HHCB und AHTN, neigen dazu, <strong>sich</strong><br />
in fetthaltigen Biofilmen anzureichern.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 627
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
„Senkung des Anteils organischer Spurenstoffe in der Ruhr<br />
durch zusätzliche Behandlungsstufen auf kommunalen Kläranlagen<br />
‒ Kostenbetrachtungen“ Vergabe-Nr. 07/111.2 (IV-7-<br />
042 1 D 6), 2008.<br />
Ternes, T., Hirsch, R., Stumpf, M., Eggert, T., Schuppert, B. und Haberer,<br />
K.: Nachweis und Screening von Arzneimittelrückständen.<br />
Diagnostika und Antiseptika in der aquatischen Umwelt.<br />
Forschungsbericht für das Bundesministerium für Bildung,<br />
Wissenschaft, Forschung und Technologie, Referenznummer<br />
02WU9567/3, 1999.<br />
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Hydrologie in<br />
Hessen. Arzneimittelbericht Südhessen 1996–2000, 2005.<br />
Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt und Geologie: Arzneimittelwirkstoffe<br />
in Gewässern und <strong>Abwasser</strong>einleitungen<br />
Sachsens, 2006.<br />
Huschek, G. und Krengel, D.: Mengenermittlung und Systematisierung<br />
von Arzneimittelwirkstoffen im Rahmen der Umweltprüfung<br />
von Human- und Tierarzneimitteln gemäß §28 AMG.<br />
Bericht 20067401. Umweltbundesamt, Deutschland, 2003.<br />
Seitz, W., Weber, W., Flottmann, D. und Schulz, W.: Lodierte Röntgenkontrastmittel<br />
in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser. CLB<br />
Chemie in Labor und Biotechnik 55 (2004) Nr. 12, S. 456-460.<br />
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
des Landes NRW: Eintrag von Arzneimitteln<br />
und deren Verhalten und Verbleib in der Umwelt. LANUV-<br />
Fachbericht 2, 2007.<br />
Ternes, T.: Abbau und Verhalten von Pharmaka in aquatischen<br />
Systemen. Schriftenreihe <strong>Wasser</strong>forschung (2000) Band 6,<br />
S. 23-33.<br />
Stockholm City Concil: Environmentally classified Pharmaceuticals,<br />
2008. www.janusinfo.se/environment<br />
Rimkus, G.G., Gatermann, R. and Hühnerfuss, H.: Musk xylene and<br />
musk ketone amino metabolites in the aquatic environment.<br />
Toxicol. Lett. 111 (1999), p. 5–15.<br />
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG): Belastungen<br />
von Fischen mit verschiedenen Umweltchemikalien in<br />
Hessischen Fließgewässern; Vergleichbare Studie, 1999–2000.<br />
Hessisches Landesamt für Umwelt (HLfU): Moschusverbindungen,<br />
Kapitel 6.14, 2004.<br />
Greenpeace-Parfüm Report: Eine Untersuchung von 36 Duft-<br />
Produkten auf gefährliche Chemikalien, 2005.<br />
Biselli, S.: Entwicklung einer analytischen Methode zum Nachweis<br />
von ökotoxikologisch relevanten organischen Problemstoffen<br />
in Sedimenten und Biota unter besonderer Berück<strong>sich</strong>tigung<br />
von Irgarol, synthetische Moschusduftstoffen und deren<br />
Transformationsprodukten. Dissertation Universität Hamburg,<br />
2001.<br />
Balk, F., Blok, J. and Salvito, D.: Environmental risks of musk fragrance<br />
ingredients. In: American Chemical Society Symposium<br />
Series 791. Pharmaceutical and Personal Care Products in<br />
the Environment: Scientific and Regulatory Issues. Eds. Daughton,<br />
C.G. and Jones-Lepp, T. American Chemical Society<br />
Washington DC, 2001.<br />
European Union Risk Assessment, Repots:<br />
HHCB: 3. European Union Risk Assessment: 1,3,4,6,7,8-HEXAHY-<br />
DRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-y-2-BENZOPYRAN<br />
(1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLIN-DEN[5,6-<br />
C]PYRAN - HHCB); final report, Netherlands 2008<br />
AHTN: 1-5,6,7,8-TETRAHYDRO-3,5,6,8,8-HEXAMETHYL)ETHAN-1-<br />
ONE (AHTN); CAS No: 1506-02-1 or 21145-77-7; EINECS<br />
No: 216-133-4 or 244-240-6<br />
FINAL APPROVED VERSION 2008<br />
musk xylene: 5-TERT-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-M-XYLENE(MUSK<br />
XYLENE); CAS No: 81-15-2 EINECS No: 201-329-4; SUMMARY<br />
RISK ASSESSMENT REPORT; Final report, 2005<br />
The Netherlands<br />
5-TERT-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-M-XYLENE(MUSK XYLENE); CAS No:<br />
81-15-2 EINECS No: 201-329-4; SUMMARY RISK ASSESSMENT<br />
REPORT; Final approved report, 2008 The Netherlands<br />
musk ketone<br />
4’TERT-BUTYL-2’,6’-DIMETHYL-3’5’-DINITROACETOPHENONE<br />
(MUSK KETONE) CAS No: 81-14-1; EINECS No: 201-328-9; RISK<br />
ASSESSMENT 2005<br />
EU (2003) Directive 2003/36/EC of the European Parliament and of<br />
the Council of 26 May 2003, amending, for the 25th time,<br />
Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the<br />
laws, regulations and administrative provisions of the Member<br />
States relating to restrictions on the marketing and use of certain<br />
dangerous substances and preparations (substances classified<br />
as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction<br />
‒ c/m/r). Official Journal of the European Communities<br />
L 156: 26–30<br />
Mons, M. N., van Genderen, J. and van Dijk-Looijard, A. M.: Inventory<br />
of presence of pharmaceuticals in Dutchwater. Abschlussbericht<br />
des Projektes von Vewin, RIWA und KIWA, Nieuwegein,<br />
Niederlande.<br />
SYRACUSE SCIENCE CENTER (SRC): Experimental octanol/water<br />
partition coefficients (of KOW), 2002. http://srcinc.com/whatwe-do/environment.aspx<br />
Umweltbundesamt Österreich: Arzneimittelwirkstoffe im Zu- und<br />
Ablauf von Kläranlagen, 2002.<br />
Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe. Arzneistoffe in<br />
Elbe und Saale, 2003.<br />
Ternes, R. A.: Occurrence of drugs in German sewage treatment<br />
plants and rivers. Wat. Res. 32 (1998), p. 3245–3260.<br />
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt: Arzneistoffe in Zuund<br />
Abläufen von kommunalen Kläranlagen des Landes Sachsen-Anhalt,<br />
2002–2004.<br />
Möhle, E., Horvath, S., Merz, W. und Metzger, J. W.: Bestimmung von<br />
schwer abbaubaren organischen Verbindungen – Identifizierung<br />
von Arzneimittelrückständen. Vom <strong>Wasser</strong> 92 (1999),<br />
S. 207–223.<br />
Rohweder, U.: Bund/Länderausschuss für Chemikalien<strong>sich</strong>erheit<br />
(BLAC): Arzneimittel in der Umwelt ‒ Auswertung der Untersuchungsergebnisse.<br />
Hamburg. Herausgeber: Freie und Hansestadt<br />
Hamburg Behörde für Umwelt und Gesundheit, S. 173.<br />
Ternes, T., Hirsch, R., Stumpf, M., Eggert, T., Schuppert, B. und Haberer,<br />
K.: Nachweis und Screening von Arzneimittelrückständen, Diagnostika<br />
und Antiseptika in der aquatischen Umwelt.<br />
Abschlussbericht BMBF Forschungsvorhaben 02WU9567/3.<br />
ESWE-Institut für <strong>Wasser</strong>forschung und <strong>Wasser</strong>technologie<br />
GmbH, S. 234.<br />
Juni 2011<br />
628 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
Hirsch, R., Ternes, T. A., Haberer, K. und Kratz, K.-L.: Nachweis von<br />
Betablockern und Bronchospasmolytika in der aquatischen<br />
Umwelt. Vom <strong>Wasser</strong> 87 (1996), S. 263–274.<br />
EPA U.S. Environmental Protection Agency: Targeted National<br />
Sewage Sludge Survey Report, 2009.<br />
Carballa, M., Fink, G., Omil, F., Lema, J. M. and Ternes, T.: Determination<br />
of the solid-water distribution coefficient (Kd) for pharmaceuticals,<br />
estrogens and musk fragrances in digested<br />
sludge. Water Research 42 (2008), p. 287–295.<br />
Ternes, T. A., Hermann, N., Bonerz, M., Knacker, T., Siegrist, H. and<br />
Joss, A.: A rapid method to measure the solid-water distribution<br />
coefficient (Kd) for pharmaceuticals and musk fragrances<br />
in sewage sludge. Water Res. 38 (19..) No. 19, p. 4075–4084.<br />
Safety Data Sheet DrugBank.<br />
Radjenocić, A., Jelić, A., Petrović, M. and Barceló, D.: Determination of<br />
pharmaceuticals in sewage sludge by pressurized liquid extraction<br />
(PLE) coupled to liquid chromatography-tandem mass<br />
spectrometry (LC-MS/MS), Analytical and Bioanalytical Chemistry<br />
393 (2009) No. 6–7, p. 1685–1695.<br />
Europäisches Patent Sielhautaufwuchskörper EP 1 707 942 A1.<br />
Veröffentlichung 04.10.2006, Patentblatt 2006/40.<br />
Simonich, St., Begley, L., William, M., Debare, G., Eckhoff and William,<br />
S.: Trace Analysis of Fragrance Materials in Wastewater and<br />
Treatment, Environ. Sci. Technol. 34 (2000) No. 6, p. 959–965.<br />
Gatermann, R., Biselli, S., Hühnerfuss, H., Rimkus, G. G., Hecker, M. and<br />
Karbe, L.: Synthetic musks in the environment. Part 1: Species<br />
-dependant bioaccumulation of the polycylic and nitromusks<br />
fragrances in freshwater fish and mussels. Arch. Environ. Contam.<br />
Toxicol. 42 (2002a), p. 437–446.<br />
Haberer, Th. et. al.: Occurence and distribution of organic contaminants<br />
in the aquatic system in Berlin. Part III: Determination of<br />
synthetic musks in Berlin surface water applying solid-phase<br />
micrioextraction (SPME). Acta Hydrobiol. 27 (1999), p. 150–<br />
156.<br />
Herren, D. and Berset, J. D.: Nitro musks, nitro musk amino metabolites<br />
and polycyclic musks in seweage sludge. Quantitative<br />
determination by HRGC-ion-trap-MS/MS and mass spectral<br />
characterisation of the amino metabolites . Chemosphere 40<br />
(2000), p. 565–574.<br />
Mersch-Sundermann, V., Reinhardt, A. and Emig, M.: Examination of<br />
mutagenicity, genotoxicity, and cogenotoxicity, and cogenotoxicity<br />
of nitro musks in the environment. Zbl. Hyg. 198<br />
(1996), p. 429–442.<br />
OSPAR Commission: Musk xylene and other musks. Hazardous<br />
Substances Series, 2004.<br />
Rimkus, G. and <strong>Wo</strong>lf, M.: Nitro musk fragrances in Biota from freshwater<br />
and marine environment. Chemosphere 30 (1995) No. 4,<br />
p. 641–651.<br />
Rimkus, G. and <strong>Wo</strong>lf, M.: Polycyclic musk fragrances in human adipose<br />
tissue and human milk. Chemosphere 33 (1996) No. 10,<br />
p. 2033–2043.<br />
Genuit, G. und Block, M.: Ermittlung von Einleitern PFT-haltigen<br />
<strong>Abwasser</strong>s durch Untersuchung der Sielhaut. Gewässerschutz-<br />
<strong>Wasser</strong>-<strong>Abwasser</strong>, Band 217.<br />
Autoren<br />
Eingereicht: 01.11.2010<br />
Korrektur: 29.04.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Ralf Murzen<br />
Geschäftsführer<br />
E-Mail: pinneberg@gba-hamburg.de<br />
Constance Zehle<br />
Projektleiterin<br />
E-Mail: c.zehle@gba-hamburg.de<br />
GBA Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH |<br />
Standort Pinneberg |<br />
Flensburger Straße 15 |<br />
D-25421 Pinneberg<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 629
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
Nahrungsmittelproduktion<br />
und Gewässerschutz<br />
Podiumsdiskussion „Landwirtschaft im Fluss – Gewässerschutz in der<br />
kommenden Agrarreform“ am 25. Januar 2011 in Berlin<br />
Nikolaus Geiler<br />
Anlässlich der „Grünen <strong>Wo</strong>che 2011“ hatten das Bundesumweltministerium<br />
(BMU) und das Umweltbundesamt<br />
(UBA) für den 25. Januar 2011 zu einer Tagung über die<br />
wasserwirtschaftlichen Implikationen der anstehenden<br />
Reform der Gemeinsamen Agrarmarktpolitik (GAP) der<br />
EU ins Internationale Congress-Centrum (ICC) nach Berlin<br />
eingeladen. Höhepunkt der Tagung war eine Podiumsdiskussion<br />
zum Thema „Landwirtschaft im Fluss –<br />
Gewässerschutz in der kommenden Agrarreform“.<br />
Zukünftig soll die Agrarförderung stärker an den Belangen<br />
des Umweltschutzes ausgerichtet werden. Für die<br />
Bereitstellung öffentlicher Güter – beispielsweise sauberes<br />
<strong>Wasser</strong> – sollen die Landwirte gezielt entlohnt<br />
werden. In der Berliner Debatte um diesen Reformansatz<br />
wurde zwar viel über „Landwirtschaft“ und wenig<br />
über den „Fluss“ gesprochen. Gleich<strong>wohl</strong> konnten die<br />
Nicht-EU-Agrar-Experten im Auditorium viele neue<br />
Erkenntnisse über die äußerst komplexen Bemühungen<br />
zu einer stärkeren Ausrichtung der GAP auf den Umweltund<br />
Naturschutz mit nach Hause nehmen.<br />
„Zufällig verteilte Brennnesselstreifen“ –<br />
viel Geld für wenig Biodiversität<br />
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer vom Johann Heinrich von<br />
Thünen-Institut und Vorsitzender des wissenschaftlichen<br />
Beirats der Bundesregierung für Agrarfragen<br />
wandte <strong>sich</strong> zu Beginn der Debatte zunächst kritisch<br />
dem geplanten „Greening“ der „ersten Säule“ zu. Aus der<br />
ersten Säule werden in der EU die Direktzahlungen für<br />
die Landwirte finanziert. Die Direktzahlungen oder<br />
Grundprämien sollen stärker als bislang an ökologische<br />
Anforderungen gekoppelt werden. Isermeyer stufte dieses<br />
Instrument als wenig zielgenau ein. So sei der Nutzen<br />
„der grün angestrichenen Direktzahlungen“ für den<br />
Klimaschutz in der Landwirtschaft „minimal“. Wenn man<br />
wirklich die Treibhausgasemissionen im Agrarmarktsektor<br />
signifikant senken wolle, müsse man beispielsweise<br />
zielgerichtet den Niedermoorumbruch angehen. Das<br />
Umbrechen der Niedermoorflächen führe zur Freisetzung<br />
großer CO 2 -Mengen. Die pauschalen Grundprämien<br />
seien auch wenig hilfreich, die Stickstoffeinträge<br />
in das Grundwasser zu reduzieren. Die Stickstoffeinträge<br />
wären insbesondere in den Veredelungsregionen<br />
mit hohen Tierbeständen und stark expandierenden<br />
Energiemaisplantagen gravierend. Also müsse man<br />
gezielt in diesen Regionen den Hebel ansetzen. Als<br />
wenig nützlich für mehr Biodiversität stufte Isermeyer<br />
auch die Verknüpfung der Grundprämie mit einer Flächenstilllegung<br />
in der Größenordnung von 10 Prozent<br />
der jeweiligen landwirtschaftlichen Nutzfläche ein. <strong>Wo</strong><br />
der Landwirt diese Flächen stilllege, bleibe in dessen<br />
Belieben gestellt. Das <strong>sich</strong> daraus ergebende „zufällige<br />
Muster“ an Stilllegungsflächen habe voraus<strong>sich</strong>tlich<br />
wenig Wert für die Biodiversität, so die Prognose von<br />
Isermeyer, der sein Verdikt auf die Aussage „Viel Geld für<br />
wenig Biodiversität“ zuspitzte.<br />
In Deutschland koste die erste Säule jährlich 6 Mrd.<br />
Euro, rechnete Isermeyer als nächstes vor. Wenn jetzt im<br />
Rahmen der GAP-Reform vielleicht 2 Mrd. davon für das<br />
„Greening“ verwendet würden, kämen dabei bestenfalls<br />
„willkürlich verteilte Brennnesselstreifen“ heraus. Isermeyer<br />
sprach <strong>sich</strong> dafür aus, stattdessen besser zielgerichtet<br />
500 Mio. Euro für eine erkennbare Verbesserung der Biodiversität<br />
auf tatsächlich geeigneten Flächen zu investieren.<br />
Die eingesparten 1,5 Mrd. könne man dann gegen<br />
das Ausbluten des ländlichen Raums oder für effizienten<br />
Klimaschutz im Agrarsektor ausgeben.<br />
Direktzahlungen:<br />
Gieskanne oder überlebenswichtig<br />
Isermeyer ging sogar soweit, die sukzessive Abschaffung<br />
der ersten Säule zu fordern, da diese nur eine Gieskannenfunktion<br />
habe. Damit stieß er auf Widerstand von<br />
Dr. Martin Scheele von der Europäischen Kommission.<br />
Der Mitarbeiter der Generaldirektion Landwirtschaft<br />
und Ländliche Entwicklung stufte die Direktzahlungen<br />
aus der ersten Säule als „überlebenswichtig“ für die<br />
Mehrheit der Landwirte ein. Ohne diese Grundprämie<br />
wären die Landwirte in EU auf dem Weltagrarmarkt<br />
nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Grundprämie müsste<br />
allerdings an Berück<strong>sich</strong>tigung von Öko- und Tierschutzanforderungen<br />
geknüpft werden, postulierte Scheele.<br />
Juni 2011<br />
630 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
In seinem Statement analysierte Prof. Dr. Manfred<br />
Niekisch vom Sachverständigenrat für Umweltfragen<br />
zunächst den Konflikt, der daraus resultiere, dass <strong>sich</strong> der<br />
Landwirt selbst als autonomen Produzenten sehe – während<br />
er von der Gesellschaft nur noch als abhängiger<br />
Subventionsempfänger betrachtet werde. Ein neues<br />
positives Selbstverständnis der Landwirte müsse <strong>sich</strong><br />
daraus ergeben, dass die Landwirte zahlreiche Ökoleistungen<br />
für die Gesellschaft erbringen würden. Dazu<br />
gehöre, dass auch auf Hochertragsflächen die Einhaltung<br />
von Umweltstandards gewährleistet werden müsse.<br />
Niekisch postulierte, dass die Landwirte ihre Daseinsberechtigung<br />
nicht mehr länger nur in der Produktion<br />
von Lebens- und Futtermitteln sehen dürften. Eine<br />
Neuorientierung hin zur Landschaftspflege sei erforderlich.<br />
Dazu reiche es allerdings nicht, das „diffuse Gewirr“<br />
unterschiedlichster Agrarumweltprogramme der zweiten<br />
Säule in der bisherigen Struktur aufrecht zu erhalten.<br />
„Bauern für sauberes <strong>Wasser</strong>!“<br />
Dr. Helmut Born, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes<br />
wandte <strong>sich</strong> gegen ein Schlechtreden der<br />
ersten Säule: Die erste Säule sei doch schon „gegreent“.<br />
Denn die Direktzahlungen gäbe es nur in voller Höhe,<br />
wenn die Anforderungen aus der „Cross Compliance“<br />
erfüllt würden. Dazu gehöre, dass die Landwirte ein<br />
ganzes Bündel an Tierhaltungs- und Öko-Anforderungen<br />
einhalten müssten. Born unterstrich, dass auch die<br />
Landwirte selbst größtes Interesse an einer intakten<br />
Umwelt hätten: „Wir Bauern haben selbst ein Interesse<br />
daran, dass das <strong>Wasser</strong> sauber bleibt. Wir leiden doch an<br />
der Dioxinfracht der Flüsse auf überschwemmten Weiden!“<br />
Born wandte <strong>sich</strong> des Weiteren gegen eine überbordende<br />
Bürokratie im Gefolge zunehmender Ökoauflagen.<br />
Um die Einhaltung der Cross Compliance-Auflagen<br />
zu bestätigen, müssten die Bauern jetzt schon alljährlich<br />
einen 152-seitigen Katalog ausfüllen.<br />
Auch ein Vertreter des Landvolkes Niedersachsen<br />
befürchtete, dass die Anhebung der Baseline auf jeden<br />
Fall mehr Bürokratie und Kontrolle nach <strong>sich</strong> ziehen<br />
würde. Und wenn erste und zweite Säule stärker verzahnt<br />
würden, „wird <strong>sich</strong> auch die Bürokratie auf noch<br />
höherem Niveau verzahnen!“ Ange<strong>sich</strong>ts dieser Befürchtungen<br />
beteuerte Scheele, dass es der EU-Kommission<br />
ganz gewiss nicht um ein Draufsatteln neuer bürokratischer<br />
Lasten gehe. Die Anforderungen im Cross Compliance-Paket<br />
müssten jedoch „neu sortiert“ werden.<br />
Born unterstrich in seinem Diskussionsbeitrag, dass<br />
bei dem ohnehin schon zu hohen Bürokratielevel ein<br />
weiteres „Draufsatteln“ unzulässig wäre. Der Generalsekrätär<br />
des Bauernverbandes wies zudem darauf hin,<br />
dass es wegen des Finanzmittel-Transfers in die jungen<br />
Beitrittsländer für die deutschen Landwirte weniger<br />
Geld aus der ersten Säule geben wird. Damit werde der<br />
ökonomische Druck auf die deutschen Bauern weiter<br />
zunehmen.<br />
„Keiner kapiert die EU-Agrarmarktpolitik!“<br />
An der Stelle griff Volker Angres, Umweltjournalist beim<br />
ZDF, in die Debatte ein. Angres, der die Diskussionsrunde<br />
moderierte, machte den Insidern den Vorwurf:<br />
„Kein Mensch auf der Straße weiß, wie GAP funktioniert.<br />
Keiner kapiert Bedeutung und Zusammenspiel von erster<br />
und zweiter Säule!“<br />
Das bessere Ineinandergreifen von erster und zweiter<br />
Säule stand allerdings weiterhin im Mittelpunkt der<br />
Insider-Debatte. Dabei forderte Dr. Fritz Holzwarth,<br />
Unterabteilungsleiter <strong>Wasser</strong>wirtschaft im Bundesumweltministerium,<br />
einen stärkeren Einbezug des Gewässerschutzes<br />
in das Instrumentarium der EU-Agarpolitik:<br />
Auch bei einer Flächenstilllegung von zehn Prozent<br />
müsse auf den verbleibenden 90 Prozent <strong>sich</strong>ergestellt<br />
werden, dass dort die Produktion möglichst wenig<br />
umweltschädlich verlaufe. Holzwarth warnte zudem vor<br />
einer naturschutzlastigen Debatte. Bei der GAP-Reform-<br />
Diskussion müssten viel stärker medienübergreifende<br />
Elemente – beispielsweise auch der Gewässerschutz –<br />
berück<strong>sich</strong>tigt werden. Jenseits von Naturschutzbelangen<br />
komme es „auf das Gesamtpaket“ an.<br />
Florian Schöne, Agrarexperte beim Naturschutzbund<br />
(Nabu), wandte <strong>sich</strong> in diesem Zusammenhang dagegen,<br />
dass ökologische Vorrangflächen unbedingt auf<br />
eine Stilllegung und auf eine völlige Herausnahme aus<br />
der landwirtschaftlichen Produktion hinauslaufen müssten.<br />
Für den Vertreter des Nabu kam eine Nutzung unter<br />
extensivierten Bedingungen durchaus in Frage. Wichtig<br />
sei aber eine Verzahnung mit der zweiten Säule. Aus der<br />
zweiten Säule könnten überdurchschnittliche Leistungen<br />
für den Natur- und Gewässerschutz honoriert werden.<br />
Die Grundprämie aus der ersten Säule würde dann<br />
sozusagen als „Flatrate“ fungieren. Und diese Flatrate sei<br />
dann die Voraussetzung um überhaupt in die zweite<br />
Säule zu kommen. Da war <strong>sich</strong> der NABU-Sprecher mit<br />
Nordeifel (Birgel) © Gerd Ostermann<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 631
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
dem Vertreter des Bauernverbandes zumindest in<br />
soweit einig, dass die zweite Säule zielgerichtet u. a.<br />
auch an den „Problem-Hotspots“ (beispielsweise Nitratproblemgebiete)<br />
investiert werden sollte. Isermeyer forderte<br />
ebenfalls, unter Effizienzge<strong>sich</strong>tspunkten „<strong>sich</strong> mit<br />
der zweiten Säule genau das an Natur- und Gewässerschutz<br />
einzukaufen, was ich zur Problemlösung brauche“.<br />
Scheele erklärte nochmals, dass die EU die Gieskanne<br />
der ersten Säule nicht einfach abschaffen könne. Umso<br />
wichtiger sei es, ökologisch wichtige Vorrangflächen mit<br />
der zweiten Säule zu optimieren. Die Ökobedingungen<br />
der ersten Säule müssten so formuliert werden, dass der<br />
Erhalt von Dauergrünland auf der betrieblichen Ebene<br />
ge<strong>sich</strong>ert bleibe.<br />
Energiepflanzen – ein neues Problemfeld<br />
Born drückte in einem weiteren Debattenbeitrag auch<br />
seine Sorge aus, dass wir mit der stark zunehmenden<br />
Biomasseproduktion geradewegs in ein neues Problemfeld<br />
hineinmarschieren würden. Der aktuelle Anstieg<br />
der Agrarpreise lasse nichts Gutes erahnen. Niekisch griff<br />
diese Argumentation auf und kündigte an, dass der<br />
Sachverständigenrat für Umweltfragen am Folgetag ein<br />
neues Energiekonzept vorlegen würde, in dem Energiepflanzen<br />
überhaupt nicht mehr vorkommen würden.<br />
Biomasseverstromung käme nur noch in Frage, wenn<br />
landwirtschaftliche Abfälle und Landschaftspflegematerial<br />
energetisch genutzt würden. Der Biomasseanbau<br />
in Brasilien sei „eine einzige Katastrophe“. „Biofuel“<br />
sei in Wirklichkeit „Biofoul“ – eine ganz gewaltige Verdummung,<br />
redete <strong>sich</strong> der Vertreter des Umweltsachverständigenrates<br />
in Rage.<br />
Nach der Öffnung der Podiumsdiskussion für das<br />
Auditorium blieb es einer Mitarbeiterin des BMU vorbehalten,<br />
danach zu fragen, wo denn in der Debatte der<br />
Gewässerschutz geblieben wäre. Die BMU-Mitarbeiterin<br />
sprach <strong>sich</strong> dafür aus, die EG-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie in<br />
den Anforderungskatalog der Cross Compliance einzubeziehen.<br />
Holzwarth stimmte diesem Ansinnen zu, was<br />
bei Born wenig Begeisterung auslöste. Eine Implementierung<br />
der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie (WRRL) im Cross<br />
Compliance-Paket würde noch mehr Bürokratiezuwachs<br />
für Landwirte und die Agrarverwaltung nach <strong>sich</strong><br />
ziehen. Als Alternative fordert der DBV-Generalsekretär<br />
„mehr gezielte Maßnahmen für den Gewässerschutz“.<br />
Scheele sprach <strong>sich</strong> als Vertreter der EU-Kommission<br />
ebenfalls dafür aus, WRRL-Maßnahmen auch in der<br />
Cross Compliance zu verankern – „aber nicht sofort“. Erst<br />
müssten überall in der EU die Maßnahmenpläne für die<br />
erste Bewirtschaftungsperiode aufgestellt sein.<br />
Niekisch kritisierte auch die These „Erst Nahrungsmittelproduktion<br />
– und alles andere ist nachrangig“.<br />
Genau diese beschränkte Denkweise hätte uns die heutigen<br />
Umweltprobleme im Gefolge der einseitig auf<br />
Höchsterträge orientierten Landwirtschaft beschert. Dr.<br />
German J. Jeub vom Bundeslandwirtschaftsministerium<br />
wollte dies nicht so stehen lassen: Kernaufgabe der<br />
Landwirtschaft bleibe trotz der aller Herausforderungen<br />
von Klima-, Natur- und Umweltschutz die Nahrungsmittelproduktion<br />
– „und das zu Weltmarktbedingungen und<br />
Preisen!“.<br />
Isermeyer drückte im weiteren Diskussionsverlauf<br />
ganz klar seine Sorge aus, das Extensivierungen und<br />
Flächenstilllegungen in der EU nur anderenorts zu einer<br />
Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion führen<br />
werde („Leakage“). Global gesehen könne von einer<br />
Ökologisierung der Landwirtschaft nur gesprochen<br />
werden, „wenn <strong>sich</strong> der Konsum ändert“. Scheele wiederum<br />
stufte das Leakage-Argument als „Totschlagargument“<br />
ein.<br />
Fazit<br />
Ange<strong>sich</strong>ts der noch ungewissen Auswirkungen der EU-<br />
Agrarmarktreform dominierte bei den Funktionären des<br />
Bauernverbandes die Angst vor dem Verlust von angestammten<br />
Besitzständen und einer überbordenden<br />
Bürokratie. Der mehr ökologisch ausgerichtete Teil des<br />
Podiums setzte durchaus Hoffnungen in die Agrarmarktreform.<br />
Allerdings wurde bezweifelt, ob das<br />
Zusammenspiel von erster Säule (Grundprämie) und<br />
zweiter Säule (Extrazahlungen für besondere ökologische<br />
Leistungen) tatsächlich zu einem Mehr an Biodiversität<br />
und Gewässerschutz führen wird. Es müsse<br />
noch an einer optimierten Verzahnung von erster und<br />
zweiter Säule gearbeitet werden. Dazu gehöre auch der<br />
Einbezug der Anforderungen aus der EG-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie.<br />
Weitere Auskunft zu der vom Umweltbundesamt<br />
mitgeschnittenen Veranstaltung und Podiumsdiskussion<br />
bei Simone Richter, FG II 2.1 „Übergreifende Angelegenheiten<br />
Gewässergüte und <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Grundwasserschutz“,<br />
Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1,<br />
D-06844 Dessau-Roßlau, E-Mail: simone.richter@uba.de<br />
Autor<br />
Eingereicht: 11.04.2011<br />
Nikolaus Geiler (Dipl.-Biol.)<br />
E-Mail: nik@akwasser.de |<br />
Ak <strong>Wasser</strong> im<br />
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU) |<br />
Rennerstraße 10 |<br />
D-79106 Freiburg |<br />
www.akwasser.de<br />
Juni 2011<br />
632 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNG<br />
Buchbesprechung<br />
Taschenbuch der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Von Johann Mutschmann und Fritz Stimmelmayr.<br />
Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag. 15., vollst.<br />
überarb. und aktual. Aufl. 2011. XLII, 931 S.,<br />
422 Abb., 286 Tab., geb., Preis: 99,95 €, ISBN 978-3-<br />
8348-0951-3.<br />
Die aktuelle und umfassende Darstellung aller<br />
Bereiche für die <strong>Wasser</strong>versorgung. Auch die aktuelle<br />
15. Auflage wird dem gerecht, was die Fachzeitschrift<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> über die 14. Auflage<br />
geschrieben hat: „Mit dieser Auflage liegt wiederum<br />
ein handliches und zugleich umfassendes und<br />
über<strong>sich</strong>tliches Standardwerk vor für all diejenigen,<br />
die <strong>sich</strong> im Studium oder im Beruf mit der Planung,<br />
dem Bau, dem Betrieb und der Verwaltung von<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen befassen.“<br />
Das seit über 50 Jahren anerkannte Standardwerk<br />
umfasst alle Bereiche der <strong>Wasser</strong>versorgung – von<br />
der Planung über Bau, Betrieb, Organisation bis zu<br />
Verwaltung und Management der Anlagen.<br />
Das Taschenbuch der <strong>Wasser</strong>versorgung erläutert<br />
dabei den derzeitigen Stand der Technik, zeigt die<br />
wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte bei Planung,<br />
Ausführung und Unterhaltung von <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
und nennt aktuelle DVGW-<br />
Regelungen, DIN-Normen, Gesetze, Verordnungen<br />
und Richtlinien.<br />
Der Inhalt:<br />
Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
Technik der <strong>Wasser</strong>versorgung, Schutz des<br />
<strong>Wasser</strong>s, Anforderungen an das Trinkwasser<br />
DVGW-Regelwerk, Normen, Gesetze,<br />
Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien<br />
Die Zielgruppen:<br />
Ingenieure und Techniker in Planungs- und<br />
Baubüros, Behörden, Verbänden und der<br />
Industrie<br />
Betriebs- und Verwaltungsfachleute in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Studierende der Fachrichtungen<br />
Bauingenieurwesen, Versorgungstechnik<br />
und Umwelttechnik mit Schwerpunkt<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Interessierte Fachleute anderer Sparten<br />
Die Autoren:<br />
Das Autorenteam (Peter Fritsch, Werner Knaus, Gerhard<br />
Merkl, Erwin Preininger, Joachim Rautenberg,<br />
Matthias Weiß, Burkhard Wricke) setzt <strong>sich</strong> aus<br />
anerkannten Fachleuten zusammen, die das Werk<br />
von Dipl.-Ing. Johann Mutschmann und Dipl.-Ing.<br />
Fritz Stimmelmayr fortführen.<br />
Bestell-Hotline<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
München<br />
Tel. +49 (0) 201/82002-11<br />
Fax +49 (0) 201/82002-34<br />
E-Mail: S.Spies@vulkan-verlag.de<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Parallelheft <strong>gwf</strong>-Gas | Erdgas<br />
Neue Technologien<br />
Sie lesen u. a. fol gende Bei träge:<br />
Rathlev/Meyer/Juerss<br />
Strauß<br />
Hadick/Wermeling<br />
Wagner<br />
a<strong>Wo</strong>nneberger/Graf/<br />
Lemmer/Reimert<br />
Lenzen/Kramer/Mickan<br />
Innovative Technologien bei der Leitungsbefliegung<br />
Umrüstung einer Gasturbine des Typs Frame3 auf schadstoffarme Verbrennung<br />
Mobiler Verdichter vermeidet klimaschädliche Methanemissionen bei der<br />
Durchführung von Pipeline-Instandsetzungsmaßnahmen<br />
Gasströmungswächter für Hochdruckleitungen – Detailbetrachtung der<br />
Sicherheitstechnik<br />
Zweistufige Druckfermentation – Ein innovatives, optimiertes Verfahren<br />
Für die Erzeugung von Biogas zur Netzeinspeisung<br />
Präzise Ermittlung der CO 2 -Emissionen aus Erdgas – Qualitäts<strong>sich</strong>erung durch Einsatz<br />
geeichter Messgeräte<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 633
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft im Wandel<br />
Arno Bäumer<br />
Johannes Remmel,<br />
Minister<br />
für Klimaschutz,<br />
Umwelt, Landwirtschaft,<br />
Natur- und<br />
Verbraucherschutz<br />
des<br />
Landes NRW.<br />
Der Verbandsrat des Ruhrverbands würdigte am<br />
21. Februar 2011 den 60. Geburtstag seines Vorstandsvorsitzenden,<br />
Prof. Harro Bode, mit einem Fachsymposium.<br />
Die Gastredner und Referenten nahmen eine<br />
umfassende Positionsbestimmung der nationalen und<br />
internationalen <strong>Wasser</strong>wirtschaft vor.<br />
Schon bei der Begrüßung benannte der Verbandsratsvorsitzende<br />
des Ruhrverbands, Dr. Bernhard Görgens,<br />
aktuelle Diskussionspunkte. Nachdem die Vorgaben<br />
des Gesetzgebers für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft <strong>sich</strong> in<br />
den letzten Jahrzehnten als äußerst dynamisch erwiesen<br />
haben, sei man davon ausgegangen, dass nach<br />
Bewältigung der Vorgaben zur Nährstoffentfernung,<br />
die in der <strong>Abwasser</strong>reinigung milliardenschwere Investitionen<br />
ausgelöst haben, keine neuen Quantensprünge<br />
mehr zu erwarten wären. Doch durch eine immer besser<br />
werdende Analytik wurde es möglich, auch kleinste<br />
Mengen von Spurenstoffen in den Gewässern festzustellen<br />
und dies hat zu einer zum Teil massiven öffentlichen<br />
Diskussion darüber geführt, ob diese Mikroverunreinigungen<br />
die Gesundheit der Menschen oder auch<br />
das Leben in unseren Gewässern beeinträchtigen und<br />
ob es deshalb notwendig ist, diese Stoffe aus dem Trinkwasser,<br />
aber auch aus dem <strong>Abwasser</strong> zu entfernen. Ausreichende<br />
Antworten über den Umfang der Risiken solcher<br />
Mikroverunreinigungen können heute noch nicht<br />
gegeben werden, da er offenbar sehr gering ist. Um<br />
letztendlich Sicherheit zu bekommen, wären vermutlich<br />
jahrzehntelange Versuche erforderlich, meinte Görgens.<br />
Dennoch haben <strong>sich</strong> Politik und <strong>Wasser</strong>wirtschaft mit<br />
den Sorgen und Ängsten der Menschen auseinanderzusetzen.<br />
Dabei geht es aus seiner Sicht selbstverständlich<br />
auch um die Frage, zu welchen Kosten welcher Erfolg zu<br />
erreichen ist und ob die Kosten und der Nutzen in<br />
einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.<br />
Dr. Görgens erinnerte daran, dass die Bürgerinnen und<br />
Bürger sowie auch die Industrie in den zurückliegenden<br />
Jahren durch die großen Investitionsprogramme im Zu -<br />
sammenhang mit der <strong>Abwasser</strong>reinigung schon erheblichen<br />
Belastungen ausgesetzt waren. Für die Zukunft<br />
ist weiterhin zu bedenken, dass für Teile Deutschlands<br />
und konkret fürs Ruhrverbandsgebiet ein Rückgang der<br />
Bevölkerung prognostiziert ist. Dies bedeutet, dass<br />
künftig die Kosten für eine weiter verbesserte Infrastruktur<br />
und also auch für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft von<br />
immer weniger Menschen und vermutlich auch von<br />
immer weniger Gewerbebetrieben zu finanzieren sind.<br />
Auch Eckhard Uhlenberg, Präsident des Landtages<br />
von Nordrhein-Westfalen, stellte in seinem Grußwort<br />
fest, dass die Spurenstoffe heute in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
bundesweit ein Zukunftsthema darstellen, dem man<br />
<strong>sich</strong> stellen muss. Aber auch die Auswirkungen des Klimawandels<br />
auf die <strong>Wasser</strong>wirtschaft und die Möglichkeiten,<br />
die Folgen zu meistern, werden die zukünftigen<br />
Aufgaben in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft wesentlich beeinflussen.<br />
Hinzu kommt, dass nicht nur das Sicherheitsbedürfnis<br />
der Menschen mit wachsendem <strong>Wo</strong>hlstand kontinuierlich<br />
ansteigt, sondern <strong>sich</strong> auch immer die Nutzungsansprüche<br />
an die Gewässer verändern. Die sondergesetzlichen<br />
<strong>Wasser</strong>verbände in Nordrhein Westfalen sollten<br />
daher eine Vorreiterrolle einnehmen. Uhlenberg<br />
meinte, dass schon die Gründungsväter der Verbände<br />
seinerzeit an der Spitze der Bewegung gestanden und<br />
bemerkenswerte Weit<strong>sich</strong>t bewiesen hätten.<br />
Paul Reiter, Executive Director der International<br />
Water Association (IWA), sprach in seinem Vortrag „The<br />
Global Water Issue“ über zukünftige Herausforderungen<br />
und Chancen bei den weltweiten <strong>Wasser</strong>fragen. Nord-<br />
Europa sei gut aufgestellt, aber für andere Regionen der<br />
Welt sieht Reiter Konflikte um das <strong>Wasser</strong> aufgrund der<br />
unterschiedlichen Bedürfnisse der Städte, der Landwirtschaft,<br />
der Industrie und nicht zuletzt auch der Umwelt<br />
voraus. Verschärft wird das Problem in Zukunft durch<br />
die prognostizierte Zunahme der Weltbevölkerung um<br />
weitere zwei Milliarden Menschen. Zwischen heute und<br />
dem Jahr 2050 werden voraus<strong>sich</strong>tlich jeden Tag rund<br />
150 000 Menschen mehr die Erde bevölkern. Von diesen<br />
Menschen werden 90 % in Entwicklungsländern und<br />
ebenso 90 % in städtischen Regionen leben. Nach<br />
Reiters Rechnung wird es bis zum Jahr 2050 mehr als<br />
2000 neue Millionenstädte auf der Erde geben. In den<br />
Juni 2011<br />
634 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
MinDir Dr. jur. Helge Wendenburg, Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktor<strong>sich</strong>erheit.<br />
Entwicklungsländern ist derzeit für fast die Hälfte der<br />
Menschen eine Versorgung mit Trinkwasser ungenügend.<br />
Darüber hinaus haben 70 % der Menschen keinen<br />
Anschluss an eine Kanalisation. Reiter ging weiterhin am<br />
Beispiel verschiedener Regionen der Welt auf die Auswirkungen<br />
des Klimwawandels ein und stellte fest, dass<br />
die CO 2 -Emissionen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft in diesem<br />
Zusammenhang nicht unrelevant sind.<br />
Für die Zukunft nannte er eine Reihe von Maßnahmen,<br />
die seitens der <strong>Wasser</strong>wirtschaft geeignet sein<br />
könnten, um regional den Problemen des Bevölkerungswachstums<br />
und der <strong>Wasser</strong>knappheit sowie global den<br />
CO 2 -Emissionen zu begegnen. Reiter nannte z. B. dezentrale<br />
<strong>Abwasser</strong>systeme, Recycling von Nährstoffen,<br />
Energiegewinnung aus <strong>Abwasser</strong> oder die Wiederverwendung<br />
von <strong>Wasser</strong>.<br />
Otto Schaaf, Präsident der Deutschen Vereinigung<br />
für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V. (DWA),<br />
führte in seine „Standortbestimmung der deutschen<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft“ mit einem technisch-historischen<br />
Rückblick ein. Dieser reichte vom römischen Köln in der<br />
Zeit um 50 n. Chr. über die ersten neuzeitlichen <strong>Abwasser</strong>systeme,<br />
z. B. in Hamburg, die Entwicklung der<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung von den Anfängen, z. B. mit der<br />
Dresdener Siebscheibenhalle, über den Imhoff-Tank<br />
(Emscherbrunnen) bis hin mit großem Sprung zur biologischen<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung Mitte der 70er-Jahre und<br />
zur darauf folgenden Einführung der Nährstoffelimination<br />
auf unseren Kläranlagen. Schaaf stellte fest, dass die<br />
deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft sehr vieles erreicht hat und<br />
dass die meisten Gewässer in biologisch/chemischer<br />
Hin<strong>sich</strong>t in einem guten Zustand sind. Die <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
hat jedoch im Jahre 2000 den Fokus<br />
erweitert und heute wird im Bereich der Gewässermorphologie<br />
noch großer Handlungsbedarf gesehen.<br />
Für die Zukunft sind die Folgen des Klimawandels,<br />
die <strong>sich</strong> auch in Deutschland in Form von lokaler <strong>Wasser</strong>knappheit<br />
und Dürren oder extremer Niederschläge<br />
und höherer Hochwasserrisiken äußern werden, zu<br />
bewältigen. Starkregen als kurzzeitigen punktuellen<br />
Ereignissen wird man nicht dadurch begegnen können,<br />
dass die Kanäle größer dimensioniert werden. Hier ist<br />
zusammen mit Stadtplanern zu überlegen, wie die<br />
deutlich bestehenden Risiken künftig gemindert werden<br />
können.<br />
Auch der DWA-Präsident ging auf die zukünftige<br />
Bevölkerungsabnahme in Deutschland ein und stellte<br />
fest, dass <strong>sich</strong> daraus Anforderungen an die Anpassung<br />
der Infrastrukturen (Stichworte Verkeimung, Ablagerungen<br />
in Ableitungssystemen) und an die Finanzierungsmodelle<br />
ergeben.<br />
Die DWA als Fachverband nimmt <strong>sich</strong> des bereits<br />
erwähnten Themas der anthropogenen Spurenstoffe<br />
offensiv an. Es ist aber auch sehr klar zu sehen, dass es<br />
Spurenstoffbelastungen in unserer Umwelt immer<br />
geben wird und eine intensive Bewertung und Diskussion<br />
zu führen sein wird, wie das Risiko dieser Belastung<br />
einzuschätzen ist und wie damit verantwortlich umgegangen<br />
wird. Schaafs Meinung nach sind dabei nicht<br />
nur End-of-Pipe-Strategien zu diskutieren, die DWA plädiert<br />
auch sehr stark dafür, dass man verstärkt an die<br />
Quelle geht und versucht, den Verbraucher als Verbündeten<br />
zu gewinnen, um ihn aktiv von einer Vermeidungsstrategie,<br />
z. B. bei bestimmten Kosmetika, zu<br />
überzeugen.<br />
Bei allen zukünftigen Aktivitäten der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
spielt die Finanzierung eine entscheidende Rolle.<br />
Schaaf stellte fest, dass wir Menschen uns vieles wünschen<br />
dürfen, es dann aber natürlich auch bezahlen<br />
müssen. Deshalb sind intelligente Lösungen notwendig,<br />
um die geplanten Maßnahmen auch umsetzen zu<br />
können. Die <strong>Abwasser</strong>beseitigung als Teil der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge muss dabei immer in die öffentliche<br />
Kontrolle eingebettet bleiben.<br />
Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes<br />
NRW, markierte in seinem Vortrag zu den „Perspektiven<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft in NRW“ drei Herausforder -<br />
ungen.<br />
Zur zentralen Herausforderung dieses Jahrhunderts,<br />
dem Klimaschutz, hat die Landesregierung den Ehrgeiz,<br />
in Nordrhein-Westfalen mit einem eigenen Klimaschutzgesetz<br />
eigene Impulse zu geben. Natürlich spielt die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft hier auch eine Rolle, wobei <strong>sich</strong> diese<br />
vor allem auf die Möglichkeiten richtet, den Energieverbrauch<br />
zu senken und die ggfs. mögliche Energieproduktion<br />
zu optimieren.<br />
Weiterhin ist es notwendig, <strong>sich</strong> mit den Spurenstoffen<br />
auseinandersetzen, besonders in Nordrhein-Westfalen,<br />
weil die Trinkwassergewinnung hier anders als in<br />
den meisten Bundesländern in hohem Maße von Oberflächengewässern<br />
abhängig ist und deshalb auch eines<br />
besonderen Schutzes bedarf. Es ist nach An<strong>sich</strong>t des<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 635
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
Univ. Prof. Dr.<br />
Dr. h. c. Helmut<br />
Kroiss,<br />
Technische<br />
Universität<br />
Wien.<br />
Ministers richtig, ein Multibarrierenkonzept auszuprägen.<br />
Es geht einerseits darum, direkt an der Quelle anzusetzen,<br />
aber auch darum, die <strong>Abwasser</strong>beseitigung zu<br />
verbessern, weil nicht alle Einträge an den Quellen<br />
unterbunden werden können. Man wird den Menschen<br />
nicht verbieten können und dürfen, Medikamente zu<br />
nehmen oder Kosmetika zu benutzen. Die Gemeinschaftsanstrengung<br />
zum vorsorgenden Verbraucherund<br />
Gesundheitsschutz bezieht aber nicht zuletzt auch<br />
Maßnahmen bei der Trinkwasseraufbereitung mit ein.<br />
Die <strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>entsorgung als<br />
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist und bleibt für<br />
Minister Remmel der Anker der Verlässlichkeit. Er unterstrich,<br />
dass es wichtig ist, die Infrastruktur in den zentralen<br />
Bereichen der Ver- und Entsorgung zu erhalten und<br />
weiter zu entwickeln. Gerade im Bereich der kommunalen<br />
<strong>Abwasser</strong>beseitigung jedoch ist die Versuchung<br />
groß, dass Sanierungs- und Investitionstätigkeiten aufgrund<br />
klammer Kassenlage der Kommunen verschoben<br />
werden. In diesem Zusammenhang unterstrich er auch,<br />
wie wichtig es ist, neben der Sanierung der öffentlichen<br />
Kanäle diese auch bei den privaten Kanälen mit aller<br />
Konsequenz weiter zu treiben.<br />
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
äußerte Remmel die Auffassung, dass<br />
die Auseinandersetzung mit der Gewässerstruktur und<br />
Gewässermorphologie nicht eine Selbstbeschäftigung<br />
von Behörden oder Administrationen sei, sondern dass<br />
es hier um das ambitionierte Vorhaben geht, unsere<br />
Gewässer jenseits der chemischen und biologischen<br />
Qualität wieder zu Lebensadern der Artenvielfalt zu<br />
machen. Zurzeit gehen weltweit pro Jahr 14 000 Arten<br />
und damit Baupläne des Lebens unwiederbringlich verloren.<br />
Minister Remmel äußerte <strong>sich</strong> davon überzeugt,<br />
dass wir heute in der Diskussion im Bereich Artenschutz<br />
an der Schwelle stehen, wo wir beim Klimaschutz ungefähr<br />
vor 10 Jahren standen. Für die 2200 Gewässerkilometermaßnahmen<br />
in Nordrhein-Westfalen, die man<br />
aufwerten wollte, seien 2,1 Milliarden € Investitionssumme<br />
bis 2027 prognostiziert, was eine große finanzielle<br />
Anstrengung sei. Für die Finanzierung der somit pro<br />
Jahr in Nordrhein-Westfalen mindestens zu investierenden<br />
80–100 Millionen € sieht er das <strong>Wasser</strong>entnahmeentgelt<br />
als geeignetes Instrument.<br />
Professor Dr.-Ing. <strong>Wo</strong>lfgang Firk, Vorstand des <strong>Wasser</strong>verbands<br />
Eifel-Rur (WVER) und Sprecher der DWA-<br />
Koordinationsgruppe „Anthropogene Spurenstoffe im<br />
<strong>Wasser</strong>kreislauf“, referierte über die „Relevanz und<br />
Beherrschbarkeit von Mikroverunreinigungen in Oberflächengewässern“.<br />
Eingangs stellte er fest, dass man in den Gewässern<br />
heute Zehntausende verschiedene Chemikalien aufspüren<br />
kann, weil <strong>sich</strong> die Analytik verfeinert hat. Die tatsächliche<br />
Wirkung der Mikroverunreinigungen auf<br />
Mensch und Natur ist heute hingegen ein noch nicht<br />
aufgearbeitetes Thema.<br />
Primäre Maßnahmen, die die Gesellschaft nach seiner<br />
Meinung ergreifen sollte, gehen in Richtung von<br />
Eintragsverboten, von Produktsubstitutionen und der<br />
Beschränkung auf das Notwendige im industriellen<br />
Bereich, aber auch bei den Privathaushalten und im<br />
gesundheitlichen Bereich. Gleichfalls gehören die Erfassung<br />
von <strong>Abwasser</strong>teilströmen und die verbesserte<br />
Vorbehandlung von industriellen und gewerblichen<br />
Abwässern zu den primären Maßnahmen. Maßnahmen<br />
auf den Kläranlagen oder in der Misch- und Regenwasserbehandlung<br />
sind seiner Auffassung nach nur als<br />
sekundär zu bezeichnen.<br />
Die Art der <strong>Abwasser</strong>reinigung zur Reduzierung von<br />
Mikroverunreinigungen ist sehr von den jeweiligen<br />
Stoffeigenschaften abhängig, z. B. hin<strong>sich</strong>tlich der Flüchtigkeit<br />
und der Polarität. Auf konventionellen Kläranlagen<br />
bereits stattfindende Entfernungsprozesse sind das<br />
Ausstrippen, ein biologischer Abbau bei Anlagen mit<br />
hohem Schlammalter und die Adsorption an Partikeln<br />
und Schlammflocken. Gezielt weitergehende Verfahren<br />
sind die chemische Oxidation, die Sorption an spezielle<br />
Adsorbentien und die Abtrennung mittels „dichter“<br />
Membranen. Firk stellte verschiedene Verfahren (Kombinationen)<br />
vor, die in dem Entwurf eines DWA-Arbeitsberichts<br />
näher dargestellt werden und stellte fest, dass<br />
es für keines von ihnen derzeit einen ge<strong>sich</strong>erten Auslegungsansatz<br />
oder ein Regelwerk zur Bemessung gibt.<br />
Zur Ozonung führte er aus, dass hier eine Breitbandwirkung<br />
bei der Elimination von Mikroverunreinigungen<br />
festzustellen ist, wobei jedoch teilweise unbekannte<br />
Reaktionsprodukte entstehen. So wurden zum Beispiel<br />
für Codein – ein Analgetikum und Hustenmittel – bisher<br />
16 Transformationsprodukte identifiziert. Solche Transformationsprodukte<br />
können generell hin<strong>sich</strong>tlich ihrer<br />
Eigenschaften und ihres Verhaltens so<strong>wohl</strong> harmlos als<br />
auch toxisch sein. Firk berichtete von Fällen, in denen<br />
Fischtests das Ergebnis hatten, dass die Mortalität steigt,<br />
wenn eine Ozonung angewendet wird.<br />
Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Kroiss von der Technischen<br />
Universität Wien reflektierte in seinem Vortrag<br />
„Neue Behandlungsverfahren von <strong>Abwasser</strong> zur Redu-<br />
Juni 2011<br />
636 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
zierung von Mikroverunreinigungen“ zunächst die<br />
Möglichkeiten der Findung von Grenzwerten für Spurenstoffe.<br />
Nach seiner An<strong>sich</strong>t gibt es einen Bedarf an<br />
wissenschaftlichen Methoden zur Feststellung der konzentrationsbezogenen<br />
Wirkung beziehungsweise der<br />
Nicht-Wirkung von Stoffen in der Umwelt – für den<br />
Menschen in der Humantoxikologie, für die Umwelt in<br />
der Ökotoxikologie. Daraus müssen zulässige Grenzwerte<br />
für Konzentrationen oder eine zulässige Dosis<br />
abgeleitet werden, die tragfähige Entscheidungen<br />
ermöglichen. Die Zielvorgaben für den Einsatz von<br />
Nachreinigungsverfahren sind dabei von der Politik<br />
festzulegen, die Wissenschaft und die Technik können<br />
nur Grundlagen liefern. Ein strenges Vorsorgeprinzip<br />
muss zuerst einmal klarstellen, welche Stoffe nicht oder<br />
nicht mehr erzeugt werden dürfen (z. B.: prioritäre<br />
Stoffe, stark gentoxische Stoffe).<br />
Kroiss ging weiterhin auf die Ergebnisse der Versuche<br />
mit einer nachgeschalteten Ozonung auf dem Hauptklärwerk<br />
Wien ein. In der ersten und zweiten biologischen<br />
Belebungsstufe dieser Anlage werden schon sehr<br />
viele Stoffe sehr weitgehend entfernt, so z. B. auch der<br />
Wirkstoff der Antibabypille. Sehr schlecht abbaubar in<br />
diesen Schritten der konventionellen <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
sind unter anderem Röntgenkontrastmittel oder<br />
Diclofenac. Mit einer nachgeschalteten Ozon-Dosierung<br />
konnten dann jedoch fast alle Stoffe sehr weitgehend<br />
bis in die Nähe der Nachweisgrenze entfernt werden.<br />
Im Ausblick stellte Prof. Kroiss fest, dass man nach<br />
dem heutigen Stand des Wissens nicht in der Lage ist,<br />
die exakte Verringerung des Risikos für Menschen und<br />
die aquatische Ökologie durch die Nachreinigungsverfahren<br />
anzugeben, dass es aber auch gut ge<strong>sich</strong>erte<br />
Hinweise gibt, dass etwa vorhandene Risiken durch die<br />
Anwendung solcher Verfahren geringer werden, insbesondere<br />
für die Gewässerbiozönosen. Politik, Wissenschaft<br />
und die Technik werden seiner An<strong>sich</strong>t nach auch<br />
beim möglichen Einsatz von Nachreinigungsverfahren<br />
in der Zukunft mit großen Un<strong>sich</strong>erheiten über die weiter<br />
verbleibenden Restrisiken leben müssen.<br />
MinDir Dr. jur. Helge Wendenburg, Abteilungsleiter im<br />
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor<strong>sich</strong>erheit,<br />
betonte in seinem Vortrag über die<br />
„Gegenwart und Zukunft der ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen<br />
bei der Trink- und <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
in Deutschland“ zunächst den im internationalen<br />
Vergleich guten Zustand der Trinkwasser- und <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
in Deutschland. In der kommunalen Ab -<br />
wasserreinigung sind in den vergangenen 20 Jahren die<br />
Stoffeinträge in die Gewässer ganz erheblich minimiert<br />
worden. Er wies darauf hin, dass heute 70 % aller Stickstoffeinträge<br />
und über 50 % der Phosphoreinträge aus<br />
diffusen Quellen aus der Landwirtschaft stammen. Im<br />
Hinblick auf die Eutrophierung der Meere sind in der<br />
Ostsee nach wie vor ganz starke Probleme gegeben, die<br />
nicht unbedingt alleine durch Deutschland, sondern<br />
auch durch Polen und die anderen angrenzenden Länder<br />
der Europäischen Union wie auch Russland verursacht<br />
sind.<br />
Wendenburg sieht die erheblichen Fortschritte und<br />
Entwicklungen in Deutschland auch mit den Entwicklungen<br />
des Ordnungsrechts begründet. Er umriss kurz<br />
die laufenden und kommenden Aktivitäten, wie z. B. die<br />
Oberflächengewässerverordnung, die Verordnung zum<br />
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Anlagen,<br />
die Weiterentwicklung von <strong>Abwasser</strong>abgabe und <strong>Wasser</strong>entnahmeentgelten<br />
zu einer umfassenden <strong>Wasser</strong>nutzungsabgabe<br />
oder die Vorbereitung der neuen<br />
Trinkwasserverordnung.<br />
Im Hinblick auf die anthropogenen Spurenstoffe<br />
stellte Wendenburg die Frage, ob wir in Deutschland<br />
eigentlich eine ausreichende Risikokultur haben. Es ist<br />
festzustellen, dass zwar regelmäßig die Entdeckung<br />
eines „Schadstoffs der <strong>Wo</strong>che oder des Monats“ durch<br />
die Medien über die reine Entdeckung hinaus mit einem<br />
Umwelt- oder Gesundheitsskandal verbunden wird –<br />
ein Problem ist aber, dass diese Nachrichten nach kürzester<br />
Zeit wieder vergessen werden. Als Beispiel diente<br />
ihm ein kürzlicher Dioxinskandal, den es vor exakt<br />
10 Jahren mit der gleichen Wirkungskette schon einmal<br />
gegeben hatte. Wendenburg regte an, darüber nachzudenken,<br />
zukünftig sehr viel stärker zu überwachen und<br />
im Falle krimineller Handlungen konsequent die Zuführung<br />
zum Strafrecht zu praktizieren. Bei den anthropogenen<br />
Spurenstoffen soll man <strong>sich</strong> auch stärker den<br />
Fragen der Produktverantwortung stellen. Bei der Herstellung<br />
von z.B. Arzneimitteln oder Haushaltschemikalien<br />
ist seitens der Hersteller deutlicher darüber nachzudenken,<br />
wie diese Stoffe an anderen Stellen wirken.<br />
Über die die Veranstaltung abschließende Geburtstagslaudatio<br />
von Norbert Frece, Vorstand Finanzen, Personal<br />
und Verwaltung des Ruhrverbands, hinaus würdigten<br />
auch die anderen Redner des Tages den Fachmann<br />
und Menschen Harro Bode als <strong>Wasser</strong>wirtschaftler<br />
mit Überblick sowie Leib und Seele, der die Entwicklung<br />
in Deutschland an vielen Stellen maßgeblich und positiv<br />
mitgeprägt hat, weil er im Sinne der Newtonschen<br />
Gesetze zu jenen Kräften gehört, die Bewegungen<br />
verursachen.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 18.05.2011<br />
Dr. Arno Bäumer<br />
E-Mail: arno-baeumer@ruhrverband.de |<br />
Ruhrverband |<br />
Kronprinzenstraße 37 |<br />
D-45128 Essen<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 637
PRAXIS<br />
Wirtschaftliche <strong>Abwasser</strong>lösung für die<br />
Verbandsgemeinde Kirchberg/Hunsrück<br />
Dipl-Ing. <strong>Wo</strong>lfgang Krämer<br />
In der größten Kläranlage im Hunsrück wird neben dem <strong>Abwasser</strong> von 20 Gemeinden der Verbandsgemeinde<br />
Kirchberg auch das Schmutzwasser sowie das enteisungsmittelhaltige <strong>Abwasser</strong> des Flughafens Frankfurt-<br />
Hahn behandelt. Mit dem Großprojekt Kyrbachtal wurde nicht nur eine wichtige Grundlage für den Gewässerschutz<br />
geschaffen, es wurden auch Synergien genutzt und damit Kosten gespart.<br />
Teilprojekt 1:<br />
Der Zweckverband Flughafen Hahn<br />
ist mit seiner Gründung zum<br />
01.01.2002 zur öffentlichen Erschließung<br />
des gesamten Flughafenareals,<br />
mit Ausnahme des Flughafen<strong>sich</strong>erheitsbereiches,<br />
auch in die<br />
<strong>Abwasser</strong>beseitigungspflicht eingetreten.<br />
Das umfasst ebenfalls die<br />
Reinigung des dort anfallenden<br />
Schmutzwassers. Der Schmutzwasseranschluss<br />
des Flughafens an die<br />
<strong>Abwasser</strong>gruppe Dill der Verbandsgemeinde<br />
Kirchberg wurde für die<br />
dortige <strong>Abwasser</strong>reinigung allerdings<br />
zunächst nur als Provisorium<br />
vereinbart. Ange<strong>sich</strong>ts der stark<br />
gewachsenen Beschäftigten- und<br />
Passagierzahlen in den letzten Jahren<br />
wurde dies unzureichend.<br />
Verbindungsschacht (d 200 mm) zwischen<br />
Belebungsbecken und Nachklärbecken.<br />
Die Flughafen Frankfurt-Hahn<br />
GmbH ist, als Träger der Verkehrsanlagen<br />
im Flug<strong>sich</strong>erheitsbereich des<br />
Flughafens, für die Entsorgung des<br />
in den Wintermonaten durch die<br />
Flugzeug- und Rollbahnenteisung<br />
anfallenden enteisungsmittelhaltigen<br />
<strong>Abwasser</strong>s verantwortlich, da<br />
das behördlich erlaubte Trennkriterium<br />
zur Einleitung ins Gewässer<br />
überschritten wurde.<br />
Bisher musste das komplette<br />
enteisungsmittelhaltige <strong>Abwasser</strong><br />
kostenintensiv zunächst per Tankwagen<br />
und dann in eine Leitung, die<br />
zur Kläranlage Dill führt, gebracht<br />
werden, um es dort leitungsgebunden<br />
reinigen zu können. Aufgrund<br />
der begrenzten Kapazität konnte<br />
trotz Ertüchtigung von der vorhandenen<br />
Kläranlage allerdings nur ein<br />
Teil des Enteisungsabwassers aufgenommen<br />
und gereinigt werden.<br />
Die notwendige Druckleitung<br />
zur Förderung der enteisungsmittelhaltigen<br />
Abwässer wurde von der<br />
Sonntag Baugesellschaft mbH + Co.<br />
KG aus Dörth als Generalunternehmer<br />
gebaut. Hier wurden rund<br />
10 km SPC Druckrohre d 250 x 22,7<br />
mm in Baulängen von 20 m verlegt.<br />
Damit das Rohr bei der Verlegung<br />
vor äußerer Beschädigung geschützt<br />
bleibt, entschied man <strong>sich</strong> für den<br />
Einsatz von SPC Schutzmantelrohren.<br />
Dieses Schutzmantelrohr ist ein<br />
im Coextrusionsverfahren hergestelltes<br />
Mehrschichtrohr mit additiver<br />
Schutzschicht. Es besteht aus<br />
einem Polyethylen-Kernrohr (PE<br />
100), das mit einem äußeren, abriebund<br />
ritzfesten Schutzmantel aus<br />
modifiziertem Polypropylen (PP)<br />
versehen ist (Rohraufbau entsprechend<br />
PAS 1075 Typ 3).<br />
Konzeptionen zur Lösung der<br />
<strong>Abwasser</strong>problematik in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchberg haben<br />
nach langjährigen Untersuchungen,<br />
Planungen und Verhandlungen zwischen<br />
den Beteiligten sowie den<br />
<strong>Wasser</strong>behörden schließlich zu dem<br />
Ergebnis geführt, als gemeinsame,<br />
ökologischste und zugleich wirtschaftlichste<br />
Lösung eine neue<br />
Gruppenkläranlage im Kyrbachtal<br />
in der Gemarkung Sohrschied zu<br />
errichten.<br />
Teilprojekt 2: Neue Gruppenkläranlage<br />
mit Freispiegelkanälen<br />
Um die gesetzlichen Umweltanforderungen<br />
zu erfüllen, war die Verbandsgemeinde<br />
Kirchberg – als Träger<br />
der <strong>Abwasser</strong>beseitigung – nach<br />
Beendigung der Erstausstattung<br />
verpflichtet, die vorhandenen kommunalen<br />
Kläranlagen Dill und Kirchberg-West<br />
mit der so genannten<br />
dritten Reinigungsstufe auszustatten.<br />
Die geforderte <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
hätte einen erheblichen baulichen<br />
und technischen Sanierungsund<br />
Erweiterungsaufwand an zwei<br />
Standorten mit hohen Investitionskosten<br />
erfordert.<br />
Durch den Bau einer zentralen<br />
Gruppenkläranlage mit moderner<br />
Technologie entfiel diese sonst notwendige<br />
Sanierung und Erweiterung<br />
der drei kleineren Kläranlagen<br />
der Verbandsgemeinde Kirchberg.<br />
Darüber hinaus gewährleistet die<br />
Neuanlage durch die bessere Reinigungsleistung<br />
eine wesentliche<br />
Juni 2011<br />
638 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRAXIS<br />
Verbesserung der Gewässergüte,<br />
die allen Bewohnern der Region zu<br />
Gute kommt.<br />
Ursprünglich sah die Bauplanung<br />
der Gruppenkläranlage zwischen<br />
dem Verteilerbauwerk und<br />
den Belebungsbecken ein konventionelles<br />
Betonbauwerk vor. Aufgrund<br />
eines Vorschlags von SIMONA<br />
entschied man <strong>sich</strong> jedoch für einen<br />
monolithischen PE 100-Schacht<br />
d 1060 x 62,1 mm mit einer Gesamthöhe<br />
von acht Metern.<br />
Alle auf der Kläranlage verlegten<br />
1200 m Rohrleitungen von d 560 bis<br />
d 900 mm, SDR 17,6 wurden mit<br />
wanddickenintegrierter Heizwendel<br />
SIMONA® SIMOFUSE® ausgeführt.<br />
Die SIMONA® SIMOFUSE® Produktgruppe<br />
ermöglicht eine fortschrittliche<br />
Verbindungstechnik<br />
von Kunststoffrohren. Die in das<br />
Polyethylen vollständig integrierte,<br />
verdeckte Heizwendel gewährleistet<br />
eine materialhomogene, dauerhaft<br />
dichte und zugfeste – analog<br />
der DVS-Richtlinien durchgeführte –<br />
Verschweißung. Dabei bietet diese<br />
fortschrittliche Verbindungstechnik<br />
eine erhöhte Effizienz beim Verlegen<br />
von Rohrsystemen und gewährleistet<br />
absolute Dichtigkeit und<br />
totalen Schutz vor Wurzeleinwuchs.<br />
Ein schnelleres Verlegen ohne aufwändige<br />
Schweißvorbereitungen,<br />
wie z. B. das Schälen der Rohrenden,<br />
wird ermöglicht.<br />
Funktionsweise der<br />
Kläranlage<br />
Über das Verteilerbauwerk erfolgt<br />
eine gezielte Dosierung der Belebungsbecken<br />
mit Enteisungsabwasser<br />
vom Flughafen-Hahn und<br />
Rohabwasser. Der Anteil des<br />
enteisungsmittelhaltigen <strong>Abwasser</strong>s<br />
beträgt jährlich rund 200 000<br />
Kubikmeter. Die Einleitung in das<br />
Belebungsbecken erfolgt über das<br />
PE-Schachtbauwerk, das eine Do -<br />
sier- und eine Kontrollfunktion<br />
erfüllt. Der Höhenunterschied zwischen<br />
Ein- und Auslauf zum Belebungsbecken<br />
beträgt 6,50 m. Man<br />
arbeitet bei der Dosierung nach<br />
dem Prinzip der kommunizierenden<br />
Röhren, d. h. der Höhenstand<br />
im Schacht entspricht dem des<br />
Belebungsbeckens. Das <strong>Abwasser</strong><br />
im Belebungsbecken wird mittels<br />
Rührwerken in Zirkulation gehalten.<br />
Durch Einblasen, bzw. Zuführung<br />
von Sauerstoff werden die biologischen<br />
Abbauprozesse in Gang<br />
gesetzt. Anschließend durchläuft<br />
das auf diese Weise gereinigte<br />
<strong>Abwasser</strong> noch ein Nachklärbecken.<br />
Erst danach kann es dem Vorfluter<br />
zugeleitet werden.<br />
Die Verbandsgemeinde Kirchberg,<br />
der Zweckverband Flughafen<br />
Hahn, die Flughafen Frankfurt-<br />
Hahn GmbH und die Umwelt profitieren<br />
vom Neubau der gemeinsam<br />
genutzten Kläranlage. Die nach<br />
dem Stand der Technik geplante<br />
neue Kläranlage hat im Vergleich zu<br />
den Altkläranlagen eine deutlich<br />
bessere Reinigungsleistung und<br />
trägt damit zum weitergehenden<br />
Schutz der Gewässer bei.<br />
Teilprojekt 3: Verbindungskanäle<br />
Kyrbachtal<br />
Die Verbandsgemeinde Kirchberg<br />
hat in drei Baulosen die Realisierung<br />
des Transportes für kommunale<br />
Abwässer, sowie die Verlegung einer<br />
Druckleitung für enteisungshaltiges<br />
<strong>Abwasser</strong>, durchführen lassen.<br />
Im Los 1 wurde der Bau der<br />
Kanaltrasse der stillzulegenden<br />
Kläranlage Dill bis zur neuen Gruppenkläranlage<br />
Kyrbachtal durchgeführt.<br />
Hierbei wurden 2200 m<br />
SIMONA® PE 100 Druckrohre (d 250<br />
x 22,7 mm); 2040 m coextrudierte<br />
PE 80 Kanalrohre mit wanddickenintegrierter<br />
Heizwendel (d 500 x<br />
28,4 mm) und 180 m coextrudierte<br />
PE Kanalrohre mit wanddickenintegrierter<br />
Heizwendel (d 630 x<br />
35,7 mm) verlegt.<br />
In den Losen 2 und 3 wurden die<br />
Kläranlage Kirchberg-West sowie<br />
das Pumpwerk Dillendorf mit insgesamt<br />
4200 m PE 80 CoEx SIMO-<br />
FUSE® (d 400 x 22,7 mm) Rohren an<br />
die neue Kläranlage angeschlossen.<br />
Damit gab es eine zentrale Lösung<br />
zur Reinhaltung der Gewässer mit<br />
deutlich positiver Umweltbilanz<br />
und Ökoeffizienz.<br />
Umfassende Kunststofflösung<br />
mit ausgezeichneter<br />
chemischer Beständigkeit<br />
Da die Anlage neben dem kommunalen<br />
<strong>Abwasser</strong> aus den stillgelegten<br />
Kläranlagen Dill und Kirchberg-<br />
West der Verbandsgemeinde auch<br />
das Schmutzwasser vom Zweckverband<br />
Flughafen Hahn sowie das<br />
enteisungshaltige <strong>Abwasser</strong> aus<br />
dem Flugbetrieb der Flughafen<br />
Frankfurt-Hahn GmbH aufnimmt,<br />
wurde sie bereits mit der ersten<br />
Ausbaustufe von 28 000 Einwohnerwerten<br />
zur größten Kläranlage<br />
im Hunsrück. So<strong>wohl</strong> die Investitions-<br />
als auch die Betriebskosten<br />
Schachtmontage<br />
durch<br />
Rohrverbindung<br />
mit<br />
wanddickenintegrierter<br />
Heizwendel.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 639
PRAXIS<br />
Exkurs Verlegeverfahren<br />
Statisches Pflugverfahren<br />
Das Pflügen ist die schnellste und <strong>wohl</strong> wirtschaftlichste Technik zur Neuverlegung<br />
von Kunststoffrohren. Die Methode greift kaum in das Erdreich ein und ist daher sehr<br />
umweltschonend. Mit Hilfe einer Seilwinde werden ein Verlegepflug und ein Verlegekasten<br />
gezogen. Nachdem die Rohrleitung durch den Verlegekasten in das Erdreich<br />
eingebracht wurde, schließt <strong>sich</strong> hinter dem Pflug der Graben.<br />
Fräsverfahren<br />
Das Fräsverfahren kommt bei standfestem Boden in der offenen Verlegung ohne Sandbett<br />
zum Einsatz. Die gewählten Schutzmantelrohre können den höheren Belastungen<br />
standhalten und bieten hervorragenden Widerstand gegen langsames Risswachstum und<br />
Punktlasten. So wird ein erhöhter Schutz beim Verlegen und im Betrieb unter schwer<br />
kalkulierbaren Belastungen garantiert<br />
Die SIMONA® Kunststoffrohre<br />
mit ihrer ausgezeichneten chemischen<br />
Beständigkeit gegen die enteisungsmittelhaltigen<br />
Abwässer<br />
und das speziell an die Topographie<br />
angepasste Druckleitungssystem<br />
haben <strong>sich</strong> bei der Realisierung des<br />
Großprojektes bewährt. Auch die<br />
stoffschlüssige, dichte Verbindung<br />
mit SIMONA® SIMOFUSE® bot viele<br />
Vorteile bei der Verlegung im<br />
Grundwasser entlang des Kyrbachs.<br />
Mit den eingesetzten Produkten<br />
lieferte SIMONA eine umfassende<br />
Kunststofflösung für die Gruppenkläranlage<br />
Kyrbachtal.<br />
für die neue Anlage werden anlagenspezifisch<br />
genau nach konkreten<br />
Verteilungsschlüsseln bemessen,<br />
sodass alle Beteiligten und<br />
damit auch die Bürger der Verbandsgemeinde<br />
Kirchberg jeweils<br />
nur den durch sie verursachten<br />
Anteil zu zahlen haben. Die Anlage<br />
ist so konzipiert, dass sie bei Bedarf<br />
in einer zweiten Ausbaustufe auf<br />
41 000 Einwohnerwerte erweitert<br />
werden kann.<br />
Kontakt:<br />
SIMONA AG,<br />
Teichweg 16,<br />
D-55606 Kirn,<br />
Tel. (06752) 14-0,<br />
E-Mail: pipingsystems@simona.de,<br />
www.simona.de<br />
Umleitung eines Baches mit NS-Pumpen –<br />
Einzigartige Lösung für <strong>Wasser</strong>haltung<br />
Geht nicht, gibt’s nicht! Mit sechs NS-Pumpen und einer innovativen Leitungsführung löste ITT Water & Wastewater<br />
für das Ingenieur-Büro Gauff Rail Engineering aus Nürnberg eine „unmögliche“ Aufgabe: die <strong>Wasser</strong>haltung<br />
am Schlangenbach in Baiersdorf bei Erlangen.<br />
Ein einzigartiges Konzept am Schlangenbach bei<br />
Erlangen.<br />
Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg,<br />
Kilometer 30,662: Hier, kurz vor<br />
dem Bahnhof Baiersdorf, unterquert<br />
der Schlangenbach die Bahnstrecke,<br />
die in diesem Bereich<br />
dreigleisig ist. Bei den Regenereignissen<br />
im Sommer 2007 wurde die<br />
bestehende Eisenbahnüberführung<br />
sehr stark beschädigt.<br />
Im Bereich von zwei Gleisen<br />
konnte der Eisenbahnbetrieb nur<br />
mit Baubehelfen weiter geführt<br />
werden. Das Ingenieur-Büro Gauff<br />
Rail Engineering wurde durch die<br />
DB PB GmbH Nürnberg im Zusammenhang<br />
mit der Baumaßnahme<br />
der Deutschen Bahn AG, Projekt<br />
VDE8 Nürnberg – Berlin, Ausbauabschnitt<br />
Nürnberg – Ebensfeld,<br />
beauftragt, die Erneuerung der<br />
Eisenbahnüberführung zu planen.<br />
Dabei wurde ITT Water & Wastewater<br />
im April 2010 ins Projekt eingezogen,<br />
eine <strong>Wasser</strong>haltung für das<br />
Projekt mitzugestalten. Eine Aufgabe,<br />
vor der andere Unternehmen<br />
schon im Vorfeld kapitulierten.<br />
Große Fördermenge,<br />
kleiner Leitungsquerschnitt<br />
Die eigentliche Herausforderung<br />
bestand dabei nicht in der Fördermenge<br />
(es galt, 2000 L/s von der<br />
einen auf die andere Seite des Bahndammes<br />
zu pumpen), sondern an<br />
einer anderen Stelle – das Volumen<br />
sollte durch einen möglichst kleinen<br />
Rohrleitungsquerschnitt gefördert<br />
werden. Grund: Der einzig<br />
mögliche Weg führte durch das<br />
Gleisbett. Die Leitungen konnten<br />
also ausschließlich unter den Schie-<br />
Juni 2011<br />
640 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRAXIS<br />
nen zwischen den Gleisschwellen<br />
verlegt werden. ITT Water & Wastewater<br />
fand auch für dieses Problem<br />
eine Lösung. Das Volumen wurde<br />
auf insgesamt 12 Stränge aus<br />
Gummi-Spiralschläuchen DN200<br />
verteilt, die direkt unter den Schienen<br />
aber außerhalb des Druckbereiches<br />
der Gleisschwellen verlegt<br />
wurden – und zwar ohne dass der<br />
Schwellenabstand somit auch die<br />
Geschwindigkeit auf den Gleisen<br />
verändert und zusätzlich ohne dass<br />
der Bahnverkehr unterbrochen werden<br />
musste.<br />
Die von ITT mit der Ausführung<br />
beauftragte Baufirma verlegte die<br />
Rohrstränge in einem sehr engen<br />
Zeitfenster und in zwei Nachtsperrpausen.<br />
Doppelt ge<strong>sich</strong>erte<br />
Kuppelstellen<br />
Pumpenseitig setzte das Unternehmen<br />
auf drei NS3301MT, die<br />
die notwendige Fördermenge<br />
ohne Probleme bewältigen können.<br />
Zur Ab<strong>sich</strong>erung wurden drei<br />
weitere Aggregate der gleichen<br />
Baugröße als Standby-Pumpen<br />
vorgesehen. Je Pumpe war folglich<br />
minimal ein <strong>Wasser</strong>volumen von<br />
340 L/s zu erwarten, das durch<br />
zwei Stränge geleitet werden<br />
musste. Damit ergab <strong>sich</strong> jedoch<br />
ein weiteres Problem. Auf Basis der<br />
Ausgangsdaten war mit einer relativ<br />
hohen Durchflussgeschwindigkeit<br />
von etwa 5,5 bis 7,5 m/s zu<br />
rechnen. Zwar konnten die NS-<br />
Pumpen die <strong>Wasser</strong>menge spielend<br />
bewältigen. Die Belastbarkeit<br />
der Kuppelstellen der Gummi-Spiralschläuche<br />
war jedoch nicht kalkulierbar<br />
– genauso wenig wie die<br />
der Verbindung Tülle-Schlauch.<br />
Um jedes Risiko auszuschließen,<br />
setzte ITT Water & Wastewater<br />
erfolgreich auf zusätzliche Sicherungsmaßnahmen<br />
an den Vaterund<br />
Mutterteilen der Gummi-Spiralschläuche.<br />
Jede Tülle wurde mit<br />
zwei Sicherungsschrauben ge<strong>sich</strong>ert,<br />
so dass <strong>sich</strong> die Verbindungen<br />
unmöglich lösen konnten.<br />
Schließlich hätte ein Bruch der<br />
Kuppelstellen zu einer Unterspülung<br />
der Gleise und damit zu unabsehbaren<br />
Folgekosten vor allem<br />
aus einer evtl. Unterbrechung des<br />
Eisenbahnverkehrs führen können.<br />
NS-Pumpen arbeiten<br />
zuverlässig im Dauerbetrieb<br />
Am 22. Oktober 2010 war es dann<br />
soweit: Die ITT-Monteure vom Service-Center<br />
Oberschleißheim nahmen<br />
die Anlage in Betrieb. Seither<br />
laufen die NS3301MT im Dauerbetrieb<br />
– und die <strong>Wasser</strong>haltung in<br />
hohem Maße zuverlässig sowie zur<br />
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten.<br />
Auf Grund des Baufortschritts<br />
konnte die Anlage schon nach vier<br />
<strong>Wo</strong>chen auf die Hälfte der Anlagenkapazität<br />
zurückgebaut werden,<br />
die ausreicht, um das erforderliche<br />
Volumen zur Umleitung bis zum<br />
Ende der Baumaßnahmen aufrechtzuerhalten.<br />
Auch im aufgetauchten Zustand voll betriebsbereit:<br />
ITT NS-Pumpen.<br />
Kontakt:<br />
ITT Water & Wastewater Deutschland GmbH,<br />
Bayerstraße 11, D-30855 Langenhagen,<br />
Tel. (0511) 78 00-0, Fax (0511) 78 28 93,<br />
E-Mail : Info.de@itt.com,<br />
www.ittwww.de<br />
Die Umleitung des Schlangenbaches konnte nur<br />
unter den Gleisen und zwischen den Schwellen<br />
erfolgen – für die ITT-Planer kein Problem.<br />
12 Stränge<br />
waren erforderlich,<br />
um das<br />
<strong>Wasser</strong>volumen<br />
des<br />
Schlangenbaches<br />
trotz<br />
des geringen<br />
Leitungsquerschnitts<br />
zu<br />
bewältigen.<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 641
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Nachweis von Bakterien in Trink- und Brauchwasser<br />
mittels der ScanVIT-Technologie<br />
Bild 1. Das<br />
VIT-Prinzip.<br />
Die Wirkungsweise<br />
der Gensonden<br />
in der<br />
Probe. Grafik:<br />
vermicon AG<br />
Es gibt kaum Produkte, deren<br />
Güte nicht von der Qualität des<br />
während der Produktionsprozesse<br />
verwendeten <strong>Wasser</strong>s abhängt.<br />
Auch die Sekundärverwendung in<br />
Klimaanlagen, Kühltürmen oder<br />
industriellen <strong>Wasser</strong>kreisläufen hat<br />
maßgeblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit<br />
und Produktionsstabilität<br />
eines Unternehmens. Mittels<br />
kultivierungsunabhängiger Ansätze<br />
wie dem VIT-Profiling, bei dem<br />
Änderungen der mikrobiellen<br />
Populationen direkt in der Probe<br />
verfolgt werden, können bakterienbedingte<br />
Störungen der Produktion<br />
rasch aufgespürt und beseitigt werden.<br />
Bakterien können aber neben<br />
ihrem industrietechnischen Einfluss<br />
auch eine ernsthafte Bedrohung für<br />
die Gesundheit darstellen. Daher<br />
liegt eine zuverlässige und schnelle<br />
Analyse immer im Interesse des<br />
Unternehmens, welches den in der<br />
Trinkwasserverordnung verankerten<br />
gesetzlichen, aber auch ethischen<br />
und wirtschaftlichen Ansprüchen<br />
genügen muss.<br />
Eine häufige und oft unbemerkte<br />
Gefahr stellen Legionellen<br />
dar. Die Vertreter der Art Legionella<br />
pneumophila können zur Legionellose<br />
führen. Diese schwer verlaufende<br />
Form der Lungenentzündung<br />
verzeichnet eine Sterberate von ca.<br />
15%. Nur wenige wissen, dass auch<br />
einige weitere Vertreter der Gattung<br />
Legionella die Legionellose hervorrufen<br />
können. Die Zahl der jährlich<br />
in Deutschland Erkrankten wird auf<br />
über 10 000 pro Jahr geschätzt. Die<br />
Verbreitung der Legionellen über<br />
Kühltürme oder Klimaanlagen in<br />
Unternehmen kann zu regelrechten<br />
Infektionswellen in der Umgebung<br />
führen. Der Nachweis der Mikroorganismen<br />
muss daher so schnell<br />
wie möglich erfolgen. Mit ScanVIT-<br />
Legionella ist ein Nachweissystem<br />
auf dem Markt, das die weltweit<br />
schnellste Identifizierung und absolute<br />
Quantifizierung von Legionellen<br />
und parallel dazu L. pneumophila<br />
ermöglicht. Hier werden im<br />
Gegensatz zu anderen konventionellen<br />
und modernen Nachweismethoden<br />
alle lebenden Bakterien<br />
in einer Probe analysiert. Innerhalb<br />
kürzester Zeit liegt das Ergebnis vor,<br />
ob und exakt wie viele Legionellen<br />
und darunter L. pneumophila in der<br />
Probe vorliegen. Die dem Test<br />
zugrunde liegende Technologie ist<br />
die VIT-Gensondentechnologie<br />
(Bild 1). Eine aktuelle internationale<br />
Studie renommierter Institute be -<br />
weist, dass ScanVIT-Legionella eine<br />
überzeugende Alternative zur kultivierungsabhängigen<br />
Standardmethode<br />
(ISO 11731) darstellt.<br />
Die Erfahrungen mit ihrer entwickelten<br />
ScanVIT-Technologie im<br />
Bereich der Legionellen, hat die vermicon<br />
AG aus München auch auf<br />
den Nachweis von coliformen Bakterien<br />
und speziell E. coli übertragen.<br />
Der Test basiert auf dem selben<br />
Prinzip und macht damit in kürzester<br />
Zeit die hochspezifische Identifizierung<br />
und gleichzeitige absolute<br />
Quantifizierung der Mikroorganismen<br />
aus einer <strong>Wasser</strong>probe möglich.<br />
Entwickelt wurde der neue<br />
Nachweis im Rahmen des EU-Forschungsprojektes<br />
TECHNEAU in<br />
enger Zusammenarbeit mit dem<br />
TZW (Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>,<br />
Karlsruhe). Ziel war es, ein schnelles<br />
und zugleich sensibles Monitoringsystem<br />
für den Nachweis von Indikatororganismen<br />
und Pathogenen<br />
in <strong>Wasser</strong> zu schaffen, da Standardtechniken<br />
wie MPN oder Kultivierung<br />
entweder zu aufwändig oder<br />
zu langwierig für ein modernes<br />
<strong>Wasser</strong><strong>sich</strong>erheitsmanagement sind.<br />
Die Herausforderung hierbei war,<br />
Schnelligkeit, Spezifität und Zuverlässigkeit<br />
miteinander zu kombinieren.<br />
Eine bisher einmalige Kombination<br />
für einen mikrobiologischen<br />
Schnelltest für den Nachweis von<br />
E.Coli/Coliforme-Keimen. Im Rahmen<br />
des Projektes fand auch die<br />
erfolgreiche Validierung des Nachweises<br />
statt. Im Anschluss an das<br />
Projekt wurde der Nachweis zu<br />
Juni 2011<br />
642 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
einem kommerziellen und standardisierten<br />
System weiterentwickelt.<br />
Die im Kit enthaltene ScanVIT-Technologie<br />
basiert wiederum auf der<br />
VIT-Gensondentechnologie. Das<br />
Nachweissystem konnte soweit<br />
optimiert werden, dass der hochspezifische<br />
Nachweis und die exakte<br />
Quantifizierung der coliformen Keime<br />
und parallel dazu von E. coli mit<br />
dem Nachweissystem ScanVIT-E.<br />
coli/Coliforme innerhalb von nur<br />
12 Stunden möglich ist. Damit ist<br />
ScanVIT-E.coli das weltweit schnellste<br />
System, welches die Identifizierung<br />
und absolute Quantifizierung<br />
der coliformen Keime ermöglicht.<br />
Quantifizierung bedeutet hier, dass<br />
im Gegensatz zu allen anderen auf<br />
dem Markt befindlichen Tests, jedes<br />
einzelne Bakterium in der vorhandenen<br />
Probe bewertet wird. Damit<br />
ist die Grundlage für ein sinnvoll<br />
Bild 2. Schnelle Entscheidungs<strong>sich</strong>erheit. ScanVIT-Zeitschema. Grafik: vermicon AG<br />
funktionierendes Monitoring der<br />
<strong>Wasser</strong>qualität in den verschiedensten<br />
Bereichen geschaffen. Zum Beispiel<br />
können im Bereich Kanalsanierung<br />
und -neubau nun innerhalb<br />
kürzester Zeit bereits während der<br />
Arbeiten Risikoeinschätzungen vorgenommen<br />
werden, die schnelle<br />
und <strong>sich</strong>ere Freigabeentscheidungen<br />
erlauben. Auch kann bei einer<br />
auftretenden Kontamination erheblich<br />
schneller reagiert werden und<br />
die Sicherstellung der <strong>Wasser</strong>qualität<br />
innerhalb kürzester Zeit erfolgen.<br />
Dabei orientiert <strong>sich</strong> die Analyse<br />
des ScanVIT-Systems streng an<br />
den gesetzlichen Vorgaben und<br />
basiert auf der Filtration einer vorgegebenen<br />
Probenmenge (Bild 2).<br />
Kontakt:<br />
vermicon AG,<br />
Barbara Roderus,<br />
Emmy-Noether-Straße 2,<br />
D-80992 München,<br />
Tel. (089) 15 88 20,<br />
Fax (089) 15 88 21 00,<br />
E-Mail: info@vermicon.com,<br />
www.vermicon.com<br />
Ultraschall-<strong>Wasser</strong>zähler MULTICAL® 21 misst<br />
nicht nur <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
Unter dem Motto „Alles zählt!“<br />
lanciert Kamstrup den elektronischen<br />
<strong>Wasser</strong>zähler MULTICAL ® 21,<br />
der eine Vielzahl der Aufgabenstellungen<br />
eines Versorgers in seinen<br />
Funktionalitäten abdeckt, besonders<br />
für die Trinkwasserversorgung.<br />
Das Gerät misst per Ultraschall und<br />
gewährleistet damit eine ge naue<br />
Registrierung der kleinsten <strong>Wasser</strong>mengen.<br />
Er <strong>sich</strong>ert eine zu verlässige<br />
Abrechnung und überwacht die<br />
Kundenanlage auf <strong>Wasser</strong>verluste<br />
und hilft, <strong>Wasser</strong>ressourcen und<br />
Geld zu sparen. Die Betriebszeit der<br />
Batterie beträgt 16 Jahre.<br />
Der MULTICAL 21 ist als ein wasserdichtes<br />
und vakuumversiegeltes<br />
Gehäuse konstruiert, das die Elektronik<br />
komplett gegen Feuchtigkeit<br />
schützt. Er kann sogar in feuchten<br />
und häufig überschwemmten Räumen<br />
installiert und drahtlos ausgelesen<br />
werden. Der kompakte <strong>Wasser</strong>zähler<br />
lässt <strong>sich</strong> auch installieren,<br />
ohne Rück<strong>sich</strong>t auf das Rohrleitungssystem<br />
nehmen zu müssen.<br />
Durch einfache Fernauslesung<br />
mit einer drahtlosen Empfängereinheit<br />
ist die Verwaltung und Abrechnung<br />
der Daten unkompliziert. Die<br />
Fernauslesung beseitigt Probleme<br />
bei der Selbstablesung wie z.B. fehlerhaft<br />
ausgefüllte Ablesekarten.<br />
Die Auslesung erfolgt drahtlos mit<br />
einem kleinen Handgerät über<br />
Wireless M-Bus.<br />
Das Messsystem wird mit einem<br />
Carbon Footprint-Zertifikat geliefert,<br />
das die geringe Umweltbelastung<br />
des Zählers und die Wiederverwendbarkeit<br />
der Materialien<br />
dokumentiert. Das verwendete<br />
Kunststoffmaterial ist frei von Blei<br />
und anderen Schwermetallen und<br />
reduziert das Gewicht gegenüber<br />
Metallausführungen um mehr als<br />
50 %.<br />
Kontakt:<br />
Kamstrup A/S,<br />
Gerald Landrock,<br />
Werderstraße 23-25,<br />
D-68165 Mannheim,<br />
Tel. (0621) 321 689 60,<br />
Fax (0621) 321 689 61,<br />
E-Mail: gla@kamstrup.de,<br />
www.kamstrup.de<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 643
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Aerzen erweitert neue Drehkolbenverdichter-<br />
Baureihe<br />
D<br />
ie neuen Drehkolbenverdichter<br />
Delta Hybrid der Aerzener<br />
Maschinenfabrik GmbH wurde jetzt<br />
um eine weitere Baugröße erweitert.<br />
Der Kunde kann somit aus<br />
einer umfangreichen Baureihe das<br />
für seinen Anwendungsfall optimale<br />
Aggregat auswählen. Mit insgesamt<br />
13 Baugrößen decken die<br />
Delta Hybrid nun Ansaugvolumenströme<br />
von 110 m³/h bis 5.800 m³/h<br />
und Überdrücke bis 1.500 mbar<br />
sowie Antriebsleistungen bis 250<br />
kW ab.<br />
Die Kompetenz aus den beiden<br />
Welten der Drehkolbengebläse und<br />
Schraubenverdichter war die Basis<br />
für die Entwicklung der neuen Delta<br />
Hybrid – der weltweit ersten Baureihe<br />
von Drehkolbenverdichtern.<br />
Delta Hybrid ist eine Synergie<br />
aus Gebläse- und Verdichtertechnik<br />
und bietet durch die Verschmelzung<br />
der Vorteile beider Systeme<br />
völlig neue Möglichkeiten in der<br />
Unter- und Überdruck-Erzeugung<br />
von Luft und neutralen Gasen.<br />
Insgesamt sieben Patente bzw.<br />
Patentanmeldungen machen den<br />
Delta Hybrid zu einem der derzeitig<br />
innovativsten Produkte in der Kompressortechnologie.<br />
Dabei ist in<br />
niedrigen Druckbereichen das<br />
Roots-Prinzip der Volldruckverdichtung,<br />
in höheren Druckbereichen<br />
das Schraubenverdichter-Prinzip<br />
mit innerer Verdichtung energetisch<br />
die erste Wahl. Das Aggregatskonzept<br />
basiert auf den Delta-Baureihen<br />
(Delta Blower und Delta<br />
Screw) aus dem Hause Aerzen und<br />
ist systematisch weiterentwickelt<br />
worden.<br />
Bei einem 10jährigen Betrieb<br />
entfallen rund 90% der gesamten<br />
Lebenszykluskosten eines Kompressors<br />
auf den Energiebedarf. Vor<br />
diesem Hintergrund lag der besondere<br />
Augenmerk bei der Entwicklung<br />
der neuen Drehkolbenverdichter-Baureihe<br />
auf einer Steigerung<br />
der Energieeffizienz mit der Zielsetzung<br />
einer deutlichen Reduzierung<br />
der Energiekosten und des CO 2 -<br />
Ausstoßes.<br />
Die Vereinigung der beiden<br />
Technologien Drehkolbengebläse<br />
und Schraubenverdichter führte zu<br />
einer verbesserten Energieeffizienz<br />
um bis zu 15%. Dabei besteht die<br />
neue Drehkolbenverdichter-Stufe<br />
bis zu einer Druckdifferenz von 800<br />
mbar aus einen verwundenen 3+3<br />
Gebläseprofil mit patentierter Stoßaufladung,<br />
bei Drücken bis 1500<br />
mbar aus einem speziellen 3+4 Verdichterprofil<br />
für Niederdruckanwendungen.<br />
Somit steht je nach<br />
Einsatzfall und Druckbereich der<br />
energetisch beste Verdichtertyp zur<br />
Auswahl. Optimierte Ein- und Auslassöffnungen<br />
sorgen für einen idealen<br />
Luftstrom in der Verdichterstufe<br />
und reduzieren somit die<br />
Rückstromverluste. Die Eintrittsluft<br />
wird auf der kalten Seite des Aggregates<br />
angesaugt und eine zusätzliche<br />
Druckschalldämpfer-Isolation<br />
erhöht den Verdichtungswirkungsgrad.<br />
Zusätzlich birgt die riemengetriebene<br />
Ausführung des Delta Hybrid<br />
den Vorteil der punktgenauen<br />
Auslegung. Denn die größte Ersparnis<br />
bringt die Energie, die gar nicht<br />
erst aufgewendet werden muss. So<br />
bedeutet z. B. eine Abweichung im<br />
Volumenstrom um 5% einen erhöhten<br />
Energieaufwand um 5%. Die<br />
Baureihe ist somit energetisch vergleichbar<br />
mit Turboverdichtern, bietet<br />
aber durch ihr maßgeschneidertes<br />
Konstruktionsprinzip gegenüber<br />
der Turbo-Technik die Vorteile einer<br />
Drehkolbenmaschine.<br />
In Forschungsarbeiten hat die<br />
Aerzener Maschinenfabrik neue<br />
Antriebs- und Förderraumabdichtungen<br />
entwickelt, die den natürlichen<br />
Verschleiß minimieren. Zusätzlich<br />
wurde eine neue Lagerung<br />
patentiert, die eine Lebensdauer<br />
von mehr als 60.000 Betriebsstunden<br />
Lh 10 (bei einer Druckdifferenz<br />
von 1000 mbar) gewährleistet.<br />
Wie auch bei den schon bekannten<br />
Delta Blower-Baureihen wird<br />
beim Druckschalldämpfer des Delta<br />
Hybrid der Schall rein durch Luftumlenkungen<br />
reduziert. Auf Absorptionsmaterial,<br />
das grundsätzlich<br />
einem Verschleiß unterliegt, wurde<br />
bewusst verzichtet. Damit ist<br />
gewährleistet, dass das nachgeschaltete<br />
System nicht verunreinigt<br />
werden kann. In z. B. der <strong>Abwasser</strong>technik<br />
wird so das Zusetzen von<br />
Belüftungssystemen vermieden<br />
und kostenintensiver Wartungsaufwand<br />
minimiert oder gar Produktionseinschränkungen<br />
ausgeschlossen.<br />
Zu der neuen Baureihe Delta<br />
Hybrid gehört auch der wahlweise<br />
Einsatz eines mechanisch oder elektrisch<br />
angetriebenen Lüfters, die<br />
standardmäßige Verwendung eines<br />
energieeffizienten EFF1/IE2-Motors<br />
und eine Verdoppelung der empfohlenen<br />
Ölwechselintervalle auf<br />
Juni 2011<br />
644 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
bis zu 16.000 Betriebsstunden Lh 10<br />
bei Verwendung des neuen Aerzener<br />
Spezialöls Delta Lube.<br />
Optional können die Drehkolbenverdichter<br />
auch mit der neuen<br />
Steuerung AERtronic ausgerüstet<br />
werden, die durch ihren modularen<br />
Aufbau eine maßgeschneiderte<br />
Lösung für jeden Anwendungsfall<br />
bietet. Darüber hinaus wird für die<br />
Delta Hybrid-Baureihe auch eine<br />
sogenannte „All-in-One“-Lösung<br />
mit integriertem Frequenzumrichter<br />
und Leistungsteil angeboten.<br />
Diese Anlagen sind nach Anschluss<br />
von Stromversorgung und Förderluft-Leitung<br />
sofort betriebsbereit.<br />
Die neuen Delta Hybrid-Aggregate<br />
wurden für alle Einsatzfälle<br />
geschaffen, bei denen Luft und neutrale<br />
Gase ölfrei gefördert werden<br />
müssen, wie z.B. in Kläranlagen, in<br />
der chemischen Industrie, der Kraftwerkstechnik<br />
oder zum Transport<br />
und zum Entladen staubförmiger<br />
Güter. Die Baureihe wurde seit drei<br />
Jahren in einem groß angelegten<br />
Feldversuch in verschiedensten<br />
Branchen bei Aerzener Kunden mit<br />
Neubedarf unter härtesten Praxisbedingungen<br />
getestet und zur<br />
Marktreife entwickelt.<br />
Kontakt:<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH,<br />
Stephan Brand,<br />
Reherweg 28,<br />
D-31855 Aerzen,<br />
Tel. (05154) 81-562,<br />
Fax (05154) 81-660,<br />
E-Mail: stephan.brand@aerzener.de,<br />
www.aerzen.com<br />
UV-Desinfektionssystem ermöglicht Forschungszentrum<br />
Erfüllung strenger <strong>Abwasser</strong>vorschriften<br />
UV-Desinfektionsexperte Berson<br />
hat es dem Entwicklungszentrum<br />
für Energiesysteme (Power Systems<br />
Development Facility, PSDF) in<br />
Wilsonville im US-amerikanischen<br />
Bundesstaat Alabama ermöglicht,<br />
die strengen behördlichen <strong>Abwasser</strong>auflagen<br />
zu erfüllen: Seit inzwischen<br />
vier Jahren werden Verunreinigungen<br />
mit minimalem Wartungsaufwand<br />
im zulässigen Be -<br />
reich gehalten.<br />
Das Forschungs- und Entwicklungszentrum<br />
PSDF in Wilsonville<br />
testet kohlebasierte Technologien,<br />
bevor sie in Energieversorgungseinrichtungen<br />
zum Einsatz kommen.<br />
2006 waren in der expandierenden<br />
Anlage 200 Personen beschäftigt.<br />
Die erzeugte <strong>Abwasser</strong>menge<br />
betrug etwa 95 Liter pro Minute. Da<br />
davon auszugehen war, dass <strong>sich</strong><br />
die Größe der Einrichtung in naher<br />
Zukunft verdoppeln würde, sahen<br />
<strong>sich</strong> die Betreiber aufgrund staatlicher<br />
und kommunaler Vorschriften<br />
ge zwungen, das erzeugte <strong>Abwasser</strong><br />
zu desinfizieren. Die örtliche Kläranlage<br />
war jedoch zu weit entfernt.<br />
Aus diesem Grund entschied das<br />
PSDF, ein eigenes <strong>Abwasser</strong>aufbereitungssystem<br />
zu installieren.<br />
Nach der Untersuchung verschiedener<br />
Produkte kam die Einrichtung<br />
zu dem Schluss, dass das<br />
UV-Desinfektionssystem OpenLine<br />
von Berson ihren technischen und<br />
finanziellen Anforderungen am besten<br />
entsprach. Bei diesem System<br />
handelt es <strong>sich</strong> um ein Desinfektionsgerät<br />
für offene Gerinne, das die<br />
Fortpflanzungsfähigkeit von Mikroorganismen<br />
mithilfe leistungsstarker<br />
UV-Niederdrucklampen auf Zellebene<br />
zerstört. Das System wurde<br />
2007 installiert und sorgt als letztes<br />
Glied in der Verfahrenskette für eine<br />
abschließende Behandlung des<br />
<strong>Abwasser</strong>s, bevor es in einen nahegelegenen<br />
Fluss eingeleitet wird.<br />
Die staatliche Genehmigung<br />
setzt voraus, dass keine <strong>Abwasser</strong>probe<br />
mehr als 200 Kolonien an<br />
Fäkalindikatoren pro 100 ml aufweist<br />
– eine Auflage, die mit dem<br />
OpenLine-System problemlos eingehalten<br />
werden konnte. Weitere<br />
Vorteile sind die kompakte Standfläche<br />
und der weitgehend wartungsfreie<br />
Betrieb: In den insgesamt<br />
21 000 Betriebsstunden seit seiner<br />
Installation hat OpenLine ohne Austausch<br />
der UV-Lampe sämtliche<br />
Desinfektionsanforderungen erfüllt.<br />
Neues OpenLine UV-Desinfektionssystem zur<br />
<strong>Abwasser</strong>aufbereitung für offene Gerinne von<br />
Berson, wie es auch im Entwicklungszentrum PSDF<br />
in Wilsonville im US-amerikanischen Alabama<br />
installiert wurde.<br />
Kontakt:<br />
Berson UV-techniek,<br />
Peter Menne, International Area Sales Manager,<br />
Postfach 90, NL-5670 AB Nuenen,<br />
Niederlande,<br />
Tel. +31 40 290 7777,<br />
Fax +31 40 283 5755,<br />
E-Mail: peter.menne@bersonuv.com/<br />
sales@bersonuv.com<br />
www.bersonuv.com<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 645
Taschenbuch für<br />
Ausbildung und Beruf<br />
WISSEN für die ZUKUNFT<br />
Begriffe, Verfahren<br />
und Konzepte in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Taschenbuch für Ausbildung und Beruf<br />
In diesem über<strong>sich</strong>tlichen Nachschlagewerk werden in<br />
alphabetischer Reihenfolge Begriffe, Verfahren und Konzepte<br />
in der <strong>Wasser</strong>versorgung genau definiert und erklärt.<br />
Von „A“ wie „Aachener Konzept“ bis „Z“ wie Zusatzstoffe lassen<br />
<strong>sich</strong> alle wichtigen Definitionen nachschlagen, mit denen Fachleute des<br />
<strong>Wasser</strong>fachs tagtäglich umgehen müssen. Die Bandbreite des Kompendiums<br />
reicht von der Trinkwassergewinnung über dessen Aufbereitung<br />
und Desinfektion, dem Transport von Trinkwasser und der Installation<br />
von Leitungen bis hin zu Entwässerungsthemen. Zudem sind alle<br />
wesentlichen DIN-, EN- und ISO-Normen sowie DVGW-Arbeitsblätter<br />
aufgeführt, deren Kenntnis in der Berufspraxis unabdingbar ist. Das<br />
handliche Format des Wörterbuchs eignet <strong>sich</strong> gut für den täglichen<br />
Gebrauch in Ausbildung und Beruf, denn – kleiner als A5 – passt es<br />
praktisch in jede Jackentasche. Die Autoren, langjährige Experten aus<br />
der <strong>Wasser</strong>branche, legen bei diesem Buch besonderen Wert auf eine<br />
gleichermaßen exakte und verständliche Sprache, um den Begrifflichkeiten<br />
Eindeutigkeit und Klarheit zu verleihen.<br />
Michael Gaßner und Rainer Kryschi<br />
1. Auflage 2010, ca. 340 Seiten, Jackentaschenformat<br />
Erscheinungstermin: 2010<br />
Nachschlagewerk mit über<br />
1.500 Definitionen wichtiger<br />
Begriffe, Verfahren und Konzepte<br />
für alle Fachleute des <strong>Wasser</strong>fachs<br />
Oldenbourg Industrieverlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 201 / 820 02 - 34 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 <strong>Wo</strong>chen zur An<strong>sich</strong>t<br />
___ Ex. Begriffe, Verfahren und Konzepte in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
1. Aufl age 2010 für € 29,00 zzgl. Versand<br />
ISBN: 978-3-8356-3180-9<br />
Die bequeme und <strong>sich</strong>ere Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer<br />
Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Garantie: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen bei der Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen<br />
schriftlich widerrufen werden. Die rechtzeitige Absendung der Mitteilung genügt. Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden<br />
Kommunikation werden Ihre persönlichen Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass<br />
ich per Post, Telefon, Telefax oder E-Mail über interessante Verlagsangebote informiert werde. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
BVKWZs0610
Impressum<br />
INFORMATION<br />
Das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Die technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>versorgung, Gewässerschutz,<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung und <strong>Abwasser</strong>technik.<br />
Organschaften:<br />
Zeitschrift des DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
des Bundesverbandes der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e. V. (BDEW),<br />
der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.<br />
(figawa),<br />
der DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
(ÖVGW),<br />
des Fachverbandes der Gas- und Wärme versorgungsunternehmen,<br />
Österreich,<br />
der Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein (AWBR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke e. V. (ARW),<br />
der Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr (AWWR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)<br />
Herausgeber:<br />
Dr.-Ing. Rolf Albus, Gaswärme Institiut e.V., Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Ruhrverband, Essen<br />
Dr.-Ing. Jörg Burkhardt, Gasversorgung Süddeutschland GmbH,<br />
Stuttgart<br />
Dipl.-Ing. Heiko Fastje, EWE Netz GmbH, Oldenburg<br />
Prof. Dr. Fritz Frimmel, Engler-Bunte-Institut, Universität (TH) Karlsruhe<br />
Prof. Dr. -Ing. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart (federführend <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>)<br />
Prof. Dr. Winfried Hoch, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Klaus Homann (federführend Gas|Erdgas),<br />
Thyssengas GmbH, Dortmund<br />
Dipl.-Ing. Jost Körte, RMG Messtechnik GmbH, Butzbach<br />
Prof. Dr. Matthias Krause, Stadtwerke Halle, Halle<br />
Dipl.-Ing. Klaus Küsel, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau<br />
GmbH, Erkrath<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
Stuttgart<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert, EBI, Karlsruhe<br />
Dr. Karl Roth, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Hans Sailer, Wiener <strong>Wasser</strong>werke, Wien<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR<br />
BauAss. Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Aggerverband, Gummersbach<br />
Dr.-Ing. Walter Thielen, DVGW e. V., Bonn<br />
Dr. Anke Tuschek, BDEW e. V., Berlin<br />
Martin Weyand, BDEW e. V., Berlin<br />
Redaktion:<br />
Hauptschriftleitung (verantwortlich):<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München,<br />
Tel. (0 89) 4 50 51-3 18, Fax (0 89) 4 50 51-3 23,<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
Redaktionsbüro im Verlag:<br />
Sieglinde Balzereit, Tel. (0 89) 4 50 51-2 22,<br />
Fax (0 89) 4 50 51-3 23, e-mail: balzereit@oiv.de<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Jan-Ulrich Arnold, Technische Unternehmens -<br />
beratungs GmbH, Bergisch Gladbach<br />
Prof Dr. med. Konrad Botzenhart, Hygiene Institut der Uni Tübingen,<br />
Tübingen<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank <strong>Wo</strong>lfgang Günthert, Universität der Bundeswehr<br />
München, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Abfalltechnik, Neubiberg<br />
Dr. rer. nat. Klaus Hagen, Krüger WABAG GmbH, Bayreuth<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW GmbH, Mülheim/Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, TU Berlin, Berlin<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Reinhold Krumnack, DVGW, Bonn<br />
Prof. Dr.-Ing. <strong>Wo</strong>lfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. Karl Morschhäuser, FIGAWA, Köln<br />
Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Bieske und Partner GmbH, Lohmar<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Universität Hannover<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doering, Hannover<br />
Prof. Dr.-Ing. <strong>Wo</strong>lfgang Uhl, Techn. Universität Dresden, Dresden<br />
Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann, DVGW-Forschungsstelle TUHH,<br />
Hamburg<br />
Verlag:<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145,<br />
D-81671 München, Tel. (089) 450 51-0, Fax (089) 450 51-207,<br />
Internet: http://www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Carsten Augsburger, Jürgen Franke, Hans-Joachim Jauch<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Essen,<br />
Tel. (0201) 82002-35 e-mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Mediaberatung:<br />
Inge Matos Feliz, im Verlag,<br />
Tel. (089) 45051-228, Fax (089) 45051-207,<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Anzeigenverwaltung:<br />
Brigitte Krawzcyk, im Verlag,<br />
Tel. (089) 450 51-226, Fax (089) 450 51-300,<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 61.<br />
Bezugsbedingungen:<br />
„<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>“ erscheint monatlich<br />
(Doppelausgabe Juli/August). Mit regelmäßiger Verlegerbeilage<br />
„R+S – Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach“ (jeden 2. Monat).<br />
Jahres-Inhaltsverzeichnis im Dezemberheft.<br />
Jahresabonnementpreis:<br />
Inland: € 360,– (€ 330,– + € 30,– Versandspesen)<br />
Ausland: € 365,– (€ 330,– + € 35,– Versandspesen)<br />
Einzelheft: € 37,– + Versandspesen<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Studentenpreis: 50 % Ermäßigung gegen Nachweis.<br />
Bestellungen über jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag.<br />
Abonnements-Kündigung 8 <strong>Wo</strong>chen zum Ende des Kalenderjahres.<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen:<br />
Leserservice <strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Postfach 91 61<br />
D-97091 Würzburg<br />
Tel. +49 (0) 931 / 4170-1615, Fax +49 (0) 931 / 4170-492<br />
e-mail: leserservice@oldenbourg.de<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen<br />
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages<br />
strafbar. Mit Namen gezeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt<br />
der Meinung der Redaktion.<br />
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH<br />
Ostring 13, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
© 1858 Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München<br />
Printed in Germany<br />
Juni 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 647
INFORMATION Termine<br />
Auf den Punkt gebracht – Kanalsanierung, Grundstücksentwässerung, Personal, Finanzen, Klimawandel<br />
21.6.2011, Dresden<br />
Technische Akademie Hannover e.V., Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover, www.ta-hannover.de<br />
Instrumente für eine zukunftsfähige <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
22.6.2011, Kassel<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
AWBR-Mitgliederversammlung<br />
1.7.2011, Karlsruhe<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein AWBR, Karola Hofstetter, Tullastraße 61, 79108 Freiburg,<br />
Tel. (0761) 279-27 04, Fax (0761) 279-27 31, E-Mail: awbr@badenova.de, www.awbr.org<br />
Kompaktkurs Vertragsrecht für Techniker und Ingenieure<br />
5.-6.7.2011, München<br />
Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, 82319 Starnberg, E-Mail: yvonne.doebler<br />
@management-forum.de, Tel. (08151) 2719-0, www.management-forum.de/vertragsrecht-technik<br />
39. <strong>Abwasser</strong>technisches Seminar (ATS) – Gewässerschutz und Nährstoffe – Einträge, Bewertung,<br />
Elimination<br />
14.7.2011, Garching bei München<br />
Gesellschaft zur Förderung des Lehrstuhls für <strong>Wasser</strong>güte- und Abfallwirtschaft der TU München e.V., Am Coulombwall,<br />
85748 Garching, Dr.-Ing. Stephanie Rapp-Fiegle, Tel. (089) 289-22377, Fax (089) 22366, E-Mail: s.rapp@bv.tum.de; Dipl.-<br />
Ing. Marcel Hagen, Tel. (089) 6004-2161, Fax (089) 6004-3858, E-Mail: marcel.hagen@unibw.de, www.wga.bv.tum.de<br />
23. Hamburger Kolloquium zur <strong>Abwasser</strong>wirtschaft<br />
31.8.–1.9.2011, Hamburg-Harburg<br />
GFEU e.V., Eißendorfer Straße 42, 21073 Hamburg, Frau Petersen, Tel. (040) 42878-3207, Fax (040) 42878-2684,<br />
E-Mail: e.petersen@tuhh.de, g.becker@tuhh.de, http://www.tu-harburg.de/t3resources/aww/Veranstaltungen/<br />
Programm_<strong>Abwasser</strong>kolloquium_2011.pdf<br />
Druckprüfung von <strong>Wasser</strong>rohrleitungen<br />
21.09.2011, Gera<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH, figawa Service GmbH, Marienburger Straße 15,<br />
50968 Köln, Tel. (0221) 37658-20, Fax (0221) 37658-62, E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung – Verlängerung zur GW 331<br />
22.09.2011, Nürnberg<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH, figawa Service GmbH, Marienburger Straße 15,<br />
50968 Köln, Tel. (0221) 37658–20, Fax (0221) 37658–62, E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
acqua alta 2011<br />
11.–13.10.2011, Hamburg<br />
Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tel. (040) 3569-2081, Fax (040) 3250-9244,<br />
E-Mail: alta09@interplan.de, www.acqua-alta.de<br />
10. <strong>Wasser</strong>wirtschaftliche Jahrestagung<br />
7.–8.11.2011, Berlin<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
Schlammfaulung statt aerober Stabilisierung – Trend der Zukunft?<br />
22.11.2011, Kaiserslautern<br />
TU Kaiserslautern, Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft & Universität Luxemburg, Paul-Ehrlich-Straße,<br />
67663 Kaiserslautern, Dipl.-Ing. Oliver Gretzschel, Tel. (0631) 205-3831, E-Mail: oliver.gretzschel@bauing.uni-kl.de,<br />
www.siwawi.arubi.uni-kl.de<br />
Juni 2011<br />
648 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Einkaufsberater<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser.de/einkaufsberater<br />
Ansprechpartnerin für den<br />
Eintrag Ihres Unternehmens<br />
Inge Matos Feliz<br />
Telefon: 0 89/4 50 51-228<br />
Telefax: 0 89/4 50 51-207<br />
E-Mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Die technisch-wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung
Armaturen<br />
Brunnenservice<br />
Absperrarmaturen<br />
Automatisierung<br />
Prozessleitsysteme<br />
Armaturen<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Fernwirktechnik<br />
Be- und Entlüftungsrohre
Korrosionsschutz<br />
Leckortung<br />
Rohrleitungen<br />
Aktiver Korrosionsschutz<br />
Kunststoffrohrsysteme<br />
Regenwasser-Behandlung,<br />
-Versickerung, -Rückhaltung<br />
Kunststoffschweißtechnik<br />
Passiver Korrosionsschutz<br />
Rohrhalterungen und<br />
Stützen<br />
Rohrhalterungen
Schachtabdeckungen<br />
Filtermaterialien<br />
von Anthrazit bis Zeolith<br />
Rohrleitungs- und Kanalbau<br />
Smart Metering<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Sonderbauwerke<br />
Umform- und<br />
Befestigungstechnik<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung und<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
Rohrdurchführungen<br />
Übersetzungen<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Chemische <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
Öffentliche Ausschreibungen
Beratende Ingenieure (für das <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>fach)<br />
Ing. Büro CJD Ihr Partner für <strong>Wasser</strong>wirtschaft und<br />
Denecken Heide 9 Prozesstechnik<br />
30900 Wedemark Beratung / Planung / Bauüberwachung /<br />
www.ibcjd.de Projektleitung<br />
+49 5130 6078 0 Prozessleitsysteme<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Grundwasserbehandlung<br />
Kanalsanierung<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Schmutz-/Regenwasserableitung<br />
<strong>Wasser</strong>gefährdende Stoffe<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />
Regenerative Energien<br />
UNGER<br />
ingenieure<br />
Rockenhausen<br />
Erfurt<br />
igr AG<br />
Luitpoldstraße 60 a<br />
67806 Rockenhausen<br />
Tel.: +49 (0)6361 919-0<br />
Fax: +49 (0)6361 919-100<br />
Baden-Airpark<br />
Leipzig<br />
Darmstadt • Freiburg • Homberg • Mainz<br />
Berlin<br />
Lichtenstein<br />
Bitburg<br />
Zagreb<br />
E-Mail: info@igr.de<br />
Internet: www.igr.de<br />
Herzogenaurach<br />
Niederstetten<br />
• Beratung<br />
• Planung<br />
• Bauüberwachung<br />
• Betreuung<br />
• Projektmanagement<br />
Beratende Ingenieure für:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
Telefon 0511/284690<br />
Telefax 0511/813786<br />
30159 Hannover<br />
Kurt-Schumacher-Str. 32<br />
• Beratung<br />
• Gutachten<br />
• Planung<br />
• Bauleitung<br />
info@scheffel-planung.de<br />
www.scheffel-planung.de<br />
<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> Abfall Infrastruktur<br />
UNGER ingenieure • Julius-Reiber-Str. 19 • 64293 Darmstadt<br />
www.unger-ingenieure.de<br />
DVGW-zertifizierte Unternehmen<br />
Die STREICHER Gruppe steht für Innovation und Qualität. Mit knapp 3.000 Mitarbeitern werden<br />
anspruchsvolle Projekte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene durchgeführt.<br />
Die Zertifizierungen der STREICHER Gruppe umfassen:<br />
DIN EN ISO 9001 GW 11 G 468-1 WHG § 19 I<br />
DIN EN ISO 14001 GW 301: G1: st, ge, pe G 493-1 AD 2000 HPO<br />
SCC** W1: st, ge, gfk, pe, az, ku G 493-2 DIN EN ISO 3834-2<br />
OHSAS 18001 GN2: B W 120 DIN 18800-7 Klasse E<br />
FW 601: FW 1: st, ku<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA, Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Schwaigerbreite 17 Tel.: +49(0)991 330-231 rlb@streicher.de<br />
94469 Deggendorf Fax: +49(0)991 330-266 www.streicher.de<br />
Das derzeit gültige Verzeichnis der Rohrleitungs-Bauunternehmen<br />
mit DVGW-Zertifikat kann im Internet unter<br />
www.dvgw.de in der Rubrik „Zertifizierung/Verzeichnisse“<br />
heruntergeladen werden.
Stellenanzeigen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungszweckverband Weimar<br />
… die Ihnen das <strong>Wasser</strong> reichen können<br />
Der <strong>Wasser</strong>versorgungszweckverband Weimar (Sitz: Kultur- und<br />
Universitätsstadt Weimar, Kulturhauptstadt Europas 1999) versorgt<br />
rd. 110.000 Bürger in der Stadt Weimar und in 50 Kommunen<br />
des Umlandes (124 Ortslagen) sowie die dort ansässigen<br />
gewerblichen, landwirtschaftlichen und öffentlichen Kunden mit rd.<br />
5,1 Mio. m³/a Trinkwasser. Dazu werden u. a. 4 <strong>Wasser</strong>werke/Aufbereitungsanlagen,<br />
61 Hoch-/Sammelbehälter, 60 Zwischenpumpwerke/<br />
Druckerhöhungsanlagen sowie rd. 1.100 km Rohrnetz betrieben.<br />
Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben satzungsgemäß<br />
durch einen Eigenbetrieb. Im Zuge der mittelfristigen Vorbereitung<br />
einer Altersnachfolgeregelung ist dort vorzugsweise ab 01.01.2012<br />
zunächst die Stelle einer Elektrofachkraft im Meisterbereich Revision<br />
der Abteilung Netz- und Anlagenbetrieb neu zu besetzen.<br />
Nach etwa vier Jahren ist dann die Übernahme der Stelle<br />
Teamleiter(in) Elektro/MSR<br />
vorgesehen. Der Elektro/MSR-Bereich ist für den Betrieb und die<br />
Wartung/ Instandhaltung/Instandsetzung von 10 Trafostationen<br />
(30 kV auf 10 kV bzw. 10 kV auf 0,4 kV), rd. 10 km Mittelspannungs-,<br />
rd. 26 km Niederspannungs- und rd. 150 km Steuer-/<br />
Fernmeldekabeln sowie von 10 Richt- bzw. Zeitschlitzfunkstrecken<br />
und des aus einem zentralen Leitstand mit rd. 140 angebundenen<br />
Fernwirkunterstationen bestehenden Prozessleitsystems verantwortlich.<br />
Der/Die Teamleiter(in) ist verantwortliche Elektrofachkraft<br />
(VEF), leitet die Betriebselektriker (derzeit 5 Mitarbeiter) an und<br />
organisiert deren Aufgbenerfüllung in engem Zusammenwirken mit<br />
den Leitern der territorial zuständigen Meisterbereiche. Er/Sie berichtet<br />
dem Abt.-Ltr. Netz- und Anlagenbetrieb.<br />
Nachfolgende Anforderungen werden gestellt:<br />
– auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung (Elektroniker[in]<br />
für Automatisierungstechnik, Systemelektroniker[in] oder vergleichbar)<br />
basierende Meister- oder Ingenieurqualikation<br />
– fundierte Kenntnisse bezüglich SPS-Einsatz (insbesondere S 5<br />
und S 7)<br />
– möglichst Schaltberechtigung bis 30 kV (ggf. Bereitschaft zum<br />
Erwerb)<br />
– mehrjährige Berufserfahrung (vorzugsweise Ver-/Entsorgungsunternehmen)<br />
– Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick, mentale und<br />
körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Führungs- und<br />
Teamfähigkeit<br />
– interne und externe Durchsetzung der hohen Qualitätsstandards<br />
des WZV Weimar sowie ausgeprägtes betriebswirtschaftliches<br />
Denken im Hinblick auf die Efzienz der Aufgabenerfüllung<br />
– hohe Einsatzbereitschaft und selbständige Arbeitsweise<br />
– gute Anwenderkenntnisse bezüglich der üblichen Of ce-Programme<br />
– Grundkenntnisse in AutoCAD od. vergleichbaren Konstruktionsprogrammen<br />
– Führerschein für PKW<br />
– Bereitschaft zur <strong>Wo</strong>hnsitznahme im Versorgungsgebiet und zur<br />
Teilnahme am Bereitschaftsdienst<br />
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifsystem des Öffentlichen Dienstes<br />
(Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe [TV-V]).<br />
Für weitergehende Informationen stehen der Abt.-Ltr. Technik,<br />
Herr Willi Gleisner (Tel. 03643/7444-300) und der Abt.-Ltr. Netzund<br />
Anlagenbetrieb, Herr Veit Exner (Tel. 03643/7444-400) zur<br />
Verfügung.<br />
Bewerber/Bewerberinnen senden ihre aussagekräftige Bewerbungen<br />
unter Beifügung der üblichen Unterlagen (bitte Umschlag mit<br />
dem Hinweis „Stellenausschreibung Elektro“ kennzeichnen) bitte<br />
bis zum 31.08.2011 an den<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungszweckverband Weimar<br />
Frau Andrea Galitzdörfer – persönlich –<br />
Friedensstraße 40<br />
99423 Weimar<br />
Die Stadt Bad Saulgau sucht für ihre Stadtwerke zum nächstmöglichen<br />
Zeitpunkt einen<br />
Netzmonteur Gas/<strong>Wasser</strong> (m/w)<br />
zur Durchführung von Bau-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten<br />
im Gas- und <strong>Wasser</strong>rohrnetz und der Versorgungsanlagen.<br />
Nach Einarbeitung ist die Teilnahme am Bereitschaftsdienst erforderlich.<br />
Folgende Anforderungen werden gestellt:<br />
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Gas- und <strong>Wasser</strong>installateur/in<br />
• Führerschein Klasse B (vorzugsweise auch C1E)<br />
• Uneingeschränkte Eignung für den Außendienst<br />
• Möglichst Erfahrungen im Tätigkeitsgebiet<br />
Wenn Sie belastbar, flexibel und zuverlässig sind, dann freuen wir<br />
uns über Ihre Bewerbung. Die <strong>Wo</strong>hnsitznahme in Bad Saulgau<br />
oder der näheren Umgebung ist aufgrund der Rufbereitschaft erforderlich.<br />
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit, leistungsgerechte<br />
Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe<br />
(TV-V) bei einer zunächst auf zwei Jahre befristeten Stelle. Eine<br />
spätere Übernahme ist gegebenenfalls möglich.<br />
Die Kurstadt Bad Saulgau ist eine moderne Stadt mit 17.500 Einwohnern,<br />
zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb mit überdurchschnittlicher<br />
Infrastruktur, kulturellem Anspruch und hohem<br />
Freizeitangebot. Bad Saulgau ist Mittelzentrum und Sitz einer Verwaltungsgemeinschaft<br />
mit über 20.000 Einwohnern.<br />
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagekräftigen<br />
Bewerbungsunterlagen bis zum 5. Juli 2011 an die<br />
Stadt Bad Saulgau, Oberamteistrasse 11, 88348 Bad Saulgau.<br />
Für telefonische Rückfragen stehen Ihnen gerne Herr Übelhör (Tel.<br />
07581 506-110) oder Herr Hellmuth (Tel. 07581 207-150) zur<br />
Verfügung. Selbstverständlich können Sie Ihre Anfragen auch per<br />
Mail an personal@bad-saulgau.de richten. Weitere Informationen<br />
finden Sie auch unter www.stadtwerke-bad-saulgau.de bzw. unter<br />
www.bad-saulgau.de.<br />
Ihr direkter Draht zum Fachmarkt<br />
Inge Matos Feliz<br />
Tel. 089 / 4 50 51-228<br />
Fax 089 / 4 50 51-207<br />
matos.feliz@oiv.de<br />
www.stelleninserate.de
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
Seite<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 629<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau 579<br />
Aquadosil <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Essen 551<br />
Aqua Ukraine 2011, Kiew, Ukraine<br />
4. Umschlagseite<br />
Compounds AG, Pfäffikon, Schweiz 559<br />
DRÖSSLER GmbH, Umwelttechnik, Siegen 575<br />
DWA-Landesverbandstagung Bayern 555<br />
Endress + Hauser Messtechnik GmbH + Co. KG,<br />
Weil am Rhein<br />
Einhefter<br />
EPC 4. Europäische Rohrleitungstage 583<br />
EUROTANK GmbH, Nortorf 573<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 576<br />
Frank GmbH, Mörfelden-Walldorf 569<br />
Hans Huber AG Maschinen- und Anlagenbau,<br />
Berching 543<br />
Hydro-Elektrik GmbH, Ravensburg<br />
Titelseite<br />
Firma<br />
Seite<br />
Körting Hannover AG, Hannover 565<br />
KRYSCHI <strong>Wasser</strong>hygiene, Kaarst 590<br />
Walther Müller & Co., KG, Rohrdurchführungen 587<br />
REMONDIS Aqua GmbH & Co.KG, Lünen 561<br />
Siemens AG, Nürnberg 567<br />
Siemens AG, Nürnberg<br />
Beilage<br />
Simona AG, Kirn 553<br />
Fritz Wiedemann & Sohn GmbH, Wiesbaden 561<br />
Einkaufsberater / Fachmarkt 649–653<br />
Stellenmarkt<br />
Stadt Bad Saulgau, Bad Saulgau 654<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungszweckverband Weimar, Weimar 654<br />
wvr <strong>Wasser</strong>versorgung Rheinhessen GmbH,<br />
Bodenheim<br />
3. Umschlagseite