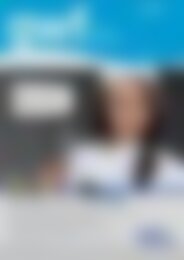gwf Wasser/Abwasser Kanalrohrleitungen, Druckrohrleitungen, Trinkwasserleitungen (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5/2013<br />
Jahrgang 154<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
www.amitech-germany.de<br />
FLOWTITE<br />
GFK-Rohrsysteme<br />
Besuchen Sie uns auf dem<br />
27. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
Stand 2.OG-H-03<br />
• <strong>Kanalrohrleitungen</strong><br />
• <strong>Druckrohrleitungen</strong><br />
• <strong>Trinkwasserleitungen</strong><br />
• Stauraumkanalsysteme<br />
• <strong>Wasser</strong>kraftleitungen<br />
• Trinkwasserspeicher<br />
• GFK-Sonderprofile<br />
• Industrieleitungen<br />
• Brunnenrohre<br />
• Schächte<br />
• Bewässerungsleitungen<br />
• Brückenrohre<br />
A Member of the<br />
Group
3. Praxistag am 29. Oktober 2013 in Essen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
Programm<br />
Moderation: Prof. Th. Wegener,<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg<br />
Wann und Wo?<br />
Themenblock 1: Netzbetrieb - Analysieren und Optimieren<br />
Auf zu neuen Ufern -<br />
aktuelle Fragestellungen in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Th. Rücken, Timo Wehr, Rechenzentrum für Versorgungsnetze Wehr<br />
GmbH, Düsseldorf<br />
Was können Asset Manager von Psychologen lernen?<br />
M. Beck, Fichtner Water & Transportation GmbH, Berlin<br />
Themenblock 2: Strategien zur Netzspülung<br />
Zustandsorientierte Spülung von Trinkwassernetzen<br />
Dr. A. Korth, TZW, Außenstelle Dresden<br />
Softwarebasierte Ermittlung von Spülprogrammen<br />
zur Unterstützung systematischer Netzspülungen<br />
Dr. J. Deuerlein, 3S Consult GmbH, Garbsen<br />
Strategische Planung von Netzspülungen mit Hilfe<br />
von Trinkwasseranalysen<br />
M. Geib, OOVW Oldenburgisch-Ostfriesischer <strong>Wasser</strong>verband, Brake<br />
Themenblock 3: Netzüberwachung<br />
Multiparameter-Sensorik und Online-Überwachung für <strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
- Einsatz im Rahmen des Forschungsprojektes<br />
IWaNet<br />
W. Geiger, GERO Meßsysteme GmbH, Braunschweig<br />
Watercloud: Neue Wege im <strong>Wasser</strong>verlustmanagement<br />
H.-P. Karle, F.A.S.T GmbH, Langenbrettach<br />
Kombination von Ortungsverfahren für die <strong>Wasser</strong>lecksuche<br />
D. Becker, Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh<br />
Themenblock 4: Netzbetrieb - Anwendungen aus Sicht<br />
der <strong>Wasser</strong>versorger<br />
Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Rohrschäden<br />
an Hauptleitungen des Hamburger Versorgungsnetzes<br />
K. Krieger, HAMBURG WASSER, Hamburg; Dr. Ch. Sorge, IWW, Mülheim<br />
Umsetzung einer Netzmanagementstrategie bei der RWW–<br />
Rheinisch-Westfälischen <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
J. Erbel, RWW GmbH, Mülheim, Dr. G. Gangl, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
3R, ZfW, iro<br />
Termin: Dienstag, 29.10.2013,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Essen, Welcome Hotel<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken<br />
und <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich<br />
Netzplanung, -inspektion und<br />
-wartung<br />
Teilnahmegebühr*:<br />
3R-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 390,- €<br />
Nichtabonnenten: 420,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen<br />
wird ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen<br />
Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet<br />
möglich) sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine<br />
schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn<br />
zu begleichen ist. Bei Absagen nach dem 15.<br />
Oktober 2013 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise<br />
verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin 3R-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
STANDPUNKT<br />
Wissen für die Zukunft<br />
Es kann beinahe schon als Binsenweisheit<br />
gelten: Wer die Branche zukunftsfähig<br />
erhalten will, muss sich um den wissenschaftlichen<br />
Nachwuchs kümmern. Mit diesem<br />
Ziel startete <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> im<br />
Oktober 2011 das Forum Netzwerk Wissen –<br />
eine Serie rund um die wissenschaftliche Ausund<br />
Weiterbildung im <strong>Wasser</strong>fach.<br />
Seither ist eine stattliche Reihe entstanden,<br />
die wir auch fortsetzen wollen. Allein im<br />
Jahr 2012 informierte Netzwerk Wissen auf<br />
fast 200 Seiten über den aktuellen Stand von<br />
Forschung und Lehre. In jeder neuen Folge<br />
werden Lehrstühle, Studiengänge und Forschungseinrichtungen<br />
porträtiert, Einblicke in<br />
Labore und Versuchseinrichtungen gewährt.<br />
Berichte über Initiativen und Kooperationen<br />
mit in- und ausländischen Institutionen, Stipendien-<br />
und Förderprogramme, aber auch<br />
Wissenswertes zu den jeweiligen Studienorten<br />
runden die Heftstrecke ab.<br />
Damit bietet sich den Hochschulen selbst<br />
eine ideale Gelegenheit, einer interessierten<br />
Fachöffentlichkeit das eigene Leistungsspektrum<br />
darzulegen. Vor allem aber liefert die<br />
Serie angehenden Studierenden eine Fülle<br />
zweckdienlicher Informationen. Sie erlaubt<br />
einen Überblick über die möglichen Fachrichtungen<br />
in der <strong>Wasser</strong>branche und unterschiedliche<br />
Ansätze in Lehre und Forschung.<br />
Netzwerk Wissen veröffentlicht auch Kurzfassungen<br />
von Dissertationen – ein Aspekt,<br />
der Studierende und Lehrende auch als Autoren<br />
ansprechen sollte. Schließlich wird <strong>gwf</strong>-<br />
<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> seit mehr als fünf Jahren<br />
als referierte Fachzeitschrift geführt: Bei der<br />
Redaktion eingereichte Fachbeiträge durchlaufen<br />
ein Gutachterverfahren, bei dem mindestens<br />
zwei Experten aus dem betreffenden<br />
Fachgebiet die Manuskripte bewerten. Dieses<br />
Peer-Review-Verfahren dient dazu, den hohen<br />
Standard der wissenschaftlichen Fachbeiträge<br />
unserer Zeitschrift zu sichern, und ist ein sichtbares<br />
Qualitäts-Instrument für Leserschaft und<br />
Autoren.<br />
Für die Autoren ist es zugleich der weltweit<br />
akzeptierte Nachweis wissenschaftlicher Publikation,<br />
denn <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> ist als<br />
eine der wenigen deutschsprachigen Publikationen<br />
auch in wissenschaftlichen Citation<br />
Indices gelistet. So wertet beispielsweise die<br />
interdisziplinäre Datenbank SciVerse Scopus<br />
mit über 40 Millionen Quellenangaben und<br />
Abstracts wissenschaftlicher Veröffentlichungen<br />
rund 19 700 internationale natur-, geistes-<br />
und sozialwissenschaftliche Zeitschriften<br />
aus und enthält Angaben zu zitierten Beiträgen.<br />
Eine Liste der in der SciVerse Scopus<br />
Datenbank geführten Publikationen lässt sich<br />
unter www.scimagojr.com/journalrank.php<br />
aufrufen.<br />
So möchte ich alle Lehrenden und Studierenden<br />
sehr herzlich einladen, ihre Fachartikel<br />
bei <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> einzureichen – und<br />
damit ihren Beitrag zum Wissen für die<br />
Zukunft der Branche zu leisten.<br />
Ihre<br />
Christine Ziegler<br />
Hauptschriftleitung <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 505
INHALT<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Basiswissen [%]<br />
grundlegend,<br />
allgemein,<br />
theoretisch<br />
+<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Summe Fortbildung [%]<br />
aktuell,<br />
für Spezialthemen<br />
kürzere Halbwertszeit,<br />
praxisorientiert<br />
+<br />
40<br />
40<br />
20<br />
20<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
+<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Erfahrung [%]<br />
aus der Tätigkeit<br />
erworben,<br />
praxisorientiert,<br />
individuell<br />
=<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Anforderungsniveau<br />
40<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
Die <strong>Wasser</strong>wärterfortbildung ist seit 40 Jahren ein bewährtes und<br />
kostengünstiges Qualifizierungs- und Fortbildungsinstrument mit<br />
breiter Trägerschaft und großer Akzeptanz. Ab Seite 580<br />
20<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
Nach umfangreicher Recherche zu Einflussfaktoren in verschiedenen<br />
Kundengruppen wurde ein <strong>Wasser</strong>bedarfsszenario<br />
für eine Rohrnetzberechnung entwickelt, um die<br />
Auswirkungen auf die Netzauslastung zu untersuchen.<br />
Ab Seite 590<br />
Fachberichte<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
580 F. Haakh<br />
40 Jahre „<strong>Wasser</strong>wärterfortbildung“<br />
in Baden-Württemberg<br />
40 Years of “Water Attendant Training”<br />
in Baden-Württemberg<br />
590 S. Cichowlas und H. Oeltjebruns<br />
Zielnetzentwicklung eines<br />
städtischen Trinkwassernetzes<br />
Target Network Development for an Urban<br />
Drinking Water Network<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
600 H. Sgier, J.M. Nieto und T.S. Rötting<br />
Entwurf einer Pilotanlage für die<br />
naturnahe (passive) Behandlung<br />
von sauren Bergwerkswässern<br />
Design of a Pilot Plant for the Passive Treatment<br />
of Acid Mine Drainage<br />
Tagungsbericht<br />
608 A. Abels, K. Klaer und D. Mousel<br />
Ressourcenschutz als interdisziplinäre<br />
Aufgabe –<br />
46. ESSENER TAGUNG vom<br />
13. bis 15. März 2013 in Aachen<br />
614 C. Scholz<br />
5. Kolloquium der Trinkwasserspeicherung<br />
der SITW –<br />
Praxisseminar am 28. Februar 2013<br />
in Koblenz<br />
Interview<br />
510 Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Vorstandsvorsitzender<br />
des Ruhrverbandes, im Interview<br />
Netzwerk Wissen<br />
Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
527 Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der<br />
Technischen Universität Dresden im Porträt<br />
Mai 2013<br />
506 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INHALT<br />
▲ Ressourcenschutz als interdisziplinäre Aufgabe – Tagungsbericht von der<br />
46. ESSENER TAGUNG vom 13. bis 15. März 2013 in Aachen. Ab Seite 608<br />
Saure Bergwerkswässer (AMD = Acid Mine Drainage) bringen gravierende Probleme für<br />
die Umwelt. Mit Hilfe der DAS-Technologie (Dispersed Alkaline Substrate) werden<br />
Gewässer in einem ehemaligen Abbaugebiet in Spanien gereinigt. Ab Seite 600 ▶<br />
Fokus<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
514 8. Nürnberger Informations- und<br />
Erfahrungsaustausch zum Rohrvortrieb<br />
516 Anspruchsvolle Erschließung des Baugebiets<br />
„Kurgarten“ in Bad Krozingen<br />
519 Sanierung einer <strong>Abwasser</strong>druckleitung<br />
in Ravenna<br />
522 Optimaler Schutz für stark beanspruchte<br />
<strong>Abwasser</strong>bauwerke<br />
524 Mobile Entwässerungsanlage für eine<br />
rasche und effiziente Bohrgutentsorgung<br />
526 Abenteuerliche Arbeiten in Garching –<br />
Sanierung von Rohrleitungen in kampfmittelgefährdetem<br />
Gebiet<br />
Nachrichten<br />
Branche<br />
548 Neuer Studiengang <strong>Wasser</strong>- und<br />
Infra strukturmanagement startet an der<br />
Hochschule Koblenz<br />
549 Zukunft aus Erfahrung: Der Ruhrverband<br />
gestern, heute, morgen<br />
552 3. Mitgliederversammlung Güteschutz<br />
Grundstücksentwässerung<br />
554 Flussgebietsmanagement in der Ukraine<br />
– was verhindert eine nachhaltige<br />
Umsetzung?<br />
556 Kann bewusster Umgang mit Arznei<br />
„Nebenwirkungen“ von Medikamenten im<br />
Gewässer senken? – Spurenstoffe-Projekt<br />
in Dülmen geht an den Start<br />
558 Arzneimittelrückstände im <strong>Wasser</strong> –<br />
Lösungen liegen bei den Verursachern<br />
559 Blick in die Zukunft: SUDPLAN – DFKI-Software<br />
visualisiert Auswirkungen des Klimawandels<br />
bis ins Jahr 2100<br />
560 <strong>Wasser</strong>tagung schlägt alle Rekorde<br />
– Süd- und Ostbayerische <strong>Wasser</strong>tagung<br />
(SOW) in Landshut<br />
561 Tracerversuch an der Saale – Bundesanstalt<br />
für Gewässerkunde (BfG) untersucht Fließgeschwindigkeiten<br />
562 GEFMA-Förderpreis für Abschlussarbeit<br />
zum Münchner Kanalreinigungsmodell<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 507
INHALT<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Vorstandsvorsitzender des<br />
Ruhrverbandes im Interview. Ab Seite 510<br />
Im Fokus: Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau Ab Seite 514<br />
Veranstaltungen<br />
571 Geprüfter Netzmonteur Gas, <strong>Wasser</strong><br />
und/oder Strom<br />
571 Dresdner Grundwassertage<br />
572 20 Jahre Technische Regeln wassergefährdender<br />
Stoffe (TRwS)<br />
573 MSR-Spezialmesse für Prozessleitsysteme,<br />
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik in<br />
Hamburg-Schnelsen<br />
574 Reparatur und Renovierung: Nürnberger<br />
Kolloquien zur Kanalsanierung<br />
574 Internationale Geothermie Industriemesse<br />
Leute<br />
575 Trauer um Harald Huberth<br />
575 Michael Riechel neuer DVGW-Vizepräsident<br />
Recht und Regelwerk<br />
576 DVGW-Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
576 DVGW-Regelwerk Gas/<strong>Wasser</strong><br />
577 Sicherstellung der Trinkwasserhygiene<br />
in Gebäuden – VDI/DVGW 6023<br />
578 Ankündigung zur Fortschreibung des<br />
DVGW-Regelwerks<br />
578 DWA: Aufruf zur Stellungnahme – Entwurf<br />
Arbeitsblatt DWA-A 216<br />
Praxis<br />
618 Weltweiter Einsatz innovativer Filtersysteme<br />
für zentrale und dezentrale Trinkwasseraufbereitung<br />
619 Weniger Datenflut, mehr Informationen<br />
in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
622 Modernisierung der <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage<br />
in Arnsberg<br />
Produkte und Verfahren<br />
623 Mehrstufige Hochdruckpumpe – Maximal<br />
effizient und mit außergewöhnlichen Funktionalitäten<br />
ausgestattet<br />
624 BEULCO-Produkte sind trinkwasserkonform<br />
625 SMARTSENS: die erste Familie von Analysesensoren,<br />
die Transmitter überflüssig macht<br />
626 Hohe Performance im Infrastrukturbau mit<br />
modernster IT-Technologie – RIB Software<br />
AG lanciert STRATIS in neuer Version<br />
Mai 2013<br />
508 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INHALT<br />
Zuverlässige<br />
Durchflussmessung<br />
für<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft?<br />
Sicher.<br />
Netzwerk Wissen: Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der Technischen<br />
Universität Dresden im Porträt. Ab Seite 527<br />
Information<br />
589, 599, 606, 607 Buchbesprechungen<br />
627 Impressum<br />
628 Termine<br />
Sonderausgabe nach Seite 562<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff 04/13<br />
Zum Beispiel mit dem magnetischinduktiven<br />
Durchflussmesser<br />
AquaMaster. Im Betrieb mit Batterie,<br />
Solarpanel oder externer Hilfsenergie<br />
ist er ideal geeignet für die zuverlässige<br />
Überwachung von Trinkwassernetzen.<br />
www.abb.de/durchfluss<br />
Wussten Sie, dass Ihnen ABB<br />
neben dem umfassenden Portfolio<br />
für die Instrumentierung ebenso<br />
herausragende Produkte und<br />
Lösungen für die Analysentechnik,<br />
maßgeschneiderte Leitsysteme<br />
sowie erstklassigen Service bietet?<br />
Lesen Sie mehr unter:<br />
www.abb.de/<br />
prozessautomatisierung<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> Juni 2013<br />
Erscheinungstermin: 24.06.2013<br />
Anzeigenschluss: 07.06.2013<br />
ABB Automation Products GmbH<br />
Tel.: 0800 111 44 11<br />
Fax: 0800 111 44 22<br />
vertrieb.messtechnik-produkte@de.abb.com<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 509
INTERVIEW<br />
Grund zu feiern<br />
Die Ruhr, größter Fluss und Namensgeber des Ruhrgebiets, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem denkbar<br />
schlechten Zustand. Kohlebergbau und zunehmende Industrialisierung hatten zu <strong>Wasser</strong>knappheit und<br />
einer so starken Verschmutzung geführt, dass akuter Handlungsbedarf bestand. So wurde im Jahr 1913 der<br />
Ruhrverband gegründet, um die dringenden Probleme mit vereinten Kräften anzupacken. Was der Verband in<br />
den vergangenen 100 Jahren alles unternommen hat, um die Ruhr wieder zu einem lebendigen Gewässer zu<br />
machen, schildert Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbandes, im Interview anlässlich<br />
des Jubiläums im Juni dieses Jahres.<br />
<strong>gwf</strong>: Ende des 19. Jahrhunderts war<br />
das <strong>Wasser</strong> der Ruhr in keinem guten<br />
Zustand. Wie muss man sich die Verhältnisse<br />
damals vorstellen?<br />
Prof. Bode: Von etwa 1850 bis<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts stiegen<br />
die Industrie- und Kohleproduktion<br />
und mit ihr auch die Bevölkerungszahlen<br />
im Ruhrgebiet rasant<br />
an. Als Ergebnis dieser Entwicklung<br />
war die Ruhr hinsichtlich ihrer<br />
<strong>Wasser</strong>güte und -menge (ein Teil<br />
des <strong>Wasser</strong>s fließt nach Benutzung<br />
über andere Flüsse zum Rhein) in<br />
einem katastrophalen Zustand. 1911<br />
berichtete August Thienemann, ein<br />
anerkannter Gewässerkundler: „Die<br />
Ruhr […] stellt eine braunschwarze<br />
Brühe dar, die stark nach Blausäure<br />
riecht, keine Spur von Sauerstoff<br />
enthält und absolut tot ist.“ In niederschlagsarmen<br />
Sommerzeiten fiel<br />
der Fluss mehrfach nahezu gänzlich<br />
trocken.<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbandes.<br />
<strong>gwf</strong>: Wie kam es dann zur Gründung<br />
des Ruhrverbands vor 100 Jahren?<br />
Wer gab den Ausschlag?<br />
Prof. Bode: Eine Versammlung mit<br />
170 Vertretern aus Behörden,<br />
Gemeinden, Industrie und <strong>Wasser</strong>werken<br />
befürwortete Ende Oktober<br />
1911 Karl Imhoffs Idee der Gründung<br />
einer Genossenschaft, die die<br />
wasserwirtschaftlichen Probleme<br />
an der Ruhr lösen sollte. Zunächst<br />
wählten sie aus ihren Reihen 28 Mitglieder,<br />
die einen „Ruhrausschuss“<br />
bildeten. Der Ausschuss empfahl<br />
Mit der Gründung einer flussgebietsweiten<br />
Genossenschaft kann man die<br />
sich aus den somit zersplitterten<br />
Zuständigkeiten ergebenden Probleme<br />
hervorragend lösen.<br />
auf der Grundlage von Imhoffs Gutachten,<br />
mit dessen Erstellung dieser<br />
vom Arnsberger Regierungspräsidenten<br />
Alfred von Bake beauftragt<br />
worden war, die Gründung eines<br />
Verbandes per Sondergesetz. Mit<br />
Inkrafttreten des Ruhrreinhaltegesetzes<br />
am 5. Juni 1913 wurde diese<br />
Empfehlung in die Tat umgesetzt.<br />
<strong>gwf</strong>: War es wichtig, eine Verbandsstruktur<br />
aufzubauen, um die anstehenden<br />
Aufgaben angehen zu können?<br />
Prof. Bode: Ja, die genossenschaftliche<br />
Struktur, die den Ruhrverband<br />
bis heute prägt, gewährleistet einen<br />
fairen Ausgleich zwischen unterschiedlichen<br />
Nutzungen der Ruhr.<br />
Die im Gesetz verankerte Verpflichtung<br />
zur Mitgliedschaft schützt<br />
davor, dass sich Nutzer der Ruhr<br />
aus der Solidargemeinschaft verabschieden,<br />
und sichert eine stabiles<br />
finanzielles Fundament, um die<br />
wichtigen Aufgaben des Gewässerschutzes<br />
und der <strong>Wasser</strong>bereitstellung<br />
erfüllen zu können. Politische<br />
Zuständigkeitsgrenzen pflegen sich<br />
in der Regel nicht an <strong>Wasser</strong>vorkommen<br />
und Flusseinzugsgebietsgrenzen<br />
zu orientieren. Mit der<br />
Gründung einer flussgebietsweiten<br />
Genossenschaft kann man die sich<br />
aus den somit zersplitterten Zustän-<br />
Mai 2013<br />
510 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INTERVIEW<br />
digkeiten ergebenden Probleme<br />
hervorragend lösen. Auch in an -<br />
deren Ländern wie zum Beispiel<br />
den Niederlanden führte diese<br />
Erkenntnis schon vor erheblich<br />
längerer Zeit zur Gründung von<br />
<strong>Wasser</strong>verbänden, die für die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft des gesamten<br />
Landes verantwortlich sind.<br />
<strong>gwf</strong>: Welche Maßnahmen wurden<br />
ergriffen, um die Qualität der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
nach und nach zu verbessern?<br />
Prof. Bode: In den ersten 50 Jahren<br />
ging es einerseits darum, das<br />
bedrohliche Problem der <strong>Wasser</strong>knappheit<br />
zu lösen. Hierzu errichtete<br />
der Ruhrverband über die Jahre<br />
insgesamt acht Talsperren, das<br />
größte zusammenhängende Talsperrenbewirtschaftungssystem<br />
Deutschlands. Zur Verbesserung der<br />
<strong>Wasser</strong>qualität wurden andererseits<br />
bereits in den 30er Jahren die Ruh r-<br />
stauseen zur Verstärkung der Selbstreinigungskraft<br />
des Flusses und<br />
daneben etliche Kläranlagen<br />
gebaut. Ab den 1970er Jahren trieb<br />
der Verband den Ausbau der Kläranlagen<br />
und Niederschlagswasserbehandlungsanlagen<br />
weiter intensiv<br />
voran. Im letzten Ausbauschritt<br />
wurden die Kläranlagen von 1990<br />
bis 2005 aufgerüstet, um auch Stickstoff<br />
und Phosphor aus dem Ab -<br />
wasser zu entfernen. In diesen Ausbau<br />
und in zusätzliche Niederschlagswasserbehandlungsanlagen<br />
hat der<br />
Ruhrverband in dieser Zeitspanne<br />
1,6 Milliarden Euro investiert.<br />
<strong>gwf</strong>: War es in früheren Zeiten einfacher,<br />
sich auf große Projekte wie<br />
beispielsweise den Bau von Talsperren<br />
zu einigen bzw. diese bei der<br />
Bevölkerung durchzusetzen?<br />
Prof. Bode: In den Anfängen des<br />
Ruhrverbands war es sicherlich<br />
deutlich einfacher, große Infrastrukturprojekte<br />
wie den Bau von Talsperren<br />
umzusetzen, auch wenn<br />
der Kauf und die teilweise auch<br />
erforderliche Enteignung von benötigten<br />
Flächen schon immer ein<br />
kompliziertes und oft schmerzhaftes<br />
Unterfangen für die Betroffenen<br />
einerseits und den Ruhrverband<br />
andererseits waren. Seit den 1970er<br />
Jahren ist allerdings die Verwirklichung<br />
derartiger Projekte aufgrund<br />
des geänderten Planungsrechts<br />
noch deutlich schwieriger<br />
geworden, wobei ich ausdrücklich<br />
betonen möchte, dass unser demokratisch<br />
legitimiertes Planungsrecht<br />
sicherlich ein wichtiges Gut mit<br />
eigenem Wert darstellt.<br />
<strong>gwf</strong>: In den letzten hundert Jahren<br />
gab es für den Ruhrverband einige<br />
Herausforderungen zu bestehen.<br />
Welches waren besonders einschneidende<br />
Ereignisse?<br />
Prof. Bode: Einiges davon ist schon<br />
erwähnt worden. Es waren die drängenden<br />
Probleme zur Gründungszeit,<br />
die Zerstörungen durch Krieg<br />
und Diktatur, die Beeinträchtigung<br />
der Gewässer durch die prosperierende<br />
Wirtschaft in den Jahren des<br />
„Wirtschaftswunders“, die Gerichtsentscheidung,<br />
den Bau einer 9. Talsperre<br />
(Negertalsperre) nicht zuzulassen,<br />
die Fusion von Ruhrtalsperrenverein<br />
und Ruhrverband (1990)<br />
und nicht zuletzt die gewaltigen<br />
Anstrengungen zur Realisierung der<br />
Nährstoffelimination in den Kläranlagen.<br />
Die aus diesem Ausbauprogramm<br />
resultierenden Schulden<br />
werden uns noch mindestens weitere<br />
zehn Jahre beschäftigen.<br />
<strong>gwf</strong>: Welche Lehren kann man aus<br />
Geschehnissen wie beispielsweise<br />
dem PFT-Skandal ziehen – gerade<br />
auch bezüglich der Wirksamkeit solcher<br />
Themen in der Öffentlichkeit?<br />
Prof. Bode: Dass <strong>Wasser</strong> ein absolut<br />
lebensnotwendiges Gut ist und<br />
damit immer auch unter besonderer<br />
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit<br />
steht, ist dem Ruhrverband seit<br />
100 Jahren zutiefst bewusst. Allerdings<br />
reden wir beim PFT und an -<br />
deren heutigen Mikroverunreinigungen<br />
in den Gewässern über<br />
Stoffe, deren Auswirkungen auf den<br />
Menschen in keiner Weise mit dem<br />
vergleichbar sind, womit er noch vor<br />
100 oder 50 Jahren konfrontiert<br />
wurde. Nach einer Studie des Amerikaners<br />
Koplan haben wir heute dank<br />
der Verbesserungen bei Trinkwasserversorgung,<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung,<br />
Abfallentsorgung und Krankenhaushygiene<br />
eine um 30 Jahre höhere<br />
Lebenserwartung als unsere Vorfahren<br />
im Jahr 1900. Selbst wenn wir in<br />
Dass <strong>Wasser</strong> ein absolut<br />
lebens notwendiges Gut ist und damit<br />
immer auch unter besonderer<br />
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit<br />
steht, ist dem Ruhrverband seit<br />
100 Jahren zutiefst bewusst.<br />
Zukunft mit hohem finanziellem<br />
Einsatz Verunreinigungen im Millionstel-<br />
bzw. Milliardstel-Grammbereich<br />
aus dem <strong>Abwasser</strong> entfernen<br />
sollten, würde dies keine auch nur<br />
ansatzweise vergleichbare Wirkung<br />
auf menschliches Leben entfalten.<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 511
INTERVIEW<br />
Allerdings gehört zu den Erfahrungen<br />
aus dem PFT-Skandal, bei<br />
dem es örtlich zu höheren als den<br />
eben angesprochenen Konzentrationen<br />
kam, auch Folgendes: Weil<br />
man nicht davon ausgehen kann,<br />
dass die Welt frei ist von krimineller<br />
Energie und damit verbundener<br />
Sorglosigkeit, ist man gut beraten,<br />
die Gewässerqualität mit hohem<br />
Einsatz zu monitoren, um im Schadensfall<br />
schnelle und wirksame<br />
Maßnahmen ergreifen zu können.<br />
Dazu gehört auch die Fähigkeit,<br />
transparent und überzeugend mit<br />
der Öffentlichkeit kommunizieren<br />
zu können.<br />
<strong>gwf</strong>: Nachhaltige <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung zu ge -<br />
währleisten sowie die Belange des<br />
Umweltschutzes zu berücksichtigen,<br />
ist nicht umsonst zu haben. Wie<br />
lassen sich Daseinsvorsorge und<br />
Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu<br />
bringen?<br />
Prof. Bode: Die „Lieferung“ von<br />
bezahlbarer Daseinsvorsorge ist und<br />
bleibt eine technisch-betriebswirtschaftliche<br />
Herausforderung, der<br />
sich jeder Betreiber mit Engagement<br />
stellen muss. Die Frage, welches<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigungsziel die Gesellschaft<br />
für angemessen hält und was<br />
sie dafür zu zahlen bereit ist, können<br />
der Ruhrverband oder andere<br />
Betreiber von Kläranlagen aber nicht<br />
selbst beantworten. Hierzu gibt es<br />
in Deutschland demokratisch ge -<br />
wählte Parlamente und Regierungen,<br />
die in der Pflicht stehen, entsprechende<br />
Regelungen zu veranlassen<br />
und Rechtssicherheit zu<br />
schaffen, da mit der Umsetzung der<br />
Regelungen hohe Inves titionen und<br />
Betriebskosten verbunden sein<br />
können. Die Pflicht der Betreiber ist<br />
es, diese Vorgaben so wirtschaftlich<br />
wie möglich umzusetzen.<br />
<strong>gwf</strong>: Was ist von den Aktivitäten der<br />
Europäischen Kommission zu halten?<br />
Ist der Entwurf der neuen Kon zessionsrichtlinie<br />
für die deutsche<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft zielführend?<br />
Man muss sich der Aufgabe der Kontrolle<br />
natürlicher Monopole stellen, wie dies<br />
beispielsweise beim Ruhrverband durch seine<br />
transparenten genossenschaftlichen<br />
Regeln der Fall ist.<br />
Prof. Bode: Einen vernünftigen ordnungsrechtlichen<br />
Rahmen zu setzen,<br />
ist immer gut. Aber mit derartigen<br />
Regelungen der Privatisierung des<br />
<strong>Wasser</strong>sektors Vorschub zu leisten,<br />
lehnen wir entschieden ab. Trinkwasserbeschaffung<br />
und <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
sind lokale, ortsgebundene<br />
und gleichzeitig generationenübergreifende<br />
Befassungen, die<br />
aus natürlichen Gegebenheiten<br />
heraus zwangsläufig in einer ge -<br />
wissen Monopolstellung münden.<br />
Man muss sich der Aufgabe der<br />
Kontrolle dieser Monopole stellen,<br />
wie dies beispielsweise beim Ruhrverband<br />
durch seine transparenten<br />
genossenschaftlichen Regeln der<br />
Fall ist. Stattdessen die sich gegenseitig<br />
kontrollierende und unterbzw.<br />
überbietende Kraft des Wettbewerbs<br />
einführen zu wollen, heißt,<br />
eine umsichtige und generationsübergreifende<br />
Verantwortungswahrnehmung<br />
im sensiblen Feld<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft grundlos aufs<br />
Spiel zu setzen.<br />
<strong>gwf</strong>: Wie sind die aktuellen Entwicklungen<br />
etwa beim Entwurf der Fortschreibung<br />
der Europäischen Richtlinie<br />
zu Prioritären Substanzen oder<br />
bei den neuen UQN (EU-Umweltqualitätsnormen,<br />
die sich in Werten<br />
für zulässige Konzentrationen in Ge -<br />
wässern manifestieren) zu beurteilen?<br />
Prof. Bode: So unglaublich niedrige<br />
UQNs zu erlassen, wie sie jetzt<br />
im Entwurf der EU in Rede stehen<br />
und die mit heutigen technischen<br />
Möglichkeiten teilweise nicht überprüft<br />
und schon gar nicht mit<br />
den zur Verfügung stehenden Verfahrenstechniken<br />
beispielsweise<br />
über Kläranlagen erreicht werden<br />
können, ist nicht zielführend. Letztlich<br />
müsste eine solche Regelung<br />
Mai 2013<br />
512 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
INTERVIEW<br />
In den letzten 100 Jahren hat der<br />
Ruhrverband, aber nicht nur er, sondern<br />
die gesamte <strong>Wasser</strong>wirtschaft in<br />
Deutschland, Herausragendes geleistet.<br />
Dieses wird international anerkannt<br />
und respektiert.<br />
auf ein Verbot der in Rede stehenden<br />
Stoffe hinauslaufen. Ich<br />
sage voraus, dass etliche der angestrebten<br />
Niedrigstkonzentrationen<br />
in den deutschen Gewässern über<br />
Jahrzehnte nicht erreicht werden,<br />
zumal der Eintrag oft diffus ist und<br />
nicht immer über Kläranlagen<br />
erfolgt. Auch sollte in der derzeitigen<br />
Diskussion ehrlicherweise<br />
stärker darauf hingewiesen werden,<br />
dass bei den UQNs die Unversehrtheit<br />
des vergleichsweise empfindlicheren<br />
aquatischen Lebens mehr<br />
im Fokus steht als die Sorge um die<br />
menschliche Gesundheit.<br />
<strong>gwf</strong>: Kann der Ausbau der Kläranlagen<br />
mit einer vierten Reinigungsstufe<br />
die Spurenstoff-Problematik<br />
lösen?<br />
Prof. Bode: Nach unseren Erkenntnissen<br />
aus den großtechnischen<br />
Versuchen auf unserer Kläranlage<br />
in Schwerte können die Mikroverunreinigungen<br />
im <strong>Abwasser</strong> nicht<br />
gänzlich eliminiert werden. Die Eliminationsraten<br />
betragen je nach<br />
Stoff etwa 40 bis 95 Prozent. Wir<br />
haben große Zweifel, dass bei Er -<br />
reichen solcher Eliminationsraten<br />
die Diskussionen um Mikroverunreinigungen<br />
verstummen werden. Die<br />
geplanten UQN können mit einer<br />
vierten Reinigungsstufe ganz sicher<br />
nicht eingehalten werden, zumal<br />
viele Stoffe – wie eben gesagt –<br />
nicht vordringlich über Kläranlagen<br />
in die Gewässer kommen.<br />
<strong>gwf</strong>: Als Resümee zum Jubiläum: Mit<br />
welchem Empfinden blicken Mitglieder<br />
und Vorstand des Ruhrverbands<br />
auf die zurückliegende Arbeit? Was<br />
wurde alles erreicht? Worin liegen die<br />
Aufgaben der Zukunft?<br />
Prof. Bode: In den letzten 100 Jahren<br />
hat der Ruhrverband, aber<br />
nicht nur er, sondern die gesamte<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft in Deutschland,<br />
Herausragendes geleistet. Dieses<br />
wird international anerkannt und<br />
respektiert. Der genossenschaftliche<br />
Aufbau der <strong>Wasser</strong>verbände<br />
in Nordrhein-Westfalen und des<br />
Ruhrverbands hat sich dabei sehr<br />
bewährt. Bis heute ist diese Solidargemeinschaft<br />
immer in der Lage<br />
gewesen, die unterschiedlichen<br />
Nutzungsinteressen an der Ruhr zu<br />
bündeln und in vernünftige Bahnen<br />
zu lenken. Die Herausforderungen<br />
der Zukunft liegen, soweit man<br />
das aus heutiger Sicht absehen<br />
kann, im demografischen Wandel,<br />
der Diskussion um weitergehende<br />
Maßnahmen bei der <strong>Abwasser</strong>reinigung,<br />
dem Klimawandel und<br />
einer weiteren Steigerung der<br />
Energieeffizienz unserer Anlagen,<br />
ein Thema, an dem wir seit 15 Jahren<br />
mit großem Nachdruck arbeiten.<br />
<strong>gwf</strong>: Ein rundes Jubiläum ist sicher<br />
ein guter Anlass, mit den Menschen<br />
im Ruhrgebiet zu feiern. Wie begeht<br />
der Ruhrverband sein 100-jähriges<br />
Jubiläum?<br />
Prof. Bode: Wenn Unternehmen<br />
oder Verbände 100 Jahre alt werden,<br />
dann besteht die Gefahr, dass sie<br />
mit und für sich selbst feiern.<br />
Der Ruhrverband geht zu seinem<br />
100-jährigen Bestehen bewusst<br />
auch einen anderen Weg und feiert<br />
gemeinsam mit den Städten und<br />
Gemeinden in seinem Verbandsgebiet.<br />
Bis Juli 2013 fährt das Infomobil<br />
des Ruhrverbands 40 Kommunen<br />
zwischen Winterberg und<br />
Duisburg an und veranstaltet dort,<br />
jeweils an einer Schule, Aktionsund<br />
Quizrunden um das Thema<br />
<strong>Wasser</strong> im Stil der legendären TV-<br />
Show „Spiel ohne Grenzen“. Die<br />
Resonanz ist erfreulicherweise groß.<br />
Zusätzlich wird noch eine Feierstunde<br />
mit den Mitgliedern des<br />
Ruhrverbands und auch mit den<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
stattfinden. Außerdem haben wir<br />
ein Jubiläumsbuch erarbeitet, das<br />
mit einer – wie wir glauben – gelungenen<br />
Mischung aus hochwertigen<br />
Fotos und informativen Texten die<br />
spannende Geschichte der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
an der Ruhr erzählt und<br />
dabei auch einen Blick in die<br />
Zukunft wirft.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 513
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
Regelwerk, Technik und Qualifikation<br />
8. Nürnberger Informations- und Erfahrungsaustausch zum Rohrvortrieb<br />
Die Teilnehmer<br />
am Nürnberger<br />
Informationsund<br />
Erfahrungsaustausch<br />
diskutierten<br />
über<br />
aktuelle Entwicklungen<br />
im<br />
Regelwerk und<br />
Technik und<br />
Qualifikationen<br />
im Rohrvortrieb.<br />
Alle Abbildungen:<br />
© Güteschutz<br />
Kanalbau<br />
Am 14. März 2013 trafen sich Mitarbeiter<br />
von Kommunalen Auftraggebern,<br />
kommunaten Vergabestellen,<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsämtern,<br />
Ingenieurbüros, Rohrvortriebsunternehmen<br />
und Herstellern von<br />
Rohren und Rohrvortriebsmaschinen<br />
zum 8. Nürnberger Informations-<br />
und Erfahrungsaustausch.<br />
Informiert und diskutiert wurde auf<br />
der gemeinsamen Veranstaltung<br />
der TÜV Rheinland LGA Bautechnik<br />
GmbH und des Güteschutz Kanalbau<br />
e.V. unter anderem über Entwicklungen<br />
im Regelwerk, Innovationen<br />
der Branche, Vortriebsprojekte<br />
und Verfahren. Zu den inhaltlichen<br />
Schwerpunkten zählten neben dem<br />
Arbeitsblatt DWA-A 161 (Weißdruck)<br />
und der Vorstellung wichtiger<br />
Änderungen bei der Baugrundbeschreibung<br />
(ATV DIN 18319) die<br />
Analyse von Gefahrenquellen beim<br />
Rohrvortrieb sowie die Diskussion<br />
über Aspekte der Qualitätssicherung<br />
von der Planung bis zur Ausführung.<br />
Themen, bei denen der Güteschutz<br />
Kanalbau und die LGA Bautechnik<br />
an einem Strang ziehen.<br />
Beide Organisationen setzen sich<br />
für Qualität und Qualifikation in diesem<br />
Bereich ein: der Güteschutz<br />
Kanalbau u.a. durch die Prüfung der<br />
Bieterqualifikation nach RAL-GZ<br />
961; die LGA Bautechnik für Dienstleistungen<br />
bei Bodengutachten,<br />
Statik, Materialprüfung und Bauüberwachung.<br />
„Im Fokus beider Institutionen<br />
steht eine Verbesserung<br />
der Qualität beim Rohrvortrieb“,<br />
erklärte Dr.-Ing. Marco Künster,<br />
Geschäftsführer des Güteschutz<br />
Kanalbau, der die Veranstaltung<br />
gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Albert<br />
Hoch, TÜV Rheinland LGA Bautechnik<br />
GmbH, moderierte.<br />
Erfahrungen aus der Praxis<br />
Ziel der Veranstaltung sei es, den<br />
am Rohrvortrieb interessierten Personenkreisen<br />
ein Forum für den<br />
praxisbezogenen und regelmäßigen<br />
Austausch zu bieten. Dementsprechend<br />
stellten aktuelle Informationen<br />
zu Regelwerken, technische<br />
Weiterentwicklungen und Berichte<br />
über Vortriebsmaßnahmen den Praxisbezug<br />
her. Ebenso wie die Erfahrungsberichte<br />
zum Thema Ausschreibung<br />
und Qualitätssicherung<br />
bei Rohrvortriebsmaßnahmen. Eine<br />
begleitende Ausstellung der beteiligten<br />
Industrie gab Auftraggebern<br />
und Fachfirmen die Gelegenheit,<br />
den Erfahrungsaustausch zu intensivieren<br />
und das berufliche Netzwerk<br />
zu pflegen.<br />
Erfolgreiche Vortriebsmaßnahmen<br />
hängen von der Qualität der<br />
Verfahren und Produkte ebenso ab,<br />
wie von der Qualifizierung der handelnden<br />
Personen – von der Planung<br />
bis zur Ausführung. Das war<br />
immer wieder Thema der Vorträge<br />
und Gespräche. So machte Dipl.-<br />
Ing. Tim Barbendererde, Barbendererde<br />
Engineers GmbH, in seinem<br />
Vortrag über „Gedanken, Wunsch<br />
und Realität – von der Ausschreibung<br />
zur Ausführung“, deutlich,<br />
dass bei manchen Vortriebsprojekten<br />
zwischen Anspruch und Wirklichkeit<br />
durchaus eine Lücke klafft.<br />
Sachverstand gefragt<br />
Bei der Durchführung von technisch<br />
anspruchsvollen Vortriebsarbeiten<br />
ist Sachverstand gefragt. Das gilt für<br />
die Planung ebenso wie für die<br />
Erstellung des erforderlichen Baugrundgutachtens.<br />
Doch hier fehlt es<br />
oft an der nötigen Erfahrung – so<br />
eine klare Botschaft des Vortrages.<br />
Dabei sind die entsprechenden<br />
Anforderungen festgelegt, etwa im<br />
Arbeitsblatt DWA-A 125 (Rohrvortrieb<br />
und verwandte Verfahren)<br />
oder der DIN 4020 (Geotechnische<br />
Untersuchungen für bautechnische<br />
Zwecke). Klare Vorgaben gibt es<br />
auch für die Leistungsbeschreibung,<br />
in der die Leistung so eindeutig<br />
und erschöpfend zu beschreiben<br />
ist, dass alle Bewerber die Beschreibung<br />
im gleichen Maße verstehen<br />
müssen und ihre Preise sicher und<br />
ohne umfangreiche Vorarbeiten<br />
berechnen können (VOB A § 7 (1)).<br />
Verantwortlich sind alle<br />
Die Realität sieht jedoch anders aus:<br />
Unklare Leistungsbeschreibungen<br />
führen zu unklaren Angeboten. Die<br />
Folgen sind schwerwiegend. So -<br />
wohl in Bezug auf die Ausführungsqualität<br />
als auch hinsichtlich der<br />
Mai 2013<br />
514 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
FOKUS<br />
Auskömmlichkeit. Hoffentlich kommen<br />
wir durch und können Geld<br />
über Nachträge generieren, so die<br />
Hoffnung mancher Unternehmen.<br />
Laut Tim Barbendererde sind wir<br />
alle für diese Entwicklung verantwortlich.<br />
Es gilt Vorschriften zu<br />
beachten, Fachleute zu beauftragen,<br />
eine ordentliche Bauvorbereitung<br />
durchzuführen und klare<br />
Dokumentationen zu erstellen – so<br />
der Appell des Referenten.<br />
Gefahren analysiert<br />
Dass bei Planung, Ausschreibung<br />
und Ausführung von Vortriebsmaßnahmen<br />
durchaus nicht immer alle<br />
Beteiligten auf dem gleichen Kenntnisstand<br />
sind, weiß auch Dipl.-Ing.<br />
Stephan Tolkmitt, einer der vom<br />
Güteausschuss der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau beauftragten Prüfingenieure.<br />
In seinem Vortrag analysierte<br />
er Gefahrenquellen beim<br />
Rohrvortrieb und gab Beispiele aus<br />
der Praxis. Nur dauerhaft intakte<br />
und dichte Kanäle ermöglichen<br />
letztlich tragbare Entsorgungskosten<br />
– hierin ist sich Tolkmitt mit seinem<br />
Kollegen Dipl.-Ing. Dieter<br />
Walter einig, der ebenfalls als Prüfingenieur<br />
für die Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau tätig ist. „Angesichts dieser<br />
Tatsache und der von schadhaften<br />
Kanälen ausgehenden Umweltbeeinträchtigungen<br />
ist eine zu -<br />
verlässige Qualitätssicherung im<br />
Kanalbau besonders wichtig“, so<br />
Walter. Auftraggeber berücksichtigen<br />
dies insbesondere durch<br />
Sicherstellung der Qualifikation der<br />
ausführenden Unternehmen. Dazu<br />
haben sie als gemeinsames Instrument<br />
die Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
geschaffen.<br />
Gemeinsam für Qualität<br />
Bei der Gütesicherung Kanalbau<br />
handelt es sich um ein System, das<br />
von Auftraggebern und Auftragnehmern<br />
gleichberechtigt getragen<br />
wird. Gemeinsam wird das Thema<br />
Ausführungsqualität angegangen –<br />
mit abgestimmten Anforderungen<br />
und den Elementen Selbstverpflichtung<br />
der Gütezeicheninhaber, Neutralität<br />
bei der Bewertung sowie<br />
Beratung und Schulung. Da Auftraggeber<br />
bei der RAL-Gütesicherung<br />
Kanalbau mitwirken, vertrauen sie<br />
diesem System und nutzen es in<br />
immer größerer Zahl.<br />
Auftraggeber führen die Bewertung<br />
der Qualifikation von Auftragnehmern<br />
auf Grundlage der Bewertung<br />
durch den neutralen Güteausschuss<br />
durch.<br />
In den Güte- und Prüfbestimmungen<br />
RAL-GZ 961 finden sich<br />
detaillierte Anforderungen an die<br />
Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit<br />
und technische Zuverlässigkeit<br />
der Bieter sowie die Dokumentation<br />
der Eigenüberwachung. Sie<br />
werden regelmäßig angepasst und<br />
überarbeitet – so auch in Bezug auf<br />
Ausschreibung und Bauüberwachung,<br />
zum Beispiel im Bereich Vortrieb<br />
(ABV), aber auch in den Bereichen<br />
Offener Kanalbau (ABAK) und<br />
Sanierung (ABS). Ziel dieser Erweiterung<br />
ist es, die Umweltverträglichkeit<br />
von <strong>Abwasser</strong>leitungen und<br />
-kanälen durch eine qualitativ hochwertige<br />
Ausschreibung und Bauüberwachung<br />
zu verbessern.<br />
Dieser Mechanismus funktioniert<br />
in der Praxis. Zusätzliche Hilfestellung<br />
bietet das umfangreiche<br />
Dienstleistungspaket der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau, zu dem unter<br />
anderem die Broschüren „Rohrvortrieb<br />
– Herstellung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen in grabenloser<br />
Bauweise“ sowie „Leitfäden zur<br />
Eigenüberwachung bei Ausschreibung“<br />
und „Bauüberwachung“ von<br />
Rohrvortriebsarbeiten (Beurteilungsgruppe<br />
ABV) und bei der Ausführung<br />
entsprechender Arbeiten<br />
(Beurteilungsgruppen VP, VM/VMD,<br />
VO/VOD) gehören. Vor allem bei der<br />
Dokumentation der Eigenüberwachung<br />
bieten die Leitfäden eine<br />
hervorragende Arbeitsgrundlage.<br />
Instrumente wie diese können<br />
dazu beitragen, die verschiedenen<br />
Projektphasen – angefangen bei<br />
der Planung über die Ausschreibung<br />
bis zur Bauausführung – einfacher,<br />
strukturierter und im Sinne<br />
eines nachhaltigen Kanalbaus<br />
Im Rahmen der begleitenden Fachausstellung präsentierte<br />
die Gütegemeinschaft Kanalbau umfangreiches<br />
Informationsmaterial zum Thema Vortrieb.<br />
Eine qualifizierte Planung, Ausschreibung und Ausführung<br />
ist Voraussetzung für die erfolgreiche<br />
Durchführung von Vortriebsprojekten.<br />
erfolgsorientiert zu gestalten: Auch<br />
das war Tenor bei der Veranstaltung<br />
zum Rohrvortrieb in Nürnberg.<br />
Kontakt:<br />
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau,<br />
Postfach 1369, D-53583 Bad Honnef,<br />
Tel. (02224) 9384-0, Fax (02224) 9384-84,<br />
E-Mail: info@kanalbau.com,<br />
www.kanalbau.com<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Grasstraße 11 • 45356 Essen<br />
Telefon (02 01) 8 61 48-60<br />
Telefax (02 01) 8 61 48-48<br />
www.aquadosil.de<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 515
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
Anspruchsvolle Erschließung in Bad Krozingen<br />
Der Fund eines 5000 Jahre alten<br />
Kammergrabs und zweier Ge -<br />
bäude aus der Römerzeit in Bad Krozingen<br />
gilt unter Archäologen als<br />
Sensation. Und es belegt das, was<br />
man in der baden-württembergischen<br />
Stadt momentan gerne be -<br />
tont: dass Wohnen an diesem Ort<br />
schon immer sehr beliebt gewesen<br />
sei – und auch künftig sein werde.<br />
Ganz in der Nähe der Ausgrabungsstellen<br />
erschließt die Knobel<br />
Bau GmbH im Auftrag der Rüdiger<br />
Kunst-KommunalKonzept GmbH<br />
auf einer Fläche von 15 ha das Baugebiet<br />
„Kurgarten“. 7000 m Kanal,<br />
rund 1900 m Hausanschlussleitungen<br />
und 410 Schachtbauwerke<br />
müssen bis Ende August 2013<br />
fertig gestellt werden, damit die<br />
Errichtung der 450 Wohneinheiten<br />
für etwa 1000 Einwohner starten<br />
kann.<br />
Ein ambitioniertes Projekt, das im<br />
Freiburger Umland für Aufsehen<br />
sorgt, denn der neue Stadtteil wird<br />
10 % der Größe des Kernortes ausmachen.<br />
Qualität ist den Verantwortlichen<br />
dabei besonders wichtig,<br />
auch bei der unterirdischen Infrastruktur:<br />
Glasfaserkabel und Gasanschlüsse<br />
werden bis zu den einzelnen<br />
Wohneinheiten verlegt, Erdwärme<br />
kann genutzt werden, und<br />
für die Kanalbaumaßnahmen kommen<br />
HS®-Kanalrohre und Formteile<br />
von der Funke Kunststoffe GmbH<br />
zum Einsatz. Die bisher durchgeführten<br />
Dichtheitsprüfungen bestätigen<br />
dabei den ersten Eindruck der Tiefbauer:<br />
Das komplette System aus<br />
PVC-U bietet alle Lösungen vom<br />
Hausanschluss bis zum Sammler<br />
und verfügt über hervorragende<br />
bautechnische Eigenschaften.<br />
Als Ende Januar 2012 mit dem<br />
symbolischen Spatenstich der offizielle<br />
Startschuss für das Baugebiet<br />
„Kurgarten“ in Bad Krozingen fiel,<br />
rollten im Hintergrund schon die<br />
ersten Baufahrzeuge über die Felder.<br />
In Spitzenzeiten arbeiteten<br />
20 Mann und acht Bagger in fünf<br />
Kolonnen auf der Baustelle. Kein<br />
Wunder, denn es sollte vorangehen.<br />
Ende August 2013 wollen die Bauherren<br />
auf der 15 ha großen Fläche<br />
mit der Errichtung der Reihen-, Einund<br />
Zweifamilienhäuser der Wohnund<br />
Geschäftsgebäude sowie der<br />
Villen beginnen.<br />
Ein neues Stadtviertel<br />
entsteht<br />
Es ist ein prestigeträchtiges Vorhaben,<br />
das Bad Krozingen nachhaltig<br />
verändern wird Dipl.-Ing. (FH) Stephan<br />
Lemper, Abteilungsleiter Tiefbau<br />
des Bauamtes, erläutert: „Was<br />
da auf der grünen Wiese passiert, ist<br />
eines der derzeit größten Städtebauprojekte<br />
im Freiburger Umland.<br />
Hier entsteht ein neues Viertel mit<br />
rund 1000 Einwohnern – eine<br />
Größe, die 10 % des Kernortes<br />
beträgt.“ Besonders attraktiv sei die<br />
Siedlung nach Ansicht der Stadt<br />
durch den angrenzenden Kurgarten,<br />
aber auch durch die Nähe zum<br />
Bahnhof mit Direktanschluss an<br />
Freiburg und Basel.<br />
Rüdiger Kunst, der mit seiner<br />
Rüdiger Kunst-KommunalKonzept<br />
GmbH mit der Gesamtkoordination<br />
des Baugebietes betraut ist, erzählt:<br />
„Das Gebiet wird durchzogen sein<br />
von einer breiten, boulevardähnlich<br />
gestalteten Grünachse mit Fuß- und<br />
Radwegen sowie attraktiven Auf-<br />
Für die Hausanschlussleitungen kommen HS ® -<br />
Kanalrohre DN/OD 160 der Funke Kunststoffe GmbH<br />
in blau für Regenwasser und braun für Schmutzwasser<br />
zum Einsatz. © Funke Kunststoffe GmbH<br />
Auf der „grünen Wiese“ entsteht in Bad Krozingen die unterirdische<br />
Infrastruktur für das neue Stadtviertel „Kurgarten“. In Spitzenzeiten<br />
waren 20 Mann und acht Bagger gleichzeitig im Einsatz, um das<br />
ambitionierte Projekt voranzubringen. © Knobel Bau GmbH<br />
Mai 2013<br />
516 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
FOKUS<br />
enthaltsmöglichkeiten. Im nördlichen<br />
Teil des Kurparks entsteht<br />
ein See mit einer Naturzone sowie<br />
einem Spiel- und Erholungsbereich<br />
zur Aufwertung des Baugebietes<br />
und des Kurparks.“<br />
7000 m Kanal,<br />
4600 m <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
Bis es allerdings so weit ist, liegt vor<br />
den Beteiligten noch ein gutes<br />
Stück Arbeit. In Zahlen ausgedrückt<br />
sieht es so aus, wie Bauleiter Dipl.-<br />
Ing. (FH) Andreas Knobel beschreibt:<br />
„Wir verlegen hier insgesamt 7000 m<br />
Kanal und 4600 m <strong>Wasser</strong>leitungen.<br />
Dafür sind umfangreiche Materialbewegungen<br />
nötig, unter anderem<br />
zählen 30 000 m³ Rohrgrabenaushub,<br />
13 000 m³ Teichaushub, 8000 m³<br />
Frostschutzkies, 10 000 m² Asphalt<br />
und 6 300 m Granitsteine hierzu.“<br />
Die Knobel Bau GmbH hat den<br />
Zuschlag für die Entwässerung,<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung und den Straßenbau<br />
erhalten. Knobel: „Das ist<br />
das bislang größte Einzelbauprojekt<br />
in unserer 65 Jahre währenden Firmengeschichte.“<br />
Dass die Arbeiten so gut vorangegangen<br />
sind, liegt an dem Engagement<br />
aller Beteiligten, aber auch<br />
an den Produkten, die es den<br />
Tiefbauern erleichtern, ordentlich<br />
Meter zu machen. „Zum Einsatz<br />
kommen für den Schmutzwassersammler<br />
2 300 m HS ® -Kanalrohre<br />
Nennweitenbereich von DN/OD 250<br />
bis 630“, zählt Planer Dipl.-Ing. (TH)<br />
Peter Stangwald, Ingenieurbüro<br />
Raupach & Stangwald, auf. Nur in<br />
höheren Nennweitenbereichen zwischen<br />
DN 700 und 1000 setzen die<br />
Bad Krozinger für den Regenwasserkanal<br />
Stahlbetonrohre ein. „Im<br />
Hausanschlussbereich dagegen<br />
werden ebenfalls PVC-U-Rohre –<br />
insgesamt 1900 m – in der Nennweite<br />
DN/OD 160 verlegt“, so Stangwald<br />
weiter.<br />
Ebenso wie Planer Stangwald ist<br />
Bauleiter Knobel von den Vorteilen<br />
der Funke-Produkte begeistert:<br />
„Durch das geringe Eigengewicht<br />
können wir im Nennweitenbereich<br />
bis DN/OD 250 neben den Dreiauch<br />
Fünfmeterrohre verlegen. So<br />
geht es auf der Baustelle schnell<br />
voran.“ Doch Geschwindigkeit ist ja<br />
auf Baustellen nicht das alleinige<br />
Kriterium. Wichtiger noch ist die<br />
Sicherheit. Und dafür, dass die Rohrverbindungen<br />
dicht sind, sorgen<br />
Ausstattungsmerkmale, wie zum<br />
Beispiel die fest eingelegte FE®-<br />
Dichtung der HS®-Kanalrohre.<br />
Funke-Fachberater Jürgen Gäßler<br />
erklärt die Funktion: „Dadurch, dass<br />
die Dichtung fest integriert ist, ist<br />
ein Vergessen, Herausdrücken oder<br />
Verschieben bei der Montage ausgeschlossen.“<br />
Flexibilität und Gelenkigkeit<br />
von der Funke Kunststoffe GmbH in Während die Tiefbauer in Bad Krozingen<br />
11:29 die Uhr HS ® -Kanalrohre Seite 1 in den<br />
KLINGER-Anzeigen_2:Layout der Nennweite DN/OD 1 250 21.03.2013 und<br />
für den Regenwassersammler insgesamt<br />
2 100 m HS ® -Kanalrohre im HS ® -Abzweigs einbinden, kommt<br />
kleineren Nennweiten mithilfe des<br />
▶▶<br />
Die Farbe macht eine einfache Zuordnung auch nach<br />
Jahrzehnten noch problemlos möglich: Mit HS ® -<br />
Kanalrohren in Blau wird der Regenwassersammler<br />
verlegt. © Funke Kunststoffe GmbH<br />
Bei kleinen Nennweiten binden die Tiefbauer in Bad<br />
Krozingen den Schmutzwassersammler mithilfe<br />
eines HS ® -Abzweigs ein. © Funke Kunststoffe GmbH<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 517
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
beim Einbinden der Rohre in den<br />
Sammler der CONNEX-Anschluss<br />
zum Einsatz. Das Besondere: Das<br />
Bauteil verfügt über ein integriertes<br />
Kugelgelenk. Gäßler: „Es sorgt da -<br />
für, dass angeschlossene Rohre in<br />
einem Bereich von 0° bis 11°<br />
schwenkbar sind. Damit erfüllt der<br />
CONNEX-Anschluss die Anforderungen<br />
der DWA-A 139 (Einbau- und<br />
Prüfung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen), wonach Anschlussleitungen<br />
so hergestellt und angeschlossen<br />
werden müssen, dass sie<br />
Bewegungen aufnehmen können.<br />
Was Bauherren freut: Die deutlich<br />
erhöhte Flexibilität und Gelenkigkeit<br />
trägt außerdem entscheidend<br />
dazu bei, dass neu verlegte<br />
Haus anschlussleitungen über die<br />
Baubesprechung vor Ort. Von links: Funke-Fachberater<br />
Jürgen Gäßler, Dipl.-Ing. (FH) Stephan Lemper,<br />
Abteilungsleiter Tiefbau des Bauamtes Bad Krozingen,<br />
Bauleiter Dipl.-Ing (FH) Andreas Knobel von der<br />
Knobel Bau GmbH, Planer Dipl.-Ing. (TH) Peter<br />
Stangwald und Baggerfahrer Michael Ehrler von der<br />
Firma Knobel. © Knobel Bau GmbH<br />
ge wünschte Ausführungsqualität<br />
und lange Lebensdauer verfügen.<br />
Bei den Tiefbauern kommt der<br />
Systemcharakter der Funke-Rohre,<br />
Form- und Sonderteile gut an. Sie<br />
seien – da sind sich die Praktiker<br />
einig – wirtschaftlich einsetzbar, flexibel<br />
auf der Baustelle zu handhaben<br />
und gut zu verarbeiten. Aber<br />
auch die logistische Planung ist einfach,<br />
wie Betriebswirt (itb) Andreas<br />
Hechinger von der Einkaufsleitung<br />
bei der Knobel Bau GmbH betont:<br />
„Alle Teile kommen aus einer Hand.<br />
Somit passen sie nicht nur ideal aufeinander,<br />
sondern sind auch noch<br />
leicht zu ordern.“<br />
Auf Nummer sicher<br />
Inzwischen sind die Regen- und<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen im Baugebiet<br />
verlegt. Die Tiefbauer hatten Gelegenheit,<br />
die Dichtheit der Verbindungen<br />
zu prüfen. Und das sogar<br />
gleich mehrfach: „Wir haben ein<br />
eigenes Prüfgerät. Damit haben wir<br />
die Leitungen zusätzlich zu den offiziellen<br />
Prüfungen unter die Lupe<br />
genommen“, erzählt Bauleiter Knobel.<br />
Und er fügt begeistert hinzu:<br />
„Die Rohre haben die Prüfungen<br />
immer bestanden. Das ist ein<br />
zusätzliches, dickes Plus für die Produkte.“<br />
Da das Baugebiet deutlich höher<br />
liegt als der angrenzende Kurpark,<br />
haben die Planer vom Ingenieurbüro<br />
Raupach & Stangwald auf dem<br />
Baugelände einen Teich vorgesehen,<br />
der mit einer Grundfläche von<br />
rund 13 000 m 2 als Vorfluter für das<br />
Regenwasser dienen soll.<br />
Das ist aber nicht die einzige<br />
Besonderheit auf der Baustelle in<br />
Bad Krozingen. Im Zuge der Vorbereitungen<br />
für das Baugebiet fand<br />
man nur 20 bis 50 cm unter der<br />
Oberfläche ein 5000 Jahre altes<br />
Kammergrab sowie zwei Gebäude<br />
aus der Römerzeit. Aufgrund der<br />
archäologischen Funde und der<br />
daraufhin begonnenen Grabungsarbeiten<br />
wurde die Verlegung der<br />
Kanäle an dieser Stelle kurzerhand<br />
umgeplant. „Die Fundstelle ist im<br />
Grüngürtel am Rande des Neubaugebietes<br />
und hat das gesamte<br />
Projekt zum Glück nicht infrage<br />
gestellt“, erläutert Stephan Lemper,<br />
Abteilungsleiter Tiefbau, Bauamt<br />
Bad Krozingen. Jetzt will Bad Krozingen<br />
die Funde auch der Allgemeinheit<br />
besser zugänglich machen.<br />
Derzeit wird geprüft, wie diese<br />
denkmalgeschützten Bereiche in<br />
das neue Baugebiet eingebunden<br />
werden können. So soll die Jahrtausende<br />
alte Geschichte erlebbar<br />
gemacht werden. Das Viertel „Kurgarten“<br />
jedenfalls wird bald ebenfalls<br />
Teil der (neuen) Stadtgeschichte<br />
Bad Krozingens sein.<br />
Kontakt:<br />
Funke Kunststoffe GmbH,<br />
Siegenbeckstraße 15,<br />
D-59071 Hamm-Uentrop,<br />
Tel. (02388) 3071-0, Fax (02388) 3071-550,<br />
E-Mail: info@funkegruppe.de,<br />
www.funkegruppe.de<br />
Ihre Hotlines für <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Redaktion<br />
Mediaberatung<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, München<br />
Inge Matos Feliz, München<br />
Telefon +49 89 2035366-33 Telefon +49 89 2035366-22<br />
Telefax +49 89 2035366-99 Telefax +49 89 2035366-99<br />
e-mail: ziegler@di-verlag.de<br />
e-mail: matos.feliz@di-verlag.de<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Leserservice <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Brigitte Krawczyk, München<br />
Postfach 9161, 97091 Würzburg Telefon +49 89 2035366-12<br />
Telefon +49 931 4170-1615 Telefax +49 89 2035366-99<br />
Telefax +49 931 4170-494<br />
e-mail: krawczyk@di-verlag.de<br />
e-mail: leserservice@di-verlag.de<br />
Wenn Sie spezielle Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne.<br />
Mai 2013<br />
518 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
FOKUS<br />
Top-Ergebnis in Top-Zeit<br />
<strong>Abwasser</strong>druckleitung in Ravenna saniert<br />
Als um 04.00 Uhr morgens der<br />
Schieber an der Druckleitung<br />
geöffnet wurde und das <strong>Abwasser</strong><br />
wieder von Ravenna in Richtung<br />
Kläranlage gepumpt werden konnte,<br />
atmeten die beteiligten Baupartner<br />
auf: In einem äußerst knappen<br />
Zeitfenster von nur 24 Stunden<br />
hatte die ROTECH Srl, ein ital. Tochterunternehmen<br />
der DIRINGER &<br />
SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GMBH<br />
& CO. KG, einen rund 82 m langen<br />
Abschnitt der <strong>Abwasser</strong>druckleitung<br />
in der Nennweite DN 500<br />
saniert, der unter einer 4-spurigen<br />
Umgehungsstraße verläuft. Bei der<br />
Sanierungsmaßnahme, die im Auftrag<br />
der Comune di Ravenna ausgeführt<br />
wurde, kam mit dem RS-Blue-<br />
Liner® ein Verfahren zum Einsatz,<br />
das in der Kombination mit einer<br />
leistungstarken Anlagentechnik zu<br />
einem hervorragenden Sanierungsergebnis<br />
führte. Dazu beigetragen<br />
haben auch die Werkstoffeigenschaften<br />
des im Verbund gefertigten<br />
elastischen Glas-Filz-Schlauches,<br />
dessen Bogengängigkeit den<br />
Einsatz in Bögen bis 45° möglich<br />
macht.<br />
Nachdem bei einer routinemäßig<br />
durchgeführten Revision Un -<br />
dichtigkeiten an der Druckrohrleitung<br />
im Bereich des Fahrbahn-<br />
Damms der Umgehungsstraße festgestellt<br />
worden waren, war die<br />
Entscheidung zu einer zügigen<br />
Sanierung schnell gefallen – zumal<br />
die Leitung im Grundwasserbereich<br />
verläuft. Vor allem um den Verkehr<br />
auf der vielbefahrenen Straße aufrechterhalten<br />
zu können, entschied<br />
sich der Auftraggeber für das<br />
BlueLine ® -Verfahren, ein grabenloses<br />
Sanierungsverfahren, bei dem<br />
ein glasfaserverstärkter Nadelfilzliner<br />
mit einem Zweikomponenten-<br />
Epoxidharz imprägniert, in die<br />
Druckleitung eingebracht und an -<br />
schließend durch Wärmezufuhr zu<br />
einem neuen Rohr ausgehärtet wird.<br />
In einem äußerst knappen Zeitfenster von nur 24 Stunden konnte ein 82 m langer<br />
Abschnitt der <strong>Abwasser</strong>druckleitung in der Nennweite DN 500 unter der 4-spurigen<br />
Um gehungsstraße saniert werden. Alle Abbildungen: © DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG<br />
Die moderne Schlauchlinertechnologie,<br />
die unter anderem als einziges<br />
Produkt eine Trinkwasserzulassung<br />
besitzt, wird von der RS Aqua GmbH<br />
hergestellt und ist in Nennweitenbereichen<br />
von DN 100 bis DN 1000 mm<br />
einsetzbar. Unter wirtschaftlichen<br />
Aspekten konnte das Verfahren<br />
ebenfalls punkten: Konventionelle<br />
Alternativen wie Bohren oder Pressen<br />
wären beide deutlich aufwendiger<br />
und teurer gewesen, heißt es<br />
von Auftraggeberseite. Auch Druckrohr-Liner<br />
der Klasse C, die mit dem<br />
Altrohr verklebt werden, konnten<br />
aufgrund der Zementmörtel-Be -<br />
schichtung nicht eingesetzt werden.<br />
Modernste Anlagentechnik<br />
Die komplette BlueLine®-Anla gentechnik<br />
ist auf einem vollständig<br />
ausgebauten Fahrzeug angeordnet.<br />
In dieser mobilen Tränk- und Mischanlage<br />
erfolgen die Dosierung und<br />
luftfreie Mischung der Harzkomponenten<br />
sowie die Imprägnierung<br />
des Liners direkt vor Ort an der Einbaustelle.<br />
Dipl.-Ing. (FH) Jens Wahr,<br />
DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIE-<br />
RUNG GMBH & CO. KG, der die Baumaßnahme<br />
vor Ort betreute, be -<br />
zeichnet die Tränkanlage der D&S<br />
Rohrsanierung als die modernste<br />
ihrer Art. „Am Steuerpanel definiert<br />
der Tränkmeister die Parameter der<br />
▶▶<br />
Nach der Trennung des Rohrstranges setzten die<br />
Arbeiter Passstücke und Absperrschieber ein. Nach<br />
dem Absaugen des <strong>Abwasser</strong>s und dem anschließenden<br />
Ausbau der Passstücke begann dann der eigentliche<br />
Sanierungsvorgang.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 519
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
Nach Tränken und Auftrommeln wurde der RS-Blue-<br />
Liner ® mit Druckluft in die Haltung eingeblasen.<br />
Am Steuerpanel definiert der Tränkmeister die Parameter<br />
der zu sanierenden Rohrleitung und die Software<br />
erstellt vollautomatisch eine Harzmischung in<br />
exakt berechneter Menge.<br />
Beim BlueLine ® -Verfahren wird ein glasfaserverstärkter<br />
Nadelfilzliner mit einem Zweikomponenten-<br />
Epoxidharz imprägniert, in die Druckleitung eingebracht<br />
und anschließend durch Wärmezufuhr zu<br />
einem neuen Rohr ausgehärtet.<br />
zu sanierenden Rohrleitung und die<br />
SPS-Software erstellt vollautomatisch<br />
eine Harzmischung in exakt<br />
berechneter Menge“, erläutert der<br />
Bauleiter aus der Niederlassung<br />
Herne, die als Kompetenzzentrum<br />
für die BlueLine-Technik gilt. Nebenbei<br />
werden die Kalibrierwalzen<br />
gesteuert, die Füllstände der Komponenten-Tanks<br />
überwacht und<br />
deren Temperaturen auf optimalem<br />
Niveau gehalten. „Tränktisch und<br />
Kalibrierwalzen sind auf Nennweiten<br />
bis DN 1 000 ausgelegt und<br />
durch die modulare Bauform der<br />
Anlage sind uns in Sachen maximaler<br />
Schlauchlänge keinerlei Grenzen<br />
gesetzt“, nennt Wahr weitere Vorteile<br />
der Anlage.<br />
Gemeinsame<br />
Projektentwicklung<br />
Die größten Herausforderungen bei<br />
der Sanierungsmaßnahme in der<br />
Emilia Romagna ergaben sich allerdings<br />
aus den Rahmenbedingungen,<br />
unter denen die Arbeiten<br />
ablaufen mussten. Entsprechend<br />
des Bauzeitenplans wurden etwa<br />
zwei Wochen vor dem Einzug des<br />
Schlauchliners zu beiden Seiten des<br />
Straßendamms die Baugruben ausgehoben<br />
und die Druckleitung freigelegt.<br />
Nach der Trennung des<br />
Rohrstranges setzten die Arbeiter<br />
Passstücke und Absperrschieber<br />
ein, mit denen der Durchfluss des<br />
<strong>Abwasser</strong>s in dem zu sanierenden<br />
Abschnitt unterbunden werden<br />
konnte. Für die eigentliche Sanierung<br />
stand nach Vorgabe des Auftraggebers<br />
dann lediglich ein Zeitfenster<br />
von 24 Stunden zur Verfügung.<br />
„Ausschlaggebend hierfür<br />
waren in erster Linie technische<br />
Gründe beim Betrieb der Kläranlage“,<br />
so ein Sprecher des Auftraggebers.<br />
Zudem mussten die Arbeiten<br />
in einer Trockenwetterphase<br />
ausgeführt werden. „Deshalb wurde<br />
das Projekt in zwei Phasen unterteilt“,<br />
so der Bauherr weiter. In der<br />
ersten Phase entwickelten die Baupartner<br />
gemeinsam die Strategie<br />
für den Ablauf der Sanierungsarbeiten,<br />
angefangen bei der Außerbetriebnahme<br />
und dem Leeren der<br />
Leitung über die Trennung des zu<br />
sanierenden Teilstücks vom Netz,<br />
den Ab lauf von Reinigung und TV-<br />
Inspektion zur Zustandserfassung,<br />
der Kalibrierung zur Nennweitenbestimmung,<br />
dem Einbau der Schieber<br />
und der Anpassung dem Einbau<br />
der beid seitig geflanschten Passstücke<br />
bis hin zur Wiederinbetriebnahme<br />
der Druckrohrleitung. Nach<br />
der Bemessung und Bestellung des<br />
Schlauches – seine Produktion<br />
erfolgte innerhalb von nur zwei<br />
Wochen – begann mit der Festlegung<br />
des Einbautermins und der<br />
Zusammen stellung der Baustelleneinrichtung<br />
die eigentliche Sanierungsphase.<br />
„Ein Sanierungsprojekt<br />
ohne jeglichen Zeitpuffer ist immer<br />
eine aufregende Sache – aber die<br />
Kollegen von ROTECH haben alles<br />
bis ins Detail geplant und die Baustellentechnik<br />
mit ausreichend<br />
Sicherheiten ausgestattet“, berichtet<br />
Jens Wahr. „Wir haben sogar<br />
eine Ersatz-Anlage vorgehalten, da<br />
konnte eigentlich gar nichts mehr<br />
schief gehen.“<br />
Gewerke griffen wie<br />
Zahnräder ineinander<br />
Mit dem Absaugen des <strong>Abwasser</strong>s<br />
über einen Entleerungsstutzen und<br />
dem anschließenden Ausbau der<br />
Passstücke begann dann der eigentliche<br />
Sanierungsvorgang. Während<br />
der Leitungsabschnitt vor und nach<br />
der Reinigung mit der TV-Kamera<br />
befahren wurde, wurde der<br />
Schlauch bereits getränkt und aufgetrommelt.<br />
Danach wurde der<br />
Liner mit Druckluft in die Haltung<br />
eingeblasen. Nach Erreichen der<br />
Zielgrube erfolgte anschließend die<br />
Aushärtung durch Wärmezufuhr zu<br />
einem neuen, statisch selbsttragenden<br />
Rohr. „Auch bei diesem Vorgang<br />
macht sich die moderne Anlagentechnik<br />
bezahlt, vor allem in Bezug<br />
auf das knapp bemessene Zeitfenster“,<br />
erinnert sich Karl-Heinz Robatscher,<br />
Geschäftsführer ROTECH Srl.<br />
„Durch die Leistungsfähigkeit un -<br />
serer Dampfanlage hatten wir einen<br />
hervorragenden Energieeintrag ins<br />
Mai 2013<br />
520 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
FOKUS<br />
Laminat und erreichten bereits nach<br />
kürzester Zeit hohe Temperaturen,<br />
sodass die in der Planungsphase<br />
angesetzte Aushärtezeit deutlich<br />
reduziert werden konnte.“<br />
Nach dem Aushärten des BlueLiners®<br />
und dem Wiedereinbau der<br />
Passstücke konnten die Schieber<br />
geöffnet werden. Während der Bauphase<br />
griffen die einzelnen Zahnräder<br />
nahtlos ineinander und alles<br />
verlief wie geplant und zur vollsten<br />
Zufriedenheit des Auftraggebers.<br />
Bei diesem Einsatz kam es auf jede<br />
Minute an. Die einzelnen Herstellungsphasen<br />
des Liners sowie das<br />
Wechselspiel zwischen den einzelnen<br />
Gewerken wurde im Vorfeld auf<br />
die Viertelstunde genau geplant.<br />
„Kaum auszudenken, was Verzögerungen<br />
in der Fertigstellung für die<br />
angeschlossene Kläranlage bedeutet<br />
hätten“, stellt Karl-Heinz Robatscher<br />
in seiner persönlichen Bilanz<br />
fest. „Als dann auch noch der Regen<br />
einsetzte, war es für alle eine Erleichterung,<br />
dass wir aufgrund der akribischen<br />
Vorplanung und der Leistung<br />
des eingespielten Teams fast<br />
zwei Stunden vor der geplanten<br />
Zeit fertig wurden.“<br />
Kontakt:<br />
DIRINGER & SCHEIDEL<br />
ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG,<br />
Wilhelm-Wundt-Straße 19,<br />
D-68199 Mannheim,<br />
Tel. (0621) 8607 440,<br />
Fax (0621) 8607 449,<br />
E-Mail: zentrale.rohrsan@dus.de,<br />
www.dus-rohrsanierung.de<br />
Lösungen aus duktiLem guss<br />
nachhaltig überlegen<br />
informieren sie sich im internet unter www.duktus.com<br />
GWF Mai 13.indd 1 20.02.2013 19:47:25<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 521
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
Die Betonbauwerke<br />
einer<br />
Kläranlage<br />
sind durch<br />
vielschichtige<br />
Reinigungsprozesse<br />
und verschiedene<br />
<strong>Wasser</strong>qualitäten<br />
potenziellen<br />
Gefahren<br />
ausgesetzt.<br />
Alle Abbildungen:<br />
© Sika Deutschland<br />
GmbH<br />
Optimaler Schutz für stark beanspruchte<br />
<strong>Abwasser</strong>bauwerke<br />
Die wichtigsten Schritte beim<br />
Bau von kommunalen <strong>Abwasser</strong>bauwerken<br />
sind eine fundierte<br />
Planung, die fachgerechte Verarbeitung<br />
sowie eine dichte und dauerhafte<br />
Bauweise, vorzugsweise aus<br />
beständigem Beton. Im Laufe der<br />
Jahre werden dennoch häufig<br />
Beim Klärprozess folgt die biologische auf die mechanische<br />
Reinigung. Dabei werden grobe Verschmutzungen<br />
aus dem <strong>Abwasser</strong> entfernt. Durch die im<br />
<strong>Abwasser</strong> enthaltenen Feststoffe entsteht im mechanischen<br />
Bereich der Klärbecken häufig Abrasion.<br />
Schutz- oder Instandsetzungsmaßnahmen<br />
notwendig, denn gerade<br />
Klärbecken und <strong>Abwasser</strong>netze<br />
unterliegen vielseitigen Beanspruchungen.<br />
Der Bauchemie-Hersteller<br />
Sika Deutschland bietet mit seiner<br />
breiten Produktpalette ganzheitliche<br />
Lösungen für den nachhaltigen<br />
Schutz von <strong>Abwasser</strong>bauwerken –<br />
von der Betoninstandsetzung über<br />
den Oberflächenschutz, Bauwerksinjektion<br />
und Hohlraumverguss bis<br />
hin zu Fugen- und Rissabdichtung<br />
sowie Sohlplattenverklebung.<br />
Höchste Beanspruchung<br />
für Klärbecken und<br />
<strong>Abwasser</strong>kanäle<br />
Durch vielschichtige Reinigungsprozesse<br />
und diverse <strong>Wasser</strong>qualitäten<br />
sind die Betonbauwerke einer<br />
Kläranlage potenziellen Gefahren<br />
ausgesetzt. Dazu gehören unter<br />
anderem die Leer- und Füllzyklen<br />
der Becken, der Angriff durch<br />
aggressive Abwässer und die Befahrung<br />
der Beckenkrone durch die<br />
Räumerbrücke. Starke Auswaschungen<br />
des Konstruktionsbetons kommen<br />
besonders in der <strong>Wasser</strong>wechselzone<br />
der Becken mit biologischer<br />
Reinigung vor, während Abrasion<br />
im mechanischen Bereich der Klärbecken<br />
zu finden ist, beispielsweise<br />
in Sandfängen und Schneckenpumpwerken.<br />
Vor allem an den<br />
Innenseiten der Faultürme ist der<br />
Beton chemischen Angriffen in<br />
Form von biogener Schwefelsäurekorrosion<br />
(BSK) ausgesetzt, da es<br />
sich dabei um einen geschlossenen<br />
Kreislauf handelt.<br />
Im unterirdischen <strong>Abwasser</strong>-<br />
Transportsystem wird zwischen<br />
begehbaren und nicht begehbaren<br />
Kanälen unterschieden: Die Durchmessergrößen<br />
der Rohre variieren<br />
zwischen 30 cm und 4 m, ab 80 cm<br />
Durchmesser gelten sie als begehbar.<br />
In Deutschland sind dies rund<br />
75 000 Kilometer. Für die Innenauskleidung<br />
können beispielweise<br />
Mai 2013<br />
522 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
FOKUS<br />
Für die Innenauskleidung von begehbaren Kanälen<br />
können beispielweise keramische Sohlplatten oder<br />
Klinkermauerwerk eingesetzt werden. Die Instandsetzung<br />
erfolgt mit den entsprechenden Betonersatzund<br />
Oberflächenschutzsystemen.<br />
Die Betonersatzsysteme, die für den Schutz oder die<br />
Instandsetzung von <strong>Abwasser</strong>bauwerken zum Einsatz<br />
kommen, werden je nach dem erforderlichen<br />
Reprofilierungsausmaß im Spritzverfahren (SPCC)<br />
oder manuell appliziert (PCC). Für beide Anwendungen<br />
bietet Sika die 1-komponentigen Systeme der<br />
Sika MonoTop- und Sika Kanal-Produktreihe zum<br />
Reprofilieren und Egalisieren an.<br />
keramische Sohlplatten oder Klinkermauerwerk<br />
eingesetzt werden.<br />
Die Instandsetzung erfolgt mit den<br />
entsprechenden Betonersatz- und<br />
Oberflächenschutzsystemen. Die<br />
übrigen Rohre werden per Roboter<br />
saniert und durch das sogenannte<br />
Liningverfahren ausgekleidet. Die<br />
Alternative hierzu ist die Gesamterneuerung.<br />
Spezifische Produktlösungen<br />
von Sika Deutschland<br />
Für den Schutz und die Betoninstandsetzung<br />
von Kläranlagen und<br />
begehbaren <strong>Abwasser</strong>kanälen stellt<br />
Sika Produktlösungen bereit, die<br />
sowohl auf die Schadensursachen<br />
als auch auf die Schädigungen<br />
selbst abgestimmt sind. So kommen<br />
bei der Instandsetzung immer<br />
Mörtelprodukte zum Einsatz, die<br />
Normalzement oder Zement mit<br />
einem hohen Sulfatwiderstand enthalten.<br />
Diese Betonersatzsysteme<br />
werden je nach dem erforderlichen<br />
Reprofilierungsausmaß im Spritzverfahren<br />
(SPCC) oder manuell<br />
appliziert (PCC). Für beide Anwendungen<br />
bietet Sika die 1-komponentigen<br />
Systeme der Sika Mono-<br />
Top- und Sika Kanal-Produktreihe<br />
zum Reprofilieren und Egalisieren<br />
an. Die Produkte der Sika Kanal-<br />
Reihe sind hoch sulfatbeständig. Für<br />
die maschinelle Applikation im Trockenspritzverfahren<br />
ist SikaCem<br />
Gunit-212 S als Betonersatz mit Normalzement<br />
besonders geeignet,<br />
während sich SikaCem Gunit-212 S<br />
(HS) durch einen hohen Sulfatwiderstand<br />
auszeichnet.<br />
Oberflächenschutz bei biogener<br />
Schwefelsäurekorrosion<br />
(BSK)<br />
Liegt eine biogene Schwefelsäurekorrosion<br />
vor, beispielsweise in ge -<br />
deckelten und geschlossenen Anlagen,<br />
wird der aufgebrachte Feinspachtel<br />
nach der Untergrundvorbereitung<br />
überarbeitet – mit dem<br />
hoch vernetzten EP-Harz Sika Permacor<br />
3326/EG-H, inklusive der<br />
Grundierung Sikagard-177 zur mo -<br />
deraten Rissüberbrückung auch in<br />
Kombination mit einem Sika-Spezialgewebe.<br />
Sind rissüberbrückende<br />
Eigenschaften erwünscht, wird der<br />
Einsatz der rasch härtenden PU-<br />
Flüssigfolie Sikalastic-844 XT empfohlen.<br />
Die Produkt- und Systemlösungen<br />
für <strong>Abwasser</strong>bauwerke von Sika<br />
Deutschland stehen für eine wirkungsvolle<br />
Prophylaxe sowie die<br />
Risse in Becken, Räumerlaufbahnen und Brüstungen<br />
müssen sorgfältig mit rissüberbrückenden Materialien<br />
beschichtet werden. Nur so können Folgeschäden<br />
an Beton und Stahl vermieden werden.<br />
zuverlässige Ursachenbekämpfung<br />
und Instandsetzung in diesen<br />
enorm beanspruchten Anwendungsbereichen.<br />
Kontakt:<br />
Sika Deutschland GmbH,<br />
Kornwestheimer Straße 103-107,<br />
D-70439 Stuttgart,<br />
Tel. (0711) 8009-0,<br />
Fax (0711) 8009-576<br />
E-Mail: info@de.sika.com,<br />
www.sika.de<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 523
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
Technische Daten<br />
Neue Technik mit hohem Nutzen<br />
Mobile Entwässerungsanlage für eine rasche und effiziente Bohrgutentsorgung<br />
Leistungsdaten der Bohrentwässerungsanlage:<br />
Maximale Bohrwasser-Leistung: 20 m 3 /h<br />
Maximaler Feststoff Austrag: 10 t/h<br />
Bei Erdsonden- und Brunnenbohrungen,<br />
beispielsweise in der<br />
Exploration oder Geothermie, finden<br />
Erdöffnungen auf mehrere<br />
100 m statt. Das anfallende Grundund<br />
Oberflächenwasser kommt<br />
unter hohem Druck an die Oberfläche<br />
(je Bohrstelle etwa 5–7 m 3 /h).<br />
Das Bohrwasser muss teilweise entspannt<br />
und immer entsorgt werden.<br />
Dies erzeugt in ökologischer und in<br />
ökonomischer Hinsicht jeweils zu -<br />
sätzlichen Aufwand.<br />
Traditionelle Entsorgungsverfahren<br />
arbeiten mit mehreren hintereinander<br />
geschalteten Absetz-<br />
(Sedimentations-)Behältern. Teilweise<br />
werden bis zu sechs Becken in<br />
Reihe geschaltet. Dafür werden insgesamt<br />
rund 100 m² Fläche benötigt.<br />
Je nach Lage der Bohrstelle<br />
muss ein natürliches Gefälle den<br />
Fluss zwischen den Becken garantieren,<br />
ansonsten müssen Pumpwerke<br />
installiert werden. Für Tankwagen<br />
muss eine Zufahrt zu den<br />
Becken möglich sein. Da das abfließende<br />
<strong>Wasser</strong> in die Kanalisation<br />
oder Umwelt entsorgt wird, muss<br />
die <strong>Wasser</strong>güte messtechnisch do -<br />
kumentiert und garantiert werden.<br />
Sediment, das in den Behältern<br />
zurückbleibt, wird von Fremdfirmen<br />
mit Tankwagen abtransportiert und<br />
entsorgt. In aller Regel hat das Sediment<br />
noch einen hohen <strong>Wasser</strong>anteil,<br />
was sich in Abfuhrmenge und<br />
Abfuhrkosten deutlich bemerkbar<br />
macht.<br />
Der Trockensubstanz-Anteil (TS)<br />
beträgt bei der traditionellen Me -<br />
thode der Entwässerung (Sedimentierung)<br />
nur etwa 5 %, der <strong>Wasser</strong>anteil<br />
ist mit 95 % noch sehr hoch.<br />
Die Abfuhrkosten liegen in einer<br />
Größenordnung von rund 80 bis<br />
120 €/m 3 – das ist für Bohrfirmen<br />
auf der Kostenseite spürbar und<br />
Die mechanische Ausführung der Bohrentwässerungsanlage:<br />
15-Fuß-Standard-Container Länge 4,5 m<br />
Breite 2,2 m<br />
Höhe 2,3 m<br />
Gewicht max. 4 t<br />
Option<br />
ausklappbare oder teleskopische Füße<br />
Sonderausführungen sind möglich.<br />
Anlagenschema. Eine kompakte Anlage mit integrierter Entwässerung<br />
trennt Sediment und <strong>Wasser</strong> sortenrein auf, die Güteprotokollierung<br />
erfolgt über eingebaute Messsensoren.<br />
demzufolge preisseitig bei den<br />
Kunden.<br />
Ein neues Verfahren, voll<br />
integriert in einen Container,<br />
verschafft Bohrfirmen Wettbewerbsvorteile<br />
(siehe Diagramm)<br />
Das ankommende Bohrgut wird als<br />
wässrige Lösung (mit Luftanteilen)<br />
in einer Entlastungskammer entspannt,<br />
die Luft wird abgetrennt<br />
und gefiltert abgeführt.<br />
Die Grobstoffe werden in einem<br />
Vibrationssieb ausgesiebt und als<br />
erste Feststofffraktion abgesondert.<br />
In der nachgeschalteten FlocFormer-Flockungsstufe<br />
werden die<br />
Schwebstoffe zu kompakten Pellets<br />
geformt, über ein Trommelsieb werden<br />
diese Pellets als zweite Feststofffraktion<br />
abgeführt. In einer<br />
automatisch zuschaltbaren Feinfilterstufe<br />
werden die Feinstschwebstoffe<br />
zurückgehalten. Nach einer<br />
messtechnischen Qualitätsdatenerfassung<br />
wird das Klarwasser in<br />
einem Klarwasserablauf in die Natur<br />
rückgeführt. Die Qualitätsdaten<br />
Mai 2013<br />
524 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
FOKUS<br />
werden als gültiger Nachweis zur<br />
Einhaltung der Grenzwerte (Ökologie)<br />
protokolliert.<br />
Mit der neuen Entwässerungsanlage<br />
wird der Trockensubstanzwert<br />
des abzutransportierenden<br />
Sediments auf rund 25 % erhöht, die<br />
Abfuhrmenge reduziert sich dementsprechend<br />
auf etwa 20 %. Auch<br />
die Abfuhrkosten reduzieren sich<br />
damit also auf ein Fünftel. Rein rechnerisch<br />
sind dies beispielsweise bei<br />
einer (bisherigen) Abfuhrmenge<br />
statt 200 m 3 x 100 € / m 3 = 20 000 €<br />
nur noch 4 000 €: Das ist eine Einsparung<br />
von 16 000 €.<br />
Ein wesentlicher Vorteil der An -<br />
lage ist die kompakte Bauform, sie<br />
ist mit etwa 20 m 2 Stellfläche (inkl.<br />
kleinem Sedimentcontainer) leicht<br />
neben der Bohrstelle zu platzieren.<br />
Der Abtransport des Sedimentes<br />
wird auf wenige Fahrten reduziert.<br />
Auf bisher fünf Tankwagenbewegungen<br />
kommt jetzt nur noch eine.<br />
Die Gesamtdauer der Bauarbeiten<br />
und die Bodenbelastungen der<br />
Grundstücke werden verringert.<br />
Das System ist für max. 20 m 3 /h ausgelegt,<br />
für bis zu drei Bohrstellen à<br />
7 m 3 im Parallelbetrieb.<br />
Ziel der Entwicklung war es,<br />
neben den technischen Leistungsdaten<br />
eine für die Bohrfachleute<br />
einfach und unkompliziert zu bedienende<br />
Anlage zur kontinuierlichen<br />
Entwässerung des anfallenden<br />
Bohrgutes anbieten zu können. Das<br />
verfahrenstechnische Know-how ist<br />
vollständig in eine leicht transportierbare<br />
Anlage integriert. Vor Ort<br />
muss nur noch der Schlauch der<br />
Bohrmaschine an den Container an -<br />
geschlossen, die Stromversorgung<br />
zugeführt (Normstecker) und der<br />
Hauptschalter betätigt werden. Das<br />
Abgabewasser kann, gereinigt und<br />
klar, direkt in die Kanalisation entlassen<br />
werden.<br />
Fazit: Die neue Bohrgutentwässerungsanlage<br />
vereinfacht die Bohrgutentsorgung<br />
deutlich. Durch eine<br />
kontinuierliche Trennung in die einzelnen<br />
Stofffraktionen Sediment,<br />
<strong>Wasser</strong> und Luft kann jede Fraktion<br />
umweltgerecht, und kostengünstig<br />
und „behördenkonform“ entsorgt<br />
werden. Die Anlage spart bis zu<br />
80 % der Entsorgungskosten ein. Sie<br />
ist einfach zu bedienen, das Innenleben<br />
einfach zu verstehen und zu<br />
warten und sie kann auch angemietet<br />
werden.<br />
Verfasser/Kontakt:<br />
aquen<br />
aqua-engineering GmbH,<br />
Dr. Christian Schröder,<br />
Lange Straße 53,<br />
D-38685 Langelsheim,<br />
Tel. (05326) 92977-0,<br />
Fax (05326) 92977-10,<br />
E-Mail: info@aquen.de,<br />
www.aquen.de<br />
Containeranlage (Transport).<br />
Containeranlage (an der Bohrstelle).<br />
GFK-Rohrsysteme<br />
Stauraumsysteme I <strong>Abwasser</strong> I Schächte I Industrie<br />
Vortrieb I Relining I <strong>Wasser</strong>kraft I Sonderprofile<br />
E Rohre GmbH l Gewerbepark 1 l 17039 Trollenhagen l T +49.395.45 28 0 l F +49.395.45 28 100 l www.hobas.de<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 525
FOKUS<br />
Tiefbau · Kanalbau · Brunnenbau<br />
Abenteuerliche Arbeiten in Garching<br />
Sanierung von Rohrleitungen in kampfmittelgefährdetem Gebiet<br />
Das Gelände entlang der Münchner Straße, zwischen der Münchner Innenstadt und dem Vorort Garching, wo<br />
sich heute die Isar beschaulich zwischen Feldern und Grün hindurchschlängelt, war im zweiten Weltkrieg<br />
Schauplatz mehrerer Luftangriffe und Bodenkämpfe. Bei der geplanten Sanierung der Garchinger Ortsdurchfahrt<br />
bestand deshalb der Verdacht auf Blindgänger im Baugebiet – ein besonderer Einsatz für die Mennicke<br />
Rohrbau GmbH, die mit der Sanierung der <strong>Wasser</strong>leitungen beauftragt wurde.<br />
Bevor mit den Bauarbeiten<br />
begonnen werden konnte,<br />
musste zunächst eine sogenannte<br />
Kampfmittelvorerkundung durchgeführt<br />
werden. Dabei wird mithilfe<br />
Herkömmliche Sanierung, besondere Rahmenbedingungen.<br />
Den Rohrsanierungsarbeiten ging eine<br />
Kampfmittelvorerkundung voraus. Die Arbeiten fanden<br />
außerdem an einer Hauptverkehrsstraße statt.<br />
© Mennicke<br />
von Luftbildern nach möglichen<br />
Bombenabwürfen, Blindgängern<br />
und Spuren von Bodenkämpfen<br />
gesucht. Da die Gutachter eine<br />
Belastung des Baugebiets nicht ausschließen<br />
konnten, mussten die<br />
Mitarbeiter im Vorfeld an einer<br />
Sicherheitsbelehrung teilnehmen.<br />
„Wir wurden darüber unterrichtet,<br />
wie wir uns verhalten sollen, falls<br />
wir bei den Bodenarbeiten auf<br />
Munition stoßen oder auf Gegenstände,<br />
die wir nicht einwandfrei<br />
identifizieren können“, berichtet<br />
Michael Flade, Bauleiter bei Mennicke.<br />
„Glücklicherweise musste bisher<br />
keiner der Mitarbeiter die neu<br />
erlernten Kenntnisse anwenden.“<br />
Herausforderung Hauptverkehrsstraße<br />
Der außergewöhnlichen Vorbereitung<br />
folgten ab Oktober 2012 die<br />
routinierten Sanierungsarbeiten im<br />
Auftrag der Stadtwerke München.<br />
Insgesamt verlegt das Team von<br />
Mennicke etwa 735 Meter duktile<br />
Gussrohre DN 200 im offenen Verfahren,<br />
wobei der Straßenaufbruch,<br />
die Erstellung des Rohrgrabens, die<br />
Rohrverlegung und die anschließende<br />
Verfüllung des Grabens zum<br />
Auftrag gehören. Obgleich die Bauarbeiten<br />
selbst im Vergleich zu den<br />
aufwendigen Vorarbeiten konventionell<br />
ablaufen, hielt die Baustelle<br />
weitere Herausforderungen bereit.<br />
„Die Baustelle befindet sich an einer<br />
Hauptverkehrsstraße und wir mussten<br />
eine Fahrbahn mehrere Wochen<br />
lang sperren“, sagt Michael Flade.<br />
Um eine völlige Straßensperrung zu<br />
vermeiden, legte das Mennicke<br />
Team eine Nachtschicht ein, um die<br />
Rohrleitungen in den Bestand einzubinden.<br />
Im Frühjahr kann voraussichtlich<br />
wieder <strong>Wasser</strong> durch die<br />
Leitungen fließen.<br />
Kontakt:<br />
MENNICKE ROHRBAU GMBH,<br />
Marion Melzer,<br />
Rollnerstraße 180,<br />
D-90425 Nürnberg,<br />
Tel. (0911) 3607-284,<br />
E-Mail: mmelzer@mennicke.de,<br />
www.mennicke.de<br />
part of it! Be part of it! Be part of it! Be part of<br />
NETZWERK WISSEN<br />
Universitäten und Hochschulen stellen sich vor:<br />
Studiengänge und Studienorte rund ums <strong>Wasser</strong>fach<br />
im Porträt – in der technisch-wissenschaftlichen<br />
Fachzeitschrift <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Kontakt zur Redaktion:<br />
E-Mail: ziegler@ di-verlag.de<br />
EAZ Netzwerk 2.indd 1 3.9.2012 15:24:16<br />
Mai 2013<br />
526 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
NETZWERK WISSEN<br />
Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
© TUD/Eckold<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
an der Technischen Universität Dresden im Porträt<br />
##<br />
Trinkwasserversorgung, Schwimmbeckenwasser, <strong>Abwasser</strong>wiederverwendung:<br />
Probleme lösen, Beobachtungen erklären, Wissen generieren<br />
##<br />
Steckbrief: Studiengang <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
##<br />
Arbeitsgebiet <strong>Wasser</strong>versorgung:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung, -aufbereitung und -verteilung holistisch betrachtet<br />
##<br />
Arbeitsgebiet Trinkwasseraufbereitung:<br />
Pilotierung und Betrieb von Membrananlagen wissenschaftlich begleitet<br />
##<br />
Arbeitsgebiet Qualitätsmanagement in der Trinkwasserverteilung:<br />
<strong>Wasser</strong>qualität in Verteilungssystemen modelliert<br />
##<br />
Arbeitsgebiet Qualität und Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser:<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl im Interview<br />
##<br />
Verbundprojekt IntegTa: Die richtige Entscheidung beim Management<br />
von Trinkwassertalsperren<br />
Forschungsprojekte und Ergebnisse<br />
##<br />
IntegTa: Pragmatische Simulation von Einflüssen der <strong>Wasser</strong>qualität<br />
auf die Trinkwasseraufbereitung<br />
##<br />
IWAS-Brasilien: Trinkwasserversorgung in Brasília DF als Teil eines IWRM-Konzeptes<br />
##<br />
ReSeRO: Fouling-minimierte Rückgewinnung sekundärer Abwässer in Israel<br />
##<br />
REGKLAM: Wie können <strong>Wasser</strong>versorger klimatische Veränderungen kompensieren?
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Probleme lösen, Beobachtungen erklären,<br />
Wissen generieren<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der Technischen Universität Dresden forscht und<br />
lehrt in ihren Kompetenzfeldern Trinkwasserversorgung, Schwimmbeckenwasser<br />
sowie <strong>Abwasser</strong>wiederverwendung<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der Technischen Universität Dresden (TUD) widmet sich wasserwirtschaftlich<br />
relevanten Fragestellungen hinsichtlich Rohwasserqualität, Trinkwasseraufbereitung und -verteilung.<br />
Darüber hinaus werden Fragestellungen zur Qualität und Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser sowie zur<br />
<strong>Abwasser</strong>wiederverwendung bearbeitet. Im Bereich der studentischen Ausbildung bietet die Professur Lehrveranstaltungen<br />
für die Studiengänge <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Hydrologie sowie Abfallwirtschaft/Altlasten.<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
gehört zur Fachrichtung Hydrowissenschaften<br />
der Fakultät<br />
Umweltwissenschaften, in der<br />
sowohl ingenieur- als auch naturwissenschaftlich<br />
ausgerichtete Institute<br />
vertreten sind. Sie ist eine von<br />
drei Professuren am Institut für<br />
Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft<br />
(ISI), das u. a. das renommierte<br />
Dresdner Kolloquium zur<br />
Siedlungswasserwirtschaft organisiert<br />
oder die Schriftenreihe Dresdner<br />
Berichte, die wasserwirtschaftliche<br />
Themen behandelt, herausgibt.<br />
Die rege Forschungstätigkeit an<br />
der Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
umfasst sowohl grundlagenorientierte<br />
als auch praxisbezogene Projekte.<br />
Die Anwendbarkeit, also der<br />
direkte Nutzen der Ergebnisse, ist<br />
dabei Handlungsmaxime der Forscher.<br />
Forschungsaufträge und Gutachten<br />
gewährleisten ständigen Wissenszuwachs,<br />
der in erster Linie der<br />
Lösung des jeweiligen Problems,<br />
jedoch gleichzeitig der Qualifikation<br />
der Bearbeiter dient und zudem<br />
garantiert, dass die Lehre immer auf<br />
einem fachlich hohen Niveau erfolgt.<br />
Fachrichtung Hydrowissenschaften an der Technischen Universität Dresden: Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung ist Teil eines<br />
weiten Netzes aus ingenieur- und naturwissenschaftlich ausgerichteten Instituten und Professuren.<br />
Mai 2013<br />
528 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
An der Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
forschen die Mitarbeiter unter<br />
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang<br />
Uhl auf den Gebieten der <strong>Wasser</strong>gewinnung,<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und <strong>Wasser</strong>verteilung. Im Wesentlichen<br />
lassen sich fünf Arbeitsgebiete<br />
unterscheiden:<br />
##<br />
Trinkwasseraufbereitung mit<br />
konventionellen und neuen<br />
Verfahren<br />
##<br />
Qualitätsmanagement bei der<br />
Trinkwasserverteilung<br />
##<br />
Integriertes <strong>Wasser</strong>ressourcenmanagement<br />
(IWRM)<br />
##<br />
Qualität und Aufbereitung von<br />
Schwimmbeckenwasser<br />
##<br />
<strong>Abwasser</strong>wiederverwendung<br />
Die Professur<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ist<br />
untergebracht<br />
im Neubau<br />
Chemische<br />
Institute.<br />
© TUD/Eckold<br />
Im Bereich der Lehre bietet die Professur<br />
Vorlesungen, Übungen, Praktika<br />
und Exkursionen im Rahmen<br />
der Bachelor- und Master-Studiengänge<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft (s. Kasten)<br />
sowie im nicht-konsekutiven Masterstudiengang<br />
Hydro Science and<br />
Engineering (HSE).<br />
In den Bachelor-Studiengängen<br />
vermittelt die Vorlesung und Übung<br />
„Grundlagen der <strong>Wasser</strong>versorgung“<br />
wichtige Grundlagen (wie<br />
u. a. Anforderungen an die Trinkwasserqualität,<br />
gesetzliche Regelungen,<br />
Zusammensetzungen von<br />
Grund- und Oberflächenwässern)<br />
sowie Grundkenntnisse der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
(insbesondere Enteisenung<br />
und Entmanganung, Stabilisierung,<br />
Fällung und Flockung, Sedimentation,<br />
Filtration, Desinfektion<br />
mit Chlor) und Trinkwasserverteilung<br />
(u. a. <strong>Wasser</strong>bedarfsberechnung,<br />
Druckzoneneinteilung).<br />
In der Vorlesung und Übung<br />
„Trinkwasseraufbereitung“ werden<br />
weitere Verfahren der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
behandelt und vertieft. Die<br />
Veranstaltung wird ergänzt durch<br />
eine ein- bis zweitägige Exkursion.<br />
Die Studierenden lernen, wichtige<br />
Verfahren der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
auszulegen. In der Lehrveranstaltung<br />
„Trinkwasserverteilung“ wird<br />
die Dimensionierung von <strong>Wasser</strong>verteilungssystemen<br />
vermittelt.<br />
Ebenso wird gelehrt, welche Einflüsse<br />
die Trinkwasserqualität bei<br />
der <strong>Wasser</strong>verteilung verändern<br />
können, wie Qualitätsbeeinträchtigungen<br />
zu beurteilen und welche<br />
Maßnahmen ggfs. zu treffen sind.<br />
In den Master-Studiengängen<br />
werden in der Lehrveranstaltung<br />
„Treatment Plant Design (Auslegung<br />
von Aufbereitungsanlagen)“, die in<br />
englischer Sprache gehalten wird,<br />
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Planung<br />
und Auslegung von Aufbereitungsanlagen<br />
sowie deren Betrieb,<br />
Instandhaltung und Erneuerung<br />
vermittelt.<br />
Im Rahmen der Seminarveranstaltung<br />
„<strong>Wasser</strong>versorgung aktuell“<br />
halten geladene Referenten aus Forschung<br />
und Praxis Vorträge über<br />
aktuelle Probleme und Entwicklungen<br />
in der Trinkwasserversorgung.<br />
In der Wahlpflichtveranstaltung<br />
„Water Transport and Distribution<br />
(<strong>Wasser</strong>transport und Verteilung)“<br />
werden weitergehende Methoden<br />
der Planung, des Betriebes und der<br />
Instandhaltung von <strong>Wasser</strong>verteilungssystemen<br />
vermittelt. Hierzu<br />
gehören beispielsweise die Planung<br />
von Rehabilitationsmaßnahmen,<br />
die Modellierung von Qualitätsbeeinträchtigungen<br />
und die Entwicklung<br />
von Spülplänen von Verteilungsnetzen.<br />
Die Vorlesung „<strong>Wasser</strong>wirtschaftliche<br />
Projektbewertung“ behandelt<br />
betriebswirtschaftliche Grundlagen<br />
für <strong>Wasser</strong>wirtschaftsingenieure,<br />
wie z. B. Kosten- und Investitionsrechnung,<br />
Projektbewertung, innerbetriebliche<br />
Kostenrechnung in<br />
<strong>Wasser</strong>ver- und <strong>Abwasser</strong>entsorgungsunternehmen<br />
oder Benchmarking.<br />
Für einen ausgedehnten Praxisanteil<br />
sorgt die Lehrveranstaltung<br />
„Projektarbeit <strong>Wasser</strong>versorgung“.<br />
Neben einer Vorlesung in Projektmanagement<br />
bearbeiten die Studenten<br />
in Kleingruppen eigenständig<br />
ein Projekt. Dabei liegt der<br />
Schwerpunkt auf Erstellung von<br />
Projektstruktur- und Zeitplänen, auf<br />
Zeiterfassung, Meilenstein- und<br />
Kostenplanung.<br />
Im Rahmen des internationalen<br />
Masterstudiengangs Hydro Science<br />
and Engineering bietet die Professur<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung außerdem<br />
das Modul „Drinking Water Supply“<br />
an, in welchem Trinkwasseraufbereitung<br />
und Trinkwasserverteilung<br />
kompakt auf wissenschaftlicher<br />
Basis gelehrt werden.<br />
Um Forschungsvorhaben und<br />
Lehrangebote effizient umsetzen zu<br />
können, nutzt die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
eine umfangreiche<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 529
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Steckbrief Studiengang <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft ist in wesentlichem Maße für die vitale Entwicklung von Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft<br />
verantwortlich. Voraussetzungen für die daraus erwachsenden Aufgaben sind die inge nieurwissenschaftliche und technische<br />
Beherrschung von <strong>Wasser</strong>gewinnung, <strong>Wasser</strong>nutzung, <strong>Wasser</strong>abgabe und Abflussregelung. Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft stellt sich<br />
den Anforderungen aus der immer zwingender werdenden Mehrfach- und Kreislaufnutzung des <strong>Wasser</strong>s und seiner Inhaltsstoffe<br />
durch Erforschung der für die unterschiedlichen Nutzungen benötigten <strong>Wasser</strong>mengen und -qualitäten. Dies beinhaltet<br />
natur wissenschaftliche, verfahrenstechnische und bautechnische Entwicklungsaufgaben unter Beachtung der natürlichen<br />
Umweltbedingungen.<br />
Bachelorstudiengang<br />
komplexer, fachübergreifender Studiengang, der die<br />
tech nischen wasserwirtschaftlichen Systeme und deren<br />
viel fältige Verknüpfungen zu den Kompartimenten Boden<br />
und Atmosphäre sowie zur Gesellschaft, naturwissenschaftliche<br />
Grund lagen der Hydrobiologie und -chemie<br />
wie auch kons truk tive Grundlagen des Bauingenieurwesens<br />
einschließlich des <strong>Wasser</strong>baus zum Gegenstand hat<br />
• Abschluss: Bachelor of Science (B. Sc.)<br />
• Semester: 6<br />
• Ablauf/Studieninhalte:<br />
Grundausbildung Mathematik bzw. Naturwissenschaften<br />
(1. und 2. Semester; obligatorisch); ingenieurwissenschaftliche<br />
und fachspezifische Grundlagen, z. B. Grundlagen der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Trinkwasserversorgung (3. bis 5. Semester;<br />
obligatorisch); Schwerpunktsetzung in den Bereichen<br />
Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft oder <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
(5. und 6. Semester; Wahlpflicht)<br />
• Zugehörige Institute:<br />
Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft;<br />
Institut für Grundwasserwirtschaft;<br />
Institut für <strong>Wasser</strong>chemie; Institut für Hydrobio logie;<br />
Institut für Hydrologie und Meteorologie;<br />
Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten<br />
• Ausbildungsziel:<br />
Vorbereitung auf ein weiterführendes Masterstudium;<br />
Mitwirken bei Planung, Bau und Betrieb technischer<br />
Anlagen zur Gewinnung, Speicherung und Umverteilung<br />
der Ressource <strong>Wasser</strong>; Lösen von Problemen in der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft und verwandten Bereichen; Mitarbeit bei<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>verbänden sowie Behörden,<br />
Planungs- und Beratungsbüros, Forschungseinrichtungen,<br />
Unternehmen des Anlagenbaus, der fertigenden,<br />
Lebensmittel-, Pharma- oder chemischen Industrie<br />
Weitere Informationen: www.tu-dresden.de/hydro/studium<br />
Masterstudiengang<br />
komplexer Studiengang aus den drei Fachgebieten<br />
Bewirtschaftung von ober- und unterirdischen Gewässern,<br />
Trinkwassergewinnung sowie <strong>Abwasser</strong>bewirtschaftung;<br />
vermittelt in den Pflichtmodulen über das Bachelorniveau<br />
hinaus gehendes Fachwissen in den Bereichen<br />
Grundwasserwirtschaft, Hydrogeologie/Hydrogeochemie,<br />
<strong>Abwasser</strong>systeme, Prozesswasserbehandlung,<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
• Abschluss: Master of Science (M. Sc.)<br />
• Semester: 4<br />
Mai 2013<br />
530 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
• Ablauf/Studieninhalte:<br />
Grundwasserbewirtschaftung mit Computer modellen,<br />
hydrogeologische und hydrogeo chemische Methoden,<br />
Modellierung von <strong>Abwasser</strong>systemen, Prozesswasserbehandlung<br />
und innerbetriebliche <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Auslegung von Aufbereitungsanlagen, Bewirtschaftung<br />
und Optimierung von <strong>Abwasser</strong>systemen (1. bis 3. Semester;<br />
obligatorisch); Studienprojekt <strong>Wasser</strong>wirtschaft (2. und<br />
3. Semester; obligatorisch); Seminarmodul <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
(2. Semester; obligatorisch); Fachpraktikum <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
(2. und 3. Semester; obligatorisch); Schwerpunkte<br />
Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft sowie<br />
<strong>Wasser</strong> bewirtschaftung, z. B. weitergehende Trinkwasseraufbereitung<br />
oder <strong>Wasser</strong>transport und -verteilung (1. bis<br />
3. Semester; Wahlpflicht); Masterarbeit mit Kolloquium<br />
(4. Semester)<br />
• Zugehörige Institute:<br />
Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft;<br />
Institut für Grundwasserwirtschaft<br />
• Ausbildungsziel:<br />
Übernahme verantwortungsvoller wasserwirtschaftlicher<br />
Tätigkeiten in <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>verbänden sowie<br />
Behörden, Planungs- und Beratungsbüros, Forschungseinrichtungen,<br />
Unternehmen des Anlagenbaus, der fertigenden,<br />
Lebensmittel-, Pharma- oder chemischen Industrie<br />
Weitere Informationen: www.tu-dresden.de/hydro/studium<br />
Labor- und Technikumsausstattung<br />
sowie zahlreiche Versuchsanlagen<br />
in <strong>Wasser</strong>werken vor Ort:<br />
##<br />
Analyse und weitergehende<br />
Charakterisierung gelöster<br />
<strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe: gesamter<br />
und gelöster organisch gebundener<br />
Kohlenstoff und Stickstoff<br />
(TOC, DOC und TON, DON);<br />
weitergehende Charakterisierung<br />
von DOC und DON mittels<br />
LC-OCD-OND; freies und gebundenes<br />
Chlor; pH-Wert; Leitfähigkeit;<br />
Redox-Potenzial; diverse<br />
gelöste <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe;<br />
gelöster Sauerstoff; Spektralphotometer<br />
(spektraler Absorptions-<br />
und Schwächungskoeffizient);<br />
Titroprozessor<br />
##<br />
In <strong>Wasser</strong> suspendierte Partikel:<br />
Trübungsmessung; Partikelgröße<br />
mittels Einzelpartikelextinktion<br />
(1 bis 200 µm);<br />
Partikelgröße mittels dynamischer<br />
Streulichtmessung/<br />
Photonenkorrelationsspektroskopie<br />
(0,6 nm bis 1 µm);<br />
Bestimmung der Dichte<br />
suspendierter Partikel<br />
##<br />
Schüttguteigenschaften:<br />
Probenteiler; Rotationsschüttler;<br />
Trockensiebung; Trocken- und<br />
Nassdichtebestimmung;<br />
Schüttungsporosität;<br />
Planetenkugelmühle<br />
##<br />
Mikrobiologische Ausstattung:<br />
Sterilbank; Plattengießautomat;<br />
Autoklav; Brutschränke,<br />
Fermenter mit Regel- und<br />
Dosiersystem; Fluoreszenzmikroskop;<br />
Durchflusszytometer;<br />
Luminometer<br />
##<br />
Reihenrührwerke zur Flockung;<br />
Versuchsstände zur Charakterisierung<br />
der Reaktivität von<br />
Aktivkohlen für Chlor und<br />
Chloramin; Versuchsstand zur<br />
Adsorption von Mikroorganismen<br />
##<br />
kleintechnische Versuchsanlage<br />
zur Flockung, Sedimentation<br />
und Filtration<br />
##<br />
kleintechnisches<br />
Schwimmbadmodell<br />
##<br />
Membranteststand<br />
Kontakt:<br />
Technische Universität Dresden,<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
D-01062 Dresden,<br />
Tel. (0351) 463-42545,<br />
E-Mail: wasserversorgung@tu-dresden.de,<br />
www.tu-dresden.de/hydro/wv<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 531
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung, -aufbereitung und -verteilung<br />
holistisch betrachtet<br />
Das Arbeitsgebiet <strong>Wasser</strong>versorgung – Forschung, Entwicklung und Beratung<br />
Das Arbeitsgebiet <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
gliedert sich in die drei<br />
Teilbereiche <strong>Wasser</strong>gewinnung,<br />
Was seraufbereitung und <strong>Wasser</strong>verteilung.<br />
Das Team der Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
berücksichtigt bei<br />
seinen Forschungsarbeiten alle<br />
Faktoren, die die <strong>Wasser</strong>qualität<br />
beeinflussen können. „Hierfür ist es<br />
von Bedeutung, Rohwasserqualität/<strong>Wasser</strong>gewinnung,<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und <strong>Wasser</strong>verteilung<br />
nicht getrennt voneinander, sondern<br />
integrativ zu betrachten“, berichtet<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl. Das<br />
heißt, dass die Forscher um den Leiter<br />
der Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
nicht nur die Qualität des Rohwassers<br />
und seine Aufbereitbarkeit<br />
unter technisch-wirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten zum einwandfreien<br />
Produkt berücksichtigen,<br />
sondern auch den Einfluss, den das<br />
Rohwasser oder die Aufbereitungstechnologie<br />
auf die mögliche Veränderung<br />
des Produktes im Verteilungsnetz<br />
haben. So kann z. B.<br />
ein nach der Aufbereitung unter<br />
chemischen und mikrobiologischen<br />
Kompetenzfelder im Arbeitsgebiet <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
• Modellierung und Optimierung von<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsprozessen<br />
• integrative Modellierung und Optimierung gekoppelter<br />
Aufbereitungsverfahren<br />
• wissenschaftliche Begleitung von Pilotierungen<br />
• Flockung, Sedimentation, Filtration<br />
• Membranverfahren (Ultrafiltration, Nanofiltration,<br />
Umkehrosmose)<br />
• Aktivkohleadsorption<br />
• Oxidation<br />
• Bioreaktoren zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
• Desinfektion<br />
• Bildung, Ablagerung und Resuspendierung amorpher<br />
Verbindungen<br />
• höhere Organismen in Verteilungssystemen<br />
Qualität und Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser<br />
• Untersuchung verschiedener Aufbereitungsverfahren<br />
anhand eines Schwimmbadmodells<br />
• Einsatz von Kornaktivkohle<br />
• Membranverfahren<br />
• UV-Verfahren<br />
<strong>Abwasser</strong>wiederverwendung<br />
• Fouling-Minimierung bei der Aufbereitung von <strong>Abwasser</strong><br />
mittels Umkehrosmose<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
• Modellierung von Prozessen in Verteilungssystemen<br />
• Optimierung von Netzspülungen<br />
• Verkeimung in Verteilungssystemen<br />
Integratives <strong>Wasser</strong>ressourcenmanagement<br />
• integratives Management von Trinkwassertalsperren und<br />
Einzugsgebieten<br />
Klimawandel<br />
• Auswirkungen des Klimawandels auf<br />
die Trinkwasserversorgung<br />
Mai 2013<br />
532 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Gesichtspunkten einwandfreies<br />
<strong>Wasser</strong> bei der Verteilung verkeimen,<br />
wenn die Aufenthaltszeit des<br />
<strong>Wasser</strong>s im Verteilungsnetz zu lang<br />
und/oder die <strong>Wasser</strong>temperatur zu<br />
hoch ist oder Rohrnetzmaterialien<br />
biologisch verwertbare Stoffe ab -<br />
geben.<br />
Ausgangspunkt für alle Forschungen<br />
sind reale Probleme oder<br />
beobachtete Phänomene hinsichtlich<br />
der Rohwasserqua lität, Trinkwasseraufbereitung<br />
und -verteilung<br />
sowie der Qualität und Aufbereitung<br />
von Schwimm beckenwasser.<br />
„Der Ansatz unserer Arbeitsgruppe<br />
ist es, zunächst die Wechselwirkungen<br />
gekoppelter chemischer,<br />
physika lischer und mikrobiologischer<br />
Prozesse zu untersuchen<br />
und zu verstehen. Im zweiten<br />
Schritt werden ausgehend von diesen<br />
Erkenntnissen mathematische<br />
Modelle entwickelt, die dazu<br />
benutzt werden, entscheidende<br />
Mechanismen zu identifi zieren und<br />
zielgerichtet weitere Untersuchungen<br />
zur Bestätigung oder<br />
Verwerfung aufgestellter Arbeitshypothesen<br />
durchzuführen“, erläutert<br />
Prof. Uhl die methodische<br />
Vorgehensweise. Ließen sich die<br />
Hypothesen verifizieren, werden die<br />
entwickelten Modelle zur Optimierung<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung eingesetzt.<br />
Neben öffentlich geförderter<br />
Grundlagenforschung wie auch<br />
angewandter Forschung führt das<br />
Team um Prof. Uhl auch Auftragsforschungen<br />
durch und ist gutachterlich<br />
tätig.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.tu-dresden.de/die_tu_dresden/<br />
fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_<br />
hydrowissenschaften/fachrichtung_<br />
wasserwesen/isiw/wv/forschung/<br />
document.2011-03-24.7449021917<br />
Steckbrief Versuchsanlage Trinkwasseraufbereitung: Flockung – Sedimentation – Filtration<br />
Um Fragestellungen zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung bearbeiten zu<br />
können, verfügt die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung über eine<br />
Versuchsanlage im Pilotmaßstab zur Flockung und Tiefenfiltration.<br />
Diese wird in der Forschung und bei der Beratung von<br />
Unternehmen eingesetzt.<br />
Die Anlage:<br />
• mögliche Betriebsweisen: Flockung – Sedimentation –<br />
Filtration; Flockenfiltration; Flockungsfiltration<br />
• Filtersäulen: Parallelbetrieb und Reihenschaltung;<br />
Computer gesteuerte Probenahme über Filterbetttiefe;<br />
Druckmessung über Filterbetttiefe<br />
• genau definiertes Rohwasser (Dosierung von Konzentraten<br />
und Trübstoffen)<br />
• Dosierung von pH-Chemikalien und Flockungsmitteln<br />
• Verdrängerpumpen<br />
• magnetisch-induktive Durchflussmessung<br />
• online-Messung: Trübung; pH-Wert; Temperatur;<br />
Redoxpotenzial; Sauerstoffkonzentration; relative<br />
Flockengröße<br />
• Datalogger<br />
• Spülung mit Luft, Luft/<strong>Wasser</strong> und <strong>Wasser</strong><br />
Einsatz in der Beratung:<br />
• Auswirkungen von Veränderungen in der Rohwasserqualität<br />
auf die Produktivität der Filtration<br />
• Test, Bewertung und Vergleich von Flockungsmitteln:<br />
Betrachtung des Flockenbildungsprozesses und der<br />
Entfernung gebildeter Flocken<br />
• Test, Bewertung und Vergleich von Filtermaterialien<br />
• Bewertung und Optimierung von Spülprozeduren<br />
• integrative Modellierung und Optimierung von Flockung<br />
und Filtration<br />
Einsatz in der Forschung:<br />
• Einfluss von Veränderungen in der Rohwasserqualität<br />
auf die Flockenbildung und deren Entfernung bei der<br />
Filtration<br />
• Vergleich von Betriebsweisen: Flockung – Sedimentation<br />
– Filtration; Flockenfiltration; Flockungsfiltration<br />
• Optimierung von Flockenbildung und Filtration<br />
• integrative Modellierung von Flockung und Filtration<br />
• Optimierung der Filterspülung<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 533
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Pilotierung und Betrieb von Membrananlagen<br />
wissenschaftlich begleitet<br />
Das Arbeitsgebiet Trinkwasseraufbereitung<br />
Membrantestzelle zur Foulinguntersuchung<br />
(LCMTC)<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
an der Technischen Universität<br />
Dresden gehört zu den führenden<br />
Forschungsinstitutionen im Bereich<br />
der Membranverfahren zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
in Deutschland. Die<br />
Mitarbeiter führen Forschungs-,<br />
Entwicklung- und Beratungsprojekte<br />
durch, begleiten die Pilotierung,<br />
Inbetriebnahme und den<br />
Betrieb von Membrananlagen wissenschaftlich,<br />
helfen bei der Prozessoptimierung,<br />
Analyse und Beseitigung<br />
von Betriebsproblemen und<br />
erstellen Gutachten.<br />
Anwendungsorientierte Forschungsprojekte<br />
werden häufig in<br />
enger Zusammenarbeit mit <strong>Wasser</strong>ver-<br />
und -entsorgern, Anlagenbauern<br />
und -betreibern, Industrieunternehmen<br />
sowie Schwimm- und Badebetrieben<br />
durchgeführt. Zahlreiche<br />
Forschungsprojekte führt die Professur<br />
in Kooperation mit nationalen<br />
und internationalen Partnern aus<br />
Wissenschaft und Industrie durch.<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ist im Bereich der Mikro-, Ultra- und<br />
Nanofiltration sowie der Umkehrosmose<br />
zur <strong>Wasser</strong>aufbereitung tätig.<br />
Zur Untersuchung von Fouling in Spiralwickelmodulen<br />
hat die Professur für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
eine neuartige Testzelle (Bild) entwickelt. Mit der<br />
1 m langen Zelle kann der RO-Fouling-Prozess<br />
ganzheitlich betrachtet werden, d.h. Veränderungen<br />
der Strömungsbedingungen über die Membranlänge<br />
können hinsichtlich Aufkonzentrierung<br />
gelöster Stoffe, Konzentrationspolarisation, osmotischem<br />
Druck, Flux/Permeabilität, Rückhalt, Foulingschicht,<br />
Schwerkräften/Fließgeschwindigkeit<br />
und Druckverlust erfasst werden.<br />
Experimentelle Untersuchungen:<br />
• Druckverlust, Salzrückhalt und Flux/<br />
Systemdruck über die Zeit von Foulingexperimenten<br />
(Biofouling)<br />
• Auflösung der Fluxentwicklung über Zeit und<br />
Länge durch im Permeatkanal befindliche<br />
abgetrennte Segmente<br />
• Test zweier unterschiedlicher Spacerhöhen<br />
• Validierungsstudien zur Eignung der Testzelle<br />
für Foulingexperimente<br />
• Anfärbung von Strömungsprofilen durch<br />
Farbstoffe<br />
Modellierung:<br />
• Strömungs- und Druckprofil<br />
• Biofoulingentwicklung<br />
• Sensitivitätsanalyse: Einflussfaktoren auf<br />
die Foulingbildung<br />
Ausgewählte Forschungsprojekte Membranverfahren<br />
• Fouling-minimierte Rückgewinnung von <strong>Abwasser</strong> mittels<br />
Umkehrosmose (ReSeRO) (2011)<br />
• Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser unter<br />
Anwendung der Membran filtration (DIN 19643-6) (2007)<br />
• Optimierung der Verfahrenskombination Flockung und<br />
Ultra filtration zur Entfernung organischer <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe<br />
(2007)<br />
• Einfluss der Flockenzerstörung durch Belüftung im Hybridprozess<br />
Flockung/Membranfiltration auf die Freisetzung organischer<br />
<strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe (2005)<br />
• Einsatz einer Ultrafiltrationsanlage mit getauchten Membranen<br />
zur Aufbereitung von Oberflächenwasser; Teil 1 Talsperren wasser<br />
(2004); Teil 2 Flusswasser (2005)<br />
Mai 2013<br />
534 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
<strong>Wasser</strong>qualität in Verteilungssystemen modelliert<br />
Das Arbeitsgebiet Qualitätsmanagement in der Trinkwasserverteilung<br />
Der Deutsche Verein des Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>faches (DVGW) platziert<br />
das Themengebiet Trinkwasserverteilungssysteme<br />
ganz oben<br />
auf der Liste der relevanten <strong>Wasser</strong>forschungsthemen<br />
– dies insbesondere<br />
vor dem Hintergrund<br />
des demografischen Wandels in<br />
Deutschland und dem Bestreben<br />
der Verbraucher, <strong>Wasser</strong> zu sparen.<br />
Daraus resultieren letztendlich zu<br />
geringe Strömungsgeschwindigkeiten<br />
und längere Aufenthaltszeiten<br />
von <strong>Wasser</strong> in Trinkwasserverteilungsnetzen,<br />
es bilden sich<br />
vermehrt Ablagerungen, die resuspendiert<br />
in Form von Trübwasserereignissen<br />
zu einer verminderten<br />
<strong>Wasser</strong>qualität beim Verbraucher<br />
führen können.<br />
Dem Forschungsbedarf trägt die<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung Rechnung<br />
mit ihrem Arbeitsgebiet Qualitätsmanagement<br />
in der Trinkwasserverteilung.<br />
„Wir untersuchen und<br />
modellieren Prozesse, die zu <strong>Wasser</strong>gütebeeinträchtigungen<br />
in Trinkwassernetzen<br />
führen können“, erläutert<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl. Eine<br />
typische Form qualitätsbeeinträchtigten<br />
Trinkwassers in Verteilungssystemen<br />
ist das Auftreten von braunem<br />
<strong>Wasser</strong> („Rostwasser“). Dieses<br />
wird durch mobilisierte partikuläre<br />
Ablagerungen aus dem Verteilungsnetz<br />
verursacht. An der Professur<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung wurden die individuellen<br />
Reaktionen, die in ihrer<br />
Summe zu einer Feststoffverfrachtung<br />
im Verteilungssystem führen,<br />
experimentell untersucht und<br />
modelliert. Mit der dynamischen<br />
<strong>Wasser</strong>qualitätsmodellierung werden<br />
diese Reaktionen mit hydraulischen<br />
Netzmodellen verknüpft. Das<br />
komplette Modell wurde in einem<br />
Softwaremodul implementiert.<br />
Basierend auf den aus einer<br />
Rohrnetzberechnung (Struktur und<br />
Hydraulik des Systems) gewonnenen<br />
Daten wird die Partikelverfrachtung,<br />
d. h. die Ablagerungsbildung<br />
in den einzelnen Rohrleitungen<br />
eines Verteilungssystems<br />
sowie die Remobilisierung und<br />
damit <strong>Wasser</strong>qualitätsänderung,<br />
für beliebig lange Zeiträume ermittelt.<br />
Es wird berechnet, wie schnell<br />
und in welchem Unfang sich Ablagerungen<br />
im Verteilungssystem<br />
ausbilden können.<br />
So können Aussagen über das<br />
Auftreten von Trübungsereignissen<br />
getroffen werden, z. B. hinsichtlich<br />
der Frage, inwieweit sich<br />
während der Verteilung eine Gütebeeinträchtigung<br />
für Trinkwasser<br />
ergibt, da der messtechnische<br />
Nachweis von verteilungsbürtigen<br />
Problemen durch sporadische,<br />
scheinbar zufällig und über einen<br />
sehr kurzen Zeitraum von Sekunden<br />
oder wenigen Minuten auftretende<br />
Gütebeeinträchtigungen<br />
nur in sehr begrenztem Maße<br />
geliefert werden kann.<br />
Ausgewählte Forschungsprojekte<br />
Trinkwasserverteilung<br />
• ASSELUS – Invertebraten und partikuläre<br />
Belastungen in Trinkwasserverteilungssystemen<br />
(2012)<br />
• Minimierung sedimentbürtiger Gütebeeinträchtigungen<br />
durch modellgestützten Rohrnetzbetrieb<br />
(2009)<br />
• Minimierung der Qualitätsbeeinträchtigung<br />
von Trinkwasser im Verteilungsnetz (2007)<br />
Ein weiterer Arbeitsbereich<br />
ergibt sich aus diesen Modellierungen.<br />
Dazu Prof. Uhl: „Für die Vermeidung<br />
von Nachteilen durch Ablagerungen<br />
entwickeln wir unter anderem<br />
kurz- und mittelfristig wirksame<br />
Spülstrategien.“ Dabei erprobt die<br />
Professur ihre Entwicklungen in<br />
Zusammenarbeit mit kleinen und<br />
großen <strong>Wasser</strong>versorgern.<br />
Qualitätsmanagement Trinkwasserverteilung: Datenerfassung – Modellierung –<br />
Schlussfolgerungen.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 535
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Wir beschäftigen uns intensiv mit verschiedenen<br />
Verfahren und Verfahrenskombinationen<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl über die Forschungen im Arbeitsgebiet Qualität und<br />
Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser<br />
Wie funktioniert ein Schwimmbadmodell? Warum stehen Desinfektionsnebenprodukte bei der Untersuchung<br />
von Schwimmbeckenwasser im Fokus? Und was sollten Badende beim Schwimmbadbesuch beachten?<br />
Diese und andere Fragen beantwortet Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl im Interview mit <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>.<br />
Außerdem gibt der Inhaber der Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der Technischen Universität Dresden (TUD)<br />
Einblicke in die Forschungsarbeiten und -ergebnisse des Arbeitsgebietes Qualität und Aufbereitung von<br />
Schwimmbeckenwasser.<br />
<strong>gwf</strong>: Ein wichtiges Arbeitsgebiet der<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der<br />
TUD ist die Qualität und Aufbereitung<br />
von Schwimmbeckenwasser. Welche<br />
Forschungsschwerpunkte existieren<br />
hier?<br />
Prof. Uhl: Wir beschäftigen uns<br />
intensiv mit verschiedenen Verfahren<br />
und Verfahrenskombinationen<br />
zur Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser.<br />
Wichtig ist, das Becken<br />
mit den Badenden, die Verunreinigungen<br />
in das <strong>Wasser</strong> eintragen,<br />
sowie der angeschlossenen Aufbereitung<br />
als Ganzes zu sehen. Zum<br />
Beispiel tragen Badende Hautschuppen<br />
ein. Bevor diese durch die<br />
installierte <strong>Wasser</strong>aufbereitung entfernt<br />
werden können, müssen sie<br />
erst einmal aus dem Becken ausgetragen<br />
werden. Daher beschäftigen<br />
wir uns auch intensiv mit der<br />
Modellierung des Transportes von<br />
Partikeln im Becken.<br />
<strong>gwf</strong>: Sie verfügen z. B. über ein<br />
kleintechnisches Schwimmbadmodell.<br />
Wo zu dient dieses?<br />
Prof. Uhl: Die Entwicklung des<br />
Schwimmbadmodells hat über ein<br />
Jahr gedauert und dessen Betrieb<br />
ist sehr aufwendig. Hier können die<br />
Wirkungen verschiedener Aufbereitungsverfahren<br />
unter kontrollierten<br />
Bedingungen untersucht werden.<br />
Denn jedes Bad ist anders und die<br />
Badenden sind heute nicht die gleichen<br />
wie morgen. Will man Wirksamkeiten<br />
nachweisen, so muss<br />
man sicherstellen, dass alle Untersuchungen<br />
unter gleichen Bedingungen<br />
durchgeführt wurden.<br />
<strong>gwf</strong>: Aktuell betreut der Lehrstuhl ein<br />
Projekt, das Belastbarkeitstests für<br />
eine neuartige Verfahrenskombination<br />
zur Aufbereitung des Schwimmbeckenwassers<br />
entwickelt. Worum<br />
genau handelt es sich?<br />
Prof. Uhl: Bei den Belastbarkeitstests<br />
wird in einem einigermaßen<br />
standardisierten Verfahren untersucht,<br />
wie durch die eingebaute<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung durch die<br />
Badenden eingetragene Schmutzstoffe<br />
entfernt werden können. Auf<br />
Basis der ermittelten Wirksamkeit<br />
Eingangsbereich mit Lichtschranken in ein Schwimmbecken während eines Belastungstests.<br />
Mai 2013<br />
536 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
kann der umzuwälzende Volumenstrom<br />
festgelegt werden. Allerdings<br />
stammt das derzeit eingesetzte Verfahren<br />
aus den 1970er-Jahren und<br />
hat noch viele Mängel. Diese<br />
machen sich insbesondere dann<br />
bemerkbar, wenn moderne, sehr<br />
wirksame Aufbereitungsverfahren<br />
eingesetzt werden. Wir arbeiten<br />
derzeit an einem dringend notwendigen<br />
neuen Verfahren.<br />
<strong>gwf</strong>: Bisher hat die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
bei den Belastungstests<br />
mit realen Personen gearbeitet, die<br />
nach streng vorgegebenen Kriterien<br />
ein Schwimmbecken genutzt haben.<br />
Jetzt erprobt sie Möglichkeiten, den<br />
anthropogenen Eintrag in das<br />
Schwimmbeckenwasser künstlich zu<br />
simulieren. Wie muss man sich das<br />
vorstellen und was wären die Vorteile<br />
einer solchen Methode?<br />
Prof. Uhl: Es ist sehr schwierig, die<br />
notwendige Personenzahl gleichmäßig<br />
über den Tag verteilt in das<br />
Becken zu schicken. Und dabei darf<br />
ja auch niemand mehrmals am Tag<br />
hinein. D. h. wir brauchen eine<br />
Möglichkeit, die durch die Badenden<br />
eingetragenen Schmutzstoffe<br />
auf andere Weise in der erforderlichen<br />
Menge in das Becken einzutragen.<br />
<strong>gwf</strong>: Wie weit sind Sie in diesem Punkt<br />
vorangeschritten?<br />
Prof. Uhl: Es gibt schon einige<br />
Vorstellungen dazu, wie vorgegangen<br />
werden sollte. Auch haben<br />
wir bereits ausgearbeitet, wie das<br />
Programm zur Entwicklung eines<br />
solchen Testes aussehen sollte.<br />
Bislang fehlt allerdings die Finanzierung.<br />
<strong>gwf</strong>: Bei den Untersuchungen stehen<br />
vor allem die sogenannten Desinfektionsnebenprodukte<br />
im Fokus.<br />
Warum und welche sind das?<br />
Prof. Uhl: Die Desinfektionsnebenprodukte<br />
wie Trichlormethane<br />
(THM) standen sehr lange im Focus.<br />
Heute erhält das Trichloramin<br />
besondere Aufmerksamkeit, da es<br />
im Verdacht steht, das Risiko von<br />
An der Pilotanlage (Schwimmbadmodell) können Wirkungen verschiedener<br />
Aufbereitungsverfahren untersucht werden.<br />
Kleinkindern zu erhöhen, als Er -<br />
wachsene an Asthma zu erkranken.<br />
<strong>gwf</strong>: Ziel der Schwimmbeckenwasseraufbereitung<br />
ist es, diese DNPs zu<br />
entfernen. Welche Verfahren sind<br />
dazu nach den Untersuchungen der<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung besonders<br />
geeignet?<br />
Prof. Uhl: Es geht nicht nur darum,<br />
die DNP selbst, sondern insbesondere<br />
auch darum, die sogenannten<br />
Präkursoren zu entfernen. Aus diesen<br />
entstehen nämlich durch die<br />
Reaktion mit Chlor die Desinfektionsnebenprodukte.<br />
Nach wie vor<br />
sind nach unserer Einschätzung Verfahren<br />
mit Aktivkohle am besten<br />
geeignet. Dies kann in Kombination<br />
mit Schnellfiltern oder auch mit<br />
Membranverfahren wie der Mikrooder<br />
Ultrafiltration erfolgen.<br />
<strong>gwf</strong>: Warum ist eine Kombination mit<br />
Membranverfahren sinnvoll?<br />
Prof. Uhl: Membranverfahren<br />
haben bei der Aufbereitung von<br />
Schwimmbeckenwasser in erster<br />
Linie die Aufgabe, Partikel wie z. B.<br />
Hautschuppen, aber auch Bakterien<br />
Ausgewählte Forschungsprojekte<br />
Schwimmbeckenwasser<br />
• Belastbarkeitstest für eine neuartige<br />
Verfahrenskombination zur Schwimmbeckenwasseraufbereitung<br />
(2012)<br />
• Integritätstests für eine keramische<br />
Mikrofiltrationsmembran (2011)<br />
• Vergleich zweier Kornaktivkohlen hinsichtlich<br />
ihrer Reaktivität gegenüber freiem Chlor und<br />
Monochloramin (2010)<br />
• Gesundheitsbezogene Optimierung der<br />
Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser<br />
(2009–2012)<br />
• Bestimmung des Belastbarkeitsfaktors für<br />
eine neuartige Verfahrenskombination zur<br />
Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser<br />
(2008)<br />
• Untersuchungen zu oberflächenkatalytischen<br />
Reaktionen und zur Filterverkeimung bei der<br />
Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser mit<br />
Kornaktivkohle (2002–2005)<br />
aus dem <strong>Wasser</strong> zu entfernen. Wir<br />
haben gezeigt, dass Membranverfahren<br />
viel besser ge eignet sind,<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 537
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Zur Person<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl hat seit 2004 die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
an der Technischen Universität Dresden (TUD) inne. Nach<br />
dem Studium in Karlsruhe sowie in Lund/Schweden war der Universitätsprofessor<br />
zunächst als Oberingenieur an der Universität Duisburg-Essen<br />
sowie als Projektingenieur, Gruppenleiter und Berater am<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> in Mülheim an der Ruhr tätig.<br />
Wolfgang Uhl beschäftigt sich seit mehr als zwanzig Jahren mit<br />
der integrativen Analyse, Modellierung und Optimierung der Trinkwasseraufbereitung<br />
und -verteilung. Dazu gehören insbesondere die<br />
Koppelung physikalischer (wie z. B. Filtration), chemischer (wie z. B. Ozonung) und biologischer<br />
(z. B. Nitrifikation und biologische Aktivkohle) Verfahren. Die Betrachtung der<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung im Zusammenhang mit der Verkeimung bei der <strong>Wasser</strong>verteilung<br />
war und ist ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit. Weitere Forschungsschwerpunkte<br />
liegen auf der Qualität und Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser sowie der<br />
<strong>Abwasser</strong>wiederverwendung.<br />
Seine Forschungsarbeit profitiert von zahlreichen Auslandsaufenthalten, z. B. am<br />
Center for Biofilm Engineering an der Montana State University (Bozeman, Mt./USA)<br />
(2004) oder am Center for Drinking Water Optimization an der University of Colorado<br />
(Boulder/USA) (2003).<br />
Außeruniversitär engagiert sich Wolfgang Uhl in verschiedenen Gremien (z. B.<br />
Vorstandsmitglied der DVGW Landesgruppe Ost seit 2005, Mitglied des Technischer<br />
Ausschuss der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. seit 2007, Obmann des<br />
DVGW Technisches Komitee Schwimmbeckenwasser seit 2008) und als Gutachter für<br />
diverse Fachzeitschriften, Konferenzbeiträge, Forschungsanträge und Gerichte bei<br />
Rechtsstreitigkeiten, die die <strong>Wasser</strong>versorgung betreffen.<br />
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl, Technische Universität Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften,<br />
Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, Professur <strong>Wasser</strong>versorgung, D-01062 Dresden,<br />
Tel. (0351) 463 33126, E-Mail: wolfgang.uhl@tu-dresden.de<br />
<strong>gwf</strong>: Wie genau funktioniert denn<br />
diese Methode?<br />
Prof. Uhl: Eine genau bekannte<br />
Menge der zu untersuchenden<br />
Aktivkohle wird in einen Reaktor<br />
gebracht und mit Chlor- oder Chloraminlösung<br />
aus einem Behälter<br />
überströmt. Das den Reaktor verlassende<br />
<strong>Wasser</strong> wird wieder in den<br />
Behälter zurückgeführt. Durch die<br />
Reaktion an der Aktivkohle wird<br />
Chlor oder Chlor amin verbraucht.<br />
Die verbrauchte Menge muss wieder<br />
ersetzt werden und daraus können<br />
wir die Abbaugeschwindigkeit<br />
berechnen.<br />
<strong>gwf</strong>: Welche Bedeutung haben die<br />
Forschungsergebnisse an der Professur<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung insgesamt für<br />
die Praxis, z. B. für die Betreiber von<br />
Schwimmbädern oder die Hersteller<br />
neuer Aufbereitungstechnologien?<br />
Prof. Uhl: Die Betreiber erhalten<br />
praxisrelevante Informationen zur<br />
Leistungsfähigkeit vorhandener<br />
Anlagen sowie für die Auswahl<br />
neuer Anlagen. Für die Anlagenbauer<br />
und Hersteller neuer Aufbereitungstechnologien<br />
ist es wichtig,<br />
ihre Verfahren wissenschaftlich fundiert<br />
untersucht zu bekommen.<br />
die Partikelkonzen tration im Becken<br />
zu vermindern.<br />
<strong>gwf</strong>: Sie sagten, Sie schätzen die Effizienz<br />
von Aktivkohleverfahren besonders<br />
hoch ein. Welche Erfahrungen<br />
haben Sie mit dieser Methode beim<br />
Einsatz in Schwimmbeckenwasser<br />
gemacht?<br />
Prof. Uhl: Wie bereits gesagt sind<br />
Aktivkohleverfahren besonders<br />
gut geeignet, die DNP-Konzentrationen<br />
im Becken so gering wie<br />
möglich zu halten. In unseren<br />
Arbeiten zum Abbau freien und<br />
gebundenen Chlors haben wir<br />
eine Methode entwickelt, mithilfe<br />
derer verschiedene Aktivkohlen<br />
miteinander verglichen werden<br />
können. Das ist wichtig für die<br />
Auslegung der Filter, in denen die<br />
Aktivkohle eingesetzt wird, und<br />
kann auch einen großen Einfluss<br />
auf die Kosten haben.<br />
<strong>gwf</strong>: Und kann man aus den Untersuchungsergebnissen<br />
auch Rückschlüsse<br />
auf das Badeverhalten von<br />
Schwimmbadbesuchern ziehen bzw.<br />
Empfehlungen für den Schwimmbadbesuch<br />
geben?<br />
Prof. Uhl: Das Wichtigste ist, dass<br />
alle Badenden vor dem Gang ins<br />
Becken gründlich duschen und sich<br />
am ganzen Körper mit Seife<br />
waschen, die dann auch wieder<br />
abgespült werden sollte.<br />
<strong>gwf</strong>: Herr Prof. Uhl, vielen Dank für<br />
das Gespräch.<br />
Mai 2013<br />
538 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Im Fokus der Untersuchungen: die Talsperre Klingenberg in Sachsen. Hier Blick auf die Staumauer. © Anschi/Pixelio<br />
Die richtige Entscheidung beim Management<br />
von Trinkwassertalsperren<br />
Verbundprojekt IntegTa liefert Entscheidungshilfe für integrative Bewirtschaftung<br />
von Trinkwassertalsperren<br />
Im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes „IntegTa – Integratives Management mehrfach genutzter Trinkwassertalsperren“<br />
wird Wissenschaftlern und Betreibern von Talsperren erstmals eine Entscheidungshilfe zur<br />
Optimierung der Talsperrenbewirtschaftung an die Hand gegeben, die ganz verschiedene Aspekte der Talsperrennutzung<br />
berücksichtigt. Das Verbundprojekt wurde durch die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung der Technischen<br />
Universität Dresden koordiniert, die auch das Teilprojekt Trinkwasseraufbereitung bearbeitete.<br />
Bei der Bewirtschaftung mehrfach<br />
genutzter Trinkwassertalsperren<br />
gibt es ausgeprägte Zielkonflikte.<br />
So kann z. B. die Vorhaltung<br />
eines möglichst großen<br />
Hochwasserrückhalteraumes für<br />
den Hochwasserschutz mit der Forderung<br />
nach der Bereitstellung qualitativ<br />
hochwertigen Rohwassers für<br />
die Trinkwasseraufbereitung in Konflikt<br />
geraten. Auch beeinflusst die<br />
Abflussregulierung die ökologische<br />
Qualität im Unterlauf. Dies kann<br />
wiederum zu Konflikten mit den<br />
Vorgaben und Zielen der EU-<br />
<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie führen.<br />
Das Gesamtsystem aus einer<br />
Trinkwassertalsperre mit ihrem Einzugsgebiet,<br />
dem Unterlauf sowie<br />
der <strong>Wasser</strong>aufbereitung ist hoch<br />
komplex und dynamisch. Eine optimale,<br />
die verschiedenen Nutzungsaspekte<br />
berücksichtigende und<br />
gegeneinander abwägende Bewirtschaftung<br />
ist daher sehr schwierig –<br />
zumal wenn die Nutzung, wie bisher<br />
üblich, auf Basis von <strong>Wasser</strong>wirtschaftsplänen<br />
sowie reaktiv erfolgt.<br />
Aus diesem Grund wird zukünftig<br />
eine proaktive Bewirtschaftung<br />
angestrebt. Dies kann nur gelingen,<br />
wenn geeignete Prognosemittel<br />
vorhanden sind, die zukünftige<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 539
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Bild 1.<br />
Schema der<br />
Anwendung<br />
eines<br />
Entscheidungshilfewerkzeugs<br />
zur Optimierung<br />
der<br />
Talsperrenbewirtschaftung.<br />
Externe Faktoren<br />
Stochastik<br />
Rohwasserqualität<br />
ä<br />
und -menge und -menge<br />
Modelle<br />
Situationen treffend beschreiben<br />
(Bild 1).<br />
Talsperrennutzung:<br />
integrativ simuliert und<br />
bewertet<br />
Im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes<br />
„IntegTa – Integratives<br />
Management mehrfach genutzter<br />
Trinkwassertalsperren“ (siehe Kasten)<br />
haben die Projektpartner unter<br />
Verwendung von Modellen zur<br />
Talsperrenbewirtschaftung<br />
Wildbettabgabe<br />
Empfehlung/<br />
Bewertung<br />
Trinkwasseraufbereitung<br />
Modell<br />
Ökologischer Zustand<br />
des Unterlaufs<br />
Modell<br />
mathematischen Beschreibung der<br />
Prozesse und Zusammenhänge in<br />
den einzelnen Teilbereichen erstmals<br />
ein solches Werkzeug entwickelt,<br />
mit dem Auswirkungen von<br />
Strategien hinsichtlich des Managements<br />
von Trinkwassertalsperren<br />
integrativ simuliert und bewertet<br />
werden können (Bild 1). Integrativ<br />
deshalb, weil alle Faktoren von der<br />
<strong>Wasser</strong>güte und -menge über Hochwasserrückhaltung<br />
und Trinkwasseraufbereitung<br />
bis hin zum ökologischen<br />
Zustand im Unterlauf<br />
berücksichtigt werden. Auch mögliche<br />
Extremereignisse (z. B. Starkregen,<br />
lange Trockenperioden) oder<br />
Veränderungen von Randbedingungen<br />
(z. B. durch Klimaänderungen)<br />
kann das System erfassen.<br />
Dabei haben die IntegTa-Projektpartner<br />
die für <strong>Wasser</strong>mengen- und<br />
-gütesimulationen bereits vorhandenen<br />
Modelle weiterentwickelt<br />
und miteinander gekoppelt. Ergebnisse<br />
der <strong>Wasser</strong>mengen- und<br />
-gütesimulationen dienten als<br />
Datengrundlagen für die Berechnungen<br />
zur Optimierung der Aufbereitungsleistung<br />
bei der Trinkwasserproduktion<br />
sowie zu Transportund<br />
Umsetzungsprozessen im<br />
Gewässer unterhalb der Talsperre.<br />
Diese Berechnungsergebnisse wurden<br />
zusammengeführt sowie Gütekriterien<br />
und Verletzungswahrscheinlichkeiten<br />
in den einzelnen<br />
Teilbereichen festgelegt.<br />
Steckbrief Verbundprojekt IntegTa<br />
• Name:<br />
IntegTa – Integratives Management mehrfach genutzter<br />
Trinkwassertalsperren<br />
• Projektpartner:<br />
Technische Universität Dresden (Professur <strong>Wasser</strong>versorgung;<br />
Institut für Hydrobiologie;<br />
Ökologische Station Neunzehnhain); Universität Kassel<br />
(Institut für Gewässerforschung und Gewässerschutz e.V.);<br />
SYDRO Consult GmbH; Krüger WABAG GmbH;<br />
DOC-Labor Dr. Huber<br />
• Projektträger:<br />
Forschungszentrum Karlsruhe, Bereich <strong>Wasser</strong>technologie<br />
und Entsorgung (Außenstelle Dresden)<br />
Talsperre Klingenberg. © Anschi/Pixelio<br />
• Kooperationspartner:<br />
u. a. Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen;<br />
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH; <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Weißeritzgruppe GmbH<br />
• Finanzierung:<br />
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF);<br />
im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes „Integriertes<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcen Management (IWRM)“<br />
• Laufzeit:<br />
Juni 2006 bis Dezember 2009<br />
• Teilprojekte:<br />
Extremereignisse; Talsperrenwassergüte; gekoppelte<br />
Optimierung <strong>Wasser</strong>güte/-menge; Fließ gewässerökologie;<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung; direkte Nanofiltration; Entwicklung<br />
LC-OCD-Detektor; Anlagentechnik<br />
Mai 2013<br />
540 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
tung und der Kosten verschiedener<br />
Aufberei tungs va rianten bei sich<br />
verändernder Roh was ser qua lität<br />
möglich.<br />
Bild 2. Funktionsprinzip des im Rahmen des Verbundprojektes<br />
IntegTa neu entwickelten Entscheidungshilfewerkzeugs.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.tu-dresden.de/die_tu_dresden/<br />
fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/fachrichtung_wasserwesen/isiw/wv/forschung/integta<br />
Ergebnis ist eine alle Teilaspekte mehrfach genutzter<br />
Talsperren berücksichtigende Entscheidungsunterstützungsprozedur<br />
(Bild 2): Ihr Anwender erhält die prognostizierten<br />
Ergebnisse für <strong>Wasser</strong>menge, <strong>Wasser</strong>güte,<br />
ökologische Qualität im Unterlauf und Auswirkungen<br />
auf die Trinkwasseraufbereitung. Im Entscheidungshilfesystem<br />
können verschiedene Bewirtschaftungsstrategien<br />
simuliert werden. Dabei sind vorab optimale Zielgrößen<br />
und unerwünschte Zustände (z. B. zu geringer<br />
Hochwasserschutz, hoher Aufwand für die Aufbereitung)<br />
zu formulieren. Der Anwender wählt zunächst ein<br />
Bewirtschaftungsszenario und lässt die Berechnungen<br />
ablaufen. Je nach Ergebnis kann er dann das Szenario<br />
auf Grund des Vergleiches der erhaltenen Ergebnisse<br />
mit den vorgegebenen Kriterien akzeptieren oder ein<br />
weiteres Szenario testen.<br />
Wie wirkt sich Rohwasser- auf<br />
Trinkwassergüte aus?<br />
Ziel des Moduls <strong>Wasser</strong>versorgung innerhalb des<br />
Gesamtprojektes IntegTa war die Entwicklung eines<br />
prozesstechnischen Teilmodells, das die Auswirkung<br />
verschiedener, je nach Bewirtschaftungsstrategie erhaltener<br />
Rohwasserqualitäten auf die Trinkwasseraufbereitung<br />
und Trinkwasserqualität beschreibt. Dieses Teilmodell<br />
wurde in der letzten Phase des Verbundprojektes in<br />
das Entscheidungshilfesystem integriert.<br />
Ein weiteres Ziel des Moduls <strong>Wasser</strong>versorgung war<br />
es, <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen ein geeignetes<br />
und wirtschaftliches Werkzeug zur Beherrschung veränderter<br />
Rohwasserbedingungen (z. B. bei Extremereignissen<br />
oder aufgrund klimatischer Veränderungen)<br />
im Hinblick auf eine sichere und nachhaltige <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
und -verteilung zur Verfügung zu stellen.<br />
Bei separater Anwendung des prozesstechnischen<br />
Modells wird so eine Prognose der Aufbereitungsleis-<br />
LEITER (M/W)<br />
NETZENTWICKLUNG<br />
FÜR DIE RWW RHEINISCH-WESTFÄLISCHE<br />
WASSERWERKSGESELLSCHAFT IN BOTTROP<br />
Als fachliche/-r und disziplinarische/-r Bereichsleiter/-in gewährleisten<br />
Sie die Grundsatz-, Ausführungs- und Genehmigungsplanungen für<br />
Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen unseres Trinkwasserverteilnetzes.<br />
Ins Netz kommen Sie mit einem ingenieurwissenschaftlichen<br />
Studienabschluss, vorzugsweise der Fachrichtung<br />
Maschinenbau oder Versorgungstechnik, und idealerweise mit<br />
angemessener Berufserfahrung.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bevorzugt online unter Angabe<br />
des Codes T13001-E001D auf www.rww.de. Bewerbungen von<br />
schwerbehinderten Menschen sind erwünscht.<br />
RWW GmbH • Dirk Sempell • Am Schloß Broich 1–3 • 45479 Mülheim<br />
Tel. +49 208 4433-477<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 541
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Pragmatische Simulation von Einflüssen<br />
der <strong>Wasser</strong>qualität auf die Trinkwasseraufbereitung<br />
Untersuchung der Professur <strong>Wasser</strong>versorgung im Rahmen<br />
des IntegTa-Verbundprojekts<br />
Bild 1. Pilotanlage Altenberg.<br />
In Trinkwassertalsperren kann es zu<br />
kurz- und langfristigen Veränderungen<br />
der Rohwasserqualität kommen,<br />
die durch natürliche Prozesse<br />
im <strong>Wasser</strong>körper hervorgerufen<br />
werden sowie aus der <strong>Wasser</strong>qualität<br />
der Zu- und Abflüsse resultieren.<br />
Sich langsam verändernde Rohwasserqualitäten<br />
können auf einen<br />
Wandel in der Einzugsgebietbewirtschaftung<br />
zurückgeführt werden,<br />
ihre Ursachen aber auch in einem<br />
beachtlichen Umfang in äußeren<br />
Einflussfaktoren (wie z. B. Klimafaktoren)<br />
haben. Extremereignisse, wie<br />
beispielsweise Starkregen nach ausgedehnten<br />
Trockenperioden, die als<br />
Folge von Klimaänderungen zukünftig<br />
verstärkt auftreten werden, können<br />
kurzzeitige Veränderungen der<br />
<strong>Wasser</strong>qualität hervorrufen. Darüber<br />
hinaus wird die <strong>Wasser</strong>qualität<br />
von Trinkwassertalsperren sehr stark<br />
durch die jeweilige Bewirtschaftungsstrategie<br />
beeinflusst.<br />
Ziel dieses Teilprojektes innerhalb<br />
des BMBF-Verbundprojektes<br />
IntegTa war die Beschreibung der<br />
Auswirkungen verschiedener Rohwasserqualitäten<br />
auf die Trinkwasseraufbereitung.<br />
Dabei galt es, die<br />
Aufbereitung unter Berücksichtigung<br />
aller Faktoren, die zu kurz-,<br />
mittel- und langfristigen Veränderungen<br />
der <strong>Wasser</strong>qualität beitragen,<br />
zu optimieren. Die Erkenntnisse<br />
fanden Eingang in ein Entscheidungshilfewerkzeug<br />
für die<br />
Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren,<br />
mit dessen Hilfe es möglich<br />
ist, <strong>Wasser</strong>qualitäten zu simulieren<br />
und den möglichen Einfluss<br />
einer Bewirtschaftungsstrategie auf<br />
Leistung und Kosten der Trinkwasseraufbereitung<br />
im Voraus<br />
abzuschätzen.<br />
Bei der Bearbeitung wurden<br />
zunächst Analysen langfristiger<br />
sowie durch Extremereignisse hervorgerufener<br />
Veränderungen der<br />
Rohwasserqualitäten von Trinkwassertalsperren<br />
durchgeführt. Ebenso<br />
wurden anhand der Daten und<br />
Erfahrungen vergangener Extremereignisse<br />
die technischen und ökonomischen<br />
Grenzen der Aufbereitungsverfahren<br />
analysiert. Diese Analysen<br />
lieferten weiterhin Eckdaten für den<br />
Betrieb von Pilotanlagen (Bild 1), mit<br />
denen umfangreiche Versuchsreihen<br />
durchgeführt wurden.<br />
Die Flockungsfiltration wurde als<br />
Standardverfahren festgelegt und<br />
dient als Orientierung für die Trinkwasseraufbereitung<br />
mit Rohwasser<br />
aus Talsperren. Anhand der umfangreichen<br />
Versuchsreihen (Bild 2)<br />
konnten Ergebnisse erzielt werden,<br />
die eine Aufstellung von Kostenbzw.<br />
Aufwandsfunktionen ermöglichten.<br />
Damit lässt sich der Einfluss<br />
von Rohwasserqualitätsparametern<br />
auf die Aufbereitungsleistung bzw.<br />
-kosten mathematisch beschreiben.<br />
Jeder Kombination an Eingangsgrößen<br />
in Form der Qualitätsparameter<br />
DOC und Trübung können bei einer<br />
optimalen Kombination an Aufbereitungsparametern<br />
ein maximales<br />
Volumen an produziertem Trinkwasser<br />
bzw. optional minimale Kosten<br />
pro produziertem m³ Trinkwasser<br />
zugeordnet werden. Eingang in<br />
das Gesamtregelwerk finden festgelegte<br />
Kriterien hinsichtlich akzeptabler<br />
Bereiche für die Parameter DOC<br />
und Trübung sowie spezifische Kosten<br />
als Maß für den Aufbereitungsaufwand.<br />
Bild 2. Versuchs schema.<br />
Autoren<br />
Dr.-Ing. Irene Slavik<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl<br />
Technische Universität Dresden |<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung |<br />
D-01062 Dresden<br />
Mai 2013<br />
542 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Aktuell NETZWERK WISSEN<br />
Nachhaltige <strong>Wasser</strong>versorgung für Brasiliens Hauptstadt<br />
Im Rahmen des Projektes IWAS-Água DF wird ein Integriertes <strong>Wasser</strong>-Ressourcen-<br />
Management-Konzept für Brasília DF entwickelt<br />
Unzureichende<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ist derzeit das zweitgrößte<br />
Problem der Welt. Dies wird<br />
nicht nur aufgrund regionaler Trockenperioden,<br />
sondern auch durch<br />
Bevölkerungswachstum und dramatische<br />
Änderungen der Landnutzung<br />
hervorgerufen. Insbesondere<br />
das Hauptproblem der<br />
Megastädte ist heutzutage die<br />
Urbanisierungsrate, die die Kapazitäten<br />
der nationalen und lokalen<br />
Regierungen häufig weit überschreitet,<br />
demografische Änderungen<br />
effizient und nachhaltig zu planen<br />
und durchzuführen.<br />
Eine dieser Städte ist Brasília, die<br />
Hauptstadt Brasiliens, mit dem Bundesbezirk<br />
Distrito Federal (DF) mit<br />
derzeit insgesamt 2,5 Millionen Einwohnern.<br />
Dies übersteigt weit die<br />
Bevölkerung von 700 000 Menschen,<br />
für die die Stadt ursprünglich<br />
im Jahr 1960 geplant wurde.<br />
Das Internationale Deutsch-Brasilianische<br />
Projekt IWAS-Água DF<br />
beschäftigt sich mit der Entwicklung<br />
eines Integrierten <strong>Wasser</strong>-Ressourcen-Management-Konzeptes<br />
(IWRM), um die nachhaltige <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
in Brasília DF in Zukunft<br />
zu sichern. Trinkwasseraufbereitung<br />
und -verteilung sind zwei der<br />
Arbeitspakete im Gesamtprojekt<br />
(siehe Bild).<br />
Das IWRM-Konzept für eine<br />
nachhaltige Trinkwasserversorgung<br />
im DF soll die folgenden Faktoren<br />
berücksichtigen:<br />
##<br />
natürliche Randbedingungen<br />
(Klima, Landnutzung, urbane<br />
Struktur usw.)<br />
##<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung (Trinkwasseraufbereitung<br />
und -verteilung)<br />
##<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
##<br />
Management<br />
Die größten Systeme im DF,<br />
Descoberto, Torto/Santa-Maria und<br />
Pipiripau, stellen <strong>Wasser</strong> hauptsächlich<br />
aus Stauseen mittels einer konventionellen<br />
Aufbereitungstechnologie<br />
seit Anfang der 1970er-Jahre<br />
bereit. Aufgrund der wachsenden<br />
Lücke zwischen Nachfrage und Verfügbarkeit<br />
des Rohwassers für die<br />
Trinkwassergewinnung wird nun<br />
eine alternative Ressource, der See<br />
Paranoá, für die zukünftige <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
berücksichtigt. Dadurch<br />
wird es möglich, die <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
und -versorgung für zusätzlich<br />
eine halbe Million Menschen sicherzustellen.<br />
Wechsel beziehungen zwischen Arbeitspaketen im<br />
Projekt IWAS-Brasilien.<br />
Dies erfordert den Einsatz innovativer<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungstechnologien,<br />
wie Hybridverfahren<br />
Flockung/Membranfiltration oder<br />
Adsorption/Membranfiltration.<br />
Besonderes Augenmerk wird dabei<br />
auf die Entfernung von Mikroschadstoffen,<br />
Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten<br />
sowie Mikroorganismen<br />
gelegt.<br />
Das allgemeine Ziel des entwickelten<br />
IWRM-Konzeptes ist es, ein<br />
Hilfsmittel zum Management aller<br />
Faktoren, die die <strong>Wasser</strong>qualität und<br />
-quantität im Paranoá See beeinflussen,<br />
zu liefern. Weiterhin sollen<br />
technische und wirtschaftliche<br />
Bestrebungen unternommen werden,<br />
um Trinkwasser von sicherer<br />
Qualität zu produzieren.<br />
Autoren<br />
Entscheidungshilfesystem für ein Integriertes <strong>Wasser</strong>ressourcenmanagement.<br />
Dr. Ekaterina Vasyukova<br />
E-Mail:<br />
ekaterina.vasyukova@tu-dresden.de |<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl<br />
E-Mail: wolfgang.uhl@tu-dresden.de |<br />
Technische Universität Dresden |<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung |<br />
D-01062 Dresden<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 543
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Kläranlage in<br />
Beer Sheva,<br />
Wüste Negev.<br />
Fouling-minimierte Rückgewinnung sekundärer<br />
Abwässer in Israel<br />
Verbundforschungsprojekt ReSeRO untersucht Auswirkungen verschiedener<br />
Vorbehandlungsverfahren zur Minimierung des Foulings von RO-Membranen<br />
Fouling auf der Membran.<br />
Mit zunehmender <strong>Wasser</strong>knappheit<br />
und häufig schlechten<br />
Rohwasserqualitäten nimmt in<br />
ariden Gebieten das Bestreben zu,<br />
geklärte Abwässer zu Trinkwasserqualität<br />
für die Bewässerung in<br />
der Landwirtschaft aufzubereiten.<br />
Hierzu werden Umkehrosmoseprozesse<br />
(RO – reverse osmosis) eingesetzt,<br />
die in Verfahrenskombinationen<br />
zum Einsatz kommen. Einschränkend<br />
auf den Prozess wirkt<br />
das sogenannte Membranfouling.<br />
Dieses kann durch kleine Partikel<br />
(Kolloide), Mikroorganismen und<br />
organische <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe verursacht<br />
werden.<br />
In das Verbundforschungsprojekt<br />
ReSeRO (Fouling Minimized<br />
Reclamation of Secondary Effluents<br />
with RO) sind mehrere Partner aus<br />
Deutschland und Israel involviert. Es<br />
werden die Auswirkungen verschiedener<br />
Vorbehandlungsverfahren<br />
zur Minimierung des Foulings von<br />
RO-Membranen untersucht und<br />
optimiert. Hierbei werden die Aufbereitungsstufen<br />
Flockung, Biofiltration<br />
und Ultrafiltration (UF)<br />
betrachtet und erforscht. Im Falle<br />
der Ultrafiltration werden insbesondere<br />
unterschiedlich modifizierte<br />
Membranen eingesetzt.<br />
Die UF dient der Entfernung von<br />
partikulären <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffen<br />
und von Mikroorganismen. Als Hybridprozess<br />
mit vorgeschalteter Flockung,<br />
Adsorption oder Biofiltration<br />
können auch <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe,<br />
die zu Fouling führen, entfernt werden.<br />
Zur experimentellen Untersuchung<br />
des Foulings werden neuartige<br />
Testzellen für Umkehrosmosemembranen<br />
entwickelt und<br />
angefertigt. Diese werden in Reihe<br />
geschaltet, um eine Standard RO-<br />
Konfiguration in einem Druckrohr<br />
mit sechs Wickelmodulen zu simulieren.<br />
Zur Auswertung werden Analysen<br />
der Konzentrat-, Permeat- und<br />
Feedströme durchgeführt. Hierbei<br />
spielen vor allem die Parameter Leitfähigkeit,<br />
gelöster organischer Kohlenstoff,<br />
spezifischer Absorptionskoeffizient<br />
und Trübung eine Rolle.<br />
Weiterhin erfolgen Modellierungen<br />
der Strömungsfelder in der UF und<br />
der RO, der sich bildenden partikulären<br />
Foulingschichten in den UF-<br />
Kapillaren und die Modellierung der<br />
biologischen Entfernung organischer<br />
Substanzen.<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Nadine Siebdrath<br />
E-Mail: nadine.siebdrath@tu-dresden.de |<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl<br />
E-Mail: wolfgang.uhl@tu-dresden.de |<br />
Technische Universität Dresden |<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung |<br />
D-01062 Dresden<br />
Mai 2013<br />
544 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Aktuell NETZWERK WISSEN<br />
Wie können <strong>Wasser</strong>versorger klimatische<br />
Veränderungen kompensieren?<br />
Innerhalb des Modellprojekts REGKLAM untersucht die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Auswirkungen auf <strong>Wasser</strong>aufbereitung und Rohwasserqualitäten<br />
Im Rahmen des Vorhabens „Entwicklung und Erprobung eines integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms<br />
für die Modellregion Dresden“ (REGKLAM) entwickeln regionale Akteure aus Politik, Verwaltung,<br />
Wirtschaft und Wissenschaft Strategien für den Umgang mit den regionalen Auswirkungen des Klimawandels.<br />
Die Professur <strong>Wasser</strong>versorgung an der Technischen Universität Dresden (TUD) analysiert innerhalb dieses<br />
Modellprojekts vorhandene Daten bezüglich realistisch zu erwartender Rohwasserqualitäten und Betriebsdaten<br />
beteiligter <strong>Wasser</strong>unternehmen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für Untersuchungen mit kleintechnischen<br />
Versuchsanlagen zur Flockung/Filtration und zur Flockung/Ultrafiltration.<br />
Klimaprognosen lassen für die<br />
Modellregion Dresden trockenere<br />
und wärmere Sommer, feuchtere<br />
und mildere Winter sowie ein<br />
häufigeres Auftreten hydrologischer<br />
Extremsituationen, wie z. B.<br />
von Starkregenereignissen sowie<br />
Hitze und Trockenperioden erwarten.<br />
Diese Änderungen werden Auswirkungen<br />
auf die <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
in der Modellregion Dresden<br />
haben, die ihr Rohwasser für die<br />
Trinkwasserbereitstellung aus Talsperren<br />
sowie aus dem Flusswasser<br />
bzw. Uferfiltrat der Elbe bezieht.<br />
Ziel des Teilprojektes 3.2.3 „<strong>Wasser</strong>versorgung“<br />
innerhalb des vom<br />
Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung geförderten Leuchtturmprojekts<br />
REGKLAM ist die Entwicklung<br />
von Anpassungsstrategien<br />
für <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen,<br />
die es ermöglichen,<br />
klimabedingte Veränderungen zu<br />
kompensieren und die Trinkwasserversorgung<br />
ohne Qualitätsminderung<br />
bei minimalem Kostenaufwand<br />
abzusichern.<br />
Klimatisch bedingte<br />
Einflüsse auf<br />
die Rohwasserqualität<br />
Die prognostizierten klimatischen<br />
Veränderungen werden das Ab -<br />
fluss verhalten der Elbe in der<br />
Region Dresden nachhaltig beeinflussen.<br />
Daraus resultierend ergeben<br />
sich kurzzeitige sowie auch<br />
langfristige Veränderungen in der<br />
Flusswasserqualität z. B. im Hinblick<br />
auf die Parameter Temperatur, pH-<br />
Wert, DOC-Konzentration, Trübung<br />
und Sauerstoffkonzentration, die<br />
wesentlichen Einfluss auf die Prozesse<br />
der Uferfiltration haben. Für<br />
den Zeitraum der letzten zehn Jahre<br />
wurde z. B. ein signifikanter Anstieg<br />
der Monatsmittel der Konzentration<br />
an gelöstem organischem Kohlenstoff<br />
(DOC) festgestellt.<br />
Die Komplexität der Wirkungsgefüge<br />
der physikalischen, chemischen<br />
und biologischen Vorgänge<br />
bei der Uferfiltration lässt nur eine<br />
kausale Herleitung möglicher Veränderungen<br />
der Beschaffenheit<br />
des Uferfiltrates durch klimatisch<br />
bedingte Einflüsse zu.<br />
Erhöhte Frachten an Trübstoffen<br />
sowie partikulärem organischem<br />
Material können zu einer Verstärkung<br />
der Kolmation der Gewässersohle<br />
führen. Die Ausprägung der<br />
Kolmationszone und damit die<br />
mögliche Infiltrationsrate durch die<br />
Gewässersohle werden entscheidend<br />
durch die hydrologischen<br />
Verhältnisse im Fließgewässer<br />
beeinflusst. Damit ist auch eine<br />
Beeinträchtigung der möglichen<br />
Fördermenge an Uferfiltrat durch<br />
klimatisch bedingte Veränderungen<br />
denkbar.<br />
Versuchsanlagen<br />
Für die Ermittlung möglicher Anpassungsoptionen<br />
konventioneller<br />
Aufbereitungsverfahren wird eine<br />
Versuchsanlage zur Flockung-Sedimentation-Mehrschichtfiltration<br />
im<br />
<strong>Wasser</strong>werk Hosterwitz betrieben.<br />
In diesem <strong>Wasser</strong>werk ist neben der<br />
direkten Uferfiltration eine Flusswasseraufbereitung<br />
mit anschließender<br />
Infiltration zur Erhöhung<br />
der Aufbereitungskapazität möglich.<br />
Daher wird mit der Versuchsanlage<br />
zunächst die Aufbereitung<br />
von Flusswasser untersucht. In einer<br />
weiteren Phase erfolgen Untersuchungen<br />
zur Uferfiltrataufbereitung.<br />
Parallel zu der konventionellen<br />
Aufbereitung wird eine Versuchsanlage<br />
zur Flockung/Ultrafiltration<br />
betrieben, sodass ein Vergleich der<br />
Anpassungsfähigkeit beider Aufbereitungsverfahren<br />
erfolgen kann.<br />
Der Betrieb der Versuchsanlagen<br />
ermöglicht es zunächst, Optimierungspotenziale<br />
für die im <strong>Wasser</strong>werk<br />
vorhandenen Aufbereitungsverfahren<br />
zu erarbeiten. Weiterhin<br />
ist es im Zulauf der Versuchsanlage<br />
möglich, eine variable Rohwasserqualität<br />
durch Dosierung von Trübstoffen<br />
und aufkonzentrierten<br />
gelösten organischen <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffen<br />
zu simulieren.<br />
Modell zur<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Zur Begrenzung des Versuchsaufwandes<br />
wurde die Methode der statistischen<br />
Versuchsplanung angewandt.<br />
Die Aufbereitungsleistung<br />
(gemessen als flächenbezogenes<br />
Filterlaufvolumen) soll als Funktion<br />
von organischer Belastung (DOC)<br />
und Trübung dargestellt werden.<br />
Diese Parameter gehen als Leitpara-<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 545
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
meter zur Rohwassergüte in das<br />
Berechnungsmodell ein. Als variable<br />
Aufbereitungsgrößen wurden<br />
die Flockungsmittelkonzentration,<br />
der pH-Wert bei der Flockung sowie<br />
die Filtergeschwindigkeit festgelegt.<br />
Die weiteren Konfigurationsgrößen<br />
der Aufbereitungsanlagen,<br />
wie z. B. Filterbetttiefe, Spüldauer,<br />
Spülvolumen oder Schlammabzug<br />
der Sedimentation, gehen als feste<br />
Aufbereitungsgrößen in das Modell<br />
ein. Als Abbruchkriterien für die<br />
Filterläufe dienten der maximale<br />
Druckverlust im Filterbett und die<br />
Trübung im Filterablauf.<br />
Im Ergebnis der Untersuchungen<br />
an den Versuchsanlagen<br />
können Regressionsgleichungen<br />
aufgestellt werden, die den Zusammenhang<br />
zwischen dem Filterlaufvolumen<br />
und den Größen pH-Wert,<br />
Filtergeschwindigkeit, Flockungsmittelkonzentration,<br />
DOC und Trübung<br />
wiedergeben.<br />
Diese ermöglichen eine Aufstellung<br />
von Kosten- bzw. Aufwandsfunktionen<br />
der <strong>Wasser</strong>aufbereitung.<br />
Mithilfe dieser Funktionen lässt sich<br />
der Einfluss von Rohwasserqualitätskenngrößen<br />
auf die Aufbereitungsleistung<br />
bzw. -kosten mathematisch<br />
beschreiben. Jeder Kombination<br />
an Eingangsgrößen in Form<br />
der Qualitätsparameter DOC und<br />
Trübung können bei einer optimalen<br />
Kombination an Aufbereitungsparametern<br />
ein maximales Volumen<br />
an produziertem Trinkwasser bzw.<br />
optional minimale Kosten pro produziertem<br />
m³ Trinkwasser zugeordnet<br />
werden. Damit ist ein Optimierungsmodul<br />
geschaffen worden,<br />
mit dem akzeptable Bereiche für die<br />
Parameter DOC und Trübung sowie<br />
für spezifische Kosten als Maß für<br />
den Aufbereitungsaufwand bei der<br />
Trinkwasserproduktion ermittelt<br />
werden können.<br />
Konzept zur Reaktion<br />
auf Veränderungen der<br />
Rohwasserqualität<br />
Es wurde ein Konzept entwickelt,<br />
wie seitens der <strong>Wasser</strong>versorger auf<br />
Veränderungen der Rohwasserbeschaffenheit<br />
des Uferfiltrats reagiert<br />
werden kann. Zunächst müssen die<br />
(gegebenenfalls zu erwartenden)<br />
Änderungen der Rohwasserbeschaffenheit<br />
erfasst werden. Für<br />
eine Feststellung kurzzeitiger Änderungen<br />
ist eine ausreichend häufige<br />
Analyse aller relevanten Qualitätsparameter<br />
des Rohwassers (Flusswasser<br />
und Uferfiltrat) erforderlich.<br />
Eine systematische Erfassung dieser<br />
Daten bildet auch die Grundlage für<br />
die Ermittlung langfristiger Trends<br />
in der Rohwasserbeschaffenheit.<br />
Mithilfe der erfassten Daten sowie<br />
gegebenenfalls vorhandener Mo -<br />
delle für die zukünftige Entwicklung<br />
der Beschaffenheit des Flusswassers<br />
bzw. des Uferfiltrats erfolgt eine<br />
Prognose der zu erwartenden Veränderungen<br />
der Rohwasserqualität.<br />
Zusätzlich müssen die örtlichen<br />
Gegebenheiten auf mögliche Handlungsoptionen<br />
untersucht werden,<br />
d. h. die vorhandenen Aufbereitungsprozesse<br />
müssen hinsichtlich<br />
ihrer Anpassungsfähigkeit und<br />
Erweiterbarkeit geprüft sowie mögliche<br />
Einschränkungen vor Ort<br />
erfasst werden. Danach kann eine<br />
Auswahl möglicher Handlungsoptionen<br />
im Hinblick auf die zu erwartenden<br />
Veränderungen der Rohwasserbeschaffenheit<br />
erfolgen.<br />
Diese werden anhand einer<br />
Kosten-Nutzen-Analyse bewertet,<br />
sodass am Ende die Entscheidung für<br />
eine ökonomisch sinnvolle Anpassung<br />
an die Veränderungen der Rohwasserbeschaffenheit<br />
erfolgen kann.<br />
Diese Konzeption bietet die Möglichkeit<br />
der Entwicklung von Strategien<br />
zur Optimierung der Trinkwasseraufbereitung<br />
aus Uferfiltrat bei variabler<br />
Rohwasserqua lität und dient als<br />
Grundlage für die Entwicklung von<br />
Entscheidungs hilfemodulen für die<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
der Region. Mit deren Hilfe sollen<br />
mögliche Verfahrensoptimierungen<br />
für die derzeitig eingesetzten Aufbereitungsprozesse<br />
und Möglichkeiten<br />
für Ergänzungen und Erweiterungen<br />
der bestehenden Trinkwasseraufbereitung<br />
durch neuartige Verfahren<br />
aufgezeigt werden. Anschließend<br />
erfolgt eine Beurteilung der einzelnen<br />
Handlungsoptionen im Hinblick<br />
auf die erzielbare Aufbereitungsleistung<br />
und die zu erwartenden<br />
Kosten.<br />
FLUSSWASSER<br />
UFERFILTRAT<br />
WASSERAUFBEREITUNG<br />
Weitere Informationen:<br />
www.regklam.de<br />
Entscheidungshilfesystem,<br />
wie <strong>Wasser</strong>versorger<br />
auf<br />
Veränderungen<br />
der Rohwasserqualität<br />
reagieren<br />
können.<br />
ERFASSUNG VON QUALITÄTSÄNDERUNGEN<br />
PROGNOSE<br />
WASSERQUALITÄT<br />
AUSWAHL MÖGLICHER<br />
HANDLUNGSOPTIONEN<br />
BEWERTUNG<br />
ENTSCHEIDUNG<br />
BETRIEBSDATEN<br />
BETRIEBSKOSTEN<br />
INVESTITIONEN?<br />
KOSTEN-NUTZEN-<br />
ANALYSE<br />
Autoren<br />
Dr.-Ing. Irene Slavik<br />
E-Mail: irene.slavik@tu-dresden.de |<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl<br />
(Teilprojektleiter) |<br />
E-Mail: wolfgang.uhl@tu-dresden.de |<br />
Technische Universität Dresden |<br />
Professur <strong>Wasser</strong>versorgung |<br />
D-01062 Dresden<br />
Mai 2013<br />
546 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ePaper mit<br />
80% Rabatt<br />
fü r Studenten<br />
Das führende Fachorgan<br />
für <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong>.<br />
Für Studenten als ePaper<br />
jetzt nur € 70,-.<br />
Die Fachpublikation informiert regelmäßig und<br />
wissenschaftlich fundiert ü ber die technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil<br />
R+S Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
Extra<br />
günstig!<br />
Einfach das passende Bezugsangebot<br />
wählen und gratis testen!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium<br />
für Computer, Tablet-PC oder Smartphone<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> erscheint in : DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstraße 124, 80636 Mü nchen<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Sofortanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170-492 oder als Brief einsenden oder QR-Code scannen<br />
Ja, ich möchte das Fachmagazin <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> zweimal gratis testen. Nur wenn ich<br />
ü berzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der zweiten Ausgabe schriftlich<br />
absage, bekomme ich <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> fü r zunächst ein Jahr (12 Ausgaben) zum Sonderpreis<br />
fü r Studenten (gegen Nachweis)<br />
□ als ePaper (PDF) fü r nur € 70,-<br />
□ als Heft fü r € 175,-<br />
zzgl. Versand (Deutschland: € 30,-/Ausland: € 35,-)<br />
Bitte geben Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse an, wenn Sie <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> als ePaper<br />
beziehen wollen.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>gwf</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder<br />
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die Datum, Unterschrift<br />
XFGWFW2013<br />
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an Leserservice <strong>gwf</strong>, Franz-Horn-Str. 2, 97082 Wü rzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich von<br />
DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
Telefax
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Neuer Studiengang <strong>Wasser</strong>- und Infrastrukturmanagement<br />
startet an der Hochschule Koblenz<br />
Bei Management- und Planungsaufgaben im Bauwesen erhalten rechtliche, betriebswirtschaftliche und ökologische<br />
Aspekte eine immer größer werdende Bedeutung. Das gilt insbesondere im Bereich <strong>Wasser</strong>wirtschafts-,<br />
<strong>Wasser</strong>bau- und Infrastrukturplanung. Diese neuen Anforderungen aus Verwaltung und Wirtschaft machen<br />
interdisziplinäre Angebote erforderlich: Der neue Bachelorstudiengang <strong>Wasser</strong>- und Infrastrukturmanagement<br />
(WIM) bildet die Studierenden für dieses zukunftsorientierte und vielseitige Berufsbild gezielt aus und fördert<br />
zudem in großem Umfang soziale Kompetenzen. Er startet zum Wintersemester 2013/14.<br />
Der neue Bauingenieur-Studiengang<br />
<strong>Wasser</strong>- und Infrastrukturmanagement<br />
befindet sich derzeit<br />
in der Akkreditierungsphase. Er wird<br />
zum Wintersemester 2013/14 als<br />
Bachelorstudiengang in Vollzeit mit<br />
maximal 30 Studierenden an den<br />
Start gehen und danach zu jedem<br />
Winter- und Sommersemester neue<br />
Studierende aufnehmen. Absolventinnen<br />
und Absolventen erhalten<br />
den akademischen Grad Bachelor of<br />
Engineering (B. Eng.).<br />
Das Bauingenieurwesen will mit<br />
dem neuen Bachelorstudiengang<br />
<strong>Wasser</strong>- und Infrastrukturmanagement<br />
(WIM) eine innovative und<br />
zukunftsorientierte Ausbildung er -<br />
möglichen, um den Bedarf von Be -<br />
trieben, Ingenieurbüros und Be -<br />
hörden zu decken. Darüber hinaus<br />
verfolgt der diversityorientierte<br />
Bachelorstudiengang das Ziel, den<br />
Frauenanteil im Bauingenieurwesen<br />
deutlich zu erhöhen. Verbesserte<br />
Rahmenbedingungen sollen<br />
auch Männer motivieren, sich für<br />
den lehrmethodisch-innovativen<br />
Studiengang zu entscheiden. „Ne-<br />
ben den zukunftsweisenden Themenbereichen<br />
<strong>Wasser</strong> und Infrastruktur<br />
liegt auch ein großer Fokus<br />
auf der Förderung von persönlichen<br />
und sozialen Kompetenzen sowie<br />
überfachlicher Qualifikationen“, be -<br />
tont Prof. Dr.-Ing. Norbert Krudewig,<br />
Dekan des Fachbereichs Bauwesen.<br />
Das WIM-Studium beginnt mit<br />
einem Kick-off-Camp, das als Motivationsgeber<br />
einen leichteren Übergang<br />
von der Schule zur Hochschule<br />
Die WIM-Studierenden erwartet unter anderem das <strong>Wasser</strong>baulabor.<br />
© Hochschule Koblenz/Gandner<br />
ermöglicht. Eine weitere Besonderheit<br />
dieses Studiengangs ist das<br />
Mentoring-Programm, das die Studierenden<br />
bei der Orientierung im<br />
Studium unterstützt. Die fachspezifischen<br />
Grundlagen im Bauingenieurwesen<br />
garantieren, dass die Studierenden<br />
in den ersten vier Semestern<br />
ein grundlegendes Verständnis entwickeln.<br />
Im 5. und 6. Semester können<br />
sich die Studierenden wahlweise<br />
auf <strong>Wasser</strong>management oder<br />
Infrastrukturmanagement spezialisieren.<br />
Im 7. Se mester, welches ausschließlich<br />
für die 16-wöchige Praxisphase<br />
und die 8-wöchige Bachelor-Thesis<br />
vorgesehen ist, erhalten<br />
die Studierenden die Möglichkeit,<br />
ihre erworbenen praxisorientierten<br />
und interdisziplinären Kenntnisse<br />
intensiver anzuwenden.<br />
Fazit: Der Studiengang WIM orientiert<br />
sich an der Berufspraxis und<br />
vermittelt ein breites Fachwissen<br />
sowie wissenschaftliche Methoden<br />
und praxisrelevante Verfahren.<br />
Neben den klassischen Grundkenntnissen<br />
einer Bauingenieurin<br />
und eines Bauingenieurs spezialisieren<br />
sich die Studierenden in den<br />
Vertiefungsrichtungen <strong>Wasser</strong>- oder<br />
Infrastrukturmanagement und er -<br />
halten somit eine profilbildende<br />
Ausbildung mit interdisziplinären<br />
Kenntnissen und Qualifikationen.<br />
Weitere Informationen:<br />
Hochschule Koblenz – University of<br />
Applied Sciences,<br />
http://www.hs-koblenz.de/<br />
Mai 2013<br />
548 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Ganzheitliche<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
an der<br />
Ruhr.<br />
Zukunft aus Erfahrung:<br />
Der Ruhrverband gestern, heute, morgen<br />
Von Professor Harro Bode, Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbands<br />
Der Ruhrverband, zuständig für die ganzheitliche <strong>Wasser</strong>wirtschaft im natürlichen Einzugsgebiet der Ruhr<br />
(Bild 1), wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Seit 1913 erfüllt er seine gesetzliche Aufgabe, die Bereitstellung von<br />
<strong>Wasser</strong> in ausreichender Menge und guter Qualität, erfolgreich auf der Basis eines eigenen nordrhein-westfälischen<br />
Sondergesetzes in genossenschaftlicher Finanzierungs- und Organisationsform. Und Beispiele aus<br />
der aktuellen Praxis belegen, warum es auch künftig sinnvoll ist, zusammenhängende Flussgebiete unter die<br />
operative Fürsorge öffentlich-rechtlicher Non-Profit-Organisationen zu stellen.<br />
Von der dünn besiedelten Agrarregion<br />
zum größten Ballungszentrum<br />
Europas: Wohl keine<br />
andere Region hat durch die Industrialisierung<br />
ab etwa 1850 derart tief<br />
greifende Veränderungen erfahren<br />
wie das Ruhrgebiet. Riesige Zechen<br />
und Industriebetriebe entstanden,<br />
Dörfer und Landgemeinden wuchsen<br />
in wenigen Jahrzehnten zu<br />
Großstädten mit mehreren hunderttausend<br />
Einwohnern an. Die<br />
Ruhr, obwohl von ihrer Länge und<br />
ihrem Abfluss her ein vergleichsweise<br />
kleiner Fluss, war der einzige<br />
geeignete Hauptlieferant von Trinkund<br />
Brauchwasser – was immer<br />
wieder zu gefährlicher <strong>Wasser</strong>knappheit<br />
und unhaltbaren hygienischen<br />
Zuständen führte. Dabei<br />
wurde der Ruhr auch <strong>Wasser</strong> entzogen,<br />
welches nach Gebrauch über<br />
andere Flussgebiete dem Rhein<br />
zufloss. Zu den Leidtragenden dieses<br />
<strong>Wasser</strong>entzugs gehörten unter<br />
anderem die Triebwerksbesitzer an<br />
der unteren Ruhr, denen der „Treibstoff“<br />
ihrer Turbinen mehr und mehr<br />
genommen wurde. 1911 schließlich<br />
kam es zum Kollaps des Systems:<br />
Wochenlange Hitze und Trockenheit,<br />
gepaart mit einem hohen Entnahmegrad<br />
durch die <strong>Wasser</strong>werke<br />
und der damals üblichen Ableitung<br />
ungeklärter Haushalts- und Industrieabwässer<br />
in den Fluss, ließen die<br />
Ruhr in ihrem Unterlauf zu einer öligen<br />
schwarzbraunen Brühe werden.<br />
In Mülheim brach eine Typhusepidemie<br />
aus, bei der 1 500 Menschen<br />
erkrankten, und schließlich brachte<br />
der <strong>Wasser</strong>mangel sogar die Indust-<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 549
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Kläranlage Menden des Ruhrverbands.<br />
Überlauf der Möhnetalsperre.<br />
rieproduktion an der unteren Ruhr<br />
zum Erliegen.<br />
Es war diese Extremsituation, die<br />
den Durchbruch brachte: 1913<br />
begründete ein preußisches Sondergesetz<br />
den Ruhrverband als<br />
öffentlich-rechtlichen <strong>Wasser</strong>verband<br />
mit der Aufgabe, Kläranlagen<br />
zur Reinhaltung der Ruhr zu betreiben,<br />
und verlieh zugleich dem bisher<br />
privatrechtlich organisierten<br />
Ruhrtalsperrenverein einen öffentlich-rechtlichen<br />
Status. Mitglieder<br />
der Verbände wurden per Gesetz<br />
alle Nutzer der Ruhr, also die ganz<br />
oder teilweise im Verbandsgebiet<br />
liegenden Kommunen und Kreise<br />
sowie Industrie- und Gewerbebetriebe,<br />
die in großen Mengen<br />
<strong>Abwasser</strong> ableiten, Unternehmen<br />
der öffentlichen <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und Triebwerksbetreiber. Eine<br />
mutige und für die damalige Zeit<br />
absolut zukunftsweisende Entscheidung,<br />
die es Ruhrverband und<br />
Ruhrtalsperrenverein ermöglichte,<br />
das gesamte Flussgebiet der Ruhr<br />
unabhängig von administrativen<br />
Grenzen, politischen Gemengelagen<br />
und wirtschaftlichen Einzelinteressen<br />
wasserwirtschaftlich als<br />
Einheit zu bewirtschaften.<br />
Bis heute arbeitet der Ruhrverband,<br />
ebenso wie die anderen<br />
der mittlerweile zehn <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverbände<br />
in Nordrhein-<br />
Westfalen, auf einer öffentlichrechtlichen<br />
Grundlage. Die jeweils<br />
flussgebietsbezogene Verantwortung<br />
jenseits von kommunalen<br />
Zuständigkeiten hat sich erneut<br />
immer wieder als sinnvoll herausgestellt<br />
– verhindert sie doch das Herausbilden<br />
eines egoistischen Ge -<br />
geneinanders von Ober- und Unterliegern,<br />
indem sie anstehende<br />
Aufgaben ganzheitlich betrachtet<br />
und anfallende Kosten in einem fairen<br />
Verhältnis auf alle Mitglieder<br />
der Gemeinschaft verteilt. Auch der<br />
genossenschaftliche Ansatz ist für<br />
die <strong>Wasser</strong>wirtschaft ideal: Kräfte<br />
können zur Bewältigung größerer<br />
Herausforderungen gebündelt, einmal<br />
gemachte Erfahrungen auch an<br />
anderer Stelle nutzbringend angewendet<br />
werden.<br />
Vor diesem Hintergrund können<br />
sich <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverbände<br />
auch an die versuchsweise Installation<br />
innovativer Technologien wa -<br />
gen, deren Vorzüge im Einzelnen<br />
noch zu belegen sind: Bei Erfolg<br />
erzeugt der wiederholte Einsatz<br />
Vorteile für die Genossenschaft, bei<br />
Misserfolg bleibt der Schaden für<br />
die Gemeinschaft begrenzt. Der<br />
Ruhrverband erprobt aktuell ein<br />
solches innovatives Verfahren im<br />
Rahmen eines vom Ministerium für<br />
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,<br />
Natur- und Verbraucherschutz<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
(MKULNV) geförderten Forschungsprojekts,<br />
das im großtechnischen<br />
Versuchsbetrieb der Frage<br />
nach möglichen Technologien zur<br />
weitergehenden Entfernung von<br />
Mikroverunreinigungen aus dem<br />
<strong>Abwasser</strong> nachgeht. Auf der Kläranlage<br />
Schwerte des Ruhrverbands<br />
wurde dazu eine großtechnische<br />
Versuchsanlage für 25 000 Einwohnerwerte<br />
errichtet, in der die Dosierung<br />
von Pulveraktivkohle und/<br />
oder Ozon in einem neu entwickelten<br />
Verfahren der „dynamischen<br />
Rezirkulation“ erforscht wird. An -<br />
dere Kläranlagenbetreiber sind an<br />
dem landesweiten Forschungsprojekt<br />
ebenfalls mit neuen, noch<br />
näher zu erprobenden Reinigungsverfahren<br />
beteiligt.<br />
Ein anderer Meilenstein zur Etablierung<br />
zukunftsweisender Methoden<br />
und Herangehensweisen hat<br />
beim Ruhrverband bereits sichtbare<br />
Erfolge hervorgebracht: Die im Jahr<br />
2005 eingeführte sogenannte Integrale<br />
Entwässerungsplanung (IEP)<br />
untersucht in einem ganzheitlichen<br />
Ansatz und auf der Basis von Messungen<br />
und einer praktischen Nachweisführung<br />
die Wechselwirkungen<br />
zwischen Kanalisation, Niederschlagswasserbehandlung,<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
und aufnehmendem<br />
Gewässer. Sie erlaubt eine zielgerichtete<br />
und kostenoptimierte Planung<br />
von Erweiterungen und Veränderungen<br />
der Siedlungsentwässerung.<br />
Ein anschauliches Beispiel<br />
unter vielen ist die erfolgreich vollzogene<br />
IEP im Einzugsgebiet der<br />
Mai 2013<br />
550 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Anzeige RoK 4_Layout 1 26.04.13 10:18 Seite 1<br />
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Kläranlage Wenden des Ruhrverbands, bei der (im Vergleich<br />
zur früher üblichen, überwiegend theoretischen<br />
und getrennten Beplanung von Kläranlage, Kanalisation<br />
und Niederschlagswasserbehandlung) für den Gebührenzahler<br />
Einsparungen in Höhe von elf Millionen Euro<br />
realisiert werden konnten – und das bei gleichzeitiger<br />
erheblicher Verbesserung der gewässerökolo gischen<br />
Situation im Einzugsgebiet.<br />
Diese Beispiele belegen, dass die rund ein Jahrhundert<br />
zurückliegende Schaffung flussgebietsbezogener<br />
operativer <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverbände ein kluger Schritt<br />
war, der auch heute und in Zukunft sach gerechte, wirtschaftlich<br />
vernünftige und häufig hochinnovative Lösungen<br />
zum Nutzen für Mensch und Umwelt erlaubt.<br />
Die Entstehungsgeschichte des Ruhrgebiets als<br />
eines von Kohle und Stahl geprägten Industrie- und<br />
Ballungsraums ist ohne die Übertragung wasserwirtschaftlicher<br />
Aufgaben auf überörtlich gebildete <strong>Wasser</strong>verbände<br />
kaum vorstellbar. Die Unternehmensform<br />
einer sich selbstverwaltenden Körperschaft war bislang<br />
allen Veränderungen in Staat und Gesellschaft gewachsen.<br />
Der Ruhrverband beschäftigt heute 960 Mitarbeiter<br />
und Mitarbeiterinnen (in Volzeitäquivalenten). Er be -<br />
steht aus 60 Mitgliedskommunen, 67 <strong>Wasser</strong>entnehmern<br />
und 405 Industriebetrieben. Sein Jahresumsatz<br />
beträgt 290 Mio. €, sein Verbandsgebiet ist 4485 km 2<br />
groß, und die Ruhr weist eine Länge von 220 km auf.<br />
Der technische Anlagenpark des Ruhrverbands<br />
umfasst unter anderem 68 Kläranlagen (Bild 2) und<br />
556 Niederschlagswasserbehandlungsmaßnahmen. Er<br />
nennt dreizehn künstliche Seen sein eigen, die sich<br />
heute neben ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung<br />
auch großer Beliebtheit bezüglich ihres Freizeit- und<br />
Naherholungswertes erfreuen. Bei acht dieser dreizehn<br />
Seen handelt es sich um Talsperren zur <strong>Wasser</strong>mengenbewirtschaftung<br />
(Bild 3), die in ihrer Summe das größte<br />
zusammenhängende Talsperrensystem Deutschlands<br />
darstellen.<br />
Auch in Zukunft ist der Ruhrverband als Träger der<br />
regionalen <strong>Wasser</strong>wirtschaft an der Ruhr unverzichtbar,<br />
um wie bisher die Versorgung mit <strong>Wasser</strong> in ausreichender<br />
Menge und hoher Qualität für mehr als vier Millionen<br />
Menschen dauerhaft sicher zu stellen.<br />
Weitere Informationen:<br />
Ruhrverband,<br />
Kronprinzenstraße 37,<br />
D-45128 Essen,<br />
Tel. (0201) 178-0,<br />
E-Mail info@ruhrverband.de,<br />
www.ruhrverband.de<br />
Verstopfen Ihre<br />
<strong>Abwasser</strong>pumpanlagen<br />
regelmäßig?<br />
Zuverlässiger Feststoffrückhalt<br />
in Pumpstationen mit der HUBER<br />
Schachtsiebanlage<br />
Wir schützen Ihre Pumpen vor Verzopfung und<br />
Verstopfung durch einen optimalen Feststoffrückhalt.<br />
Unsere Siebanlage ist auch für tiefe Schachtbauwerke<br />
hervorragend geeignet und garantiert somit eine<br />
maximale Verfügbarkeit Ihrer Pumpstationen.<br />
info@huber.de<br />
www.huber.de<br />
WASTE WATER Solutions<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 551
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Mit definierten Schritten auf guten Wegen<br />
3. Mitgliederversammlung Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
Mitte Januar trafen sich unter<br />
der Leitung ihres Vorstandsvorsitzenden<br />
Karl-Heinz Flick die<br />
Mitglieder der „Gütegemeinschaft<br />
Herstellung, baulicher Unterhalt,<br />
Sanierung und Prüfung von Grundstücksentwässerungen<br />
e. V. – Güteschutz<br />
Grundstücksentwässerung“<br />
zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung<br />
im hessischen Fulda.<br />
Bekanntheit und bekennen<br />
Karl-Heinz Flick stellte in seinem<br />
Bericht mit Rückblick auf das vergangene<br />
Jahr fest, dass seit der<br />
Gründung der Gütegemeinschaft<br />
alle wichtigen organisatorischen<br />
Dinge und Gremien nun fest installiert<br />
seien und sich aufgrund der<br />
verstärkten Öffentlichkeitsarbeit auf<br />
verschiedenen Ebenen der Bekanntheitsgrad<br />
des neuen Gütezeichens<br />
RAL-GZ 968 erhöht hat. Dies gelte,<br />
so Flick, für verbandsübergreifende<br />
Erklärungen bis hin zu Entwürfen<br />
des Landeswassergesetzes im NRW-<br />
Landtag und v. a. überall dort, wo<br />
man sich fachtechnisch mit der<br />
Grundstücksentwässerung auseinandersetze.<br />
Neue Unterstützung<br />
erfahre man nun auch durch den<br />
Fachbeirat, der im Dezember 2012<br />
getagt habe.<br />
Selbstverständlich stand auch<br />
das Thema Dichtheitsprüfung wieder<br />
auf der Agenda des Vorstandsberichts:<br />
Großer Handlungsbedarf<br />
besteht nach wie vor in Hinblick<br />
darauf, wie auch zuletzt der LANUV-<br />
Fachbericht 43 gezeigt hat, dass<br />
unser Grundwasser durch undichte<br />
Kanäle gefährdet ist. Auch die Veröffentlichungen<br />
in Fachzeitschriften<br />
machen immer wieder die Notwendigkeit<br />
zum Schutz von Boden und<br />
Grundwasser deutlich.<br />
Das System RAL-GZ 968<br />
etablieren<br />
Für dieses Jahr hat die Gütegemeinschaft<br />
eine Kampagne geplant, mit<br />
Fritz Schellhorn (stellv. Vorstandsvorsitzender), Karl-Heinz Flick (Vorstandsvorsitzender)<br />
und Dirk Bellinghausen (Geschäftsführer) (v.l.n.r.).<br />
Alle Fotos: © Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
der gezielt die Kommunen angesprochen<br />
werden sollen. Das hierfür<br />
überarbeitete DWA-M 190 „Eignung<br />
von Unternehmen für Herstellung,<br />
baulichen Unterhalt, Sanierung und<br />
Prüfung von Grundstücksentwässerungen“<br />
soll dabei als Arbeitshilfe<br />
dienen. Außerdem sollen die gütegesicherten<br />
Arbeiten als System<br />
RAL-GZ 968 vorgeschrieben werden.<br />
Flick richtete den Appell an die<br />
Kommunen, Inspektion und Sanierung<br />
voneinander getrennt zu<br />
behandeln; es sei sinnvoll, nach der<br />
Inspektion den IST-Zustand zu<br />
bewerten und eine mögliche Sanierung<br />
federführend zu begleiten. Mit<br />
dieser Vorgehensweise schiebe man<br />
unseriösen ‚Dienstleistern‘ einen<br />
Riegel vor.<br />
Zum Abschluss seines Berichts<br />
gab er seinem Bedauern Ausdruck,<br />
dass die Hervorhebung positiver<br />
Beispiele in der Branche doch recht<br />
mager ausfalle. Mit Blick auf den<br />
vorangegangenen Gastvortrag von<br />
Dipl.-Ing. Joachim Adams, der das<br />
gelungene und umgesetzte Konzept<br />
des <strong>Abwasser</strong>verbandes Fulda<br />
vorstellte, sei auch einmal ein<br />
erfreuliches Beispiel für Auftraggeber<br />
gegeben, welches das ganzheitliche<br />
Denken zeige und das die<br />
Anwesenden auch positiv werteten.<br />
Abschließend unterstrich der<br />
Vorstandsvorsitzende noch einmal<br />
ausdrücklich die bundesweite Tätigkeit<br />
des Güteschutzes und forderte<br />
die Mitgliedsverbände auf, weiterhin<br />
durch ihr Netzwerk „Landesverbände“<br />
die Ziele der Gütegemeinschaft<br />
mit zu unterstützen.<br />
Die Pflöcke sind<br />
eingeschlagen<br />
Den Bericht des Güteausschusses<br />
übernahm in Vertretung für den<br />
Obmann Karsten Selleng sein Stellvertreter<br />
Hans-Christian Möser. Aus<br />
den Sitzungen und Tagungen des<br />
vergangenen Jahres hatte er folgendes<br />
zu berichten:<br />
##<br />
Gezielte Anforderungsprofile für<br />
Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
wurden definiert<br />
und in sogenannten<br />
„Checklisten“ durch die Prüfer<br />
bei den Firmen abgefragt. So<br />
wird auch bei der Erstprüfung<br />
ein besonderes Augenmerk auf<br />
Referenz-Objekte der Fachbetriebe<br />
gelegt.<br />
##<br />
Einrichtung eines Login-Bereichs<br />
zur Daten-Erfassung der neuen<br />
Mai 2013<br />
552 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Firmen zur Vorbereitung auf die<br />
folgende Prüftätigkeit bis hin zur<br />
Erstellung eines einheitlichen<br />
Prüfberichtes der Prüforganisationen.<br />
##<br />
Änderungen und Ergänzungen<br />
zu den Güte- und Prüfbestimmungen.<br />
Schwerpunkt: neue<br />
Beurteilungsgruppe „Sanierung,<br />
S-GE“.<br />
##<br />
Fortschreibung des DWA-M 190<br />
als Leitfaden für satzungsgebende<br />
Stellen (Kommunen), da<br />
gütegesicherte Arbeiten an<br />
GEA’s in <strong>Abwasser</strong>satzungen verankert<br />
werden müssen.<br />
Möser beendete seinen Bericht mit<br />
einem nochmaligen Hinweis auf<br />
den neuen Ausführungsbereich<br />
„S-GE“. Bereits aus vorhandenen<br />
Ausführungsbereichen, wie z.B.<br />
„ESP-ASG“, muss der Bereich Sanierung<br />
abgegrenzt werden. Er<br />
begründet diese Notwendigkeit<br />
damit, dass viele Firmen in der Praxis<br />
entweder nur den Einbau und<br />
die Prüfung oder nur die Sanierung<br />
vornehmen.<br />
Positionieren, publizieren,<br />
platzieren<br />
Geschäftsführer Dirk Bellinghausen<br />
gab im Anschluss an den Bericht des<br />
Güteausschusses einen Überblick<br />
über die Aktivitäten und Geschehnisse<br />
des abgelaufenen Jahres. So<br />
war die Gütegemeinschaft an fünf<br />
größeren Messen mit einem Stand<br />
vertreten und nutzte zwölf Vortragsveranstaltungen<br />
zur kontinuierlichen<br />
Bekanntmachung des Gütezeichens.<br />
Der aktuelle Mitgliederstand ist: Fünf<br />
Verbände, 43 Fachbetriebe, ein Fördermitglied<br />
und 90 Gütezeicheninhaber.<br />
Unabhängig von der landesgesetzlichen<br />
Situation in NRW und<br />
Hessen wird im Vergleich zu Januar<br />
2012 eine Steigerung der Gütezeichenvergaben<br />
registriert: Die Anzahl<br />
der Fachbetriebe mit Gütezeichen ist<br />
auf bundesweit 139 Unternehmen<br />
gewachsen.<br />
Bellinghausen fügt abschließend<br />
seinem Bericht hinzu, dass die<br />
Pressearbeit dieses Jahr stark ausgebaut<br />
wird. Die Erwähnung RAL-<br />
GZ 968 in der DIN 1986-30 und<br />
unter anderem in der bayerischen<br />
Musterentwässerungssatzung müssen<br />
werblich verbreitet werden.<br />
Ebenso ist die Gütegemeinschaft<br />
aufgefordert, selber für positive Signale<br />
in der Branche zu sorgen. Verschiedene<br />
Messen und Veranstaltungen<br />
bieten sich auch dafür an.<br />
Beraten und beschlossen:<br />
„Sanierung S-GE“<br />
Hans-Christian Möser umriss beim<br />
nächsten TOP den Stand der Beratungen<br />
zur Sanierungsgruppe S-GE,<br />
wobei er einleitend die Notwendigkeit<br />
eines eigenen Ausführungsbereiches<br />
Sanierung auf dem Grundstück<br />
klar betonte. „Eine Abgrenzung<br />
zu RAL-GZ 961 erfolgt über die<br />
in den <strong>Abwasser</strong>satzungen geregelten<br />
Grundstücksgrenzen sowie über<br />
die Nennweitenbeschränkung bis<br />
DN 250“, so Möser. Er wies auch<br />
noch einmal darauf hin, dass die<br />
Sanierung bereits in mehreren Ausführungsbereichen<br />
enthalten sei<br />
(z.B. ESP-ASG); das „S“ müsse hier<br />
entfernt und in einem gesonderten<br />
Bereich erfasst werden.<br />
Der Ausführungsbereich S-GE<br />
kann auf Antrag von Gütezeicheninhabern<br />
RAL-GZ 961 mit der Beurteilungsgruppe<br />
S gestellt werden. Über<br />
die Einzelheiten der Zulassung und<br />
Prüfung von „S-GE“ bzw. DIBt-Zulassungen<br />
für das Sanierungsverfahren<br />
werde der Güteausschuss<br />
beraten.<br />
Die neue Beurteilungsgruppe<br />
S-GE rundet nun das Bild „gütegesicherte<br />
Arbeiten an Grundstückentwässerungsanlagen“<br />
ab und öffnet<br />
neue Möglichkeiten, weitere Unternehmen<br />
für den Güteschutz zu<br />
gewinnen. Auch ist so eine Abgrenzung<br />
zu unseriösen Dienstleistern,<br />
den sogenannten Kanalhaien, möglich.<br />
Nach den Ausführungen Mösers<br />
wird folgender Beschluss gefasst:<br />
Die Güte- und Prüfbestimmungen<br />
werden um den Ausführungsbereich<br />
S-GE und die Anforderungen<br />
an die Beurteilungsgruppe S-GE<br />
Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft<br />
Grundstücksentwässerung Januar 2013 in Fulda.<br />
ergänzt. Die Annahme des Beschlusses<br />
erfolgte einstimmig.<br />
Wahl des Fachbeirats<br />
Auf der 2. Mitgliederversammlung<br />
2012 wurden die Kandidaten für die<br />
Wahl in den Fachbeirat bereits<br />
benannt und gewählt. Herr Flick<br />
stellte noch ergänzend Dipl.-Ing.<br />
Frank Diederich als Vorsitzenden<br />
des VuSD, Verband der unabhängigen<br />
Sachkundigen für Dichtheitsprüfungen<br />
von <strong>Abwasser</strong>anlagen,<br />
vor, der als 15. Mitglied des Fachbeirats<br />
zur Wahl gestellt wurde.<br />
Die Mitgliederversammlung<br />
wähl te Frank Diederich einstimmig<br />
in den Fachbeirat.<br />
Dr. Dipl.-Ing. Bernhard Fischer<br />
wurde bereits 2012 als Obmann vorgeschlagen,<br />
eine Wahl fand aber<br />
nicht statt, da die personelle Besetzung<br />
noch nicht abgeschlossen war.<br />
Dr. Fischer wurde ebenfalls einstimmig<br />
zum Obmann des Fachbeirates<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
gewählt.<br />
Nach Verabschiedung des Jahresabschluss<br />
2012, der Entlastung<br />
des Vorstandes sowie weiterer notwendiger<br />
Formalia wurden Termin<br />
und Ort der nächsten Mitgliederversammlung<br />
festgelegt: Dienstag,<br />
8. Oktober 2013, in Bonn<br />
Kontakt:<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung e.V.,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-226, Fax (02242) 872-178,<br />
E-Mail: bellinghausen@gs-ge.de,<br />
www.gs-ge.de<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 553
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Flussgebietsmanagement in der Ukraine –<br />
was verhindert eine nachhaltige Umsetzung?<br />
Mit Blick auf die Anforderungen der EU-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie, die mit rechtlich bindenden Zwischenschritten<br />
bis 2027 in der EU umgesetzt werden soll, kümmern sich Natur- und Sozialwissenschaftler sowie Fachleute<br />
aus der Praxis um die Verbesserung der Gewässerqualität am Westlichen Bug/Ukraine. Eine interdisziplinäre<br />
Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) und der TU Dresden, die auf der AquaConSoil<br />
2013 in Barcelona vorgestellt wurde, zeigt, dass die dringend notwendige Modernisierung des Flussgebietsmanagements<br />
bislang vor allem an der Organisation des <strong>Wasser</strong>managements, an fehlenden oder veralteten<br />
rechtlichen Grundlagen und mangelnden finanziellen Ressourcen scheitert.<br />
Alle europäischen Grund- und<br />
Oberflächengewässer sind in<br />
einem „guten Zustand“. Sie weisen<br />
nicht nur eine gute chemische <strong>Wasser</strong>qualität<br />
auf, sondern sind zu -<br />
gleich auch ein attraktiver Lebensraum<br />
für Tiere und Pflanzen. Eine<br />
Vision mit sehr ambitionierten<br />
Umweltzielen, die in der EU bis spätestens<br />
2027 Wirklichkeit werden<br />
soll. So sieht es die EG-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
(WRRL) aus dem Jahr<br />
2000 vor. Doch Flüsse halten sich<br />
nicht an Ländergrenzen. Von großem<br />
Interesse für die Erreichung<br />
des europäischen Ziels ist daher<br />
auch die <strong>Wasser</strong>qualität von Flüssen,<br />
die ihren Ursprung und viele<br />
Kilometer Flussverlauf außerhalb<br />
der EU haben, ihre Schadstofffrachten<br />
jedoch mit hineinbringen.<br />
Das Einzugsgebiet des Westlichen<br />
Bugs beispielsweise befindet sich<br />
im Grenzgebiet zwischen Ukraine,<br />
Weißrussland und Polen. Der Fluss<br />
entspringt in der westlichen Ukraine,<br />
fließt entlang der Grenze zu<br />
Polen und Weißrussland und mündet<br />
über die Weichsel (Vistula) in die<br />
Ostsee. Obwohl morphologisch<br />
intakt, ist der Fluss durch Einträge<br />
aus Landwirtschaft, Industrie,<br />
urbane Gebiete und den Bergbau<br />
stark belastet.<br />
Seit fast fünf Jahren befassen<br />
sich deutsche Wissenschaftler und<br />
Fachleute aus der Praxis mit der<br />
gezielten Verbesserung der Gewässerqualität<br />
dieser Region (im Rahmen<br />
des Projektes IWAS – Internationale<br />
<strong>Wasser</strong>forschungs-Allianz<br />
Sachsen). Zusammen mit den Um -<br />
weltbehörden vor Ort und der Ivan-<br />
Westlicher Bug. GfK Macon 2005, ESRI Basemap 2000.<br />
Franko-Universität in Lviv (Lemberg)<br />
hatten sie 2009/10 bspw. im Oberlauf<br />
des Westlichen Bugs <strong>Wasser</strong>proben<br />
entnommen. Deren Analyse<br />
ergab u.a. sehr hohe Konzentrationen<br />
von Phosphat und pathogenen<br />
Bakterien – hauptsächlich verursacht<br />
durch völlig veraltete Kläranlagen<br />
in der westukrainischen Metropole<br />
Lviv bzw. das völlige Fehlen<br />
von Kläranlagen in den dörflichen<br />
Regionen. Gleichzeitig untersuchten<br />
Sozialwissenschaftler die politische<br />
und sozio-ökonomische Situation<br />
in der Westukraine und führten<br />
dazu Grundlagenerhebungen und<br />
Interviews mit einer Vielzahl von<br />
Akteuren im <strong>Wasser</strong>bereich durch.<br />
Denn obwohl sich die Ukraine<br />
seit Mitte der 90er-Jahre „eine ganzheitliche<br />
Bewirtschaftung der Flussgebiete“<br />
auf die Fahnen geschrieben<br />
hat, passiert in der Praxis –<br />
zumindest nach unseren Maßstäben<br />
– relativ wenig. Das hat viele Ursachen.<br />
„Traditionell ist die Ukraine ein<br />
sehr zentralistisch organisierter<br />
Staat, in dem die meisten Kompetenzen<br />
auf der nationalen Ebene<br />
angesiedelt sind. Das erschwert die<br />
konkrete Umsetzung eines nachhaltigen<br />
Flussgebietsmanagements<br />
auf regionaler Ebene erheblich“,<br />
erklärt die Politikwissenschaftlerin<br />
Nina Hagemann vom UFZ. Zwar<br />
gibt es Gesetze zum <strong>Wasser</strong>management,<br />
aber die sind entweder<br />
so alt, dass sie nicht mehr den heutigen<br />
Anforderungen entsprechen,<br />
oder es hapert in der Praxis, weil<br />
Mai 2013<br />
554 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
konkrete Verordnungen für die Handhabung<br />
fehlen. „Zum Beispiel ist der Bau<br />
von Häusern an geschützten Flussufern<br />
gesetzlich verboten, aber die Behörden<br />
tun sich schwer, dagegen auf privatem<br />
Land vorzugehen. Oder das Gesetz verspricht<br />
Steuerermäßigungen für Firmen,<br />
die in umweltfreundliche Technologien<br />
investieren. Wie hoch diese aber tatsächlich<br />
sind und wie sie geltend gemacht<br />
werden können, bleibt unklar“, schildert<br />
Hagemann. Neben konkreten Verordnungen<br />
hält sie vor allem eine Dezentralisierung<br />
der Kompetenzen und Finanzen für<br />
dringend notwendig, damit die Behörden<br />
vor Ort überhaupt die Ressourcen und<br />
Mittel haben, die <strong>Wasser</strong>gesetze umzusetzen.<br />
Während in der Europäischen Union<br />
mit dem Volksbegehren „<strong>Wasser</strong> ist ein<br />
Menschenrecht – Right2Water“ gerade<br />
eine Initiative gegen Pläne zur Privatisierung<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung kämpft, gibt<br />
es in der Ukraine bisher nur zwei Privatisierungsversuche,<br />
von denen einer bereits<br />
gescheitert ist. Hohe Inves titionskosten,<br />
lange Abschreibungszeiten von oftmals<br />
mehreren Jahrzehnten, politisch motivierte<br />
und nicht kostendeckende <strong>Wasser</strong>tarife<br />
und die unsichere Entwicklung<br />
machen das Land für ausländische Investoren<br />
unattraktiv.<br />
Trotz der schwierigen ökonomischen<br />
und politischen Situation besteht aber<br />
auch Hoffnung: Auf die Initiative der Wissenschaftler<br />
des IWAS-Projekts haben sich<br />
2012 erstmals seit mehreren Jahren wieder<br />
alle Behörden im Einzugsbereich des<br />
Westlichen Bugs an einen Tisch gesetzt<br />
und einen Arbeitsplan für die nächsten<br />
Jahre aufgestellt. „Die Einsicht, dass substanzielle<br />
Veränderungen notwendig sind,<br />
um eine ökologische Katastrophe in der<br />
Zukunft zu verhindern, setzt sich immer<br />
mehr durch. Die ukrainischen Partner und<br />
insbesondere die Behörden sind sehr an<br />
unseren Ergebnissen und Vorschlägen<br />
interessiert, die wir im Juli auf verschiedenen<br />
Abschlussveranstaltungen in der<br />
Ukraine präsentieren werden“, berichtet<br />
Nina Hagemann. Erste Ergebnisse stellte<br />
sie auf der AquaConSoil in Barcelona vor.<br />
Zur AquaConSoil 2013, der größten<br />
europäischen Konferenz zum Management<br />
von Boden-<strong>Wasser</strong>-Systemen,<br />
kamen vom 16. bis 19. April zahlreiche<br />
Experten aus Forschung, Behörden und<br />
Industrie in Barcelona. Organisiert wurde<br />
sie vom Helmholtz-Zentrum für Um -<br />
weltforschung (UFZ) zusammen mit dem<br />
niederländischen Forschungszentrum<br />
Deltares. Die Schirmherren der wissenschaftlichen<br />
Tagung wa ren Prof. Dr. Georg<br />
Teutsch, Wissenschaftlicher Geschäftsführer<br />
des UFZ, und Prof. Dr. ir. Huub Rijnaarts,<br />
Lehrstuhlinhaber für Umwelttechnologie<br />
der Universität Wageningen, Niederlande.<br />
Mitte 2008 wurde die „Internationale<br />
<strong>Wasser</strong>forschungs-Allianz Sachsen“<br />
(IWAS) gegründet. Neben Wissenschaftlern<br />
des UFZ und der TU Dresden sind<br />
daran auch Praxispartner wie die DREBE-<br />
RIS GmbH und die Stadtentwässerung<br />
Dresden GmbH/Gelsenwasser AG beteiligt.<br />
Gefördert durch das Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung (BMBF)<br />
werden im Rahmen des Programms „Spitzenforschung<br />
und Innovation in den<br />
Neuen Ländern“ gezielt angepasste<br />
System lösungen für die jeweiligen <strong>Wasser</strong>probleme<br />
in verschiedenen Regionen<br />
der Erde entwickelt. Die Modellregion für<br />
Osteuropa befindet sich am Westlichen<br />
Bug.<br />
Kontakt:<br />
Nina Hagemann,<br />
Helmholtz-Zentrum für<br />
Umweltforschung (UFZ),<br />
Tel. (0341) 235-1734,<br />
E-Mail: nina.hagemann@ufz.de<br />
Publikationen<br />
Leidel, M., Niemann, S., Hagemann, N., (2012):<br />
Capacity development as a key factor for<br />
integrated water resources management<br />
(IWRM): improving water management in<br />
the Western Bug River Basin, Ukraine. Environ.<br />
Earth Sci. 65 (5), S. 1415 – 1426.<br />
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-011-<br />
1223-5<br />
Hagemann, N., Blumensaat, F., Wahren, T., Trümper,<br />
J., Burmeister, C., Moynihan, R., Scheifhacken,<br />
N., (2012): The long way of implementing<br />
river basin management in Post-<br />
Soviet states - a conflict analysis in the<br />
Western Bug River basin (Ukraine).<br />
In: Steusloff, H., (ed.): Conference proceedings<br />
of the „IWRM - Integrated Water<br />
Resources Management- Interactions of<br />
Water with Energy and Materials in Urban<br />
Areas and Agriculture“, 21 - 22 November<br />
2012, Karlsruhe, Germany. Fraunhofer Verl.,<br />
Stuttgart, p. 80 – 86.<br />
Stauraumsysteme<br />
aus<br />
GFK<br />
• Variable Durchmesser bis<br />
DN 3000<br />
• Stauraumsystem einschließlich<br />
Überlauf und Drosselschacht<br />
• Mehrstranglösung möglich<br />
• Beständig gegen aggressive<br />
Abwässer<br />
• Individuelle Fertigteilbauweise<br />
• Verkehrstauglich<br />
• Komplettlösung<br />
Amitech Germany GmbH<br />
Am Fuchsloch 19 · 04720 Mochau<br />
Tel.: + 49 34 31 71 82 - 0<br />
Fax: + 49 34 31 70 23 24<br />
info@amitech-germany.de<br />
www.amitech-germany.de<br />
A Member of the<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.amiantit.com<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 555<br />
Group
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Kann bewusster Umgang mit Arznei „Nebenwirkungen“<br />
von Medikamenten im Gewässer senken?<br />
Spurenstoffe-Projekt in Dülmen geht an den Start<br />
Rückstände von über 150 Arzneiwirkstoffen wurden bisher in deutschen Gewässern nachgewiesen, 23 davon<br />
auch im Trinkwasser. Wie schädlich solche Stoffe in den gemessenen Konzentrationen für Mensch und Umwelt<br />
langfristig sind, lässt sich derzeit noch nicht sicher beurteilen. Als Alternative und Ergänzung zu technischen<br />
Lösungen wie zusätzlichen Reinigungsstufen auf Kläranlagen soll mit dem Projekt „Den Spurenstoffen auf der<br />
Spur in Dülmen“ – kurz DSADS – ergründet werden, inwieweit eine Sensibilisierung von Bevölkerung sowie<br />
Ärzten und Apothekern die Belastung des <strong>Wasser</strong>s mindern kann. Für das vom Land NRW unterstützte Projekt<br />
wurde Dülmen im Münsterland als Modellstadt ausgewählt.<br />
Bei der Auftaktveranstaltung im<br />
April mit einem Bürgerforum,<br />
wurden Ziele, Hintergründe und<br />
Zeitplan des Projektes vorgestellt.<br />
„Die Belastung des <strong>Wasser</strong>s<br />
durch Rückstände von Arzneiwirkstoffen<br />
steht seit einigen Jahren im<br />
Zentrum der Umweltforschung“, so<br />
Prof. Klaus Kümmerer vom renommierten<br />
Institut für Nachhaltige<br />
Chemie und Umweltchemie (INUC),<br />
„Eine akute Gefahr stellen diese<br />
Stoffe für den Menschen nicht dar.<br />
Ob sie langfristig die Gesundheit<br />
beeinträchtigen könnten, ist derzeit<br />
nicht völlig auszuschließen. Wirkungen<br />
auf Fische sind jedoch nachgewiesen.<br />
Deshalb sollten wir alle<br />
Möglichkeiten nutzen, diese Stoffe<br />
vom <strong>Wasser</strong>kreislauf fernzuhalten,<br />
zumal zu erwarten ist, dass der Arzneimittelverbrauch<br />
in der Zukunft<br />
zunehmen wird.“<br />
„Wir setzen uns aktiv und konkret<br />
mit technischen Lösungen zur<br />
Elimination von Spurenstoffen im<br />
<strong>Wasser</strong> auseinander – beispielsweise<br />
mit Versuchsanlagen auf<br />
unseren Kläranlagen in Hünxe und<br />
Bad-Sassendorf sowie mit einer<br />
Pilotanlage am Marienhospital in<br />
Gelsenkirchen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende<br />
des Lippeverbandes,<br />
Dr. Jochen Stemplewski,<br />
„aber bisher gibt es keinen vollständigen<br />
Abbau solcher Stoffen mit<br />
weitergehenden <strong>Abwasser</strong>reinigungstechniken.<br />
Eine Beseitigung<br />
der Rückstände erst in Kläranlagen<br />
– sozusagen „end of pipe“ – ist auch<br />
sicher nicht der Weisheit letzter<br />
Schluss! Im Dülmener Projekt wollen<br />
wir mit einem ganzheitlichen<br />
Ansatz in Kooperation mit Apothekern<br />
und Medizinern durch eine<br />
Informationskampagne und Bildungsarbeit<br />
in Schulen nachhaltige<br />
Verhaltensänderungen beim Um -<br />
gang mit Medikamenten bewirken.“<br />
Dülmens Bürgermeisterin Lisa<br />
Stremlau freut sich, dass das Projekt<br />
in Dülmen stattfindet: „Wir können<br />
nur davon profitieren, denn wir<br />
erweitern unser Wissen. Wenn alle<br />
schließlich bewusster mit Medikamenten<br />
umgehen, schützen wir die<br />
Umwelt, unser Trinkwasser und auf<br />
diesem Wege natürlich auch unsere<br />
Gesundheit.“<br />
Im „DSADS“-Projekt sollen über<br />
gezielte Informationen Verhaltensänderungen<br />
bei der Verordnung,<br />
Einnahme und Entsorgung von<br />
© GG-Berlin / pixelio.de<br />
Medikamenten bewirkt werden, um<br />
Umweltbelastungen im <strong>Wasser</strong> zu<br />
senken. Das INUC-Institut als Projektpartner<br />
quantifiziert und analysiert<br />
die Gesamtmenge der Arzneimittel,<br />
die in das Dülmener <strong>Abwasser</strong><br />
gelangen.<br />
Der Lippeverband misst an seiner<br />
Dülmener Kläranlage die Konzentrationen<br />
zum Beispiel von<br />
Di clofenac und Ibuprofen, von Antibiotika,<br />
Antiepileptika, Wirkstoffen<br />
gegen Bluthochdruck und Röntgenkontrastmitteln<br />
und vergleicht<br />
die Werte im Zeitverlauf.<br />
Zusätzlich will der Lippeverband<br />
im kommenden Jahr auf seiner Dülmener<br />
Kläranlage eine Aktivkohle-<br />
Stufe installieren und auf ihre Wirkung<br />
testen. Diese Behandlung des<br />
<strong>Abwasser</strong>s ist eins von mehreren<br />
Verfahren, um Spurenstoffe wie<br />
Mai 2013<br />
556 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Vom Umgang mit<br />
wassergefährdenden<br />
Stoffen<br />
Arzneimittelrückstände aus dem<br />
<strong>Abwasser</strong> zu eliminieren. Allerdings<br />
sind alle bisher bekannten Techniken<br />
nur bedingt tauglich, um das<br />
Spurenstoff-Problem in unseren<br />
Gewässern zu lösen.<br />
Zum Abschluss Ende 2014 wird<br />
das Sozialforschungsinstitut RISP<br />
nochmals eine Umfrage bei Dülmener<br />
Haushalten durchführen,<br />
um festzustellen, ob sich gegenüber<br />
einer Vorab-Befragung im Februar<br />
2013 Veränderungen im Umgang<br />
mit Arzneimitteln zeigen.<br />
Gefördert vom Land NRW<br />
und der EU<br />
Das Projekt „Den Spurenstoffen auf<br />
der Spur in Dülmen“ ist Teil eines<br />
umfassenderen EU-Projektes mit<br />
dem Titel „noPILLS in water“, mit dem<br />
sowohl technische Innovationen als<br />
auch soziale Faktoren erforscht werden.<br />
Das Dülmener Projekt wird ge -<br />
tragen vom Land NRW, der Stadt<br />
Dülmen und dem LIPPEVERBAND<br />
und ist auf zwei Jahre angelegt. Die<br />
Förderung teilen sich das Ministerium<br />
für Klimaschutz, Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz<br />
des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen (MKULNV) und die Europäische<br />
Union mit dem INTERREG-<br />
IV-B-Programm.<br />
Der Lippeverband arbeitet mit<br />
kompetenten Partnern zusammen:<br />
##<br />
Institut für Nachhaltige Chemie<br />
und Umweltchemie (INUC) der<br />
Leuphana Universität Lüneburg<br />
##<br />
Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung<br />
und Politikberatung<br />
(RISP), Duisburg<br />
##<br />
Keep it balanced (kib), Berlin<br />
##<br />
Institut für sozial-ökologische<br />
Forschung (ISOE), Mannheim<br />
Inkl. Online-<br />
Vorschriftendatenbank!<br />
Lagerung und Transport<br />
wassergefährdender Stoffe<br />
Ergänzbares Handbuch der rechtlichen,<br />
technischen und naturwissenschaftlichen<br />
Grundlagen für Betrieb und Verwaltung<br />
Von Dr. Ernst-W. Diesel † und<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Lühr<br />
Loseblattwerk, 11.454 Seiten in 6 Ordnern,<br />
ca. 10 Ergänzungslieferungen pro Jahr<br />
ISBN 978-3-503-01990-8<br />
Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz<br />
bestellen: 0800 25 00 850<br />
Dieses Werk ist ein echter Klassiker im Bereich wassergefährdender<br />
Stoffe. Es verschafft Ihnen einen repräsentativen<br />
Überblick über das komplexe Thema – aus Sicht<br />
des Gewässerschutzes, des technischen Rechts und allen<br />
Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten.<br />
»Dem Bedürfnis nach umfassender Information trägt das<br />
profunde Werk Rechnung.«<br />
Immissionsschutz, 1/2011<br />
Weitere Informationen:<br />
www.ESV.info/978-3-503-01990-8<br />
Weitere Informationen:<br />
www.DSADS.de<br />
www.no-pills.eu<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin<br />
Mai 2013<br />
Tel. (030) 25 00 85-228 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 557<br />
· www.ESV.info
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
Arzneimittelrückstände im <strong>Wasser</strong> –<br />
Lösungen liegen bei den Verursachern<br />
Heute werden mehr als 100 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe in fast allen Oberflächengewässern, zum Teil<br />
auch im Grundwasser und selbst im Trinkwasser nachgewiesen. Rechtliche Regelungen greifen zu kurz. Aktuelle<br />
Forschungsprojekte des ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung zeigen wirkungsvolle Strategien<br />
zur Lösung des Problems.<br />
Die häuslichen Abwässer sind die<br />
Hauptquelle des Problems.<br />
„Damit Arzneimittel im menschlichen<br />
Körper genau dort wirken,<br />
wo sie gebraucht werden, werden<br />
manche Arzneimittelwirkstoffe so<br />
ge baut, dass sie ausreichend stabil<br />
sind für ihre Reise durch den<br />
menschlichen Körper“, erklärt Dr.<br />
Martina Winker. Danach werden<br />
Wirkstoffe direkt oder als Abbauprodukte<br />
mit dem Urin wieder ausgeschieden<br />
und gelangen so ins<br />
<strong>Abwasser</strong> und damit in die Kläranlagen.<br />
Hier erschwert die große Bandbreite<br />
der chemischen Verbindungen<br />
den weiteren Abbau. „Ein Teil<br />
der Arzneimittelrückstände wird<br />
daher gar nicht, andere nur zum Teil<br />
entfernt und finden so ihren Weg<br />
über den <strong>Wasser</strong>kreislauf in die<br />
Umwelt und letztlich wieder zum<br />
Menschen“, sagt Winker.<br />
Eindeutige Daten über die Höhe<br />
des Arzneimittelverbrauchs gibt es<br />
nicht. Es werden nur jährliche Hochrechnungen<br />
veröffentlicht. Die aktuellsten<br />
verfügbaren Zahlen stammen<br />
aus dem Jahr 2011. Danach<br />
wurden über Apotheken und Krankenhäuser<br />
insgesamt 38 000 Tonnen<br />
Arzneimittel abgegeben, verteilt auf<br />
2 671 verschiedene Wirkstoffe. Zu<br />
den verkaufsstärksten Wirkstoffgruppen<br />
gehörten Schmerzmittel<br />
(2 500 Tonnen), ge folgt von Antibiotika<br />
(500 Tonnen).<br />
„Derzeit gibt es weder in<br />
Deutschland noch auf europäischer<br />
Ebene eine abgestimmte Strategie,<br />
mit der das Problem von Arzneimitteln<br />
in unserem <strong>Wasser</strong> wirkungsvoll<br />
angegangen werden kann“,<br />
sagt Dr. Konrad Götz (ISOE). „Die<br />
rechtlichen Regelungen innerhalb<br />
des europäischen Zulassungsverfahrens<br />
konzentrieren sich bisher<br />
auf die wenigen Neuzulassungen<br />
und werden dem Problem nicht<br />
gerecht“, sagt Götz. Es bestehe<br />
daher dringender Bedarf an Lösungen,<br />
die das Problem systematisch<br />
angehen – unter Berücksichtigung<br />
des hohen gesellschaftlichen Nutzens<br />
von Arzneimitteln.<br />
Eine Änderung der gegenwärtigen<br />
Verschreibungspraktiken sowie<br />
der Ge brauchs- und Entsorgungsmuster<br />
beim Patienten spielt hierbei<br />
eine wichtige Rolle.<br />
Das ISOE führt daher im Auftrag<br />
des Umweltbundesamtes und in<br />
Zusammenarbeit mit der Uni Witten-Herdecke<br />
ein Projekt zur Sensibilisierung<br />
von Medizin-Studierenden<br />
und zur Weiterbildung von Ärzten<br />
durch. „Aber letztlich geht es um<br />
Lösungen, die umfassend wirken“,<br />
sagt ISOE-Forscher Götz. Im Projektstart<br />
wurde daher ausgehend<br />
vom Lebenszyklus eines Medikaments<br />
eine Vorsorgestrategie entwickelt<br />
– gemeinsam mit Ärzten,<br />
Apothekern, der Pharma industrie<br />
und Kommunen.<br />
Das Thema erfährt heute eine<br />
größere Aufmerksamkeit als noch<br />
vor wenigen Jahren. Auch eine verbesserte<br />
Forschungsförderung auf<br />
Bund-, Länder- und EU-Ebene zeigt<br />
Erfolge. So arbeitet das ISOE heute<br />
an Kommunikationsstrategien zur<br />
Sensibilisierung der Patienten, Ärzte<br />
und Apotheker, entwickelt Maßnahmen<br />
zur zielgruppenspezifischen<br />
Aufklärung der Bevölkerung und<br />
Handlungsstrategien für sogenannte<br />
Emissions-Hotspots: Spezialkliniken<br />
und Pflegeeinrichtungen.<br />
„Dies kann jedoch erst der Anfang<br />
sein. Für einen nachhaltigen Schutz<br />
der Umwelt ist noch einiges zu tun<br />
und bedarf es weiterer Anstrengungen“,<br />
lautet das Fazit der ISOE-Forscher.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.isoe.de<br />
© Andrea Damm / pixelio.de<br />
Mai 2013<br />
558 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Blick in die Zukunft<br />
SUDPLAN – DFKI-Software visualisiert Auswirkungen des Klimawandels bis ins Jahr 2100<br />
Ein interdisziplinäres Team aus<br />
Experten der Informationstechnologie,<br />
Raumplanung und Meteorologie<br />
entwickelte im Gemeinschaftsprojekt<br />
„SUDPLAN“ (Sustainable<br />
Urban Development Planner<br />
for Climate Change Adaption) Technologien,<br />
welche es Planern in ganz<br />
Europa ermöglichen, die Auswirkungen<br />
zukünftiger Klimaänderungen<br />
in ihre Arbeit zu integrieren und<br />
damit den langfristigen Ressourcen-Einsatz<br />
zu optimieren. Städteplaner<br />
können das System verwenden,<br />
um die Konsequenzen der heutigen<br />
und zukünftigen Infrastruktur-,<br />
Transportsystem- und Städtebauentwicklung<br />
abzuschätzen.<br />
Das Herz von SUDPLAN ist das<br />
„Scenario Management System“<br />
(SMS) genannte Frontend. Diese<br />
Applikation erlaubt die Benutzung<br />
von standardisierten Services, die<br />
Verwaltung und die Visualisierung<br />
allgemeiner Daten in unterschiedlichen<br />
Planungsszenarien. Elementarer<br />
Bestandteil des SMS ist die<br />
komplexe 3D-Software-Komponente<br />
des DFKI. Sie sorgt für die dreidimensionale<br />
Visualisierung der<br />
Daten und Ergebnisse von SUD-<br />
PLAN. Die intuitive Darstellung von<br />
und Interaktion mit den gewonnenen<br />
Informationen ist ebenso ein<br />
wesentliches Merkmal der 3D-Komponente.<br />
Die Entwicklungen bauen<br />
auf dem sogenannten World Wind<br />
SDK der NASA auf – einer Open<br />
Source Alternative zu Google-Earth.<br />
Die 3D-Visualisierungssoftware des<br />
DFKI kann zukünftig auch eigenständig<br />
für viele weitere Anwendungen<br />
Geografischer Informationssysteme<br />
eingesetzt werden,<br />
beispielsweise für raumbezogene<br />
Marktanalysen, Tourismus, Umweltforschung<br />
oder Energieversorgung.<br />
SUDPLAN passt die globalen<br />
Klima- und Emissionsmodelle<br />
zunächst für Europa und anschließend,<br />
unter Berücksichtigung lokaler<br />
und historischer Daten, für einzelne<br />
Städte an. Verschiedene Web-<br />
Services stellen die relevanten<br />
Daten und Modelle über standardisierte<br />
Schnittstellen zur Verfügung.<br />
Die Berechnungen und Simulationen<br />
können mit aktuellen und darüber<br />
hinaus mit bis ins Jahr 2100 prognostizierten<br />
Daten durchgeführt<br />
werden. Dabei werden Veränderungen<br />
in Regenmenge, Regenhäufigkeit<br />
und jahreszeitlicher Verteilung,<br />
die Entwicklung der Luftqualität in<br />
Städten sowie der Einfluss hydrologischer<br />
Daten einberechnet. Stadtplaner<br />
können damit zukünftige<br />
Baumaßnahmen, wie die Anlage<br />
von <strong>Abwasser</strong>kanälen oder den Bau<br />
neuer Straßen, in ihren Planungsszenarien<br />
berücksichtigen und<br />
mögliche Auswirkungen auf Überflutungen<br />
und Luftqualität berechnen<br />
und durch die fortschrittliche<br />
Visualisierung darstellen. Als Forschungsszenarien<br />
dienten unter<br />
anderem durch Regenwasser verursachte<br />
Überflutung in Wuppertal,<br />
<strong>Wasser</strong>verschmutzung in Linz und<br />
Luftverschmutzung in Stockholm.<br />
Unter der Leitung des Swedish<br />
Meteorological and Hydrological<br />
Institute (SMHI, Stockholm) arbeiteten<br />
folgende Partner im SUDPLAN<br />
Projekt: Austrian Institute of Technology<br />
(AIT, Wien), cismet (Saarbrücken),<br />
Cenia (Prag), Deutsches Forschungszentrum<br />
für Künstliche<br />
Intelligenz (DFKI, Kaiserslautern),<br />
Stockholm Uppsala Air Quality<br />
Management Association (SULVF,<br />
Stockholm), Technische Universität<br />
Graz, APERTUM IT AB (Linköping),<br />
Stadt Wuppertal. SUDPLAN wurde<br />
Visualisierung Stockholm. © DFKI<br />
3D-Visualisierung. © DFK<br />
von der europäischen Union von<br />
Januar 2010 bis zum Jahresende<br />
2012 gefördert.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.sudplan.eu<br />
http://av.dfki.de/sudplan<br />
Kontakt:<br />
Deutsches Forschungszentrum für<br />
Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH,<br />
Forschungsbereich Erweiterte Realität,<br />
Prof. Dr. Didier Stricker,<br />
Dipl.-Inf. Daniel Steffen (Technische Leitung),<br />
Trippstadter Straße 122,<br />
D-67663 Kaiserslautern,<br />
Tel. (0631) 20575-3500,<br />
E-Mail: av-info@dfki.de<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 559
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
<strong>Wasser</strong>tagung schlägt alle Rekorde<br />
Spannende Themen, angeregte Diskussionen, volle Gänge: Mit knapp 2 000 Besuchern und über 140 Ausstellern<br />
schlug die diesjährige Süd- und Ostbayerische <strong>Wasser</strong>tagung (SOW) in Landshut, 10. bis 11. April 2013,<br />
alle Rekorde. Die Resonanz auf das Thema „Energie- und Ressourceneffizienz rund ums <strong>Wasser</strong>“ war riesig.<br />
Dies zeigt, dass in Unternehmen und Kommunen das Thema <strong>Wasser</strong> aktueller denn je ist und dass zwar global<br />
große Herausforderungen bevorstehen, diese aber lokal mit Tatkraft in Angriff genommen werden.<br />
Unsere Erwartungen seitens der<br />
Organisatoren wurden noch<br />
übertroffen. Wir haben über 500<br />
Besucher und 40 Aussteller mehr als<br />
bei der letzten SOW“, freute sich Dr.<br />
Manuela Wimmer, Geschäftsführerin<br />
des Trägervereins Umwelttechnologie-Cluster<br />
Bayern e.V. „Von den<br />
Besuchern und Ausstellern haben<br />
wir viele positive Rückmeldungen<br />
bekommen. Wir sind mit der Veranstaltung<br />
hoch zufrieden und freuen<br />
uns schon auf die nächste SOW im<br />
Frühjahr 2015!“<br />
Besonders bei den Kommunen<br />
ist das Interesse an Informationen<br />
rund ums <strong>Wasser</strong> groß. Sie konnten<br />
sich informieren, wie sich die bayerische<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung in den kommenden<br />
Jahrzehnten entwickelt<br />
und wie sich der Klimawandel auswirken<br />
soll. Beispielsweise müssen<br />
bei den öffentlichen Kanälen mit<br />
Sanierungsmaßnahmen gerechnet<br />
und verstärkt Vorkehrungen gegen<br />
Hochwasser getroffen werden.<br />
Scheckübergabe des Erlöses des Unternehmerforums<br />
(4500 Euro) an die Lebenshilfe Landshut. Dr. Manuela<br />
Wimmer, Geschäftsführerin Umweltcluster Bayern;<br />
Manfred Kaschel, ehemaliger Oberbürgermeister<br />
Landshut; Josef Deimer, Vorsitzender Lebenshilfe<br />
Landshut; Dr. Hannelore Omari, Geschäftsführerin<br />
Lebenshilfe Landshut (v.l.n.r.).<br />
Besucher der 2. Süd- und Ostbayerischen <strong>Wasser</strong>tagung an den Ständen<br />
in der Messehalle der Sparkassenarena Landshut.<br />
Ein weiterer Themenkomplex<br />
widmete sich den Schwimmbädern.<br />
Bei der Energieeffizienz können<br />
Bäderbetreiber noch viel Geld sparen<br />
– bereits kleine Maßnahmen<br />
wirken sich besonders stark aus.<br />
Aufgezeigt wurde, wie vielfältig hier<br />
die Möglichkeiten sind: Modernisierung<br />
der Wärmeerzeugung, Anpassungen<br />
der Lüftungsanlagen,<br />
Dämm-Maßnahmen an der Gebäudehülle<br />
oder Verfahren zur Wärmerückgewinnung.<br />
Neu in diesem Jahr war das<br />
Unternehmerforum, für das der<br />
Andrang im Vorfeld so groß war,<br />
dass eine Warteliste geführt werden<br />
musste. Hier stellten sich Unternehmen<br />
und ihre Produkte vor und zeigen<br />
einmal mehr, dass Innovationen<br />
im <strong>Wasser</strong>-Bereich in Bayern<br />
zuhause sind. Themen waren hierbei<br />
unter anderem Energie aus<br />
<strong>Abwasser</strong>, Sanierung von Trinkwasserspeichern,<br />
energieeffiziente Pumpen,<br />
Gefährdungsanalyse von Trinkwasser,<br />
verbesserte Entkeimungsverfahren<br />
oder neue Materialien für<br />
Leitungsbau und Trinkwasserspeicher.<br />
Nicht nur die Teilnehmer profitierten:<br />
Der Erlös des Unternehmerforums<br />
in Höhe von 4500 € wurde<br />
im Rahmen der Abendveranstaltung<br />
vom ehemaligen Oberbürgermeister<br />
der Stadt Landshut Manfred<br />
Kaschel an die Lebenshilfe für Menschen<br />
mit Behinderung Vereinigung<br />
Landshut e.V. übergeben.<br />
Veranstaltet wurde die Tagung<br />
vom Umweltcluster Bayern, der<br />
ARGE <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> Niederbayern/Oberpfalz<br />
und der DWA. Kooperationspartner<br />
waren der <strong>Wasser</strong>werksnachbarschaften<br />
Bayern e.V.,<br />
der Bayerische Gemeindetag, die<br />
Mösslein GmbH, der Berufsverband<br />
Bayerischer Hygieneinspektoren,<br />
die Bayerische Verwaltungsschule,<br />
Funtana Beratung für Bäderbetriebe<br />
und Infowelle e.V. Schirmherr war<br />
Klaus Kumutat, Präsident des bayerischen<br />
Landesamtes für Umwelt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.wassertagung.de<br />
Mai 2013<br />
560 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
NACHRICHTEN<br />
Tracerversuch an der Saale<br />
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) untersucht Fließgeschwindigkeiten<br />
Im April 2013 führte die Bundesanstalt für Gewässerkunde (Koblenz) an der Saale eine Untersuchung zur<br />
Bestimmung von Stofftransport-Laufzeiten durch. Dabei wurde in Naumburg im Bereich der Straßenbrücke<br />
zum Ortsteil Henne (Saale-km 160,0) gegen Mittag ein Fluoreszenz-Farbstoff (Sulforhodamin G) ins Gewässer<br />
eingebracht, dessen Ausbreitung in Saale und Elbe verfolgt wurde.<br />
Einbringen des Farbstoffs Sulforhodamin G bei einem Tracerversuch,<br />
den die BfG im Jahr 2012 an der Moldau durchführte.<br />
© Stephan Mai / BfG<br />
Der Markierungsstoff wird im<br />
Bereich der Einleitungsstelle<br />
deutlich sichtbar sein, er ruft im<br />
Gewässer eine rot-orange Färbung<br />
hervor“, so Stephan Mai, der Leiter<br />
der Traceruntersuchung. „Aufgrund<br />
der fortschreitenden Vermischung<br />
und Verdünnung ist die Färbung<br />
jedoch nach etwa 10 km Fließstrecke<br />
mit bloßem Auge nicht mehr<br />
erkennbar.“ Die Wissenschaftler der<br />
BfG erfassten die Konzentration des<br />
Markierungsstoffes im <strong>Wasser</strong> mit<br />
speziellen Geräten zur Messung der<br />
Fluoreszenz (Fluorometer). Der Tracer<br />
Sulforhodamin G ist umweltneutral<br />
und unschädlich für <strong>Wasser</strong>organismen.<br />
Die Genehmigung zur<br />
Einbringung des Farbstoffs war<br />
durch die Untere <strong>Wasser</strong>behörde<br />
erteilt worden.<br />
Die EU-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
fordert für jedes Flussgebiet den<br />
Aufbau von Strukturen zur Frühwarnung.<br />
Daher findet die jetzige<br />
Untersuchung im Rahmen der Ausweitung<br />
des Elbe-Alarmmodells<br />
(ALAMO) auf die Nebenflüsse Saale<br />
und Moldau statt. Diese Erweiterung<br />
erfolgt auf Wunsch der Internationalen<br />
Kommission zum Schutz<br />
der Elbe (IKSE). Ferner dienen die im<br />
Versuch gemessenen Transportzeiten<br />
auch zur Kalibrierung weiterer<br />
Modelle, mit denen die BfG bei hydrologischen<br />
Extremsituationen, Un -<br />
fällen und anderen Schadensereignissen<br />
Ausbreitungsprognosen in<br />
den großen deutschen Flüssen (Bundeswasserstraßen)<br />
erstellen kann.<br />
An der Saale sind Kontrollmessungen<br />
in Oeblitz, Bad Dürrenberg,<br />
Rischmühle, Planena, Halle-Trotha,<br />
Wettin, Alsleben, Bernburg, Calbe<br />
und Rosenburg geplant. Desweiteren<br />
werden an der Elbe in Barby,<br />
Magdeburg, Tangermünde, Wittenberge<br />
und Geesthacht Messungen<br />
durchgeführt.<br />
Vollständige Funktionalität unter<br />
WINDOWS, Projektverwaltung,<br />
Hintergrundbilder (DXF, BMP, TIF, etc.),<br />
Datenübernahme (ODBC, SQL), Online-<br />
Hilfe, umfangreiche GIS-/CAD-<br />
Schnittstellen, Online-Karten aus Internet.<br />
Weitere Informationen:<br />
Dr. Stephan Mai,<br />
Bundesanstalt für Gewässerkunde,<br />
Am Mainzer Tor 1, D-56068 Koblenz,<br />
Tel. (0261)1306 5322,<br />
E-Mail: mai@bafg.de<br />
Gas, <strong>Wasser</strong>,<br />
Fernwärme, <strong>Abwasser</strong>,<br />
Dampf, Strom<br />
Stationäre und dynamische Simulation,<br />
Topologieprüfung (Teilnetze),<br />
Abnahmeverteilung aus der Jahresverbrauchsabrechnung,<br />
Mischung von<br />
Inhaltsstoffen, Verbrauchsprognose,<br />
Feuerlöschmengen, Fernwärme mit<br />
Schwachlast und Kondensation,<br />
Durchmesseroptimierung, Höheninterpolation,<br />
Speicherung von<br />
Rechenfällen<br />
I NGE N I E U R B Ü R O FIS C H E R — U H R I G<br />
WÜRTTEMBERGALLEE 27 14052 BERLIN<br />
TELEFON: 030 — 300 993 90 FAX: 030 — 30 82 42 12<br />
INTERNET: WWW.STAFU.DE<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 561
NACHRICHTEN<br />
Branche<br />
GEFMA-Förderpreis für Abschlussarbeit zum<br />
Münchner Kanalreinigungsmodell<br />
Absolventin des Nürnberger Masterstudiengangs „Facility Management“ erhielt den<br />
begehrten Förderpreis<br />
Im Rahmen des jährlichen Karrieretages der deutschen Fachmesse für Facility Management wurden am<br />
28. Februar 2013 Förderpreise der GEFMA (German Facility Management Association) vergeben. Ausgezeichnet<br />
wurden dabei akademische Abschlussarbeiten, die den Unternehmen der Branche wichtige Impulse geben.<br />
In der Fachkategorie „Entsorgungsnetze“ wurde Simone Blankenburg, Absolventin des berufsbegleitenden<br />
Masterstudiengangs „Facility Management“ der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Kooperation mit der Hochschule<br />
München und dem Verbund IQ gGmbH, geehrt.<br />
Die GEFMA-<br />
Förderpreisträger<br />
2013: Andreas<br />
Diem,<br />
Simone Blankenburg,<br />
Gerrit<br />
Fischer, Yvonne<br />
Schoeberichts,<br />
Manuel Wider<br />
(Hauptpreis)<br />
und Stephan<br />
Stößel (v. l.).<br />
© Uta Mosler,<br />
LichtEinfall<br />
Unter dem Titel „Das Münchner<br />
Kanalreinigungsmodell“ analysierte<br />
und bewertete Simone Blankenburg<br />
dieses Modell und entwarf<br />
ein neues Instrument zum Einstieg<br />
in eine bedarfsgerechte Kanalreinigung.<br />
Das Münchner Kanalreinigungsmodell<br />
entwickelte sich aus<br />
einer traditionellen Kanalreinigung,<br />
bei der Zonen von Süd nach Nord<br />
abgearbeitet werden. Die Reinigungskosten<br />
der <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
gehen dabei mit den Wartungskosten<br />
einher. Dem stellte sie in<br />
ihrer Arbeit ein bedarfsorientiertes<br />
Modell gegenüber, das auf der ökonomischen<br />
Optimierung der Wartungsstrategie<br />
beruht. Dieses profitiert<br />
von technischen Rückmeldeergebnissen,<br />
der Verlängerung von<br />
Prüfintervallen und der einzuführenden,<br />
einfachen Sichtprüfung. So<br />
wird es möglich, Kanalreinigung<br />
wie -instandhaltung bedarfsgerecht<br />
zu planen. Die Strategie bleibt dabei<br />
innerhalb der vorgegebenen Regelwerke<br />
und gefährdet die hydraulische<br />
Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes<br />
nicht. Zwar stiege die Frequenz<br />
der notwendigen optischen<br />
Sichtprüfungen um 27 Prozent, so<br />
ermittelte Blankenburg, doch durch<br />
den sinkenden Aufwand in der<br />
Kanalreinigung könne das Personal<br />
anderweitig eingesetzt werden.<br />
Gleichzeitig reduzierten sich durch<br />
den geringeren Reinigungsaufwand<br />
auch die Betriebskosten für<br />
Großfahrzeuge. In ihrer Masterarbeit<br />
legt die Absolventin anhand<br />
von Planungen, Berechnungen und<br />
Kalkulationen detailliert dar, dass<br />
die Stadt München mit einer solchen<br />
Modifikation ihrer Kanalreinigungsstrategie<br />
eine Viertelmillion<br />
Euro einsparen könnte.<br />
Theoretisches Fachwissen<br />
verbunden mit praktischem<br />
Mehrwert<br />
Die Ansätze von Simone Blankenburg<br />
wurden von der Jury des Förderpreises<br />
der GEFMA Ende Februar<br />
ausgezeichnet. Die Förderpreise sollen<br />
den Austausch zwischen Wissenschaft<br />
und Praxis intensivieren<br />
und werden jährlich im Rahmen der<br />
Facility Management Messe in<br />
Frankfurt vergeben. „Eine kosteneffiziente<br />
Wartung der <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
sollte oberstes Ziel eines<br />
Kanalbetriebes sein, da die Betriebskosten<br />
letztendlich die Gebührenberechnung<br />
beeinflussen. In meiner<br />
Masterarbeit beschreibe ich die<br />
Möglichkeit der Verbesserung des<br />
Prozesses Kanalreinigung“, so die<br />
Preisträgerin, die sich über die Anerkennung<br />
für ihre Arbeit freut. Die<br />
theoretischen Kenntnisse zu ihrer<br />
Masterarbeit eignete sie sich während<br />
ihrer Weiterbildung zur Facility<br />
Managerin an. Von Oktober 2010<br />
bis Sommer 2012 absolvierte die<br />
37-Jährige aus München mit großem<br />
Erfolg den berufsbegleitenden<br />
Studiengang zum Master im Facility<br />
Management in der Kooperation<br />
der Hochschulen Nürnberg und<br />
München mit Verbund IQ.<br />
Kontakt:<br />
Verbund IQ gGmbH, Dr. Ursula Baumeister,<br />
Dürrenhofstraße 4, D-90402 Nürnberg,<br />
Tel. (0911) 424599-0,<br />
E-Mail: info@verbund-iq.de,<br />
www.verbund-iq.de<br />
Mai 2013<br />
562 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
SONDERAUSGABE<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff<br />
04/13<br />
D e r e . q u a N e w s l e t t e r<br />
Netzwerk Energierückgewinnung<br />
und Ressourcenmanagement<br />
Das e.qua Netzwerk berichtet<br />
Veranstaltungen<br />
Veranstaltungen<br />
Aus dem Netzwerk<br />
15<br />
Premiere auf der ISH:<br />
Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
stellt sich vor<br />
Unter dem Dach des von der e.qua<br />
organisierten Gemeinschaftsstandes<br />
präsentierte sich die Themenallianz<br />
erstmals bei der ISH ................. Seite 2<br />
Nachbericht zur Dresdner<br />
<strong>Abwasser</strong>tagung:<br />
Die 15. Dresdner <strong>Abwasser</strong>tagung (DAT)<br />
endete mit neuem Teilnahmerekord<br />
Die Dresdner <strong>Abwasser</strong>tagung festigte<br />
ihre Position als wichtiger deutscher<br />
Branchentreff und feierte einen neuen<br />
Teilnahmerekord ...................... Seite 2<br />
Neues Netzwerkmitglied<br />
stellt sich vor:<br />
REESE INGENIEURE e³ Ihr Planungsbüro<br />
für Heizen und Kühlen mit <strong>Abwasser</strong><br />
Reese Ingenieure e³ analysiert zusammen<br />
mit seinen Kunden das enorme<br />
Potenzial, das unter Ihren Füßen<br />
schlummert und erarbeitet alle Phasen<br />
der <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung bis hin zur<br />
schlüsselfertigen Anlage .......... Seite 4<br />
Themenallianz AWN<br />
Themenallianz AWN<br />
Themenallianz AWN<br />
Cramer-Klett Preis 2012:<br />
Christian Frommann wird für seine<br />
Leistung geehrt<br />
Für seine herausragende Leistung<br />
auf dem Gebiet der <strong>Abwasser</strong>wärmerückgewinnung<br />
wurde Herr Christian<br />
Frommann von der HUBER SE mit dem<br />
Theodor von Cramer-Klett-Preis geehrt<br />
................................................. Seite 4<br />
Bayerischer<br />
Energiepreis 2012:<br />
Netzwerkmitglied HUBER SE belegt<br />
ersten Platz<br />
Bayerns Wirtschafts- und Energieminister<br />
Zeil verlieh am 18. Oktober in<br />
Nürnberg den Energiepreis 2012. Das<br />
Unternehmen HUBER SE belegte in der<br />
Kategorie Energiekonzepte und Initiativen<br />
den ersten Platz ................. Seite 6<br />
Die Rabtherm AG:<br />
Leuchtturmprojekt in der historischen<br />
denkmalgeschützten Altstadt von<br />
Salzburg<br />
Der Almkanal wurde bei der Suche<br />
nach alternativer Energienutzung aus<br />
dem Schlaf geweckt und in die moderne<br />
Zeit katapultiert ................... Seite 7
Veranstaltungen<br />
Premiere auf der ISH:<br />
Die Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung stellt sich vor<br />
V<br />
om 12. bis zum 16. März 2013 öffnete<br />
die ISH Messe in Frankfurt ihre<br />
Pforten. Die ISH ist die Weltleitmesse<br />
für die Erlebniswelt Bad, Gebäude-,<br />
Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare<br />
Energien, und damit die weltgrößte Leistungsschau<br />
für den Verbund von <strong>Wasser</strong><br />
und Energie. Ob nachhaltige Sanitärlösungen,<br />
energieeffiziente Heiztechnologien<br />
in Kombination mit erneuerbaren<br />
Energien oder umweltschonende Klima-,<br />
Kälte- und Lüftungstechnik – die Weltleitmesse<br />
deckt mit ihrem Angebot in<br />
Breite und Tiefe alle Aspekte zukunftsweisender<br />
Gebäudelösungen ab.<br />
Klar, dass auch die Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
hier nicht fehlen<br />
durfte. Unter dem Dach des von der<br />
e.qua organisierten Gemeinschaftsstandes<br />
präsentierte sich die Themenallianz<br />
erstmals bei der ISH. Zusammen mit<br />
den Mitgliedsunternehmen ECO.S Energieconsulting<br />
Stodtmeister, PEWO Energietechnik<br />
GmbH, Reese Ingenieure e 3<br />
und Uhrig Kanaltechnik GmbH stellte der<br />
e.qua Messestand einen Treffpunkt und<br />
Informationsplattform für Fachbesucher<br />
aus Handwerk, Handel, Ingenieur- und<br />
Architekturbüros, Wohnungsbau- und<br />
Immobiliengesellschaften, Dienstleister,<br />
Behörden und Hochschulen dar.<br />
Ziel war es, auf das Potential und die<br />
Marktreife der <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
hinzuweisen und weitere Projektpartner<br />
zu gewinnen. <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
ist als Wärmebereitstellungsoption im-<br />
mer noch relativ unbekannt, so dass bei<br />
der ISH insbesondere bei Planern und<br />
Investoren von Immobilienprojekten für<br />
diese neue Technologieoption geworben<br />
werden konnte.<br />
Weitere Informationen rund um das Thema<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzung und die<br />
Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
finden Sie unter www.abwasserwaermenutzung.com<br />
Nachbericht zur Dresdner <strong>Abwasser</strong>tagung:<br />
Die 15. Dresdner <strong>Abwasser</strong>tagung (DAT) endete mit neuem Teilnahmerekord<br />
E<br />
in neuer Teilnahmerekord, Dresdens<br />
Barockkulisse und hochkarätige Referenten<br />
— das sind die Zutaten für eine<br />
gelungene Fachveranstaltung. Die Dresdner<br />
<strong>Abwasser</strong>tagung festigte ihre Position<br />
als wichtiger deutscher Branchentreff.<br />
440 <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>experten<br />
versammelten sich am 26. und 27. März<br />
2013 im MARITIM Internationales Con-<br />
gress Center Dresden (ICC). Diesmal gab<br />
es ein kleines Jubiläum zu feiern: Der Treff<br />
fand bereits zum 15. Mal statt. Insbesondere<br />
die Aussteller der 80 teilnehmenden<br />
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen<br />
zeigten sich hoch zufrieden.<br />
„Die Gänge waren in den langen Pausen<br />
immer gut besucht. Die Zusammensetzung<br />
der Kongressteilnehmer entsprach<br />
- 2 -<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff 04/13
Veranstaltungen<br />
dabei voll und ganz unseren Erwartungen.<br />
Wir unterhielten uns mit zahlreichen<br />
Entscheidern der Ver- und Entsorgungswirtschaft“,<br />
sagte Reinhard Böttner von<br />
HOBAS Rohre GmbH, „wir sind 2014 auf<br />
jeden Fall wieder dabei.“<br />
Den Auftakt bildete am Dienstag, dem 26.<br />
März 2013, die Eröffnung der Industrieausstellung<br />
im ICC. Johannes Pohl, Technischer<br />
Geschäftsführer der Stadtentwässerung<br />
Dresden, begrüßte rund 150<br />
Gäste. Nach den offiziellen Worten ließ es<br />
Magic Andy krachen. Der selbsternannte<br />
Science Comedian brachte <strong>Wasser</strong> zum<br />
Singen und zauberte ein Maß Bier herbei.<br />
Höhepunkt war der ohrenbetäubende<br />
Knall, bei dem zwei wassergefüllte Metallkugeln<br />
unter dem Einfluss von flüssigem<br />
Stickstoff barsten.<br />
Der traditionelle Erfahrungsaustausch<br />
am Vorabend fand in der Tonne unter<br />
den Dresdner Festungsmauern statt. Die<br />
230 Stühle im Gewölbe des ehemaligen<br />
Studentenklubs Bärenzwinger waren bis<br />
auf den letzten Platz belegt. So gemütlich<br />
wie die Sitzordnung wurde der gesamte<br />
Abend. Peter Till, einziges Ensemblemitglied<br />
des Universal Druckluftorchesters,<br />
webte seinen Klangteppich und Zauberer<br />
Mario Wilson fand dankbare „Opfer“ für<br />
seine Kunststückchen. Typisch sächsische<br />
Tafelfreuden, vom Kräutersüppchen<br />
über Wildschweinbraten bis zur Eispyramide,<br />
bildeten die solide Basis für Bier,<br />
Wein und gute Gespräche.<br />
Am Mittwoch, dem 27. März 2013, eröffnete<br />
Gunda Röstel, Kaufmännische Geschäftsführerin<br />
der Stadtentwässerung<br />
Dresden, die 15. Dresdner <strong>Abwasser</strong>tagung<br />
(DAT). Die Grußworte der Landeshauptstadt<br />
Dresden überbrachte Bürgermeister<br />
Detlef Sittel, Beigeordneter für<br />
Ordnung und Sicherheit. Er freute sich<br />
über die starke überregionale Resonanz<br />
der DAT.<br />
Den ersten Fachvortrag im Themenblock<br />
Zwänge und Chancen zur Veränderung<br />
hielt Rainer Zieschank, Chef der DREWAG,<br />
Dresdner Stadtwerke GmbH. Sein Beitrag<br />
zur Energiewende aus Sicht eines Energieversorgungsunternehmens<br />
kam bei<br />
den Teilnehmern sehr gut an. Mit klaren<br />
Worten brandmarkte er Reglungswut und<br />
Kostentreiber am Strommarkt – seine<br />
pointierte Zusammenfassung lautete:<br />
Planwirtschaft ohne Plan.<br />
Prof. Dr. Peter Krebs von der Technischen<br />
Universität Dresden berichtete über das<br />
Projekt REGKLAM (Regionales Klimaanpassungsmanagement)<br />
am Beispiel des<br />
Moduls <strong>Wasser</strong>systeme. So besteht eine<br />
Methode darin, mit dem zunehmenden<br />
hydraulischen Stress in Kanalnetzen<br />
umzugehen, das <strong>Wasser</strong> an geeigneten<br />
Punkten gezielt austreten zu lassen.<br />
Prof. Dr. Joachim Hansen von der Universität<br />
Luxemburg verglich die Schlammfaulung<br />
mit der aeroben Stabilisierung.<br />
Bereits heute lohne sich eine Faulungsanlage<br />
bei Kläranlagen ab 20.000 Einwohnerwerten<br />
(EW). Seine Prognose:<br />
Zunehmende Kosten für Energie und<br />
Schlammentsorgung führen zu einer Verschiebung<br />
der Wirtschaftlichkeitsgrenze<br />
in Richtung 10.000 EW.<br />
15<br />
Das Programm am Nachmittag bot Lösungen<br />
aus der Praxis für die Praxis. Dr. Ulrich<br />
Meyer, Technischer Geschäftsführer, berichtete<br />
über die Investitionsstrategie der<br />
Kommunalen <strong>Wasser</strong>werke Leipzigs, mit<br />
denen die KWL innerhalb der nächsten 10<br />
bis 15 Jahre den Aufholprozess im Kanalnetz<br />
der Messestadt meistern will. Etwa<br />
21 Millionen Euro müssen dafür jährlich<br />
aufgebracht werden.<br />
Den vielen Inspirationen des Tages setzte<br />
Kommunikations-Experte Renè Borbonus<br />
noch einen drauf. Sein Appell an alle Redner:<br />
Du sollst nicht langweilen! Dass Renè<br />
Borbonus kein Theoretiker ist, bewies er<br />
mit seinem viel beachteten und belachten<br />
Beitrag über die Kunst der Rhetorik.<br />
440 prall gefüllte Umhängetaschen<br />
mit dem Logo der 15. DAT verließen am<br />
Abend das ICC auf den Schultern froher<br />
Teilnehmer. Johannes Pohl, Technischer<br />
Geschäftsführer der Stadtentwässerung<br />
Dresden, stellte in seinem Schlusswort<br />
fest: „Hält dieser Trend auch im nächsten<br />
Jahr an, werden wir anbauen müssen. In<br />
diesem Sinn: Wir sehen uns auf der 16.<br />
DAT im März 2014 in Dresden!“<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff 04/13 - 3 -
Aus dem Netzwerk<br />
Neues Netzwerkmitglied stellt sich vor:<br />
REESE INGENIEURE e³ - Ihr Planungsbüro für Heizen und Kühlen mit <strong>Abwasser</strong><br />
In Zeiten der Energiewende wird immer<br />
mehr nach alternativen Energieformen<br />
geforscht. Diese sollen nachhaltig und<br />
umweltschonend sowie wirtschaftlich<br />
sinnvoll sein. Neben den bekannten und<br />
bislang ausschließlich propagierten regenerativen<br />
Energiequellen, rückt nun die<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmenutzung als neue nachhaltige<br />
Energiequelle zunehmend in den<br />
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Doch wie<br />
und vor allem wo können Sie diese Energieform<br />
nutzen?<br />
Zur Klärung dieser Fragen kommt die Firma<br />
Reese Ingenieure e³ ins Spiel. Wir analysieren<br />
zusammen mit Ihnen das enorme Potenzial,<br />
das unter Ihren Füßen schlummert<br />
und erarbeiten alle Phasen der <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
hin zur schlüsselfertigen<br />
Anlage. Um dies zu realisieren sind<br />
fundierte Kenntnisse in den Bereichen<br />
Tiefbau, Thermodynamik, Verfahrenstechnik<br />
sowie Hydraulik und Haustechnik notwendig.<br />
Reese Ingenieure e³ vereint diese<br />
Qualitäten in einem Ingenieurbüro und ist<br />
somit Ihr kompetenter Ansprechpartner<br />
rund um das Thema „Energie aus <strong>Abwasser</strong>“.<br />
Mit ersten Informationsgesprächen oder<br />
einer Energieberatung beginnen wir unsere<br />
Leistungen, um Ihnen einen verständlichen<br />
Überblick über die Vielfalt des energetischen<br />
Recyclings zu verschaffen. Wir<br />
erstellen auch Potenzialstudien für Ihre<br />
gesamten Kanalnetze oder messen mit<br />
modernster Messtechnik das vor Ort liegende<br />
Potenzial. Außerdem fertigen wir<br />
Machbarkeitsstudien für ein potenzielles<br />
Gebäude an, um Ihnen einen Vorausblick<br />
über die Möglichkeiten und Kosteneinsparungen<br />
zu geben. Auch in der Konzeptund<br />
Bauphase stehen wir Ihnen beratend<br />
zur Seite.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!<br />
Reese Ingenieure e³<br />
Fraunhoferstraße 3<br />
25524 Itzehoe<br />
Telefon: 04821-14846-23<br />
Fax: 04821 - 14846-29<br />
E-Mail: info@reese-e3.de<br />
Internet: www.reese-e3.de<br />
Brandenburger Liner GmbH & Co. KG.<br />
Mittlerweile sind in Deutschland mehr<br />
als 30 Projekte umgesetzt und es gibt<br />
annähernd 30 verschiedene technische<br />
Lösungen diverser Herstellern mit unterschiedlichster<br />
Auslegung.<br />
Die Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
Cramer-Klett Preis 2012:<br />
Christian Frommann wird für seine Leistung geehrt<br />
er Theodor von Cramer-Klett-Preis<br />
D<br />
wird im zweijährigen Turnus vom<br />
VDI Bayern Nordost an herausragende<br />
Nachwuchswissenschaftler und Ingenieure<br />
verliehen. Namensgeber des<br />
Preises ist der Nürnberger Unternehmer<br />
Theodor von Cramer-Klett, der in der<br />
Zeit von 1817 – 1884 lebte und zu den<br />
herausragenden Persönlichkeiten der<br />
damaligen Zeit zählt. Mit seinem unternehmerischen<br />
Weitblick initiierte er<br />
zahlreiche Projekte und Unternehmen<br />
Christian Frommann (links)<br />
bei der Preisübergabe<br />
und legte auch den Grundstein für das<br />
heute international bekannte Unternehmen<br />
MAN. Aufgrund dieser historischen<br />
Zusammenhänge ist es auch nicht weiter<br />
verwunderlich, dass die Preisverleihung<br />
traditionell auf dem Werksgelände der<br />
MAN in Nürnberg stattfindet. Nach einer<br />
kurzen Begrüßung der anwesenden<br />
Gäste würdigte Herr Volker Thomas in<br />
seiner Funktion als Vorsitzender des<br />
VDI Bayern Nordost in seiner Laudatio<br />
die herausragende Leistung von Herrn<br />
- 4 -<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff 04/13
Die Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
Christian Frommann auf dem Gebiet der<br />
<strong>Abwasser</strong>wärmerückgewinnung.<br />
<strong>Abwasser</strong>, wie es in der Kanalisation<br />
fließt, hat meist das ganze Jahr über<br />
eine Temperatur<br />
von mind. 10 – 12<br />
Grad Celsius. Berücksichtigt<br />
man<br />
dann noch die enormen<br />
Mengen, welche<br />
hier fließen, so<br />
stellt man fest, dass<br />
sich unter unseren<br />
Füßen ein enormer<br />
Energiestrom<br />
befindet, der – die<br />
richtige Technologie<br />
vorausgesetzt – für<br />
die Beheizung von<br />
Gebäuden benutzt<br />
werden kann. Herr<br />
Frommann hat sich<br />
dieser Herausforderung<br />
gestellt und in<br />
seiner Funktion als<br />
Geschäftsbereichsleiter<br />
der HUBER<br />
SE für das Unternehmen ein neues zukunftsträchtiges<br />
Geschäftsfeld erschlossen.<br />
Kernstück der innovativen Technik<br />
ist der HUBER <strong>Abwasser</strong>wärmetauscher<br />
RoWin, der ganz speziell für diese Anwendung<br />
mit <strong>Abwasser</strong> konzipiert wurde.<br />
Mittels des einzigartigen und auch<br />
patentierten Wärmetauschers wird nun<br />
in Kombination mit einer Wärmepumpe<br />
dem <strong>Abwasser</strong> thermische Energie entzogen<br />
und diese Wärme dann für die Beheizung<br />
eines Gebäudes zur Verfügung<br />
gestellt. Das <strong>Abwasser</strong> kühlt sich dabei<br />
nur um wenige Grad ab. Interessant ist<br />
hier auch, dass dieses Prinzip auch für<br />
die Kühlung von Gebäuden verwendet<br />
werden kann. In diesem Fall wird über<br />
die Wärmepumpe dem Gebäude thermische<br />
Energie entzogen und diese Wärme<br />
über den <strong>Abwasser</strong>wärmetauscher an<br />
das <strong>Abwasser</strong> übertragen.<br />
Kommunales <strong>Abwasser</strong> wird zum Heizen und Kühlen eines Bürogebäudes mit ca.<br />
22.000m² genutzt<br />
Im Lichte der aktuellen Diskussion um<br />
das Ende der fossilen Brennstoffe, dem<br />
drohenden Klimawandel und der Energiewende<br />
gilt diese Technologie als absolut<br />
nachhaltig und zukunftsorientiert.<br />
Durch die <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung werden<br />
die mit konventioneller Heizung<br />
notwendigen Brennstoffe wie Öl oder<br />
Gas überflüssig und die CO2-Emissionen<br />
werden deutlich gesenkt.<br />
In einem Vortrag erläuterte Herr Frommann<br />
dann auch seine gesamten<br />
HUBER-Entwicklungsaktivitäten der <strong>Abwasser</strong>wärmerückgewinnung<br />
von den<br />
Anfängen 2006 bis zum heutigen Tage.<br />
Anhand zahlreicher Bilder und Beispiele<br />
erklärte er den interessierten Anwesenden,<br />
welche Hindernisse es zu überwinden<br />
galt und welche technischen und<br />
verfahrenstechnischen Herausforderungen<br />
zu meistern waren, bis aus der<br />
ersten Idee ein funktionierendes und<br />
marktfähiges Verfahren entstand – und<br />
vor allem dann auch die ersten Aufträge<br />
an Land gezogen werden konnten.<br />
Im Anschluss an den Vortrag folgte nun<br />
die Preisverleihung. Herr Volker Thomas<br />
übergab zunächst die Urkunde „Cramer-<br />
Klett-Preis 2012“<br />
und lüftete dann<br />
das Geheimnis des<br />
„Überraschungs-<br />
Sachpreises“: Herr<br />
Frommann und seine<br />
Frau werden eingeladen<br />
zu einem<br />
Luxus-Wochenende<br />
in Dresden mit<br />
2-Übernachtungen,<br />
speziellen Besichtigungen<br />
inklusive<br />
Tickets für die berühmte<br />
Semper-<br />
Oper.<br />
Der Preisverleihung<br />
folgte dann eine<br />
interessante Werksführung<br />
durch die<br />
Motorenfertigung<br />
der MAN und abschließend<br />
lud der Hausherr und Gastgeber<br />
Herr Dr.-Ing. Ulrich Dilling (Direktor<br />
MAN Truck&Bus AG) zum festlichen<br />
Mittagessen, womit die Preisverleihung<br />
einen würdigen Abschluss fand.<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff 04/13<br />
- 5 -
Die Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
Bayerischer Energiepreis 2012:<br />
Netzwerkmitglied HUBER SE belegt ersten Platz<br />
B<br />
ayerns Wirtschafts- und Energieminister<br />
Zeil verlieh am 18. Oktober<br />
in Nürnberg den Energiepreis 2012. Das<br />
Unternehmen HUBER SE belegte in der<br />
Kategorie Energiekonzepte und Initiativen<br />
den ersten Platz und wurde für den<br />
innovativen und verantwortungsvollen<br />
Umgang mit Energie ausgezeichnet.<br />
Martin Zeil bezeichnete die ausgezeichneten<br />
Projekte als „Herausragende<br />
Entwicklungen für eine innovationsorientierte<br />
Energiewende“. Das CO2-<br />
sparende Projekt „Heizwärme aus dem<br />
<strong>Abwasser</strong>kanal“, das die HUBER SE in<br />
Zusammenarbeit mit der Stadt Straubing/Stadtentwässerung<br />
und der GFM<br />
beratende Ingenieure GmbH umsetzte<br />
versorgt in Straubing 102 Wohneinheiten<br />
mit rund 65 % des Wärmebedarfs<br />
über das <strong>Abwasser</strong>. Bei diesem Objekt<br />
mit guter Wärmedämmung entspricht<br />
das jährlich knapp 350.000 kWh. Ermöglicht<br />
wird diese Einsparung durch<br />
ein Verfahren, bei dem die Wärme des<br />
<strong>Abwasser</strong>s – also warmes <strong>Wasser</strong> das<br />
beim Duschen, Baden, Waschen und<br />
Spülen in die Kanalisation fließt – durch<br />
einen speziellen Wärmetauscher entzogen<br />
wird. Eine Wärmepumpe passt die<br />
Temperatur der entzogenen <strong>Abwasser</strong>wärme<br />
der benötigten Heiztemperatur<br />
der Wohnungen an. Im Vergleich zur Erdund<br />
Grundwasserwärme punktet das<br />
Verfahren der <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
mit ganzjährig hohen Temperaturen von<br />
mindestens 12 Grad Celsius.<br />
HUBER erkannte die <strong>Abwasser</strong>wärme<br />
früh als Energieschatz und entwickelte<br />
im Stammhaus in Berching das in Straubing<br />
installierte ThermWin®-Verfahren.<br />
Wichtigster Bestandteil dieser zukunftsweisenden<br />
Entwicklung ist der Wärmetauscher<br />
RoWin. Er steht in direktem<br />
Kontakt mit dem kommunalen <strong>Abwasser</strong>,<br />
trotz aller Unreinheiten und Störstoffe,<br />
die das <strong>Abwasser</strong> enthält. Deshalb<br />
entwickelten Ingenieure der HUBER SE<br />
ein Selbstreinigungsverfahren für den<br />
Wäremtauscher RoWin um bestmögliche<br />
Übertragungswerte liefern zu können<br />
damit die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage<br />
garantiert ist.<br />
Das Projekt läuft seit dem eisigen Winter<br />
des Jahres 2010 und überzeugte gleich<br />
bei seinem ersten Härtetest mit zuverlässiger<br />
Wärmeleistung. Entscheidend<br />
für die Auszeichnung mit dem Bayerischen<br />
Energiepreis waren die Nutzung<br />
regenerativer Energiequellen und die<br />
daraus resultierende Einsparung von<br />
circa 70 Tonnen CO2. Der Bayerische<br />
Energiepreis wurde erstmals 1999 verliehen<br />
und wird seit 2000 im Zwei-Jahres-<br />
Turnus vergeben. Die Preisträger werden<br />
durch eine unabhängige Jury von Energieexperten<br />
verschiedener bayerischer<br />
Universitäten in einem mehrstufigen<br />
Auswahlverfahren gekürt.<br />
Kontakt:<br />
HUBER SE<br />
Franziska Schierl<br />
Industriepark Erasbach A1<br />
92334 Berching<br />
sf@huber.de<br />
von links nach rechts:<br />
Oberbürgermeister Pannermayr Straubing<br />
Dr.-Ing. Ralf Mitsdörffer, Geschäftsführer GFM<br />
Bay. Wirtschaftsminister Zeil<br />
Georg Huber, Vorstandsvorsitzender HUBER SE<br />
- 6 - <strong>Wasser</strong>Stoff 04/13
Die Themenallianz <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung<br />
Die Rabtherm AG:<br />
Leuchtturmprojekt in der historischen denkmalgeschützten Altstadt von Salzburg<br />
D<br />
er Almkanal, Mitteleuropas ältestes<br />
<strong>Wasser</strong>- und Energiesystem, dokumentiert<br />
bereits im 12. Jahrhundert, ist<br />
eine historische Lebensader. Der Almkanal,<br />
der einige Meter unter der Altstadt in<br />
die Salzach fließt, wurde bei der Suche<br />
nach alternativen Energienutzungen aus<br />
dem Schlaf geweckt und in die moderne<br />
Zeit katapultiert.<br />
Kanal mit Eichenholz ausgekleidet<br />
frei an das Almkanalwasser abgeben.<br />
Rabtherm und Urs Studer haben für diese<br />
Innovation den Energy Globe Award<br />
2012 gewonnen.<br />
Der Almkanal ist Gold wert, denn ohne<br />
dieses Gewässer und die sehr sachdienliche<br />
Mithilfe der Almkanalhüter Dr.<br />
Berger und Herrn Peter beim Einbau des<br />
Rabtherm-Systems wäre die Kühlung<br />
der SPAR-Märkte ein großes Problem<br />
gewesen. SPAR und das Ingenieurbüro<br />
Moser&Partner (Herr Wachter) haben<br />
einen Meilenstein gesetzt für die energetische<br />
Nutzung von Kanalgewässern<br />
und Abwässern. Ein echtes Leuchtturmprojekt<br />
aus Salzburg.<br />
Mehr Details unter www.rabtherm.com<br />
Almkanal im Rohzustand<br />
SPAR hat mehrere Standorte in der Salzburger<br />
Altstadt. Um beste Qualität der<br />
Lebensmittel garantieren zu können,<br />
müssen die Märkte in der Altstadt laufend<br />
gekühlt werden. Der Almkanal stellt<br />
sich mit seinem denkmalgeschützten<br />
und wasserführenden, grottenähnlichen<br />
Flusslauf zur Verfügung und aus der<br />
Schweiz kommt eine technische Innovation<br />
zur Lösung der Aufgabe.<br />
Kühlaggregate müssen ihre Wärme irgendwohin<br />
abgeben können. In den<br />
Almkanal werden auf Eichenbohlen<br />
montierte patentierte Wärmetauscher<br />
der Schweizer Firma Rabtherm mit ihrer<br />
Partner-Firma Wallstein aus Deutschland<br />
eingebaut, die die Wärme unterhalts-<br />
Almkanal mit eingebauten Wärmetauschern<br />
<strong>Wasser</strong>Stoff 04/13<br />
- 7 -
Energie aus <strong>Abwasser</strong><br />
Sind wir nicht alle ein bisschen grün...<br />
„Unser <strong>Abwasser</strong>“<br />
Energieträger zum<br />
Heizen und Kühlen<br />
Uhrig Kanaltechnik GmbH • e-mail: zentrale@uhrig-bau.de • www.uhrig-bau.de<br />
Am Roten Kreuz 2 • D-78187 Geisingen • Tel. +49 (0) 7704 / 806-0 • Fax +49 (0) 7704 / 806-50<br />
Sind Sie ein -Typ? Jetzt den richtigen Partner finden.<br />
Are you an -Type? Find the right partner now.<br />
Beste Vorreinigung<br />
in jedem Fall<br />
Mit Sicherheit mehr herausholen!<br />
Wir finden optimale Lösungen für Ihre Bedürfnisse:<br />
➤ Unsere Rechen und Siebe sichern den<br />
problemlosen Betrieb Ihrer Anlagen<br />
➤ Unsere Waschpressen und Sandwäscher<br />
minimieren Ihre Entsorgungskosten<br />
Wie die Planer und Betreiber tausender Kläranlagen<br />
weltweit können auch Sie sich auf unsere Produkte<br />
und Lösungen verlassen.<br />
Kaufm. Leiterin Betreiberunternehmen,<br />
Sparfuchs<br />
Commercial Manager of<br />
Operating Company, thrifty<br />
Dipl.-Ing. Planungsbüro,<br />
immer eine kreative Idee<br />
Engineers Planning Office,<br />
always a creative idea<br />
Geschäftsführerin Stadtwerk,<br />
offen für Neues<br />
Manager of Public Utility,<br />
open to change<br />
Leiter Klärwerk,<br />
energiegeladen<br />
Manager of Waste Water Treatment<br />
Plant, brimming with energy<br />
info@huber.de<br />
www.huber.de<br />
WASTE WATER Solutions<br />
Einladung IFAT V5.indd 1 24.04.2012 09:01:38<br />
Energieforum Stralauer Platz 34 10243 Berlin<br />
Fon +49 30 2936457-0 Fax +49 30 2936457-10<br />
www.e-qua.de<br />
info@e-qua.de<br />
Senatsverwaltung für Wirtschaft,<br />
Technologie und Frauen<br />
Dieses Projekt wird hälftig mit Bundes- und Landesmitteln<br />
aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen<br />
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert.
Veranstaltungen<br />
NACHRICHTEN<br />
Geprüfter Netzmonteur Gas, <strong>Wasser</strong><br />
und/oder Strom<br />
Ausbildung wird ab 21. Oktober 2013 auch im Norden angeboten<br />
Neuorganisationen in der Aufbau-<br />
und Ablaufstruktur von<br />
Versorgungsunternehmen gehören<br />
zwischenzeitlich zum betrieblichen<br />
Alltag. Der Wechsel der Konzessionsgebiete<br />
von einem Netzbetreiber zu<br />
einem anderen birgt umfassende<br />
Qualifikationsnotwendigkeiten für<br />
die betroffenen Mitarbeiter, in den<br />
operativen Ebenen. Mitarbeiter welche<br />
bislang ausschließlich z. B. im<br />
Bereich der Gasversorgung tätig<br />
waren, müssen zukünftig zusätzlich<br />
im Bereich der Stromversorgung<br />
Arbeiten ausführen.<br />
Bislang hat das DVGW-Berufsbildungswerk<br />
am Standort Lübeck<br />
zum/zur Netzmeister/-in ausgebildet.<br />
Ab Oktober 2013 ist der<br />
Vorbereitungslehrgang zum/zur<br />
Netzmonteur/-in mit den Fachrichtungen<br />
Gasversorgung, <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und Stromversorgung neu<br />
im Qualifizierungsangebot in Norddeutschland.<br />
Kombinationen der<br />
Fachrichtungen sind dabei möglich.<br />
Die Prüfung der Netzmonteure wird<br />
von der IHK zu Kiel abgenommen.<br />
Zwei Besonderheiten machen<br />
die Ausbildung in Lübeck weiter<br />
interessant. Die Teilnehmer haben<br />
die Möglichkeit, zusätzlich im<br />
Bereich der Stromversorgung die<br />
Ausbildung zur 10 kV-Schaltberechtigung<br />
zu erlangen. Teilnehmer im<br />
Bereich der Gas- oder <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
können ein besonderes An -<br />
gebot der DVGW-Partnerzentren<br />
SLV Hamburg und ABZ Bau Hamburg<br />
nutzen. Im Unterrichtsplan der<br />
Netzmonteurausbildung integriert,<br />
können sie ihre Qualifikation für die<br />
Nachumhüllung von Rohren, Armaturen<br />
und Formteilen nach DVGW-<br />
Arbeitsblatt GW 15 (Modul A und B)<br />
erwerben. Weiter ist der Erwerb<br />
der Grundausbildung PE-Schweißer<br />
GW 330 einschließlich der DVGW-<br />
Prüfung hierfür möglich.<br />
Die Ausbildung findet als Blocklehrgang<br />
statt und umfasst etwa<br />
neun Monate Unterrichtszeit. Diese<br />
beginnt am 21. Oktober 2013 und<br />
endet am 14. November 2014. Weitere<br />
Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen<br />
der IHK Kiel<br />
sowie Anmeldeunterlagen sind<br />
beim DVGW Berufsbildungswerk<br />
Center Nord erhältlich.<br />
Ansprechpartner:<br />
Ralf Mauel, E-Mail: mauel@dvgw.de<br />
Messung an einem kleinen Schacht.<br />
Info<br />
Vorbereitungslehrgänge zum geprüften Netzmonteur<br />
Gas, <strong>Wasser</strong> und/oder Strom<br />
Beginn: 21. Oktober 2013 in Lübeck<br />
Anmeldung unter www.dvgw-veranstaltungen.de<br />
Stichwort: Netzmonteur<br />
www.wassertermine.de<br />
Dresdner Grundwassertage<br />
Am 11. und 12. Juni 2013 veranstaltet das Dresdner Grundwasserforschungszentrum e. V. die Dresdner Grundwassertage<br />
2013 in der Dreikönigskirche. Thematisch stehen in diesem Jahr aktuelle Probleme und ihre<br />
Lösungsansätze zur Entwicklung und Applikation innovativer Grundwasserschutz- und Grundwasserbehandlungsmaßnahmen,<br />
wie sie sich vor allem beim Aktiv- und Sanierungsbergbau in den neuen Bundesländern<br />
ergeben, im Mittelpunkt. Die Fachvorträge zu diesem Problemkreis sollen in engem Verbund mit Posterbeiträgen,<br />
Firmenpräsentationen und Diskussionsmöglichkeiten stehen.<br />
Das Vortragsprogramm der Dresdner<br />
Grundwassertage untergliedert<br />
sich in sechs Blöcke. Block 0<br />
ist der Vergabe des Dresdner Grundwasserforschungspreises<br />
2013 vorbehalten.<br />
Block 1 dient der Reflektion<br />
aktueller rechtlicher Rahmenbedingungen<br />
und dem Aufzeigen<br />
der sich hieraus ableitenden Handlungserfordernisse.<br />
Block 2 ist exemplarischen<br />
Maßnahmen gewidmet,<br />
die beim Gewässerschutz und der<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 571
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
<strong>Wasser</strong>behandlung bei der Rohstoffgewinnung<br />
ergriffen werden.<br />
Im Block 3 gilt es anzuzeigen, wie<br />
GW-Sanierung und GW-Schutz bei<br />
der Wiedernutzbarmachung bergbaubetroffener<br />
Flächen zu hochwertigen<br />
Bergbaufolgelandschaften<br />
beizutragen vermögen. Block 4<br />
fokussiert nachfolgend die Betrachtungen<br />
auf eine Reihe innovativer<br />
In-situ- und Ex-situ-GW-Behandlungsverfahren,<br />
die einen effizienten<br />
Gewässerschutz in Bergbaugebieten<br />
und -folgelandschaften un -<br />
terstützen können. Block 5 dient<br />
letztlich der Reflektion ausgewählter<br />
Fallbeispiele. Durch Poster sollen<br />
die geplanten Vorträge so untersetzt<br />
werden, dass eine gute Grundlage<br />
für vertiefte Fachdiskussionen<br />
entsteht.<br />
Die Fachtagung wird am 12. Juni<br />
2013 durch eine Exkursion in das<br />
Freitaler Bergbaurevier abgerundet,<br />
in der über die Wiedernutzbarmachung<br />
eines Reviers mit Steinkohlen-,<br />
Uran- und anderem Erzbergbau<br />
vor Ort informiert werden soll.<br />
Die Dresdner Grundwassertage<br />
2013 erstreben durch die Vorträge<br />
sowie durch die Diskussionen, Poster-<br />
und Firmenpräsentationen und<br />
durch individuelle Gespräche am<br />
Rande der Fachtagung den Austausch<br />
konzeptioneller Lösungsansätze<br />
und innovativer, applikativer<br />
Ideen unter den Partnern sowie den<br />
Anwendern in Wirtschaft und<br />
Behörden. Eine Dokumentation der<br />
Fachtagung ist auch diesmal in den<br />
Proceedings des DGFZ e. V. (ISSN<br />
1430-0176) vorgesehen.<br />
Die Veranstaltung wendet sich<br />
somit an alle, die auf behördlicher<br />
und unternehmerischer Seite sowie<br />
in der Forschung und Entwicklung<br />
heute und künftig mit den Wirkungen<br />
des Aktiv- und Sanierungsbergbaus<br />
konfrontiert sind und über den<br />
aktuellen Stand der zu bewältigenden<br />
Aufgaben und ihre Lösungen<br />
fachkundige Informationen erstreben.<br />
Informationen und Anmeldung:<br />
Dresdner Grundwasserforschungszentrum<br />
e.V.,<br />
Dipl.-Ing. S. Raimann,<br />
Meraner Straße 10,<br />
D-01217 Dresden,<br />
Tel. (0351) 4050642,<br />
Fax (0351) 4050679<br />
20 Jahre Technische Regeln wassergefährdender<br />
Stoffe (TRwS)<br />
© DWA<br />
Tagung vom 18. bis 19. September 2013 in Kassel<br />
Um das Grund- und Oberflächenwasser<br />
vor Verunreinigungen<br />
zu schützen sind für Anlagen zum<br />
Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen im <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
und auf Verordnungsebene Rahmenbedingungen<br />
vorgegeben.<br />
Zur Ausfüllung dieser gesetzlichen<br />
Vorgaben werden von der<br />
DWA seit rund 20 Jahren Technische<br />
Regeln wassergefährdender Stoffe<br />
(TRwS) erarbeitet, die Konkretisierungen<br />
der gesetzlichen Vorgaben<br />
zur Ausführung, Betrieb und Überwachung<br />
von Anlagen zum<br />
Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen beinhalten.<br />
Im September 1993 wurden die<br />
Arbeiten zu den ersten TRwS aufgenommen.<br />
Nach 20 Jahren eine gute Gelegenheit,<br />
Resümee zu ziehen, Veränderungen<br />
in den rechtlichen und<br />
technischen Regelungen aufzuzeigen<br />
und einen Ausblick auf aktuelle<br />
Entwicklungen zu geben.<br />
Die Fachtagung richtet sich an<br />
Anlagenbetreiber, Behörden, Sachverständigenorganisationen,<br />
Fachbetriebe,<br />
Ingenieurbüros, die im<br />
Bereich des Gewässerschutzes nach<br />
§ 62 WHG tätig sind.<br />
Auf der Jubiläumsveranstaltung<br />
könnte Ihr Foto ausgestellt werden<br />
und gewinnen!<br />
Die DWA sucht Fotos von Anlagen<br />
zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen.<br />
Im Rahmen der Veranstaltung<br />
werden die drei besten Fotos prämiert.<br />
Nähere Informationen auf der<br />
Homepage der DWA.<br />
Kontakt:<br />
DWA Deutsche Vereinigung für<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
<strong>Abwasser</strong> und Abfall e. V., Doris Herweg,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-236, Fax (02242) 872-135,<br />
E-Mail: herweg@dwa.de, www.dwa.de<br />
Mai 2013<br />
572 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
NACHRICHTEN<br />
MSR-Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Mess-,<br />
Regel- und Steuerungstechnik in Hamburg-Schnelsen<br />
MEORGA veranstaltet am 5. Juni 2013 in Hamburg-Schnelsen eine regionale Spezialmesse<br />
für Prozessleitsysteme, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik<br />
Rund 140 Fachfirmen zeigen auf<br />
der Messe Geräte und Systeme,<br />
Engineering- und Serviceleistungen<br />
sowie neue Trends im Bereich der<br />
Automatisierung.<br />
Die Messe wendet sich an Fachleute<br />
und Entscheidungsträger, die<br />
in ihren Unternehmen für die Optimierung<br />
der Geschäfts- und Produktionsprozesse<br />
entlang der<br />
gesamten Wertschöpfungskette<br />
verantwortlich sind. Der Eintritt zur<br />
Messe und die Teilnahme an den<br />
Workshops sind für die Besucher<br />
kostenlos und sollen ihnen Informationen<br />
und interessante Gespräche<br />
ohne Hektik oder Zeitdruck ermöglichen.<br />
MEORGA organisiert seit mehreren<br />
Jahren mit großem Erfolg regionale<br />
Spezialmessen für die Mess-,<br />
Steuerungs-, Regelungs- und Automatisierungstechnik.<br />
Durch den<br />
wachsenden Kostendruck in den<br />
Unternehmen und die damit einhergehenden<br />
Restriktionen bei<br />
Dienstreisen finden lokale Messen –<br />
vor der Haustür – immer größeren<br />
Anklang und sind ein Gewinn für<br />
Aussteller wie für Besucher.<br />
Weitere Informationen:<br />
MEORGA GmbH,<br />
Sportplatzstraße 27,<br />
D-66809 Nalbach,<br />
Tel. (06838) 8960035,<br />
Fax (06838) 983292,<br />
E-Mail: info@meorga.de,<br />
www.meorga.de<br />
Die regionale Messe: Produkte, Systeme und Informationen<br />
vor der Haustür.<br />
E I N L A D U N G<br />
Mittwoch, 05. Juni 2013<br />
8:00 bis 16:00 Uhr<br />
MesseHalle<br />
Modering 1a<br />
22457 Hamburg-Schnelsen<br />
Führende Fachfirmen der Branche präsentieren ihre Geräte und Systeme und<br />
zeigen neue Trends im Bereich Automatisierung auf. Die Messe wendet sich an<br />
Fachleute und Entscheidungsträger die in ihren Unternehmen für die Automatisierung<br />
verantwortlich sind.<br />
Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an den Workshops ist für die<br />
Besucher kostenlos.<br />
Weitere Informationen finden Interessierte auf unserer Internetseite.<br />
Internet: www.meorga.de<br />
Email: info@meorga.de<br />
MEORGA GmbH<br />
Sportplatzstraße 27<br />
66809 Nalbach<br />
Tel. 06838 / 8960035<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> Fax <strong>Abwasser</strong> 06838 / 573 983292
NACHRICHTEN<br />
Veranstaltungen<br />
Reparatur und Renovierung:<br />
Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung<br />
Experten diskutieren passende Methoden für die Sanierung von Schächten,<br />
Anschlüssen und Anschlussleitungen<br />
Die Verbund IQ gGmbH veranstaltet am 26. September 2013 zum zwölften Mal die Nürnberger Kolloquien zur<br />
Kanalsanierung mit begleitender Hausmesse. Kernthema in diesem Jahr ist die Reparatur und Renovierung<br />
von Kanälen. Dabei werden nicht nur bewährte Methoden und Vorgehensweisen aus der Praxis vorgestellt,<br />
sondern auch die zu Grunde liegenden Regelwerke diskutiert.<br />
Reparatur und Renovierung stehen im Mittelpunkt<br />
der Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung 2013.<br />
Experten geben Auskunft über verschiedene Reparaturverfahren<br />
und deren Umsetzung.<br />
Aktuell gibt es für die Renovierung<br />
von Kanälen strukturierte<br />
Regelwerke wie die DIN<br />
18326, die Aufgaben und Pflichten<br />
von Planern beschreibt. Für Reparatursysteme<br />
hingegen gibt es noch<br />
keine anerkannten Regeln der Technik.<br />
Auf den Nürnberger Kolloquien<br />
zur Kanalsanierung 2013 greift<br />
Dipl.-Ing. Mario Heinlein, Projektleiter<br />
beim Stadtentwässerungsbetrieb<br />
Nürnberg, bestehende<br />
Regu larien auf. Dabei geht er auf<br />
allgemeine und zusätzliche technische<br />
Vertragsbedingungen ein, die<br />
in der Praxis angewendet werden.<br />
In mehreren Vorträgen erläutern<br />
anschließend weitere Experten<br />
Grundlagen, Materialien und Ausführungen<br />
von Reparaturverfahren<br />
für Schächte, Anschlüsse und<br />
Anschlussleitungen. Im Fokus stehen<br />
auch konkrete Beispiele aus der<br />
Praxis, die Umsetzung und Anwendungsgrenzen<br />
der einzelnen<br />
Methoden aufzeigen. Denn erst<br />
nach der genauen Schadensfeststellung<br />
und Analyse ist eine fundierte<br />
Entscheidung für ein Reparaturverfahren<br />
möglich.<br />
Ausschlaggebend sind hierbei<br />
nicht nur Schadensart und -häufigkeit,<br />
sondern auch die verwendeten<br />
Materialien und deren Beschaffenheit.<br />
Weitere Informationen:<br />
Verbund IQ gGmbH,<br />
Stefan Wolf,<br />
Tel. (0911) 424599-16,<br />
E-Mail: stefan.wolf@verbund-iq.de,<br />
www.kanalsanierung-weiterbildung.de<br />
Internationale Geothermie Industriemesse<br />
12. bis 14. November 2013 in Essen<br />
Die Geothermische Energie<br />
erlebt einen rasanten Aufschwung.<br />
Die Zeit ist reif für eine<br />
internationale Messe – die GEO-T<br />
Expo 2013. Sie wird Marktplatz der<br />
industriellen Geothermie und zu -<br />
gleich ein weltweiter Expertentreff.<br />
Eine Plattform für Aussteller aus<br />
unterschiedlichsten Bereichen wie<br />
Bohrgeräte, Pumpen und Kompressoren,<br />
Anlagen- und Kraftwerkstechnik,<br />
Exploration u.v.m. Ein An -<br />
ziehungspunkt für Fachbesucher<br />
aus aller Welt. Eine Chance für<br />
Neugeschäfte und Kooperationen,<br />
Know-how-Transfer und Networking.<br />
Ein Highlight der GEO-T Expo ist<br />
der DGK 2013, der renommierte<br />
Kongress des GtV-Bundesverbandes<br />
Geothermie mit hochkarätigen<br />
Referaten und Workshops.<br />
Für die kommenden 50 Jahre soll<br />
sich der Weltenergiebedarf verdreifachen,<br />
so wird prognostiziert. Das<br />
bedeutet eine dramatische Herausforderung,<br />
aber auch große Chancen<br />
für die Energiewirtschaft. Während<br />
die fossilen Energieträger<br />
sich unweigerlich erschöpfen und<br />
wegen ihres Treibhauseffekts immer<br />
kritischer gesehen werden, bieten<br />
die erneuerbaren Energien unerschöpfliche<br />
– und umweltfreundliche<br />
– Ressourcen.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.geotexpo.com<br />
Mai 2013<br />
574 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Leute<br />
NACHRICHTEN<br />
Trauer um Harald Huberth<br />
Das Süddeutsche Kunststoff-<br />
Zentrum (SKZ) trauert um seinen<br />
Geschäftsführer der Aus- und<br />
Weiterbildung Harald Huberth, der<br />
völlig unerwartet am 15. April verstorben<br />
ist.<br />
Der Name Harald Huberth steht<br />
wie kein anderer für die Entwicklung<br />
der Aus- und Weiterbildung<br />
des SKZ!<br />
Seinen Einstieg im SKZ Würzburg<br />
hatte der Diplom-Ingenieur im<br />
Juli 1982 als Dozent für die Lehrgänge<br />
Werkstoffkunde der Thermoplaste,<br />
später übernahm er die Leitung<br />
der Abteilung ‚Aus- und Weiterbildung‘,<br />
bevor er 2002 zum<br />
Geschäftsführer ernannt wurde.<br />
Durch seine zahlreichen internationalen<br />
Bildungsaktivitäten, u.a. in<br />
Afrika, China, Iran, Kanada, USA,<br />
Indonesien, Malaysia, Singapur,<br />
Kuwait, VAE, Russland und der Ukraine<br />
hat Harald Huberth die internationale<br />
Ausrichtung und Wahrnehmung<br />
des SKZ im Ausland maßgeblich<br />
geprägt. So entstand zum<br />
Beispiel 2010 in China ein eigener<br />
SKZ Standort mit dem Ziel, den Vertrieb<br />
der Prüfungs-, Zertifizierungsund<br />
Entwicklungsleistungen sowie<br />
die Aus- und Weiterbildungsangebote<br />
auch in Fernost zu etablieren.<br />
Das Angebot von Praxislehrgängen<br />
auf internationalem Boden und<br />
auch die Beteiligung an vielen internationalen<br />
Projekten haben das SKZ<br />
dank des unermüdlichen Einsatzes<br />
von Harald Huberth zu einem Global<br />
Player im Bereich der Kunststoffe<br />
weltweit gemacht. Mittlerweile<br />
werden bereits 15 % des<br />
Umsatzes in diesem Geschäftsbereich<br />
im Ausland erwirtschaftet,<br />
Tendenz steigend.<br />
Harald Huberth war permanent<br />
auf der Suche nach attraktiven Themenfeldern<br />
für die Aus- und Weiterbildung<br />
von Fachkräften der Branche.<br />
Zahlreiche Kontakte zu vielen<br />
Wirtschaftsunternehmen und seine<br />
Mitarbeit in unzähligen Gremien<br />
wie beispielsweise IHK, RBV, DVS<br />
und DVGW kamen ihm dabei<br />
bezüglich der Fokussierung relevanter<br />
Topics sehr zugute. Die stets<br />
sehr hohe Qualität der Fachtagungen,<br />
Seminare und Lehrgänge<br />
waren Garant für die seit geraumer<br />
Zeit hohe Schulungsteilnehmerzahl.<br />
In den letzten Jahren lag diese<br />
stets bei deutlich mehr als 10 000<br />
per anno.<br />
Das SKZ ist Harald Huberth zu<br />
großem Dank verpflichtet. Er hat<br />
seine ganze Schaffenskraft stets<br />
vollumfänglich in den Dienst des<br />
Unternehmens gestellt und mit großem<br />
fachlichen Können und hohem<br />
persönlichem Engagement die zu -<br />
rückliegende Modernisierung des<br />
SKZ, insbesondere die konsequente<br />
Weiterentwicklung der internationalen<br />
Ausrichtung und Wahrnehmung<br />
des Instituts entscheidend<br />
mitgeprägt.<br />
„Sein plötzlicher Tod bedeutet<br />
für uns im SKZ einen extrem<br />
schmerzlichen Verlust. Wir werden<br />
ihm stets ein ehrendes Gedenken<br />
bewahren. Unser ganzes Mitgefühl<br />
gilt seiner Frau und seiner Tochter“,<br />
äußert sich Institutsdirektor Prof.<br />
Martin Bastian bestürzt.<br />
Michael Riechel neuer DVGW-Vizepräsident<br />
Michael Riechel ist zum neuen<br />
Vizepräsidenten des DVGW<br />
Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches<br />
e. V. gewählt worden. Die<br />
Wahl erfolgte einstimmig durch den<br />
Vorstand des DVGW. Riechel folgt in<br />
diesem Amt Dr. Karl Roth nach, der<br />
dem DVGW seit Januar 2013 ehrenamtlich<br />
als Präsident vorsteht. Dem<br />
DVGW-Präsidium gehören außerdem<br />
wie bisher Dr. Jürgen Lenz als<br />
Vizepräsident Gas und Dr. Georg<br />
Grunwald als Vizepräsident <strong>Wasser</strong><br />
an.<br />
Michael Riechel ist seit 2006 Mitglied<br />
des Vorstands der Thüga<br />
Aktiengesellschaft. Seit 2011 ist er<br />
zusätzlich Geschäftsführer der<br />
Thüga Erneuerbare Energien GmbH<br />
& Co. KG. Bevor Riechel zur Thüga<br />
kam, bekleidete er führende Positionen<br />
in der technischen Leitung bei<br />
der Preussag und seit 1993 bei der<br />
E.ON Ruhrgas AG in Essen.<br />
Riechel gehört seit 2008 dem<br />
DVGW-Vorstand an. Davor engagierte<br />
er sich im DVGW-Lenkungskomitee<br />
Gasversorgung und im<br />
europäischen Normungsgremium<br />
CEN TC 234 Gasinfrastruktur.<br />
Der in Osterode am Harz geborene<br />
Riechel (Jahrgang 1961) hat<br />
sein Diplom der Ingenieurwissenschaften<br />
an der Technischen Universität<br />
Clausthal erworben.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 575
RECHT UND REGELWERK<br />
Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
W 651: Dosieranlagen für Pulveraktivkohle in der Trinkwasseraufbereitung, 4/2013<br />
Das neue Merkblatt W 651 gilt für<br />
den Aufbau und die Funktionsweise<br />
von Anlagen zur Herstellung<br />
und Dosierung von wässrigen Pulverkohlesuspensionen.<br />
Pulveraktivkohle wird in der<br />
Trinkwasseraufbereitung zur Ad -<br />
sorption von störenden <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffen<br />
verwendet. Sie kommt<br />
dabei in der Regel als wässrige Suspension<br />
zum Einsatz. Dem An -<br />
wender werden mit W 651 praxisbezogene<br />
Hinweise zur Auslegung,<br />
konstruktiven Gestaltung und zum<br />
Betrieb von Anlagen zur Herstellung<br />
und Dosierung wässriger Pulverkohlesuspensionen<br />
gegeben.<br />
Das Merkblatt behandelt im Detail<br />
den Aufbau und die Funktion der<br />
am häufigsten eingesetzten Anlagen.<br />
Wesentliche Inhalte sind hierbei:<br />
##<br />
Grundsätzliches zu den Eigenschaften<br />
von Pulveraktivkohle<br />
##<br />
Transport und Lagerung von<br />
Pulveraktivkohle, mit ausführlicher<br />
Betrachtung der Silotechnik<br />
##<br />
Herstellprozess von Aktivkohlesuspensionen<br />
##<br />
Dosieren von Suspensionen<br />
##<br />
Kompaktanlagen zur Dosierung<br />
##<br />
Betrieb und Instandhaltung von<br />
Anlagen<br />
W 623 wurde vom DVGW-<br />
Projektkreis „Maschinelle Einrichtungen<br />
in Aufbereitungsanlagen“<br />
im Technischen Komitee „Anlagentechnik“<br />
erarbeitet.<br />
Preis:<br />
€ 22,27 für Mitglieder;<br />
€ 29,69 € für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3,<br />
D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9191-40,<br />
Fax (0228) 9191-499,<br />
www.wvgw.de<br />
Regelwerk Gas/<strong>Wasser</strong><br />
GW 335-B4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und <strong>Wasser</strong>verteilung Teil B4:<br />
Metallene Formstücke mit mechanischen oder Steckmuffenverbindungen für die<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung – Anforderungen und Prüfungen, 4/2013<br />
Die Prüfgrundlage GW 335-B4<br />
gilt für metallene Formstücke<br />
mit mechanischen oder Steckmuffenverbindungen<br />
(auch Werkstoffübergangsverbinder)<br />
für Polyethylenrohre<br />
(SDR 11, SDR 17) gemäß<br />
DVGW GW 335-A2 (A), GW 335-A3<br />
(A) und DVGW VP 640 sowie PVC-<br />
Rohre gemäß DVGW GW 335-A1 (A)<br />
und DVGW VP 654 (PVC-O) für<br />
die <strong>Wasser</strong>verteilung nach DVGW<br />
W 400-1 (A) bis 16 bar und bis<br />
Außendurchmesser d ≤ 160 mm.<br />
Diese Prüfgrundlage wurde vom<br />
Projektkreis „Metallische Werkstoffe<br />
in <strong>Wasser</strong>versorgungssystemen“ im<br />
Technischen Komitee „Bauteile<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungssysteme“ erarbeitet.<br />
Sie kann als Grundlage für<br />
die Zertifizierung von metallenen<br />
Verbindern für die <strong>Wasser</strong>verteilung<br />
herangezogen werden.<br />
GW 335-B4 basiert auf den<br />
Anforderungen und Prüfungen von<br />
DIN EN 12842, wobei bei der Erarbeitung<br />
ebenfalls darauf geachtet<br />
wurde, dass die Anforderungen der<br />
DIN 8076 und ISO 14236 nicht<br />
unterschritten wurden.<br />
Diese Prüfgrundlage ersetzt teilweise<br />
(wasserseitig) die DVGW-Prüfgrundlage<br />
VP 600.<br />
Etwaige Einsprüche können bis<br />
zum 31. Juli 2013 per E-Mail:<br />
gies@dvgw.de an den DVGW ge -<br />
sendet werden.<br />
Preis:<br />
€ 17,27 € für Mitglieder;<br />
€ 23,03 € für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3,<br />
D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9191-40, Fax (0228) 9191-499,<br />
www.wvgw.de<br />
Mai 2013<br />
576 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
RECHT UND REGELWERK<br />
Sicherstellung der Trinkwasserhygiene in Gebäuden<br />
VDI/DVGW 6023: Hygiene in Trinkwasser-Installationen – Anforderungen an Planung,<br />
Ausführung, Betrieb und Instandhaltung, 4/2013<br />
Trinkwasserhygiene in Gebäuden<br />
hat einen großen Einfluss auf die<br />
Gesundheit der Bewohner. Jedes<br />
Jahr erkranken nach Schätzungen<br />
des Umweltbundesamts allein in<br />
Deutschland etwa 30 000 Menschen<br />
an einer Erkrankung, die durch Legionellen<br />
hervorgerufen wird. Infektionsquellen<br />
sind häufig Trinkwasser-Installationen,<br />
die falsch geplant,<br />
ausgeführt oder betrieben werden.<br />
Wie die Qualität des Trinkwassers bis<br />
hin zur letzten Entnahmestelle gesichert<br />
werden kann, zeigt die neue<br />
Richtlinie VDI/DVGW 6023.<br />
Entscheidend ist: <strong>Wasser</strong> muss<br />
fließen und die entsprechende Temperatur<br />
haben. Kaltes <strong>Wasser</strong> muss<br />
kalt, d.h. unter 25 °C bleiben, das<br />
Heißwassersystem darf nirgends<br />
kälter als 55 °C sein. Bei <strong>Wasser</strong>, das<br />
länger als 72 Stunden in einer Trinkwasser-Installation<br />
stagniert, kann<br />
nicht mehr von einem hygienisch<br />
einwandfreien Zustand ausgegangen<br />
werden. Schlimmer noch: Längere<br />
und wiederholte Stagnation in<br />
Leitungsteilen kann zu einer Verkeimung<br />
der gesamten Trinkwasser-<br />
Installation führen, die aufwendige<br />
Sanierungsmaßnahmen erforderlich<br />
macht. Eine Desinfektion einer<br />
einmal verkeimten Trinkwasser-Installation<br />
zeigt zumeist keinen nachhaltigen<br />
Erfolg, weil die Ursache der<br />
Verkeimung im Layout der Anlage<br />
oder im nicht bestimmungsgemäßen<br />
Betrieb zu suchen ist. Die Verantwortung<br />
trägt der Betreiber im<br />
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.<br />
Er muss seine Installation<br />
und deren Schwachstellen kennen<br />
und sicherstellen, dass keine Gefahr<br />
für die Nutzer entsteht.<br />
Die Bedeutung der Trinkwasser-<br />
Installation für gesundes Wohnen<br />
und Arbeiten verlangt eine Verständigung<br />
unter allen für Planung,<br />
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung<br />
verantwortlichen Partnern –<br />
vom Hersteller über den Groß- und<br />
Einzelhandel bis hin zum Fachhandwerker<br />
und vom Gebäudeeigner<br />
oder -vermieter bis hin zum individuellen<br />
Mieter. Damit alle Beteiligten<br />
die nötigen Kenntnisse haben,<br />
legt die Richtlinie VDI/DVGW 6023<br />
eine Schulung fest, in der zielgruppengerecht<br />
den Planern, Errichtern<br />
und Betreibern das Thema „Trinkwasserhygiene“<br />
nahe gebracht<br />
wird. Die Richtlinie gilt für alle Trinkwasser-Installationen<br />
auf Grundstücken<br />
und in Gebäuden sowie für<br />
ähnliche Anlagen, z. B. auf Schiffen<br />
und gibt Hinweise für die Planung,<br />
Errichtung, Inbetriebnahme, Nutzung,<br />
Betriebsweise und Instandhaltung<br />
aller Trinkwasser-Installationen.<br />
Die neue Richtlinie VDI/DVGW 6023 stellt die Trinkwasserhygiene<br />
in Gebäuden sicher. © VDI<br />
Preis:<br />
€ 122,70 für Mitglieder;<br />
€ 114,67 für Nichtmitglieder.<br />
Herausgeber:<br />
VDI/DVGW 6023 „Hygiene in Trinkwasser-<br />
Installationen; Anforderungen an Planung,<br />
Ausführung, Betrieb und Instandhaltung“ ist<br />
die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik<br />
(GBG) in Kooperation mit dem Deutschen<br />
Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches<br />
(DVGW).<br />
part of it! Be part of it! Be part of it! Be part of<br />
NETZWERK WISSEN<br />
Universitäten und Hochschulen stellen sich vor:<br />
Studiengänge und Studienorte rund ums <strong>Wasser</strong>fach<br />
im Porträt – in der technisch-wissenschaftlichen<br />
Fachzeitschrift <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Kontakt zur Redaktion:<br />
E-Mail: ziegler@ di-verlag.de<br />
EAZ Netzwerk 1.indd 1 3.9.2012 15:25:06<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 577
RECHT UND REGELWERK<br />
Ankündigung zur Fortschreibung des<br />
DVGW-Regelwerks<br />
Ankündigung zur Erarbeitung von Regelwerken gemäß GW 100<br />
##<br />
GW 335-A5 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme<br />
in der Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung; Anforderungen<br />
und Prüfungen – Teil A5:<br />
Mehrschichtige PE-Rohrleitungssysteme<br />
mit Verstärkungsschicht“<br />
##<br />
GW 335-A6 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme<br />
in der Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung; Anforderungen<br />
und Prüfungen – Teil A6: PA-<br />
Rohrleitungssysteme“<br />
##<br />
GW 326 „Fachmonteur von<br />
mechanischen Verbindern in<br />
unterirdischen Gas- und <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
aus PE – Lehr- und<br />
Prüfplan“<br />
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen<br />
an den DVGW: Josef- Wirmer-<br />
Straße 1–3, D-53123 Bonn, www.<br />
dvgw.de<br />
Aufruf zur Stellungnahme<br />
Entwurf Arbeitsblatt DWA-A 216: Energiecheck und Energieanalyse – Instrumente zur<br />
Energieoptimierung von <strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
Der weltweit steigende Energiebedarf,<br />
die Endlichkeit fossiler<br />
Ressourcen, steigende Energiekosten<br />
und die Sorge um die Auswirkungen<br />
auf das Klima erfordern<br />
einen deutlichen Wandel in der<br />
Energieversorgung und im Energieverbrauch<br />
– auch bei der <strong>Abwasser</strong>beseitigung.<br />
Die Bestrebungen zur<br />
Verbesserung der Energieeffizienz<br />
dürfen hierbei jedoch nicht dem<br />
eigentlichen Zweck der <strong>Abwasser</strong>beseitigung,<br />
das heißt der Ableitung<br />
und Reinigung mit dem Ziel des<br />
Gewässerschutzes, zuwiderlaufen.<br />
Der Gesamtstromverbrauch der<br />
rund 10 000 <strong>Abwasser</strong>behandlungsanlagen<br />
in Deutschland liegt bei<br />
4200 Gigawattstunden (GWh) pro<br />
Jahr. Die <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
zählt zu den größten Energieverbrauchern<br />
einer Kommune. Energieananlysen<br />
zeigen Potenziale zur<br />
Steigerung der Energieeffizienz auf.<br />
Angesichts der komplexen Verfahrensabläufe<br />
in der <strong>Abwasser</strong>beseitgung<br />
ist eine systematische<br />
Vorgehensweise und umfangreiches<br />
Fachwissen für die Energieoptimierung<br />
von <strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
erforderlich. Bisher gab es keine<br />
bundesweit einheitliche Methodik<br />
zur Einschätzung der Energieeffizienz<br />
von <strong>Abwasser</strong>anlagen. Mit dem<br />
Arbeitsblatt DWA-A 216 werden<br />
Energiecheck und Energieanalyse<br />
als Instrumente zur Energieoptimierung<br />
von <strong>Abwasser</strong>anlagen eingeführt<br />
und Anforderungen an die<br />
Ausführung formuliert.<br />
Das Arbeitsblatt bezieht sich auf<br />
Anlagen zur <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
und -ableitung. Die für Pumpwerke<br />
auf Kläranlagen vorgestellten An -<br />
sätze sind analog auf Pumpwerke<br />
im Bereich der <strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
an wendbar. Im Bereich der Regenwasser-<br />
und Mischwasserbehandlungsanlagen<br />
(zum Beispiel Retentionsbodenfilter<br />
etc.) existieren derzeit<br />
keine ausreichend systematisch<br />
erhobenen Betriebserfahrungen.<br />
Gleiches gilt für Druckluftspülung,<br />
pneumatische Förderung, Vakuumentwässerung<br />
und Druckleitungsnetze.<br />
Das Arbeitsblatt richtet sich an<br />
Planer, Betreiber und Fachbehörden<br />
und stellt eine praxisorientierte,<br />
wissenschaftlich fundierte Arbeitshilfe<br />
zur verfahrenstechnischen und<br />
energetischen Optimierung von<br />
<strong>Abwasser</strong>anlagen und eine einheitliche<br />
Methodik zur Verfügung.<br />
Frist zur Stellungsnahme<br />
Hinweise und Anregungen zu dieser Thematik<br />
nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle gern<br />
entgegen. Das Arbeitsblatt DWA-A 216 wird<br />
bis zum 15. Juli 2013 öffentlich zur Diskussion<br />
gestellt.<br />
Stellungnahmen schriftlich, nach Möglichkeit<br />
in digitaler Form, an:<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle,<br />
Dr. agr. Stefanie Budewig,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-144,<br />
Fax (02242) 872-184,<br />
E-Mail: budewig@dwa.de<br />
Digitale Vorlage für Stellungnahmen<br />
befindet sich unter:<br />
http://de.dwa.de/themen.html.3/3<br />
Information:<br />
April, 2013, 48 Seiten,<br />
ISBN 978-3-942964-87-6,<br />
Ladenpreis: 50 Euro,<br />
fördernde DWA-Mitglieder: 40 Euro<br />
Herausgeber und Vertrieb:<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
<strong>Abwasser</strong> und Abfall e. V.,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-333,<br />
Fax (02242) 872-100,<br />
E-Mail: info@dwa.de,<br />
DWA-Shop: www.dwa.de/shop<br />
Mai 2013<br />
578 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Die fachzeitschrift<br />
für Gasversorgung<br />
und Gaswirtschaft<br />
www.<strong>gwf</strong>-gas-erdgas.de<br />
Jetzt zwei Ausgaben gratis!<br />
Sichern Sie sich regelmäßig diese führende Publikation. Lassen Sie sich<br />
Antworten geben auf alle fragen zur Gewinnung, erzeugung, Verteilung<br />
und Verwendung von Gas und erdgas.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil r+S recht und Steuern im Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>fach.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
<strong>gwf</strong> Gas/Erdgas erscheint in der DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte zwei aktuelle Ausgaben des Fachmagazins <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> gratis lesen. Nur<br />
wenn ich überzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des zweiten Hefts schriftlich<br />
absage, bekomme ich <strong>gwf</strong> Gas/Erdgas für zunächst ein Jahr (10 Ausgaben)<br />
als Heft für € 350,- zzgl. Versand (Deutschland: € 30,- / Ausland: € 35,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 350,-<br />
als Heft + ePaper für € 485,- (Deutschland) / € 490,- (Ausland).<br />
Für Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 175,- zzgl. Versand (Deutschland: € 30,- / Ausland: € 35,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 175,-<br />
als Heft + ePaper für € 257,50 (Deutschland) / € 262,50 (Ausland) pro Jahr.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>gwf</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Telefon<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>gwf</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PAGWfW0113<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
40 Jahre „<strong>Wasser</strong>wärterfortbildung“ 1<br />
in Baden-Württemberg<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, kommunale <strong>Wasser</strong>versorgung, Fortbildung, Organisation, Qualifikation<br />
Frieder Haakh<br />
Um die <strong>Wasser</strong>versorgung der 1102 Gemeinden in<br />
Baden-Württemberg kümmern sich 1077 <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen.<br />
Die Struktur ist bürgernah,<br />
aber kleinteilig. Dies wirft die Frage auf, wie für das<br />
Personal in der <strong>Wasser</strong>versorgung flächendeckend<br />
die notwendige Qualifikation hergestellt und entsprechend<br />
dem technischen Fortschritt weiter entwickelt<br />
werden kann. Diese Anforderung ist keine Freiwilligkeitsleistung<br />
sondern Pflichtaufgabe der Kommunen.<br />
Sind Störfälle auf eine Nichteinhaltung dieser Vorgaben<br />
zurückzuführen, so stellt sich die Frage des<br />
Organisationsverschuldens des für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
verantwortlichen; i. d. R. ist das der Bürgermeister.<br />
So wird in der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai<br />
2001 explizit die Einhaltung des Technischen Regelwerkes<br />
eingefordert. Das DVGW-Arbeitsblatt W 1000<br />
definiert die Mindestanforderungen an die Organisation<br />
und die Qualifikation des mit der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
betrauten Personals einschließlich dessen Fortbildung.<br />
An dieser Stelle setzt die „<strong>Wasser</strong>wärterfortbildung“<br />
1 an. Sie ist seit nunmehr 40 Jahren ein<br />
bewährtes und kostengünstiges Qualifizierungs- und<br />
Fortbildungsinstrument mit breiter Trägerschaft und<br />
großer Akzeptanz.<br />
40 Years of “Water Attendant Training” in<br />
Baden-Württemberg<br />
The water supply to the 1,102 communities in<br />
Baden-Württemberg is looked after by 1,077 supply<br />
companies. The structure is close to the people but<br />
small-scale. This raises the question of how the necessary<br />
qualification for the water supply personnel<br />
can be created comprehensively and developed in<br />
line with technical progress. This requirement is not<br />
voluntary but rather a compulsory task for the local<br />
authorities. If incidents can be traced to noncompliance<br />
with these standards then the question is<br />
raised of organisational fault of the person responsible<br />
for the water supply; this is generally the mayor.<br />
As such, the drinking water ordinance of 21 st May<br />
2011 explicitly demands compliance with the technical<br />
regulations. DVGW (German gas and water industry<br />
association) worksheet W 1000 defines the minimum<br />
requirements of the organisation and the qualification<br />
of the personnel entrusted with the water<br />
supply, including the further training of the same.<br />
This is where the “water attendant training” applies,<br />
which has now been a tried and tested, cost-effective<br />
instrument of qualification and training for 40 years<br />
and has broad-based support as well as wide acceptance.<br />
1. Einleitung<br />
Die <strong>Wasser</strong>versorgung in Baden-Württemberg ist kommunal<br />
geprägt. Die 10,7 Mio. Einwohner in 1102<br />
Gemeinden werden durch 1077 Unternehmen mit<br />
Trinkwasser versorgt.<br />
Bei 987 Gemeinden mit 6,31 Mio. Einwohnern sind es<br />
Regie- und Eigenbetriebe. Davon arbeiten 563 im ländlichen<br />
Raum, 424 in Verdichtungsräumen. Überwiegend<br />
in Verdichtungsräumen (66 von 76) liefern <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
des privaten Sektors Trinkwasser<br />
an zusammen 4,2 Mio. Bürgerinnen und Bürger und<br />
1<br />
Im folgenden Beitrag werden die Begriffe „<strong>Wasser</strong>wärterfortbildung“<br />
und „Gemeinsame Fortbildung des Personals in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung“ in Baden-Württemberg synonym verwendet<br />
und mit WWFB abgekürzt.<br />
2<br />
Quelle: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 1/2011.<br />
32 Gemeinden (0,2 Mio. Einwohner) werden durch 14<br />
Zweckverbände versorgt (Bild 1).<br />
Die kleinteilige Struktur der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ergibt sich aus der Struktur der Gemeinden. Fast 4/5<br />
aller Gemeinden liegen im Bereich bis 10 000 Einwohner,<br />
über 50 % sogar im Bereich bis 5 000 Einwohner<br />
(vgl. Bild 2). Daraus ergibt sich aber auch eine gewisse<br />
Problemlage hinsichtlich einer gerichtsfesten Organisation<br />
und der notwendigen Qualitätssicherung, wie es<br />
für kleinere Einheiten typisch ist. Die kleineren <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
erfüllen ihre Aufgabe dennoch<br />
weitgehend ohne Beanstandungen; allerdings hat<br />
sich in den vergangenen Jahren der Druck auf diese<br />
Unternehmen durch neue Normen und Vorgaben,<br />
insbe sondere mit Inkrafttreten der novellierten Trinkwasserverordnung<br />
vom 21. Mai 2001 [2] spürbar erhöht.<br />
Hinzu kommt auch die Empfehlung der WHO, dass sich<br />
Mai 2013<br />
580 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Mio. Einwohner<br />
7,0<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
6,31<br />
4,2<br />
Anzahl WVU<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
424<br />
563<br />
Verdichtungsraum<br />
Ländlicher Raum<br />
Bild 1.<br />
Struktur der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
(Endverteilung)<br />
in Baden-<br />
Württemberg.<br />
Quelle:<br />
Statistisches<br />
Monatsheft Baden-<br />
Württemberg<br />
1/2011<br />
1,0<br />
200<br />
0,0<br />
Regie- und<br />
Eigenbetriebe<br />
Privater Sektor<br />
0,2<br />
Zweckverbände<br />
0<br />
Regie- und<br />
Eigenbetriebe<br />
66<br />
Privater Sektor<br />
32<br />
Zweckverbände<br />
gerade kleinere <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen auf<br />
der Basis eines „water safety plans („<strong>Wasser</strong>sicherheitskonzept“)<br />
überprüfen lassen sollten. Die WHO be -<br />
gründet dies damit, dass größere Unternehmen im<br />
Unterschied zu kleineren das notwendige Know-how<br />
und die Organisation meist aus eigener Kraft vorhalten<br />
können. In diesem Zusammenhang muss die Frage<br />
gestellt werden, was eine sichere <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ausmacht und was dies für die <strong>Wasser</strong>versorgung in<br />
Baden-Württemberg mit ihrer kleinteiligen Struktur<br />
bedeutet. Wesentliche Anhaltspunkte sind dem Bild 3<br />
zu entnehmen.<br />
2. Rechtsgrundlagen<br />
und Technisches Regelwerk<br />
Die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung bzw.<br />
die <strong>Wasser</strong>gewinnungsanlagen werden durch die Trinkwasserverordnung<br />
3 und das <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
geregelt (Bild 4). Die rechtliche Ermächtigungsgrundlage<br />
der Trinkwasserverordnung ist das Infektionsschutzgesetz,<br />
die fachliche Basis ist die EU-Trinkwasserrichtlinie.<br />
4 In der Trinkwasserverordnung wird direkt auf<br />
das Technische Regelwerk verwiesen („Wenn bei der<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung und der <strong>Wasser</strong>verteilung min-<br />
3<br />
„Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370), die durch Artikel 2<br />
Absatz 19 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044)<br />
geändert worden ist“; Stand: Neugefasst durch Bek. v.<br />
28.11.2011 I 2370; Geändert durch Art. 2 Abs. 19 G v. 22.12.2011<br />
I 3044; http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/<br />
trinkwv_2001/gesamt.pdf; Die Zweite Verordnung zur Änderung<br />
der Trinkwasserverordnung ist am 13. Oktober 2012 veröffentlicht<br />
worden und am 14. Dezember 2012 in Kraft getreten.<br />
4<br />
RICHTLINIE 98/83/EG DES RATES vom 3. November 1998 über<br />
die Qualität von <strong>Wasser</strong> für den menschlichen Gebrauch<br />
Anzahl<br />
[ 1 ]<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
191<br />
17,2<br />
400<br />
53,2<br />
77,4<br />
269<br />
< 2.000 2.000–5.000 5.000–<br />
10.000<br />
91,1<br />
152<br />
10.000–<br />
20.000<br />
97,9 99,2 100,0<br />
76<br />
20.000–<br />
50.000<br />
14 9<br />
50.000–<br />
100.000<br />
100.000 und<br />
mehr<br />
Bild 2. Gemeindegrößenklassen in Baden-Württemberg 2004.<br />
Quelle: Statistisches Landesamt<br />
##<br />
zuverlässige Technik<br />
##<br />
sichere Organisation<br />
##<br />
qualifiziertes Personal<br />
Bild 3. Was macht eine sichere <strong>Wasser</strong>versorgung aus?<br />
Summe<br />
[ % ]<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
##<br />
ausreichende Redundanz<br />
##<br />
Anpassungsfähigkeit<br />
##<br />
Schutz der Ressourcen<br />
##<br />
vollständige<br />
Dokumentation<br />
##<br />
nachhaltiger Betrieb und<br />
Finanzierungen<br />
##<br />
sichere Rechtsgrundlage<br />
0<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 581
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
destens die anerkannten Regeln der Technik eingehalten<br />
werden…“). Damit ist das Referenzniveau vorgegeben<br />
und de jure ist das Technische Regelwerk als<br />
„antizipiertes Sachverständigengutachten“ [Reinhardt,<br />
2012] anzusehen 5 (vgl. lat., anticipare, dt. vorwegnehmen).<br />
Damit wird auch klar: Wenn ein Störfall auftritt<br />
und das Technische Regelwerk nicht eingehalten wurde,<br />
ist der Weg zum Nachweis eines Organisationsverschuldens<br />
nicht mehr weit bzw. der Nachweis einer sicheren<br />
Organisation wird steinig.<br />
Der Kernpunkt liegt in den Anforderungen an die<br />
Technische Führungskraft des <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmens<br />
gemäß 6.2 des W 1000 bzw. der Tabelle<br />
im Anhang 1 (Bild 5). Das W 1000 führt hierzu Folgendes<br />
aus:<br />
Bild 4. Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, WHG und<br />
Technisches Regelwerk.<br />
Trinkwasserversorgungsunternehmen<br />
nur Verteilung, ohne eigene<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Verteilung mit eigener<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung, jedoch<br />
ohne <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Verteilung mit eigener<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und<br />
einfacher <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Verteilung mit eigener<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und mehrstufiger<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Jahreswasserabgabe in 10 3 m 3 /a<br />
Ver- und<br />
Entsorger<br />
0 200 400 600 800 1000<br />
Anlagenmechaniker<br />
Industriemeister<br />
<strong>Wasser</strong>meister/<br />
Techniker<br />
Ingenieur<br />
Bild 5. DVGW-Arbeitsblatt W 1000 (2005) –<br />
Anforderungen an die Ausbildung der Technischen Führungskraft<br />
des Trinkwasser versorgers.<br />
6.2.2 Qualifikation<br />
Die technische Führungskraft muss über die erforderlichen<br />
Fachkenntnisse verfügen. Bezüglich der Anforderungen<br />
an die Ausbildung der technischen Führungskraft<br />
des Trinkwasserversorgers gilt Anhang A.<br />
Die technische Führungskraft muss über eine qualifizierte,<br />
in der Regel dreijährige Berufserfahrung in<br />
verantwortlicher Position bei einem Trinkwasserversorger<br />
oder einem vergleichbaren Unternehmen<br />
verfügen.<br />
Die technische Führungskraft muss über die für<br />
ihre Funktion erforderlichen Kenntnisse der gesetzlichen<br />
und behördlichen Vorschriften, der einschlägigen<br />
Unfallverhütungsvorschriften sowie der allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere<br />
der technischen Regeln des DVGW, verfügen, die für<br />
Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen zu beachten sind.<br />
6.2.3 Fort- und Weiterbildung<br />
Die technische Führungskraft muss sich für die von<br />
ihr wahrzunehmenden Fachaufgaben fort- bzw. weiterbilden.<br />
Die Maßnahmen sind zu dokumentieren.<br />
Neben der Technischen Führungskraft gelten<br />
entsprechende Vorgaben auch für das Technische<br />
Fachpersonal.<br />
6.3.3 Fort-, Weiterbildung und Unterweisung<br />
Das technische Fachpersonal muss sich durch Fort-,<br />
Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen im<br />
Bereich der von ihm wahrzunehmenden Fachaufgaben<br />
weiterbilden. Dies ist zu dokumentieren. Die<br />
technische Führungskraft hat das Notwendige zu<br />
veranlassen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter entsprechend<br />
ihrem Aufgabengebiet über den jeweils<br />
5 Michael Reinhardt (Trier): Die Regeln der Technik im <strong>Wasser</strong>recht<br />
– Staatliche und private Standardsetzung in Zeiten des Wandels;<br />
KA Korrespondenz <strong>Abwasser</strong>, Abfall · 2012 (59) . Nr. 7<br />
Mai 2013<br />
582 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
gül tigen Stand der für sie relevanten Rechtsvorschriften,<br />
Unfallverhütungsvorschriften, technischen<br />
Regeln und unternehmensinternen Anweisungen<br />
informiert bzw. unterwiesen werden und auf diese<br />
Unterlagen jederzeit zugreifen können.<br />
Relevante Fachveröffentlichungen müssen nutzbar<br />
sein. Dies gilt insbesondere für den Bereich der<br />
Sicherung der Trinkwasserqualität, der Arbeitssicherheit,<br />
der Notfallvorsorge und des Umweltschutzes.<br />
Bei Unterweisungen sind die Fristen aus den<br />
vorgenannten Regelungen und gesetzlichen Vorschriften<br />
einzuhalten.<br />
Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und<br />
unverzüglichen Ablaufes von sicherheitsrelevanten,<br />
selten auftretenden Prozessen sind Übungen in<br />
zeitlich angemessenen Abständen erforderlich.<br />
Überlagerungsbereich = Basis für<br />
eine qualifizierte Berufsausübung<br />
Stand der Technik<br />
→ Fortbildung<br />
Basis<br />
→ Ausbildung<br />
Best Practice<br />
→ Erfahrung<br />
Bild 6. Das<br />
Zusammenwirken<br />
der<br />
Erst „Wissensbausteine“.<br />
Erst von<br />
das richtige<br />
Zusammenwirken<br />
Fortbildung, das richtige Erfahrun<br />
Ausbildung Zusammenwirken<br />
<strong>Wasser</strong>versorg<br />
von<br />
garantier<br />
sichere<br />
Fortbildung,<br />
Er fahrung und<br />
Ausbildung<br />
garantiert eine<br />
sicherer<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
Damit ist der Rahmen umrissen, der hinsichtlich Qualifikation<br />
und Weiterbildung einzuhalten ist. Anhand<br />
dieser Anforderungen wird deutlich, dass der Qualifikation<br />
des Personals und der Fortbildung eine Schlüsselrolle<br />
im Hinblick auf eine gerichtsfeste Organisation<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung zukommt. Durch die WWFB<br />
werden die Punkte „Sichere Organisation“ und „Qualifiziertes<br />
Personal“ (vgl. Bild 3) einer sicheren <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
abgedeckt.<br />
3. Das Zusammenspiel von Qualifikation,<br />
Erfahrung und Fortbildung<br />
Ganz allgemein folgt jede hochwertige berufliche<br />
Leistung aus dem Zusammentreffen von einer<br />
Grundqualifikation aus der Ausbildung, der angewandten<br />
„Best Practice“ aus dem Erfahrungsschatz (bzw.<br />
Erfahrungswissen) und zeitgemäßer Ausführung durch<br />
Wissen um den Stand der Technik. Letzteres ist das<br />
Ergebnis berufsbegleitender Schulungen (vgl. Bild 6).<br />
Über ein Berufsleben gesehen nimmt die Bedeutung<br />
der Erstqualifikation mit dem Grundlagenwissen ab. Die<br />
„Halbwertszeit“ von Wissen beträgt heute in vielen technischen<br />
Berufen nur noch 5–10 Jahre, d. h. alles, was<br />
nicht unmittelbare Grundlagen sind, verliert innerhalb<br />
der ersten 10 Berufsjahre 50 % seiner Bedeutung und ist<br />
überholt. Diese Lücke wird durch zwei Bausteine<br />
geschlossen: Erfahrung und Fortbildung. So nimmt die<br />
Berufserfahrung in den ersten Berufsjahren wesentlich<br />
stärker zu als anschließend. Allerdings kann der Zu -<br />
gewinn an Erfahrung nicht (immer) die Lücke zum An -<br />
forderungsniveau schließen, die sich aus dem abklingenden<br />
Basiswissen aus der Ausbildung und neuen<br />
Anforderungen durch Fortentwicklung des Standes der<br />
Technik ergibt (vgl. Bild 7). Diese Mechanik ist die Rechtfertigung<br />
für regelmäßige Schulungen! Die WWFB greift<br />
nun just diesen Punkt mit folgenden Ansätzen auf:<br />
##<br />
Wiederholung der wesentlichen Grundlagen<br />
##<br />
Aktuelle Themen aus der Fortentwicklung des<br />
Standes der Technik<br />
##<br />
Vermitteln von Erfahrungswissen durch praktische<br />
Übungen<br />
##<br />
Didaktische Aufbereitung für „Handwerker“<br />
##<br />
Schulung in regelmäßigen Abständen (jährlich)<br />
Hinzu kommen Randbedingungen, die sich aus dem<br />
Umfeld ergeben. So muss die WWFB entsprechend der<br />
kleinteiligen Struktur flächendeckend angeboten<br />
werden, was einen hohen Organisationsaufwand erfordert.<br />
Um überhaupt auf Akzeptanz bei den Entscheidungsträgern,<br />
i. d. R. sind das die Bürgermeister oder<br />
Kämmerer, zu stoßen, muss sie kostengünstig sein. Zur<br />
Quadratur dieses Kreises hat entscheidend das nachfolgend<br />
dar gestellte Organisationsmodell beigetragen.<br />
4. Struktur der „<strong>Wasser</strong>wärterfortbildung“<br />
in Baden-Württemberg<br />
In Baden-Württemberg wurde der Fortbildung des<br />
Personals in der <strong>Wasser</strong>versorgung seit jeher große<br />
Bedeutung zugemessen. Bereits 1974 wurden die bis<br />
dahin schon regelmäßig durchgeführten Schulungen<br />
im Rahmen der WWFB institutionalisiert. Seit 1979 werden<br />
die Veranstaltungen jährlich durchgeführt. Die<br />
„<strong>Wasser</strong>wärterfortbildung Baden Württemberg“ stellt<br />
sich die Aufgabe, das Betriebspersonal der <strong>Wasser</strong>werke,<br />
insbesondere der kleinen und mittleren Werke,<br />
fortzubilden. Sie steht allen <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
in Baden-Württemberg offen, unabhängig von<br />
ihrer Größe, Unternehmensart oder Verbandszugehörigkeit.<br />
Sie ist unabhängig von Unternehmens- oder<br />
sonstigen Einzelinteressen und stellt ihr Angebot zu<br />
kostendeckenden Preisen ohne Gewinnerzielungsabsicht<br />
zur Verfügung.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 583
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 7.<br />
Die Bedeutung<br />
der Fortbildung<br />
im<br />
Zusammenwirken<br />
der<br />
Wissensbausteine.<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
Basiswissen [%]<br />
grundlegend,<br />
allgemein,<br />
theoretisch<br />
+<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
Summe Fortbildung [%]<br />
aktuell,<br />
für Spezialthemen<br />
kürzere Halbwertszeit,<br />
praxisorientiert<br />
+<br />
20<br />
20<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
+<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Erfahrung [%]<br />
aus der Tätigkeit<br />
erworben,<br />
praxisorientiert,<br />
individuell<br />
=<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Anforderungsniveau<br />
40<br />
40<br />
20<br />
20<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
Veranstalter<br />
= DVGW<br />
Kooperationspartner = VfEW, VKU,<br />
Gemeindetag, Städtetag<br />
Unterstützer = Landkreistag, Umweltministerium,<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsverwaltung, Ministerium für<br />
Ländlichen Raum u. Verbraucherschutz<br />
entsenden Mitglieder<br />
entsenden Mitglieder im Gaststatus<br />
Rückkopplung<br />
Anregungen<br />
Schulungsunterlagen<br />
Lehrer-/Sprechertagung<br />
-<br />
(ca. alle 2 Jahre)<br />
Sprecher<br />
Rückkopplung<br />
Beirat<br />
(Lenkungsgremium)<br />
gibt Themen/<br />
Fortbildungsinhalte<br />
zur Ausarbeitung vor<br />
Koordinationskreis<br />
Autoren und<br />
Referenten<br />
Lehrer<br />
informiert<br />
bieten Mitarbeit an<br />
Geschäftsführung<br />
(DVGW-Geschäftsstelle)<br />
Fachleute aus der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
unterstützt/organisiert<br />
Bild 8.<br />
Organisationsstruktur<br />
der<br />
WWFB in<br />
Baden-<br />
Württemberg.<br />
wählen (Rückkopplung)<br />
Schulungen<br />
durch Übungstage<br />
32 Nachbarschaften<br />
Schulungen<br />
durch Vortragstage<br />
Mai 2013<br />
584 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Die WWFB kann und will nicht fachspezifische oder<br />
unternehmensspezifische Schulungen, den Erfahrungsaustausch<br />
und Unterweisungen ersetzen. Sie arbeitet<br />
vielmehr mit den entsprechenden Einrichtungen der<br />
Kooperationspartner und anderer Bildungsträger<br />
zusammen, die durch ihr Angebot die Veranstaltungen<br />
der WWFB ergänzen.<br />
Dabei wurden die „<strong>Wasser</strong>wärterkurse“ als Anpassungsfortbildung<br />
mit dem Ziel eingeführt, das Wissen<br />
des Fachpersonals entsprechend dem Bedarf auszubauen<br />
und fortzuentwickeln und andererseits aktuelle<br />
Probleme der <strong>Wasser</strong>versorgung zu behandeln und aufzuarbeiten.<br />
Das Konzept ermöglicht es, dass bei regelmäßiger<br />
Teilnahme der „<strong>Wasser</strong>wärterkurse“ bei den<br />
Teilnehmern ein breit gefächertes Wissen auf dem<br />
Gebiet der <strong>Wasser</strong>versorgung aufgebaut werden kann.<br />
Dies gilt insbesondere für das Personal in der <strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
das bei Inkrafttreten des Arbeitsblattes W 1000<br />
nicht die darin geforderte Basisqualifikation nach weisen<br />
kann.<br />
Veranstalter ist der Deutsche Verein des Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>faches e.V. (DVGW), Landesgruppe Baden-Württemberg.<br />
Kooperationspartner sind:<br />
##<br />
Städtetag Baden-Württemberg (ST)<br />
##<br />
Gemeindetag Baden-Württemberg (GT)<br />
##<br />
Verband für Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Baden-Württemberg e.V. (VfEW)<br />
##<br />
Verband Kommunaler Unternehmen e.V.,<br />
Landesgruppe Baden-Württemberg (VKU)<br />
Unterstützer sind die <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverwaltung des<br />
Landes, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz,<br />
der Landkreistag sowie die Unternehmen<br />
und Kooperationen der <strong>Wasser</strong>versorgung in<br />
Baden-Württemberg. Diese bringen ihre Interessen<br />
durch ihre Vertreter in den Gremien der WWFB ein und<br />
beteiligen sich insbesondere mit dem Fachwissen ihrer<br />
Mitarbeiter an Inhalten, Gestaltung und Weiterentwicklung<br />
der Fortbildungsveranstaltungen.<br />
Der Beirat setzt sich aus Vertretern des Veranstalters,<br />
der Kooperationspartner und der Unterstützer zu -<br />
sammen. Dem Beirat obliegt die Beschlussfassung über<br />
wesentliche Fragen, insbesondere über Inhalte und<br />
Themen der WWFB sowie die Finanzierung einschließlich<br />
der Bewirtschaftung der Rücklagen. Die Schulungsinhalte<br />
werden vom Beirat, der sich aus Vertretern der<br />
o.g. Organisationen zusammensetzt, festgelegt und in<br />
einem Koordinierungskreis von Autoren und Referenten<br />
ausgearbeitet. Der Beirat ist damit das Beschlussgremium<br />
mit Richtlinienkompetenz für die WWFB. Der<br />
Beirat beschließt über die Themenvorschläge und gibt<br />
dem „Koordinierungskreis Autoren und Referenten“<br />
aktuelle branchenrelevante Themen zur inhaltlichen<br />
Ausarbeitung für die Fortbildungsveranstaltungen vor.<br />
Der Geschäftsstelle der DVGW-Landesgruppe Baden-<br />
Württemberg wurde 2010 von den Kooperationspartnern<br />
die Geschäftsführung der WWFB übertragen.<br />
Von dort werden die organisatorischen Arbeiten vorgenommen<br />
bzw. koordiniert. Das weitere operative<br />
Geschäft läuft im „Koordinationskreis der Autoren und<br />
Referenten“, der Lehrer-/Sprecher-Tagung und insbesondere<br />
in den Schulungsveranstaltungen der 32 Nachbarschaften<br />
(vgl. Bild 8). Die Geschäftsführung berichtet<br />
dem Beirat und den Kooperationspartnern über die<br />
organisatorische und wirtschaftliche Abwicklung mindestens<br />
einmal jährlich.<br />
In der WWFB besteht ein „Koordinierungskreis Autoren/<br />
Referenten“. Dem Kreis gehören Fachleute aus allen an<br />
der WWFB beteiligten und interessierten Organisationen<br />
an. Der Koordinierungskreis wird aus erfahrenen<br />
Fachleuten der <strong>Wasser</strong>wirtschaft gebildet und umfasst<br />
4–6 Mitwirkende. Er ist vom Beirat mit Zustimmung der<br />
Kooperationspartner zu benennen. Der Koordinierungskreis<br />
hat die zentrale Aufgabe der Meinungsbildung<br />
und Meinungsbündelung in fachlichen Fragen sowie<br />
der Themenfindung und -ausarbeitung für die Vortragsveranstaltungen.<br />
Themenvorschläge für die Vortragsveranstaltungen<br />
und die Nachbarschaftstage können<br />
vom Koordinierungskreis Autoren/Referenten, den<br />
Sprechern, Lehrern, den Beiräten oder anderen Beteiligten<br />
eingebracht werden. Zur Findung von Themen<br />
dient auch die Lehrer-/Sprecher-Tagung.<br />
Im Koordinierungskreis findet die inhaltliche Bearbeitung<br />
der Themen nach Beschluss und Vorgabe durch<br />
den Beirat statt. Mit dieser Aufgabe besitzt der Koordinierungskreis<br />
eine zentrale Aufgabe. Fachlich ist der<br />
Stand der Technik, der Normung sowie der Rechtsgrundlagen<br />
themenspezifisch zusammenzustellen. Es sind die<br />
(aktuelle) Fachliteratur, eigene Erfahrungen der Autoren/Referenten<br />
und evtl. die Tagespresse einzu beziehen.<br />
Die inhaltliche Themenbearbeitung bildet die fachliche<br />
Grundlage zur Erstellung der Schulungsunterlagen.<br />
Die abgestimmte inhaltliche Themenbearbeitung ist<br />
in zielgruppengerechtes und verständliches Schulungsmaterial<br />
umzusetzen. Schulungsmaterialien sind Präsentationen,<br />
Teilnehmerunterlagen der Vortragstage<br />
und Skripte für die Übungstage. Durch die Autoren und<br />
Referenten wird der Vortragstag abgehalten. Regionale<br />
Bezüge der Referenten zu den Nachbarschaften sind zu<br />
beachten.<br />
5. Was, wie und durch wen wird geschult?<br />
Fachlich ist der Stand der Technik, der Normung sowie<br />
der Rechtsgrundlagen themenspezifisch zusammenzustellen.<br />
Es sind die (aktuelle) Fachliteratur, eigene<br />
Erfahrungen der Autoren und Referenten und evtl. die<br />
Tagespresse einzubeziehen. Die inhaltliche Themenbearbeitung<br />
ist dem Koordinierungskreis zur Kenntnis<br />
zu geben und abzustimmen. Sie bildet die fachliche<br />
Grundlage zur Erstellung der Schulungsunterlagen.<br />
Grundsätzlich ist bei den Schulungen zu unterscheiden<br />
zwischen „Vortragstag“ und „Übungstag“.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 585
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Tabelle 1. Themen der Vortragstage der WWFB in den vergangenen Jahren.<br />
Vortrags-Nr. erstellt Thema<br />
Thema 22 Oktober 2012<br />
(exakte<br />
Überschriften<br />
müssen noch<br />
festgelegt werden)<br />
Behälter (Zustand, Reinigung, Lüftung, Bausubstanz, Objektschutz, Betrieb); <strong>Wasser</strong>schutzgewinnung und<br />
Schutzgebiete/Dokumentation, Archivierung, Planwerk, Rechte und Pflichten der <strong>Wasser</strong>wärter<br />
Thema 21 Oktober 2010 Desinfektion von <strong>Trinkwasserleitungen</strong>/Notversorgung/Energieeinsparung in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 20 Oktober 2008 Bereitstellung von Löschwasser/Betriebsdokumentationen/Elektrische Anlagen in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 19 Oktober 2006 Erstellung, Überwachung und Abnahme von Hausanschlussleitungen/<br />
Rehabilitationsstrategien gemäß Enwurf W 400-3 in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 18 Oktober 2004 Grundwasserbeeinflussung in Schutzgebieten/Behälter- und Rohrreinigung –<br />
Desinfektion/Ortsnetzspülungen und der Umgang mit den Abwässern in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 17 November 2002 Sicherung von <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen/ W 555 Nutzung von Dachablaufwasser/<br />
Trinkwasserverordnung<br />
Thema 16 Dezember 2000 Neue Gesetze und Verordnungen in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 15 Dezember 1998 Rohrleitungen und Armaturen in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 14 Dezember 1996 Reinigung und Desinfektion in <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
Thema 13 Dezember 1994 Betrieb, Steuerung, Überwachung von <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
Thema 12 Dezember 1996 Rohrleitungsbau, Rohrverlegung<br />
Thema 11 Dezember 1990 <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Thema 10 Dezember 1988 Schutz des Trinkwassers gegen Beeinflussung von außen<br />
Thema 9 Dezember 1986 Neue Gesetze und Verordnungen für unser Trinkwasser<br />
Thema 8 Dezember 1984 Wartung III – Rohrnetze<br />
Thema 7 Dezember 1982 Wartung II – Quellen, Brunnen, Schutzgebiete<br />
Thema 6 Dezember 1980 Hausinstallation aus der Sicht des <strong>Wasser</strong>werks<br />
Thema 5 Dezember 1978 Wartung I – Pumpen und Behälter<br />
Thema 4 Dezember 1976 Rohrmaterial<br />
Thema 3 Dezember 1974 <strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>qualität<br />
Thema 2 Januar 1973 Hauswasserzähler und Eichgesetz/ <strong>Wasser</strong>versorgung und Feuerwehrbelange/<br />
Leitungs- und Rohrbruchsuche<br />
Tabelle 2. Themen der Übungstage der WWFB in den vergangenen Jahren.<br />
Übungstag-<br />
Nr.<br />
erstellt<br />
Thema<br />
Thema 18 Oktober 2011 Praktische Anwendung: Pumpen-Kosten-Check/Standrohre und Desinfektion/<br />
Arbeitsschutz in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Thema 17 Oktober 2009 Löschwasserversorgung in der Praxis<br />
Thema 16 Oktober 2007 Netzleitungen – vom Schaden über die Instandsetzung bis zur Dokumentation<br />
Thema 15 Oktober 2005 Verantwortliche Tätigkeiten in der <strong>Wasser</strong>versorgung/Grundlagen des Arbeitsschutzes/<br />
Gefahrenpotenziale/Gefahrstoffverordnung sowie Informationen zur Einführung eines<br />
Benchmarking-Systems<br />
Thema 14 Oktober 2003 Rohwasseruntersuchung nach der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr (UVM) und der<br />
neuen Kooperationsvereinbarung<br />
Thema 13 Dezember 2011 <strong>Wasser</strong>vermessung/Zählung/Eichung/Stichprobenverfahren<br />
Thema 12 Dezember 1999 Rohrnetzarbeiten und Löschwasserversorgung<br />
Thema 11 Dezember 1997 Reinigung und Desinfektion im Störfall<br />
Thema 10 Dezember 1995 Betrieb und Betriebskontrolle<br />
Thema 9 Dezember 1993 Rohrverlegung – wichtige Nebensache<br />
Thema 8 Dezember 1991 <strong>Wasser</strong>versorgungssatzung, Regenwassernutzung<br />
Mai 2013<br />
586 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Während beim Vortragstag das theoretische Wissen vermittelt<br />
und über aktuelle Entwicklungen berichtet wird,<br />
stehen beim „Übungstag“ – wie der Name schon sagt –<br />
konkrete praktische Übungen, beispielsweise das<br />
Ansetzen von Desinfektionsmitteln oder die richtige<br />
Leckortung, im Vordergrund. Die Tabellen 1 und 2<br />
geben einen Überblick über die Themen der Vortragsund<br />
Übungstage der vergangen Jahre. Dabei wird der<br />
Vortragstag durch die Autoren und Referenten abgehalten,<br />
die Übungstage hingegen werden durch die<br />
Lehrer in den derzeitig 32 „Nachbarschaften“, welche<br />
überwiegend deckungsgleich mit den Landkreisen sind,<br />
abgehalten und organisatorisch durch die DVGW-<br />
Geschäftsstelle unterstützt.<br />
Die Benennung von Lehrern erfolgt auf Vorschlag<br />
des Koordinierungskreises „Autoren und Referenten“,<br />
der Kooperationspartner, der <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverwaltung<br />
des Landes sowie von <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
durch die DVGW-Landesgeschäftsstelle.<br />
Damit ist sichergestellt, dass nur erfahrene Personen<br />
berufen werden. Die Bestätigung von Lehrern erfolgt<br />
dann durch den Beirat.<br />
Weiterhin wird jede Nachbarschaft durch einen<br />
Sprecher repräsentiert. Der Lehrer einer Nachbarschaft<br />
nimmt am Vortragstag teil. Er hält die Kontakte zum<br />
Sprecher und den Teilnehmern. Darüber hinaus findet<br />
alle zwei Jahre eine „Lehrer-/Sprecher-Tagung“ statt.<br />
Lehrer und Sprecher vertreten dabei gemeinsam „ihre“<br />
Nachbarschaft und berichten über die Schulungsveranstaltungen,<br />
Exkursionen oder sonstige Ereignisse.<br />
Lehrer und Sprecher stimmen sich über die Berichte ab.<br />
Bild 9 gibt eine Übersicht zu den Kosten und Erlösen<br />
der WWFB, die ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeitet.<br />
6. Aktuelle Entwicklungen<br />
Seit dem Jahr 2007 bietet der GT-Service des Gemeindetags<br />
das „Betriebs- und Organisationshandbuch BOH“<br />
für kleine und mittlere <strong>Wasser</strong>versorgungsunter nehmen<br />
an. Im Gesamtpaket des BOH ist ein wichtiger Baustein<br />
die Vermeidung eines Organisationsverschuldens. Die<br />
hierfür erforderlichen Gesetze, Regelwerke und sonstigen<br />
formellen Unterlagen sind Bestandteil des BOH.<br />
Darüber hinaus bietet der DVGW jetzt auch das DVGW-<br />
Regelwerk für kleinere <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
an. Damit ist es allen <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
möglich, das BOH und das Regelwerk mit den<br />
für kleine <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen wichtigsten<br />
Arbeitsblättern kostengünstig zu erhalten. Damit<br />
können mögliche Lücken hinsichtlich eines Organisationsverschuldens<br />
geschlossen werden, denn die<br />
geforderte Einhaltung des Technischen Regelwerkes<br />
setzt trivialerweise voraus, dass das Technische Regelwerk<br />
dem mit der <strong>Wasser</strong>versorgung operativ betrauten<br />
Mitarbeiter(n) auch tatsächlich zur Verfügung steht.<br />
Zusammen mit der Teilnahme an der WWFB lassen<br />
sich damit die Anforderungen erfüllen, die eine sichere<br />
€ im Jahr<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
4.000<br />
8.000<br />
10.000<br />
10.000<br />
10.000<br />
20.000<br />
30.000<br />
36.000<br />
40.000<br />
Kosten<br />
168.000<br />
Ertrag<br />
und „gerichtsfeste“ Organisation der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
hinsichtlich des Personals einfordert.<br />
Die ungebrochen hohe Teilnehmerzahl (Bild 10)<br />
bestätigt, dass die grundsätzliche Ausrichtung der<br />
„Gemeinsamen Fortbildung des Personals in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung“ stimmt und dass damit verbandsübergreifend<br />
und landesweit die richtige Zielgruppe<br />
angesprochen werden kann. Unterstützend wirken hier<br />
auch die nach wie vor kostengünstigen Teilnahmegebühren<br />
von 140 Euro, die gerade zur Kostendeckung<br />
der Organisation ausreichen und deutlich unterhalb<br />
ansonsten marktüblicher Schulungsangebote mit vergleichbaren<br />
Inhalten und Qualitätsansprüchen liegen.<br />
Besonders erfreulich ist, dass es in den vergangenen<br />
Jahren gelungen ist, die Zahl der Gäste, insbesondere<br />
aus den Gesundheitsämtern, deutlich zu steigern. Dies<br />
schafft auf der Seite der Überwachungsbehörde das<br />
notwendige Praxisverständnis. Gleichzeitig ergibt sich<br />
Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Lehrer<br />
Lehrerbildung<br />
Sonstiges (Besprechungen / Sitzungen /<br />
Sonderdrucke)<br />
Porto, Kopier- und Druckkosten<br />
Aufwandsentsch. Referenten für Vortragstage<br />
Betriebsführung durch Geschäftsstelle DVGW<br />
Dienstleistung Organisation<br />
Saalmieten, Bewirtungen<br />
Vorbereitung Vortragstag, Ausarbeitung der<br />
Vorträge<br />
Bild 9. Gewinn- und Verlustrechnung der WWFB Baden-Württemberg<br />
(Wirtschaftsplan 2012/2013).<br />
1400<br />
Gäste (z.B.<br />
1232 1213 1181 1196 1208 1240 1233 1215 1239 1305<br />
1200 Gesundheitsämter …)<br />
1176<br />
1121<br />
<strong>Wasser</strong>wärter<br />
987<br />
1000<br />
969 959 933 905 919 887<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
60 61 53 52 53 62 74<br />
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Jahre<br />
Bild 10. Teilnehmerzahlen der WWFB in den Jahren 1993 – 2011 sowie<br />
Gäste der WWFB.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 587
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
der notwendige Kontakt zwischen Hygieneinspektoren<br />
und Amtsärzten zu den örtlichen <strong>Wasser</strong>meistern.<br />
Die kostengünstige Durchführung der WWFB ist nur<br />
möglich dank der Kooperation und Unterstützung<br />
durch die Kooperationspartner und Unterstützer, das<br />
ehrenamtliche Engagement im Beirat, die hervorragende<br />
Unterstützung durch die Autoren und Referenten<br />
und natürlich auch der Lehrer. Unter dem Kalkül der<br />
Wirtschaftlichkeit für kleinere <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
ist anzumerken, dass jeder Störfall in der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung ein Vielfaches der Schulungskosten<br />
der WWFB verursacht, beginnend bei zusätzlichen<br />
Analysekosten bis hin zu möglichen Regressansprüchen<br />
und dem Aufwand in der Verwaltung für das dann erforderliche<br />
Krisenmanagement.<br />
7. Zusammenfassung<br />
Die WWFB wird in Baden-Württemberg von den kommunalen<br />
Landesverbänden, den Landesministerien<br />
sowie vom DVGW, VKU und VfEW getragen bzw. unterstützt<br />
und sichert seit Jahrzehnten die notwendige und<br />
erforderliche Qualifikation des operativ tätigen Personals<br />
in der <strong>Wasser</strong>versorgung. Die hohe Beteiligungsquote<br />
zeigt zum einen, dass die Themen der als Anpassungsfortbildung<br />
ausgelegten Schulungen mit Vortrags-<br />
und Übungstagen den „Nerv“ treffen, zum<br />
anderen aber auch das Bewusstsein der für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Verantwortlichen, also in der Regel der<br />
Bürgermeister, dass eine sichere und „gerichtsfeste“<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung nur durch eine konsequente<br />
Schulung des Personals aufrecht zu erhalten ist. Dank<br />
der Gemeinnutzorientierung kann die WWFB eine hohe<br />
und praxisorientierte Schulungsqualität zu günstigen<br />
Fortbildungskosten anbieten. Die Vorteile der WWFB<br />
lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
##<br />
günstige Teilnahmegebühr<br />
##<br />
schlanke Organisation<br />
##<br />
breite Trägerschaft<br />
##<br />
frei von Einzelinteressen<br />
##<br />
Regelwerk für kleine <strong>Wasser</strong>versorger<br />
##<br />
Zugriff auf das Regelwerk in Nachbarschaften<br />
##<br />
flächendeckend durch 32 Nachbarschaften<br />
##<br />
Fortbildung in Theorie und Praxis<br />
##<br />
gleichzeitig Erfahrungsaustausch<br />
##<br />
Gesundheitsämter integriert<br />
Damit leistet die WWFB einen wichtigen Beitrag zur<br />
sicheren Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg<br />
und kann auf 40 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 22.01.2013<br />
Korrektur: 04.04.2013<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh<br />
E-Mail: Haakh.F@lw-online.de |<br />
Technischer Geschäftsführer beim<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung |<br />
Vorsitzender des Beirates der <strong>Wasser</strong>wärterfortbildung<br />
Baden-Württemberg |<br />
Schützenstraße 4 |<br />
D-70182 Stuttgart<br />
Parallelheft <strong>gwf</strong>-Gas | Erdgas<br />
Biogas / Gasbeschaffenheit<br />
In der Ausgabe 5/2013 lesen Sie u. a. fol gende Bei träge:<br />
Wolf/Scherello<br />
Messung der Methanemission an der Biogasanlage Einbeck mittels CHARM<br />
Feldhaus Zertifizierung von Biokraftstoffen nach der Biokraft-NachV –<br />
Ein alternativer Absatzmarkt für Biogas/Biomethan<br />
Mischner/Dornack/Seifert Netzanschlusskosten von Biogasanlagen, Teil 1<br />
Kaltenmaier/Endisch<br />
Kastner<br />
Steiner/Wolf/Mozgovoy/Vieth<br />
Das GASQUAL-Projekt – Ausweitung der Grenzen der Erdgasbeschaffenheit<br />
und Konsequenzen für den Betrieb Häuslicher Geräte im Bestand<br />
Weiterentwicklung der Prozessgaschromatographie<br />
Einfluss von <strong>Wasser</strong>stoff auf die Hochdruckfehlerkurve von Erdgaszählern<br />
Mai 2013<br />
588 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNG<br />
Buchbesprechung<br />
Chemistry of Ozone in Water and Wastewater<br />
Treatment – From Basic Principles to<br />
Applications<br />
Von Clemens von Sonntag and Urs von Gunten. IWA<br />
Publishing, London (2012), ISBN 978- 843-393-139<br />
(Hardback), Preis: £ 99,00, ISBN 978-178-040-0839<br />
(eBook), 302 Seiten.<br />
Seit ungefähr 100 Jahren ist die Ozonung verschiedener<br />
Wässer eine bekannte Aufbereitungstechnologie,<br />
angefangen mit der ersten Ozondesinfektionsanlage<br />
1906 in Nizza, Frankreich. Die Entdeckung von<br />
Ozon in der Chemie stammt aus dem Jahre 1839, als<br />
Schönbein darüber berichtete. Aufgrund des starken<br />
Geruchs nannte er es Ozon nach dem griechischen<br />
Word „Ozein“. Seitdem haben zahlreiche Forscher<br />
ihr ganzes Augenmerk auf die Reaktionsfähigkeit<br />
von Ozon in organischen Flüssigkeiten und im <strong>Wasser</strong><br />
gerichtet.<br />
Das neue Buch über die Chemie der Ozons in der<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung und der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
stammt von zwei herausragenden Forschern auf<br />
dem Gebiet des Ozons und der davon induzierten<br />
radikalischen Reaktionen im <strong>Wasser</strong>, Clemens von<br />
Sonntag (Deutschland) und Urs von Gunten<br />
(Schweiz). Beide Autoren haben Hunderte von<br />
exzellenten Artikeln in Fachzeitschriften veröffentlicht<br />
(sowohl zu Grundlagen wie zur praxisnahen<br />
Anwendung). Das neu verfasste Standardwerk widmet<br />
sich den chemischen Aspekten der Ozonung für<br />
die Aufbereitung von Trinkwasser und <strong>Abwasser</strong><br />
und deren anorganischen und organischen Inhaltsstoffen<br />
mit natürlicher und anthropogener Herkunft.<br />
Das Buch fasst die umfangreichen Forschungsergebnisse<br />
der Autoren und anderes detailliertes Wissen<br />
zusammen, einschließlich der Studien zur Reaktionskinetik<br />
und Reaktionstechnik ebenso wie zu<br />
den praktischen Aspekten der Ozonung in realen<br />
Anwendungsfällen.<br />
Die 14 Kapitel sind sehr gut gegliedert und beinhalten<br />
die Geschichte des Ozons, seine Eigenschaften,<br />
die komplexe Kinetik der Ozonreaktionen, die<br />
Desinfektion, die Toxikologie der Produkte und die<br />
Interpretation der Ozonung in Aufbereitungstechniken.<br />
Der größte Anteil befasst sich mit den Reaktionen<br />
verschiedener Klassen von organischen und<br />
anorganischen Substanzen. Da Ozon wichtige und<br />
bedeutende radikalische Reaktionen induziert bzw.<br />
dafür verwendet werden kann, beschäftigen sich<br />
die letzten zwei Kapitel mit freien Hydroxyl- und<br />
Peroxyl-Radikalen.<br />
Das Buch endet mit der umfangreichsten Literaturliste<br />
(ca. 900 Zitate) der ich je bei Oxidationsbüchern<br />
begegnet bin, und mit einem sehr guten und<br />
ausführlichen Indexverzeichnis auf 15 Seiten, das<br />
ich bereits zur erfolgreichen Suche nach Methoden,<br />
Reaktionen und Kinetikkonstanten benutzt habe.<br />
Der neuesten Forschung auf dem Gebiet der<br />
Ozonung von organischen Spurenstoffen (emerging<br />
pollutants genannt) im <strong>Wasser</strong> und häuslichem Ab -<br />
wasser wurde im Buch spezielle Aufmerksamkeit<br />
gewidmet. Es ist ja bekannt, dass Ozon und Hydroxyl-Radikale<br />
Spurenstoffe chemisch transformieren,<br />
aber zur Mineralisation kommt es in der Regel nicht,<br />
allenfalls bei sehr hohen Oxidationsmitteldosierungen.<br />
Deshalb müssen die Oxidationsprodukte mit<br />
Blick auf deren Eigenschaften und ihrer toxikologischer<br />
Bedeutung analysiert werden.<br />
Dieses Ozonbuch ist definitiv das neue Standardtextbuch<br />
für die kommenden Jahrzehnte, passend<br />
für Vorlesungen und für Forscher und Praktiker die<br />
an Ozon und ozon-basierten „Advanced Oxidation<br />
Processes“ (AOP) arbeiten. Die Fülle der Informationen<br />
ist überragend. Als ich es für verschiedene Fragen<br />
benutzte, fand ich immer eine Antwort in dem<br />
Buch. Jedoch sollte man schon ein gewisses chemisches<br />
Hintergrundwissen haben, um die detaillierten<br />
Reaktionswege und die kinetische Komplexität<br />
von Ozon zu verstehen. Martin Jekel, Berlin<br />
Bestellmöglichkeit online<br />
www.iwapublishing.com<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 589
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Zielnetzentwicklung eines städtischen<br />
Trinkwassernetzes<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Zielnetzplanung, Demografischer Wandel, <strong>Wasser</strong>bedarfsprognose,<br />
Rohrnetzmodell, Löschwasserberechnung<br />
Sebastian Cichowlas und Holger Oeltjebruns<br />
Bedingt durch lange Nutzungsdauern und überhöhte<br />
Bevölkerungs- und Bedarfsprognosen sind Trinkwassernetze<br />
aus heutiger Sicht häufig überdimensioniert.<br />
Insbesondere die Entwicklung in den neuen Bundesländern<br />
hat gezeigt, dass die sinkende Auslastung<br />
der Netze durch den demografischen Wandel, den<br />
rückläufigen spezifischen <strong>Wasser</strong>verbrauch sowie<br />
zum Teil durch umfangreiche Stadtumbaumaßnahmen<br />
verstärkt wird. Bei der EWE NETZ GmbH<br />
(Oldenburg) wurden im Rahmen einer Masterarbeit<br />
die Einflussfaktoren und Folgen für ein städtisches<br />
Trinkwassernetz untersucht. Auf Basis einer umfangreichen<br />
Recherche zu den Einflussfaktoren in den<br />
Kundengruppen wurde ein <strong>Wasser</strong>bedarfsszenario<br />
entwickelt, das in eine Rohrnetzberechnung eingeflossen<br />
ist, um die Auswirkungen auf die Netzauslastung<br />
zu untersuchen. Die Definition von betriebsrelevanten<br />
Randbedingungen gemäß DVGW-Regelwerk<br />
ermöglichte eine Bewertung der Simulationsergebnisse.<br />
Für die identifizierten Stagnationszonen<br />
ergaben sich betriebliche und bauliche Handlungsoptionen.<br />
Im Hinblick auf mögliche Probleme bei<br />
Durchmesseroptimierungen wurde auch eine Untersuchung<br />
der Löschwasserversorgung einbezogen.<br />
Target Network Development for an Urban Drinking<br />
Water Network<br />
Because of long pipe life expectancies and excessive<br />
population and water demand prognosis drinking<br />
water networks are overdesigned from the presentday<br />
perspective. Especially the development in the<br />
eastern states of Germany showed that decreasing<br />
network utilization is reinforced by demographic<br />
changes, decreasing specific water consumption and<br />
wide-ranging reconstruction works in urban areas.<br />
The EWE NETZ GmbH (Oldenburg) investigated the<br />
different factors with influence on water demand and<br />
specified the consequences for an urban pipe network.<br />
Based on a research of future demand trends in<br />
the consumer groups a water demand scenario was<br />
formulated and integrated in a pipe network analysis<br />
to show the long-term effects on the network utilization.<br />
The definition of hydraulic boundary conditions<br />
according to the technical rules of the DVGW enabled<br />
an evaluation of the simulation results. For the identified<br />
stagnation zones several options for construction<br />
and operation could be identified. Regarding to<br />
possible problems by diameter optimization the analysis<br />
of the provision of water for fire fighting was<br />
integrated.<br />
1. Einführung<br />
Die EWE NETZ GmbH (Oldenburg) betreibt in den Sparten<br />
Strom, Gas, <strong>Wasser</strong> und Telekommunikation ausgedehnte<br />
Versorgungsnetze zwischen Ems und Elbe sowie<br />
in Brandenburg, auf Rügen und Teilen Nord-Vorpommerns.<br />
Trinkwassernetze – z. T. als Betriebsführer –<br />
betreut das Unternehmen in Bremervörde, Cuxhaven,<br />
Oldenburg, Scheeßel und Varel (Bild 1, Tabelle 1).<br />
Tabelle 1.<br />
Stand: 31.12.2012<br />
EWE gesamt<br />
Versorgte Einwohner 280 000<br />
Anzahl <strong>Wasser</strong>werke 6<br />
Trinkwasserabgabe in Mio. m³/a 13 184<br />
Leitungsnetz ohne HA in km 1335<br />
Anzahl Hausanschlüsse 63 203<br />
Das Cuxhavener Trinkwassernetz ist mit rund 250 km<br />
Länge und zwei <strong>Wasser</strong>werken das zweitgrößte Versorgungssystem.<br />
Im Stadtzentrum finden sich stark vermaschte<br />
Netzbereiche, die bis in die ländlich geprägten<br />
Ortsteile in ein Verästelungsnetz übergehen (Bild 2). Im<br />
Jahr 2010 wurden in Cuxhaven 3,2 Mio. m³ Reinwasser<br />
aus den beiden <strong>Wasser</strong>werken in das Trinkwassernetz<br />
eingespeist.<br />
2. Struktur und Entwicklung<br />
des <strong>Wasser</strong>verbrauchs<br />
Seit 1990 ist ein Rückgang der geförderten <strong>Wasser</strong>menge<br />
zu beobachten. Alleine im Zeitraum von 1996<br />
bis 2009 sank die jährliche Abgabe um etwa 23 %. Basierend<br />
auf dieser Entwicklung stellte sich die Frage, welcher<br />
<strong>Wasser</strong>bedarf in den kommenden 20 Jahren zu<br />
erwarten ist und welche Maßnahmen im Bestandsnetz<br />
Mai 2013<br />
590 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
Bild 1.<br />
Lage der<br />
Versorgungsgebiete<br />
der<br />
EWE NETZ<br />
GmbH.<br />
Bild 2. Ausdehnung des Trinkwassernetzes der EWE NETZ GmbH in Cuxhaven.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 591
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
getroffen werden müssen, um auch zukünftig die<br />
hydraulischen Anforderungen an Trinkwassernetze zu<br />
erfüllen. Die Kundenstruktur bezogen auf die jährliche<br />
Abrechnungsmenge ist in Bild 3 verdeutlicht. In Cuxhaven<br />
entfallen 54,5 % der <strong>Wasser</strong>abgabe auf den Sektor<br />
Haushalte inkl. Kleingewerbe. Zum Vergleich macht<br />
dieser Sektor in einem benachbarten Versorgungsgebiet<br />
rund 66 % des gesamten <strong>Wasser</strong>bedarfes aus,<br />
während für Oldenburg ein Anteil von 74,4 % angegeben<br />
werden kann [1]. Weiterhin ist in Cuxhaven mit<br />
insgesamt 11,1 % die touristisch beeinflusste <strong>Wasser</strong>abgabe<br />
abzugrenzen, in der überwiegend eine haushaltsähnliche<br />
<strong>Wasser</strong> nutzung erfolgt. Die gewerbliche<br />
und industrielle <strong>Wasser</strong>nutzung hatte einen Anteil von<br />
23,8 % an der abgerechneten Jahresmenge 2009.<br />
Darunter entfällt mehr als die Hälfte auf die fischverarbeitende<br />
Industrie und den Fischfang. Es ergibt sich<br />
eine spezifische <strong>Wasser</strong>abgabe von 116 L/E · d, die mit<br />
dem Pro-Kopf-Verbrauch von 115,0 L/E · d in einem<br />
benachbarten Verbandsgebiet vergleichbar ist und<br />
unter dem bundesweiten Durchschnitt von 126,0 L/E · d<br />
liegt [2].<br />
3. Randbedingungen<br />
des <strong>Wasser</strong>bedarfsszenarios<br />
Als wichtigster Einflussfaktor wirkt sich in Cuxhaven<br />
eine prognostizierte rückläufige Bevölkerungsentwicklung<br />
auf die <strong>Wasser</strong>abgabe aus. In den verfügbaren<br />
Prognosen wird bis 2030 ein Bevölkerungsrückgang<br />
zwischen 13,5 und 24 % erwartet. Eine kleinräumige<br />
Prognose der Stadt Cuxhaven [3] geht von ortsteil -<br />
bezogenen Bevölkerungsrückgängen zwischen 18,6 bis<br />
25,5 % aus. Als Reaktion auf diese Prognosen wurde<br />
auf Basis eines Stadtentwicklungsprogramms ein<br />
Stad tumbau eingeleitet. Der Wohnungsbestand wird<br />
durch Wohnungszusammenlegungen, Umnutzungen<br />
und Abriss den rückläufigen Einwohnerzahlen angepasst.<br />
Infolge der abnehmenden Gesamtanzahl an<br />
Haushalten und eines steigenden Anteils der Ein- bis<br />
Bild 3. Prognostizierte Aufteilung der <strong>Wasser</strong>abgabe auf<br />
Kundengruppen im Vergleich zu 2009.<br />
Zweipersonenhaushalte geht die Effizienz der <strong>Wasser</strong>nutzung<br />
zurück [4]. Zu diesem Ergebnis kommen u. a.<br />
auch Unter suchungen für die Hamburger <strong>Wasser</strong>werke<br />
[5]. Für Cuxhaven wurde eine Erhöhung des derzeitigen<br />
Pro-Kopf-Verbrauches von 116 auf rund 133 L/E · d<br />
durch ineffizientere Ressourcennutzung ermittelt,<br />
indem die bestehenden Trends in den Einzelbestandteilen<br />
der spezifischen <strong>Wasser</strong>abgabe untersucht wurden.<br />
Gleichzeitig werden den Trends zufolge Einsparpotenziale<br />
in der Kundengruppe Haushalte inkl. Kleingewerbe<br />
wirksam. Viele der Einsparpotenziale sind<br />
immer dann auf andere Kundengruppen übertragbar,<br />
wenn die <strong>Wasser</strong>nutzung haushaltsbezogen erfolgt<br />
(z. B. Ferienwohnungen, Pflegeheime). In Anlehnung an<br />
vorhandene Untersuchungen zu Einspareffekten [4, 6]<br />
wurde zwischen konventioneller und moderner Technologie<br />
bei Erneuerung/Ersatz von Hausinstallation und<br />
-ausstattung differenziert, wodurch sich beim Ersatz<br />
vorhandener, älterer Technik durch moderne Technologien<br />
stärkere Einsparungen erzielen lassen. Ohne<br />
Berücksichtigung des verbrauchssteigernden Trends<br />
der kleineren Haushalte könnte sich der Pro-Kopf-Verbrauch<br />
von derzeit 116 auf 94 L/E · d bzw. 75 L/E · d<br />
verringern. Wird der Effekt der ineffizienteren <strong>Wasser</strong>nutzung<br />
in Singlehaushalten einbezogen, so kann sich<br />
bei Einsatz konventioneller Spartechnologien der derzeitige<br />
spezifische <strong>Wasser</strong>bedarf von 116 auf 107 L/E · d<br />
reduzieren, der mit dem Bestandswert von 105,8 L/E · d<br />
in Oldenburg vergleichbar ist. Unter Berücksichtigung<br />
moderner Spartechnologien könnte die spezifische<br />
<strong>Wasser</strong>abgabe sogar von 116 bis auf 88 L/E · d abfallen<br />
und somit den heutigen Wert von 89 L/E · d in Sachsen<br />
leicht unterschreiten [2]. Das prognostizierte Verbrauchsniveau<br />
in Cuxhaven erscheint vor dem Hintergrund<br />
der gegenwärtigen Pro-Kopf-Verbräuche in den<br />
neuen Bundesländern als realistisch. Ende der 90er-<br />
Jahre wurde ein Rückgang des spezifischen <strong>Wasser</strong>bedarfs<br />
auf 90 bis 100 L/E · d erwartet, wenn wassersparende<br />
Armaturen flächendeckend eingeführt sein<br />
werden [7]. Die Ergebnisse sprechen eher für eine<br />
gemäßigte Entwicklung der spezifischen <strong>Wasser</strong> abgabe,<br />
da bis heute die größten Einsparpotenziale bereits<br />
nahezu ausgeschöpft wurden [4]. Auch die neue EU-<br />
<strong>Wasser</strong>strategie [8] wird hieran in Deutschland wenig<br />
ändern.<br />
In der zweitgrößten Kundengruppe „Gewerbe und<br />
Industrie“ kann langfristig die Effizienz der <strong>Wasser</strong>nutzung<br />
durch Kreislaufführung, wassersparende oder<br />
indirekte Spülsysteme sowie Regenwassernutzung<br />
gesteigert werden. Es sind starke Aktivitäten bei Maßnahmen<br />
zur Verbesserung der <strong>Wasser</strong>effizienz zu beobachten.<br />
Für Cuxhaven wird in Anlehnung an [9] die<br />
Annahme getroffen, dass ein Rückgang von 20 bis 30 %<br />
bis zum Jahr 2020 eintreten wird, da unternehmensspezifische<br />
Angaben nicht verfügbar waren. Die Tourismusbranche<br />
hat an der Jahreswasserabgabe in Cuxhaven<br />
Mai 2013<br />
592 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
einen Anteil von rund 11 %. Der ermittelte <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
von 92 L/Übernachtung für Campingplätze ist<br />
vergleichbar mit Umfragen unter 466 europäischen<br />
Beherbergungsbetrieben [10], in denen ein Wert von<br />
96 L/ Übernachtung angegeben wird. Für Hotels ergibt<br />
sich in Cuxhaven ein spezifischer Verbrauchswert von<br />
269 L/Übernachtung und liegt über den Angaben in der<br />
VDI-Richtlinie 3807 [11], nach denen in Deutschland<br />
durchschnittliche Werte im Bereich von 235 bis 253 L/<br />
Übernachtung liegen. Der <strong>Wasser</strong>verbrauch von 110 L/<br />
Übernachtung in Ferienwohnungen ist mit dem spezifischen<br />
<strong>Wasser</strong>bedarf von 116 L/E · d für Cuxhavener<br />
Haushalte vergleichbar. Der Wert erscheint plausibel, da<br />
Ferienwohnungen ähnliche Ausstattungsmerkmale wie<br />
Privathaushalte vorweisen. Es ist davon auszugehen,<br />
dass in allen Beherbergungsbetrieben grundsätzlich<br />
ähnliche Einsparpotenziale wie in Privathaushalten<br />
realisierbar sind, da Trinkwasser für haushaltsähnliche<br />
Zwecke verwendet wird (Dusche, WC, Waschmaschinen,<br />
Küchen) [4].<br />
4. <strong>Wasser</strong>bedarfsszenario<br />
Auf Grundlage der identifizierten Einflussfaktoren<br />
wurde ein potenzielles <strong>Wasser</strong>bedarfsszenario für Cuxhaven<br />
formuliert. Verbrauchssenkende Einflüsse durch<br />
Änderung der Haushaltsgröße und -ausstattung wurden<br />
berücksichtigt. Dabei erfolgte eine Differenzierung<br />
zwischen unterschiedlichen Bebauungen, in denen<br />
aufgrund der Altersstruktur der Gebäude sowie der<br />
Nutzungsdauer von Sanitäranlagen sowohl konventionelle<br />
als auch moderne Spartechnologien wirksam<br />
werden könnten. Es ergab sich je nach Bebauungsstruktur<br />
und ggf. geplanter Stadtumbaumaßnahmen eine<br />
relative Abnahme des Pro-Kopf-Bedarfs von 7,8 bis<br />
24,1 %. Zusätzlich ist die Einwohnerentwicklung einbezogen<br />
worden, die auf der kleinräumigen Bevölkerungsprognose<br />
der Stadt Cuxhaven basiert [3]. Hierbei<br />
wurden in neun definierten Bebauungsgebieten je<br />
Ortsteil unterschiedliche Bevölkerungsentwicklungen<br />
prognostiziert. Zu den bedarfssteigernden Einflüssen<br />
zählen im Wesentlichen neue Wohn- und Gewerbeflächen,<br />
die in den derzeit ausgewiesenen Bebauungsplänen<br />
festgeschrieben sind. Über Bedarfswerte gemäß<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 410 [12] konnten diese Einflüsse<br />
berücksichtigt werden.<br />
Bild 3 veranschaulicht, welche Umverteilung der<br />
Jahreswasserabgabe auf die Kundengruppen eintreten<br />
kann. Insgesamt kann der <strong>Wasser</strong>bedarf dem Szenario<br />
zufolge bis 2030 um rund 19 % zurückgehen. Ein deutlicher<br />
Rückgang von fast 30 % würde in Privathaushalten<br />
eintreten. Damit verbunden kann der Anteil der<br />
Haushalte an der gesamten jährlichen <strong>Wasser</strong>abgabe<br />
von 54,5 % auf 47,8 % sinken. Durch vollständige Be -<br />
bauung ausgewiesener Gewerbeflächen und Ansiedlung<br />
neuer Industriebetriebe wird der gewerbliche<br />
<strong>Wasser</strong>bedarf um 9,2 % ansteigen. Gleichzeitig erhöht<br />
sich der gewerbliche Anteil an der jährlichen <strong>Wasser</strong>abgabe<br />
um 3,9 % auf 15,0 %. Veränderungen in übrigen<br />
Kundengruppen haben kaum Auswirkungen auf die<br />
prozentuale Aufteilung der Jahresabgabe.<br />
5. Anforderungen an ein Zielnetz<br />
Eine zentrale Anforderung und Kenngröße zur Auswertung<br />
der Ergebnisse aus der Rohrnetzberechnung<br />
liefert das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 [13]. Bei mittlerem<br />
Stundenbedarf in einem Trinkwassernetz soll die<br />
Mindestfließgeschwindigkeit einen Wert von v min =<br />
0,005 m/s nicht unterschreiten. Im Zusammenwirken<br />
mit einem fehlenden oder nicht regelmäßigen <strong>Wasser</strong>austausch<br />
kann durch Stagnation eine Wiederverkeimung,<br />
Trübung, Geschmacksbeeinträchtigung oder<br />
verstärkte Rostwasserbildung eintreten [14]. Im Zuge<br />
der Recherchen für die Masterarbeit konnten nur aus<br />
wenigen Quellen Angaben zu einer Mindestfließgeschwindigkeit<br />
herangezogen werden. Es findet sich<br />
weiterhin der Begriff der wirtschaftlichen Fließgeschwindigkeit,<br />
die in einem Bereich von 0,5 bis 1,5 m/s<br />
liegt [15, 16, 17]. Vor dem Hintergrund der Simulationsergebnisse<br />
mit berechneten durchschnittlichen Fließgeschwindigkeiten<br />
von 0,08 bis 0,14 m/s je nach<br />
Betriebszustand und Bedarfsszenario wurden diese<br />
Anhaltswerte nicht weiter einbezogen. Insbesondere<br />
bei Stichleitungen mit z. T. nur temporären Abnahmen<br />
ist eine (automatisierte) Optimierung auf eine wirtschaft<br />
liche Fließgeschwindigkeit hin nicht zielführend,<br />
da sich sehr kleine Rohrdurchmesser ergeben würden.<br />
Um eine weitergehende Differenzierung der Simulationsergebnisse<br />
zu ermöglichen, wurde die Grenzgeschwindigkeit<br />
festgesetzt, die sich am Übergang von<br />
laminarer zur turbulenten Strömung ergibt. Dieser ist<br />
über die kritische Reynoldszahl Re krit = 2320 beschrieben.<br />
1 Es ergeben sich vier Kategorien zur Bewertung der<br />
Fließgeschwindigkeit:<br />
##<br />
StagnationNichtv<br />
= 0 m/s --- einhaltung<br />
}<br />
##<br />
schlechte Strömungsbedingungen W 400-1<br />
v < 0,005 m/s Re < 2320<br />
##<br />
gute Strömungsbedingungen<br />
}<br />
v > 0,005 m/s Re < 2320 Einhaltung<br />
##<br />
optimale Strömungsbedingungen W 400-1<br />
v > 0,005 m/s Re > 2320<br />
Während für die Auswertung der Simulationsergebnisse<br />
dieses Bewertungsschema angewandt wurde, ist bei<br />
der Netzoptimierung ausschließlich die Mindestfließgeschwindigkeit<br />
von v min = 0,005 m/s als Bewertungskriterium<br />
verwendet worden.<br />
1 Tatsächlich handelt es sich um einen breiten Übergangsbereich,<br />
in dem der Wechsel von laminarer zur turbulenten Strömung<br />
erfolgt. Ein plötzlicher Umschlag der Strömungsverhältnisse<br />
erfolgt nicht.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 593
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Der Versorgungsdruck als weitere Anforderung soll<br />
an den Hausanschlussleitungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 400-1 je nach Gebäudehöhe zwischen 2 und<br />
3,4 bar betragen [13]. Das gesamte Rechenmodell<br />
wurde im ersten Schritt unabhängig von der Gebäudehöhe<br />
auf die Einhaltung eines Mindestversorgungsdrucks<br />
von 3,4 bar geprüft. Haben sich lokal geringere<br />
Drücke ergeben, so wurden Einzelfallprüfungen vorgenommen,<br />
um die Zulässigkeit des berechneten Wertes<br />
zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt anhand von Be -<br />
bauungsplänen bzw. durch Ermittlung der Gebäudehöhen<br />
über Schrägluftbilder.<br />
Neben den genannten Einzelanforderungen sind<br />
zwei bemessungsrelevante Betriebszustände (Bz 1 und<br />
Bz 2) gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 [18] und W 410<br />
voneinander abgegrenzt worden. Für die Dimensionierung<br />
des Rohrnetzes ist die Berechnung für den<br />
Spitzenlastfall (Bz 1) maßgebend [19]. Es handelt sich<br />
um den Tag mit dem größten Verbrauch Q d,max zu einer<br />
Spitzenstunde Q h,max ohne Löschwasserbedarf [20]. Für<br />
Haupt- und Versorgungsleitungen ist der Bemessungsdurchfluss<br />
für eine Stunde maßgebend, der nicht den<br />
meist kurzzeitig auftretenden Maximaldurchflüssen in<br />
einzelnen Leitungen entspricht. Von der Grundbelastung<br />
ausgehend (Bz 2) erfolgt die Beurteilung der<br />
Löschwasserversorgung. Es handelt sich um die maximale<br />
stündliche Abgabe Q h,max an einem Tag mit<br />
mittlerem Verbrauch Q d,m [18]. Somit wird nicht davon<br />
ausgegangen, dass die maximal auftretende Trinkwasserabgabe<br />
mit einem Löschwasserbedarfsfall<br />
zusammenfällt. Sollte dieser Fall doch eintreten, so<br />
müsste mit Einschränkungen in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
gerechnet werden.<br />
Nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 erfolgt der Nachweis<br />
einer ausreichenden Löschwasserversorgung für den<br />
Grundschutz in Abhängigkeit von der Bebauung und<br />
Brandgefährdung. Für die Zielnetzermittlung wird in<br />
Wohngebieten von einer mittleren Brandausbreitungsgefahr<br />
ausgegangen, so dass ein Löschwasserbedarf<br />
von 96 m³/h angesetzt wurde. In Gewerbe- und Industriegebieten<br />
ist der volle Bedarf von 192 m³/h zum<br />
Tragen gekommen. Der summierte Wert aller Entnahmemöglichkeiten<br />
im Löschbereich muss den angegebenen<br />
Mindestmengenwert zur Brandbekämpfung<br />
überschreiten. Geringere Werte in der Netzberechnung<br />
wurden ähnlich der Mindestversorgungsdrücke einer<br />
Einzelfallbetrachtung unterzogen. Unter der Voraussetzung,<br />
dass mehrere Hydranten gleichzeitig zur<br />
Brandbekämpfung eingesetzt werden, wurden die<br />
verfügbaren Grundschutzmengen aus max. zwei<br />
Hydranten im Radius von 300 m automatisch überprüft.<br />
Aufgrund begrenzter Schlauchlängen auf Feuerwehrfahrzeugen<br />
ist dieser Radius jedoch nicht praktikabel<br />
und ist auf 150 m reduziert worden [21]. Weiterhin soll<br />
der Versorgungsdruck bei Löschwasserentnahme mindestens<br />
1,5 bar an jedem Punkt des Netzes betragen<br />
[18]. Aufgrund des erforderlichen Pumpeneingangsdruckes<br />
bei Feuerlöschkreiselpumpen darf auch am<br />
Hydranten der Druck nicht unter 1,5 bar fallen [22].<br />
Bei der Ermittlung von Spitzenfaktoren ist zunächst<br />
ein bundesweites DVGW-Forschungsvorhaben aus den<br />
1980er-Jahren zum Lastverhalten verschiedener Kundengruppen<br />
zu nennen [23]. Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens<br />
sind in die Vorfassung der DVGW<br />
W 410 (1995) eingeflossen und werden in der Neufassung<br />
nur noch zum Teil aufgeführt. Zum Teil sind sie<br />
nicht mehr aktuell. In aktuellen Untersuchungen zur<br />
Dimensionierung von Hauswasserzählern [24] wurden<br />
empirische Formeln auf Grundlage der Untersuchungen<br />
aus den 1980er-Jahren mit aktuellen Vergleichsmessungen<br />
überarbeitet. Die gewonnenen Daten sind<br />
trotz ihrer Aktualität für diese Betrachtung nicht von<br />
Bedeutung, da sich die Messungen auf eine Bezugszeit<br />
von 5 min beziehen.<br />
Der Spitzenbedarf im Betriebszustand 1 (Bz 1) kann<br />
auch über einen Spitzenfaktor nach Gleichung (1) er -<br />
mittelt werden, der von der Einwohnerzahl abhängig ist<br />
[12]:<br />
f h,Bz 1 = 18,104 · E –0,1682 (1)<br />
Diese empirisch ermittelte Gleichung gilt für Versorgungsgebiete<br />
mit mehr als 1000 Einwohnern. Demnach<br />
bewegt sich der Spitzenfaktor f h,Bz1 bei einer Einwohnerzahl<br />
von 1000 bis 100 000 Personen in einem Wertebereich<br />
von etwa 5,6 bis 2,6, der durch die abnehmende<br />
Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Benutzung aller<br />
Trinkwasserinstallationen in größer werdenden Versorgungseinheiten<br />
begründet ist. Für das EWE-Versorgungsgebiet<br />
in Cuxhaven ergibt sich nach Gleichung (1)<br />
für 39 500 Einwohner ein Spitzenfaktor von f h,Bz1 = 3,05,<br />
der in der Simulation den Normverbräuchen für Haushalte<br />
zugeordnet wurde. Tatsächlich ergibt sich für das<br />
Jahr 2009 ein im <strong>Wasser</strong>werk gemessener maximaler<br />
Stundenwert von Q h,max = 1145 m³/h bei einer mittleren<br />
Abgabe Q h,m = 369 m³/h. Der Quotient ergibt einen<br />
Spitzenfaktor von f h,Bz1, 2009 = 3,10 und stimmt mit f h,Bz1<br />
in etwa überein. Hierbei sind jedoch Unterschiede in<br />
einzelnen Kundengruppen vernachlässigt, sodass für<br />
alle Großkunden mit einer Jahresabnahmemenge von<br />
Q a > 5000 m³/a stündliche Abgabespitzen ermittelt<br />
wurden. Weiterhin wurde für alle Beherbergungsbetriebe<br />
unter der Annahme ähnlicher Nutzungsmuster<br />
wie in Privathaushalten der Stundenspitzenfaktor f h,Bz1<br />
verwendet und über den Einfluss der starken saisonalen<br />
Abhängigkeit erweitert. Im Rohrnetzmodell wurde<br />
schließlich eine Spitzenabgabe von 1196 m³/h simuliert,<br />
die mit der im Jahr 2009 tatsächlich aufgetretenen Stundenspitze<br />
von 1145 m³/h in etwa übereinstimmte. Für<br />
den Bz 2 wurden die Spitzenfaktoren aus Bz 1 in Höhe<br />
des Tagesspitzenfaktors f d gemindert, um u. a. Aussagen<br />
über verfügbare Löschmengen an Hydranten zu ermög-<br />
Mai 2013<br />
594 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
lichen. Es ergab sich ein Wert von f h,Bz2 = 2,03, der mit<br />
Ergebnissen aus dem DVGW-Forschungsprogramm [23]<br />
vergleichbar ist.<br />
6. Ergebnisse für das Bestandsnetz<br />
Zunächst werden die Simulationsergebnisse für das<br />
Bestandsnetz bei gegenwärtigem und prognostiziertem<br />
<strong>Wasser</strong>bedarf verdeutlicht. Bezogen auf die<br />
Gesamtleitungslänge ist die Verteilung der Fließgeschwindigkeitsklassen<br />
in Bild 4 dargestellt. Im Bz 2 vergrößert<br />
sich bis 2030 die Leitungslänge mit v < 0,005 m/s<br />
um 11 % auf 45,1 km (in Rot und Orange markiert).<br />
Gemäß den formulierten Bewertungskriterien liegen im<br />
Jahr 2030 bei rund 81 % der Leitungslänge im Bz 2 gute<br />
bis optimale Strömungsbedingungen vor. Die mittlere<br />
Fließgeschwindigkeit sinkt um 16 % auf 0,077 m/s. Diesen<br />
Veränderungen steht ein prognostizierter <strong>Wasser</strong>bedarfsrückgang<br />
von 19 % gegenüber.<br />
Bei der Betrachtung der Stagnationsbereiche (Bild 5)<br />
fällt auf, dass häufig Stichleitungen zu Hydranten oder<br />
sonstigen Abnahmestellen verlegt wurden, an denen<br />
nur temporäre Abnahmen erfolgen. Nicht in jedem Fall<br />
lassen sich diese Situationen vermeiden, da z. B. im<br />
Hafengebiet die Schiffswasserabgabe über die Hy -<br />
dranten erfolgt. Hinzu kommen strandnahe, touristisch<br />
geprägte Einrichtungen, in denen überwiegend in den<br />
Sommermonaten Trinkwasser abgenommen wird. Gut<br />
durchströmte Netzbereiche finden sich erwartungsgemäß<br />
im Stadtzentrum sowie in Ortsteilen mit hoher<br />
Hausanschlussdichte und starker Vermaschung.<br />
Im Bestandsnetz kann sich infolge der geringeren<br />
Netzauslastung im Jahr 2030 eine Verbesserung der<br />
Druckverhältnisse einstellen. Für den Bz 1 mit heutigem<br />
<strong>Wasser</strong>bedarf im Bestandsnetz wurde ein minimaler<br />
Druck von 2,8 bar berechnet, der im Jahr 2030 rund<br />
3,1 bar beträgt.<br />
Es ergibt sich weiterhin eine geringe Steigerung der<br />
Entnahmemengen von durchschnittlich 1,96 m³/h je<br />
Hydrant infolge des zurückgehenden <strong>Wasser</strong>bedarfes.<br />
Für rund 500 von 10 400 Gebäuden in der Simulation ist<br />
nur ein Hydrant innerhalb des festgelegten Löschradius<br />
von 150 m auffindbar, der nicht die ausreichende Entnahmemenge<br />
liefert (Bild 6). Vereinzelt finden sich weit<br />
abgelegene Einzelgebäude (u. a. landwirtschaftliche<br />
Anwesen), für die eine Hydrantenentnahme im Brandfall<br />
nicht infrage kommt. Stellenweise ergibt sich auch in<br />
Gewerbegebieten ein unzureichender Grundschutz, in<br />
denen der Löschwasserbedarf von 192 m³/h nicht<br />
bereitsteht. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden,<br />
dass detaillierte Gebäudedaten nicht zur Verfügung<br />
standen, da gemäß Niedersächsischer Industriebaurichtlinie<br />
[25] je nach Brandabschnittsgröße und Art der<br />
selbsttätigen Löscheinrichtungen der Wert von 192 auf<br />
96 m³/h herabgesetzt werden kann. Weiterhin befand<br />
sich im Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit das<br />
Verzeichnis der Löschwasserentnahmestellen in der<br />
Bild 4. Aufteilung der Gesamtleitungslänge des Bestandsnetzes auf<br />
vier Fließgeschwindigkeitsklassen (Bz 1 und 2).<br />
Bild 5. Betriebszustand 1 – Bestandsnetz mit <strong>Wasser</strong>bedarf 2030<br />
(Einfärbung gemäß Bild 4, Punkte bilden Simulationsknoten mit<br />
p > 3,4 bar).<br />
Bild 6. Simulationsergebnis Löschmengenberechnung für Bz 2<br />
mit <strong>Wasser</strong>bedarf 2030 im Bestandsnetz. Quadrate – Gebäude:<br />
Rot – unzureichende Menge aus 1 Hydr./türkis – ausreichende<br />
Menge aus 1 Hydr. Dreiecke – Entnahmemengen: pink – über 192,<br />
blau – 96 bis 192, hellgrün – 48 bis 96 m³/h<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 595
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Stadt Cuxhaven in Überarbeitung und konnte somit<br />
nicht in die Betrachtung einbezogen werden.<br />
In stark vermaschten Netzbereichen ergeben sich<br />
kaum Probleme bei der Abdeckung des Grundschutzes.<br />
In der Netzperipherie ist aufgrund geringerer Rohrdimensionen<br />
und fehlender Vermaschung eine ausreichende<br />
Bereitstellung von Löschwasser nicht immer<br />
gewährleistet. Auf eine Einzelfallprüfung unter Einbezug<br />
aller alternativen Entnahmemöglichkeiten<br />
(Brunnen, Teiche, Flüsse, Schwimmbäder u. a.) sei erneut<br />
hingewiesen.<br />
7. Netzoptimierung und Auswirkungen<br />
Es kommen unterschiedliche Handlungsoptionen für<br />
die ermittelten Stagnationszonen in Betracht, die sich<br />
durch die Dauer ihrer Umsetzung und den damit verbundenen<br />
Aufwand unterscheiden. Betriebliche Maßnahmen<br />
sind grundsätzlich kurzfristig realisierbar. Dazu<br />
gehören Rohrnetzspülungen oder das gezielte<br />
Schließen von Absperrarmaturen, um Leitungen oder<br />
Teilbereiche des Netzes temporär außer Betrieb zu nehmen.<br />
Demgegenüber stehen alle baulichen Maßnahmen,<br />
die mittel- bis langfristig realisiert werden können.<br />
Hierzu gehören endgültige Außerbetriebnahmen (Stilllegung<br />
und Rückbau), Querschnittsreduzierungen,<br />
Überprüfung von Hydrantenstandorten sowie Auftrennung<br />
stark vermaschter Netzbereiche. Für Leitungen<br />
bzw. Teilnetze mit dauerhaft unzureichendem Durchfluss<br />
besteht z. B. die Möglichkeit einer nur temporären<br />
Bild 7. Beispiele für seitlich verschleppte Hydranten. Hydranten ohne<br />
Zwangsspülung.<br />
Bild 8. Durchgeführte Veränderungen am Bestandsnetz.<br />
Inbetriebnahme, wie sie von der EWE NETZ GmbH auf<br />
einem Veranstaltungsgelände in Oldenburg bereits<br />
praktiziert wird.<br />
In Anlehnung an die Ergebnisse der Rohrnetzberechnung<br />
sowie DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 müssen<br />
insbesondere Stichleitungen in Wohn- und Gewerbegebieten,<br />
seitlich verschleppte Hydranten (Bild 7) sowie<br />
großdimensionierte Leitungen infolge Löschwasserbereitstellung<br />
untersucht werden. Nach den DVGW-<br />
Arbeitsblättern W 400-1 und W 331 muss an einer<br />
Hydrantenstichleitung ein Hausanschluss folgen, um<br />
Verkeimungsquellen auszuschließen. Diese Anforderung<br />
wurde bei der Erarbeitung des optimierten Zielnetzes<br />
berücksichtigt. Stellenweise wurden Hydranten<br />
an durchgehende Leitungen verlegt, falls sich kein<br />
Hausanschluss in unmittelbarer Nähe befand.<br />
Bei der Verknüpfung der Zielnetzplanung mit einer<br />
Rehabilitationsstrategie stellt sich auch die Frage, ob es<br />
zweckmäßig ist, die vorhandenen Rohrleitungen in<br />
einem vermaschten Netz am Ende der Nutzungsdauer<br />
fortlaufend zu sanieren. An mehreren Stellen konnte für<br />
Cuxhaven über die Rohrnetzberechnung nachgewiesen<br />
werden, dass sich insbesondere in stark vermaschten<br />
Netzbereichen Stilllegungen positiv auf die Strömungsbedingungen<br />
auswirken. Im Vergleich zu anderen Zielnetzberechnungen<br />
mit automatischer Durchmesseroptimierung<br />
wurde in dieser Masterarbeit eine manuelle<br />
Optimierung durchgeführt, um zu verdeutlichen,<br />
mit welchem Aufwand eine Optimierung ausschließlich<br />
derjenigen Leitungen verbunden ist, die nicht die<br />
hy draulischen Randbedingungen erfüllen. Somit verbleiben<br />
Leitungen im Netz, die trotz Einhaltung der<br />
Bewertungskriterien zukünftig in einem verringerten<br />
Durchmesser verlegt werden könnten. Dabei wird die<br />
Optimierung durch die sich ergebenden Fließgeschwindigkeiten<br />
sowie daraus resultierenden Druckverluste<br />
begrenzt.<br />
Bild 8 verdeutlicht, welche Veränderungen im<br />
Bestandsnetz vorgenommen wurden. Durch bauliche<br />
Handlungsmöglichkeiten wurden Leitungen auf einer<br />
Länge von insgesamt 30,4 km optimiert. Durchmesserverkleinerungen<br />
erfolgten auf 21,1 km der Gesamtnetzlänge<br />
– vorwiegend in Stichleitungen. Auf 6,7 km Leitungslänge<br />
können betriebliche Maßnahmen zu einer<br />
Reduzierung der Stagnationszonen beitragen. Zusätzlich<br />
wurden 133 seitlich verschleppte Hydranten an eine<br />
durchgehende Leitung versetzt. Es fanden erneut Rohrnetzberechnungen<br />
statt, um die Wirksamkeit der Maßnahmen<br />
zu überprüfen (Bild 9). Ohne Netzanpassung<br />
erhöhte sich der Anteil der Leitungen, in denen im Bz 1<br />
Fließgeschwindigkeiten von weniger als 0,005 m/s auftraten,<br />
von 13,5 auf 14,7 % (linker und mittlerer Balken).<br />
Nach der Netzoptimierung sank dieser Anteil auf 3,4 %<br />
der Gesamtnetzlänge bei gleichzeitiger Stilllegung von<br />
6,8 % bzw. 16,5 km Rohrleitungen. Bei den schlecht<br />
durchströmten Anteilen handelt es sich meist um Stich-<br />
Mai 2013<br />
596 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
FACHBERICHTE<br />
leitungen, für die sich sehr geringe Durchmesser ergeben<br />
würden und die nicht über die vorgeschlagenen<br />
Optimierungsmaßnahmen verändert werden können.<br />
Durch die Durchmesseroptimierung auf den Trinkwasserbedarf<br />
erhöhte sich die Anzahl der Hydranten<br />
mit Entnahmemengen von weniger als 24 m³/h von<br />
zwei auf insgesamt 63 Stück. Die geringere Leistungsfähigkeit<br />
der Hydranten äußert sich ebenfalls in einem<br />
leicht verschlechterten Gebäude-Grundschutz, wenn<br />
die Ergebnisse auf den Gesamtbestand von<br />
10 400 Gebäuden bezogen werden (Bild 10). Im Zielnetz<br />
vergrößerte sich die Anzahl der Gebäude ohne<br />
Hydrant im Löschradius von 0,9 auf 1,7 %. Für 7,7 % bzw.<br />
802 Gebäude kann der Grundschutz im Zielnetz nicht<br />
über einen auffindbaren Hydranten im Umkreis abgedeckt<br />
werden. Es zeigte sich auch eine geringfügige<br />
Erhöhung der Hydrantenentnahmemengen, da bei<br />
mehr Gebäuden der Grundschutz über nur einen<br />
Hy dranten abgedeckt werden kann. Dieses ist auf die<br />
Verlagerung der Hydrantenstandorte sowie den <strong>Wasser</strong>bedarfsrückgang<br />
zurückzuführen. Es stellt sich jedoch<br />
im Zuge dieser Ergebnisse vor allem die Frage, ob in<br />
allen Wohngebieten von der hier angenommenen mittleren<br />
Brandausbreitungsgefahr ausgegangen werden<br />
muss, infolge dessen ein Löschwasserbedarf von<br />
96 m³/h angesetzt wurde.<br />
8. Fazit<br />
Als Untersuchungsergebnis ist in der Masterarbeit ein<br />
<strong>Wasser</strong>bedarfsrückgang bis 2030 in Höhe von rund 19 %<br />
prognostiziert worden. Bei Auswertung der Simulationen<br />
zeigte sich jedoch, dass eine geringere <strong>Wasser</strong>abgabe<br />
in dieser Größenordnung keine besonderen<br />
Auswirkungen auf die hydraulischen Bedingungen im<br />
Bestandsnetz hat. Fließgeschwindigkeiten und Mindestversorgungsdrücke<br />
ändern sich nur unwesentlich.<br />
Diese Ergebnisse stimmen mit Feststellungen im Jahr<br />
1996 [26] überein, wonach ein Verbrauchsrückgang von<br />
10 bis 20 % in der Fläche keine besonderen Auswirkungen<br />
auf Trinkwassernetze hat. Unabhängig davon sind<br />
jedoch im heutigen Bestandsnetz bereits Stagnationsbereiche<br />
vorhanden, für die Handlungsempfehlungen<br />
formuliert worden sind und in der Summe ein Zielnetz<br />
ergeben. Für die problematischen Netzbereiche konnten<br />
Handlungsoptionen dargestellt werden, die mit<br />
einer Optimierung von 15 % der Gesamtnetzlänge verbunden<br />
waren. Ungeachtet der Simulationsergebnisse<br />
im Bestandsnetz ergab sich im überwiegenden Teil des<br />
Versorgungssystems eine relativ geringe Beeinträchtigung<br />
der Löschwasserbereitstellung.<br />
Der zeitliche Ablauf des Netzumbaus (Migrationspfad)<br />
sollte aus einer risiko- und kostenorientierten<br />
Rehabilitationsplanung abgeleitet werden, da ein Netzumbau<br />
aus alleiniger Sicht der Zielnetzplanung weder<br />
sinnvoll noch wirtschaftlich realisierbar ist. Somit ist<br />
eine rechnergestützte Zielnetzplanung, die auf einem<br />
Bild 9. Aufteilung der Gesamtleitungslänge des Bestands- und<br />
Zielnetzes auf die Fließgeschwindigkeitsklassen (Bz 1).<br />
Bild 10. Vergleich der Überprüfung von geforderten Grundschutzmengen<br />
am Bestands- und Zielnetz.<br />
zukünftig zu erwartenden <strong>Wasser</strong>bedarf basiert, als<br />
Baustein eines integrierten und ganzheitlichen An -<br />
satzes zur strategischen Netzoptimierung zu sehen,<br />
wenn es im Zuge von Netzerneuerungen um die Frage<br />
nach den geeigneten Rohrdurchmessern geht, wodurch<br />
sich mitunter kostengünstigere Erneuerungsmethoden<br />
(grabenlose Sanierungsmethoden, z. B. Inliner) ergeben<br />
oder im Extremfall Leitungen stillgelegt werden k önnen.<br />
In Einzelfällen muss jedoch durch Netzberechnungen<br />
geprüft werden, ob ein geringerer Durchmesser gemäß<br />
der Zielnetzplanung schon heute zulässig ist oder eine<br />
teilweise Reduzierung erfolgen muss, da zum Rehabilitationszeitpunkt<br />
der <strong>Wasser</strong>bedarf mitunter noch auf<br />
einem höheren Niveau liegt als bei der Zielnetzentwicklung<br />
angenommen. Die Schwierigkeit der Umsetzungsphase<br />
besteht darin, dass die geografische Verteilung<br />
von Baumaßnahmen hauptsächlich durch Mit- oder<br />
Umverlegung infolge anderer Infrastrukturmaßnahmen<br />
oder Straßenerneuerungen bestimmt ist, wodurch mitunter<br />
von den grundsätzlichen strategischen (Rehabilitations-)Zielen<br />
des Netzbetreibers abgewichen wird.<br />
Eine Löschwasserbereitstellung vorwiegend oder<br />
ausschließlich aus Trinkwassernetzen ist angesichts des<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 597
FACHBERICHTE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
zurückgehenden <strong>Wasser</strong>bedarfs und kleinerer erforderlicher<br />
Rohrdurchmesser nicht angebracht. Außerhalb<br />
des Netzes kommen verstärkt unerschöpfliche Entnahmemöglichkeiten<br />
in Betracht. Weiterhin wird über bauliche<br />
Auflagen (z. B. Industriebaurichtlinien) eine Entlastung<br />
der Löschwasserbereitstellung geschaffen. Speziell<br />
in Hafengebieten kann über Saugrohre auch Seewasser<br />
zur Brandbekämpfung eingesetzt werden.<br />
Literatur<br />
[1] Stadt Oldenburg (Hrsg.): Statistik Verkehr und Versorgung –<br />
Energielieferungen nach Verbrauchern in der Stadt Oldenburg<br />
im Jahr 2009. Fachdienst Stadtinformation und Geodaten.<br />
Oldenburg, 2009.<br />
[2] BDEW (Hrsg.): 118. <strong>Wasser</strong>statistik Bundesrepublik Deutschland.<br />
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas- und <strong>Wasser</strong><br />
mbH, Bonn, 2008.<br />
[3] Stadt Cuxhaven (Hrsg.): Kleinräumige Bevölkerungsprognose<br />
2030 im Rahmen des Modellvorhabens Cuxhavener<br />
Wohnlotsen – Experimenteller Wohnungs- und Städtebau<br />
(ExWoSt). Forschungsprogramm des BMVBS. Cuxhaven,<br />
2009.<br />
[4] Herber, W., Roth, U. und Wagner, H.: Die <strong>Wasser</strong>bedarfsprognose<br />
als Grundlage für den Regionalen <strong>Wasser</strong>bedarfsnachweis<br />
der Hessenwasser GmbH & Co. KG. <strong>gwf</strong>-<br />
<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 149 (2008) Nr. 5, S. 426–434.<br />
[5] Institut für sozial-ökologische Forschung/Cooperative Infrastruktur<br />
und Umwelt (Hrsg.): Integrierte <strong>Wasser</strong>bedarfsprognosen<br />
in Metropolregionen – Grundlagen und Methodik.<br />
Frankfurt am Main/Darmstadt, 2007.<br />
[6] Hillenbrand, T., Londong, J., Otterpohl, R., Peters, I. und Tillman,<br />
D.: Vom Sinn des <strong>Wasser</strong>sparens. Korrespondenz <strong>Abwasser</strong>/<br />
Abfall 51 (2004) Nr. 12, S. 1381–1385.<br />
[7] Cichorowski, G. und Schreiber, K.: Trinkwasser-Einsparung in<br />
privaten Haushalten. Modellprojekt Frankfurt-Zeilsheim.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 139 (1998) Nr. 11, S. 714–718.<br />
[8] Communication from the Commission to the European<br />
Parliament, the Council, the European Economic and Social<br />
Committee and the Committee of the Regions (Hrsg.): A<br />
Blueprint to Safeguard Europe‘s Water Resources.<br />
COM(2012)0673.<br />
[9] Böhm, E. und Hillenbrand, T.: Entwicklungstrends des industriellen<br />
<strong>Wasser</strong>einsatzes in Deutschland. Korrespondenz<br />
<strong>Abwasser</strong>/Abfall 55 (2008) Nr. 8, S. 872–882.<br />
[10] Ecotrans e.V. (Hrsg.): Umweltleistungen europäischer Tourismusbetriebe<br />
– Instrumente, Kennzahlen und Praxisbeispiele.<br />
Saarbrücken, 2006.<br />
[11] VDI-Richtlinie 3807: <strong>Wasser</strong>verbrauchskennwerte für<br />
Gebäude und Grundstücke. Ausg. 07/2000. Beuth Verlag<br />
GmbH, Düsseldorf.<br />
[12] DVGW-Arbeitsblatt W 410: <strong>Wasser</strong>bedarf - Kennwerte und<br />
Einflussgrößen. Ausg. 12/2008. WVGW-Verlag, Bonn.<br />
[13] DVGW-Arbeitsblatt W 400-1: Technische Regeln <strong>Wasser</strong>verteilungsanlagen<br />
(TRWV) – Teil 1: Planung. Ausg. 10/2004.<br />
WVGW-Verlag, Bonn.<br />
[14] Korth, A., Richardt, S. und Wricke, B.: Optimierte Spülpläne für<br />
Trinkwassernetze. energie|wasser-praxis 61 (2010) Nr. 5,<br />
S. 66–67.<br />
[15] Grombach, P., Haberer, K., Merkl, G. und Trüeb, E.U .: Handbuch<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgungstechnik. 3. Aufl. Oldenbourg Industrieverlag<br />
München/Wien, 2000.<br />
[16] Merkl, G.: Technik der <strong>Wasser</strong>versorgung. Oldenbourg Industrieverlag<br />
München, 2008.<br />
[17] Mutschmann, J. und Stimmelmayr, F.: Taschenbuch der <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
14. Aufl. Vieweg Verlag Wiesbaden, 2007.<br />
[18] DVGW-Arbeitsblatt W 405: Bereitstellung von Löschwasser<br />
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung. Ausg. 02/2008.<br />
WVGW-Verlag, Bonn.<br />
[19] DVGW-Arbeitsblatt GW 303-1: Berechnung von Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>rohrnetzen. Teil 1: Hydraulische Grundlagen, Netzmodellierung<br />
und Berechnung. Ausg. 10/2006. WVGW-<br />
Verlag, Bonn.<br />
[20] König, D. T. und Wehr, R.: Was kostet die Löschwasserbereitstellung<br />
über das öffentliche Trinkwassernetz? energie|<br />
wasser-praxis 61 (2010) Nr. 5, S. 8–14.<br />
[21] Beilke, G. und Wiegleb, K.: Erfahrungen zur Löschwasserbereitstellung<br />
aus Trinkwassernetzen. <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
145 (2004) Nr. 6, S. 432–438.<br />
[22] Berliner Feuerwehr (Hrsg.): Löschwasserförderung. Ausbildungsunterlagen<br />
für den Maschinisten-Lehrgang. Berlin,<br />
2008.<br />
[23] DVGW (Hrsg.): Ermittlung des <strong>Wasser</strong>bedarfs als Planungsgrundlage<br />
zur Bemessung von <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
– Schlussbericht Wohngebäude - Band 1: Textteil. DVGW-<br />
Forschungsprogramm 02-WT-956. Eschborn, 1986.<br />
[24] Hofmann, G.: Berechnungsformeln für Hauswasserzähler in<br />
Wohngebäuden. energie|wasser-praxis 60 (2009) Nr. 6,<br />
S. 27–31.<br />
[25] Industriebaurichtlinie (IndBauRL): Richtlinie über den baulichen<br />
Brandschutz im Industriebau Niedersachsen vom<br />
29. Dezember 2003 (MBl. Nr. 2 vom 28.01.2004 S. 29).<br />
[26] Björnsen, G. und Roth, U.: Auswirkungen rückläufiger <strong>Wasser</strong>abgabe<br />
auf Planung und Betrieb von <strong>Wasser</strong>versorgungsnetzen.<br />
Neue DELIWA-Zeitschrift 47 (1996) Nr. 2, S. 42–47.<br />
Autoren<br />
Eingereicht: 22.01.2013<br />
Korrektur: 12.04.2013<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
M.Eng. Sebastian Cichowlas<br />
E-Mail: sebastian.cichowlas@ewe.de |<br />
Dipl.-Ing. Holger Oeltjebruns<br />
E-Mail: holger.oeltjebruns@ewe.de |<br />
EWE NETZ GmbH |<br />
Cloppenburger Straße 302 |<br />
D-26133 Oldenburg<br />
Mai 2013<br />
598 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNGEN<br />
Buchbesprechungen<br />
Planung – Bauteile, Apparate, Werkstoffe<br />
Kommentar zu DIN EN 806-2 und DIN 1988-200<br />
Herausgeber: DIN, ZVSHK. Von Franz-Josef Heinrichs,<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Klement und Bernd Rickmann.<br />
Berlin: Beuth Verlag GmbH. Ausgabedatum<br />
2012-07. 1. Auflage, 250 S., A4, Broschiert, Preis:<br />
€ 88,00, ISBN 978-3-410-23148-6. Auch erhältlich<br />
als: E-Book im Download: € 88,00, E-Kombi (Buch +<br />
E-Book): € 114,40.<br />
In der europäischen Grundlagennorm DIN EN 806-2<br />
in Verbindung mit der nationalen Ergänzungsnorm<br />
DIN 1988-200 werden die anerkannten Regeln der<br />
Technik für die Planung von Trinkwasser-Installationen<br />
definiert.<br />
Im vorliegenden Kommentar werden die Regelungen<br />
der beiden Normen thematisch zusammengefasst<br />
und abschnittsweise kommentiert.<br />
Damit wird dem Anwender das parallele Lesen in<br />
den sich ergänzenden Regelwerken erleichtert.<br />
Die neuen Planungsregeln berücksichtigen insbesondere<br />
die Anforderungen aus der Trinkwasserverordnung<br />
hinsichtlich der Sicherstellung der<br />
Trinkwasserqualität an den Entnahmestellen. Daraus<br />
ergeben sich Planungsziele für die Trinkwasser-<br />
Installation, die schärfer auf die Themen Werkstoffauswahl,<br />
Temperaturhaltung in <strong>Trinkwasserleitungen</strong><br />
kalt und warm, Vermeidung von Stagnation,<br />
Verbesserung der Durchströmung mit regelmäßigem<br />
<strong>Wasser</strong>austausch und Einhaltung des bestimmungsgemäßen<br />
Betriebs fokussiert werden.<br />
Damit bei der Trinkwassererwärmung sowohl<br />
energetische als auch hygienische Anforderungen<br />
erfüllt werden können, enthält DIN 1988-200 in<br />
Abhängigkeit von der Anlagengröße und der<br />
Systemtechnik spezifizierte Anforderungen.<br />
Die normativen Festlegungen werden durch ein<br />
Autorenteam aus Wissenschaft, Planung, Handwerk<br />
und Industrie ausführlich und praxisgerecht<br />
kommentiert.<br />
Bestell-Hotline<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
München<br />
Tel. +49 (0) 201/82002-11<br />
Fax +49 (0) 201/82002-34<br />
E-Mail: S.Spies@vulkan-verlag.de<br />
www.di-verlag.de<br />
<strong>Wasser</strong> – Grundlage des Lebens<br />
Hydrologie für eine Welt im Wandel<br />
Hrsg.: Gerhard Strigel; Anna-Dorothea Ebner von<br />
Eschenbach; Ulrich Barjenbruch. Stuttgart: Schweizerbart<br />
2010. 133 S., durchgehend farbige Abb.,<br />
geb., Preis: € 26,80, ISBN 978-3-510-65266-2.<br />
Ziel der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung ist die Bereitstellung<br />
von <strong>Wasser</strong>mengen in entsprechender Qualität,<br />
wie sie für die Bedürfnisse von Mensch und Natur<br />
benötigt werden. Die Bewirtschaftung soll nachhaltig<br />
sein, Umweltschäden müssen vermieden werden<br />
und sie soll auch Schutz vor dem <strong>Wasser</strong> gewähren.<br />
Dieses breite Aufgabenfeld verlangt differenzierte<br />
Ansätze, um die komplexen Zusammenhänge und<br />
Wechselwirkungen zu verstehen und nutzen zu<br />
können. Erkenntnisse aus den Geowissenschaften,<br />
Biologie, Ökologie, Gewässerchemie, Ingenieurhydrologie<br />
und der Arbeit der operationellen hydrologischen<br />
Dienste sind die Grundlage der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung.<br />
Das Buch zeigt von der technischen Entwicklung<br />
wesentlicher hydrologischer Messgeräte<br />
für die Erfassung der <strong>Wasser</strong>haushaltsgrößen über<br />
Bewirtschaftungsbeispiele bis zu den aktuellen<br />
Herausforderungen Facetten der Hydrologie im<br />
Zeitfenster der letzten 200 Jahre. Beginnend mit<br />
dem Ablesen von <strong>Wasser</strong>ständen hat sich die<br />
Hydrologie zu einer ganzheitlichen Wissenschaft<br />
vom <strong>Wasser</strong> entwickelt. Die Auswirkungen der<br />
Bewirtschaftung, des gesellschaftlichen Wandels,<br />
des Klimas und seiner Variabilität auf das <strong>Wasser</strong><br />
werden ebenso aufgezeigt wie die Ansätze zur<br />
Bewältigung des zunehmenden <strong>Wasser</strong>bedarfs für<br />
die Nahrungsmittelproduktion einer ständig wachsenden<br />
Weltbevölkerung.<br />
Allgemeinverständlich formuliert und mit zahlreichen<br />
Fotos illustriert richtet sich das Buch an alle<br />
Interessierten, die verstehen wollen, wie <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung,<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, <strong>Wasser</strong>straßen<br />
und Hochwasserschutz organisiert werden, um<br />
unserem täglichen Bedarf und Umgang mit dem<br />
<strong>Wasser</strong> zu entsprechen.<br />
Bestell-Hotline<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
München<br />
Tel. +49 (0) 201/82002-11<br />
Fax +49 (0) 201/82002-34<br />
E-Mail: S.Spies@vulkan-verlag.de<br />
www.di-verlag.de<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 599
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Entwurf einer Pilotanlage für<br />
die naturnahe (passive) Behandlung<br />
von sauren Bergwerkswässern<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung, Säure, saures Minenwasser, passive Behandlung, FPI (Faja Piritica Ibérica<br />
– Spanischer Pyrit-Gürtel im Südwesten Spaniens), DAS (Dispersed Alcaline Substrate) –<br />
disperses (verteiltes), alkalines Substrat<br />
Hans Sgier, José Miguel Nieto und Tobias S. Rötting<br />
Eines der drängendsten Probleme der Menschheit<br />
ist das Umwelt-Problem: Die Verschmutzung der<br />
Ge wässer, des Bodens und der Luft. Von diesen ist die<br />
Auswirkung durch die sauren Bergwerkswässer (im<br />
Folgenden: AMD genannt, wegen seiner Abkürzung<br />
aus dem Englischen – Acid Mine Drainage) eines der<br />
gravierendsten Probleme aufgrund ihres Umfangs,<br />
ihrer Eigenart und der Schwierigkeit ihrer Beseitigung<br />
wegen ihrer Komplexität.<br />
Ein Beispiel dafür sind die Umweltbelastungen in<br />
der spanischen „Faja Piritica Ibérica“ (FPI), (Spanischer<br />
Pyritgürtel), im Südwesten der Iberischen Halbinsel,<br />
welche eines der Gebiete mit den größten Lagerstätten<br />
an massiven Pyrit weltweit ist.<br />
Zur Lösung dieses Problems hat der folgende Artikel<br />
das Ziel, einen Beitrag zur Gestaltung einer passiven<br />
Reinigungsanlage für saure Bergwerkswässer<br />
(AMD) zu leisten.<br />
In dieser Arbeit entwickeln wir eine passive Reinigungsanlage<br />
mithilfe der DAS-Technologie (Dispersed<br />
Alkaline Substrate) in der aufgelassenen Mine<br />
Monte Romero, im Abbaugebiet Cueva de la Mora<br />
(Provinz Huelva), mit dem Ziel, den kontaminierten<br />
Bach Monte Romero, der in den Stausee Olivargas<br />
fließt, zu reinigen.<br />
Mit der DAS-Technik, einer neuen Methode der<br />
passiven Behandlung von sauren Bergwerkswässern,<br />
können wir erstmals das AMD der FPI mit hohen<br />
Konzentrationen von Schwermetallen und Sulfaten<br />
und sehr niedrigem pH- Wert behandeln.<br />
Design of a Pilot Plant for the Passive Treatment<br />
of Acid Mine Drainage<br />
One of the most pressing problems of mankind is the<br />
environmental problem: The pollution of water, soil<br />
and air. Of these, the effect of the acidic mine waters<br />
(Acid Mine Drainage, AMD) is one of the most serious<br />
problems because of its size, nature and the difficulty<br />
of their removal because of the complexity.<br />
One example is the pollution in the Spanish “Faja<br />
Pirítica Ibérica” (FPI), the Spanish Pyrite Belt, southwest<br />
of the Iberian Peninsula, which is one of the<br />
provinces with the world’s largest deposits of massive<br />
pyrite. In this paper we develop a passive treatment<br />
plant with the help of the DAS technology (Dispersed<br />
Alkaline Substrate), in the abandoned mine Monte<br />
Romero in the mining area of Cueva de la Mora (Province<br />
of Huelva), to decontaminate the Monte Romero<br />
creek that flows in the barrage of Olivargas.<br />
With the DAS technology, a new method of passive<br />
treatment of acidic mine waters, we can treat the first<br />
time that AMD of the FPI with high concentrations of<br />
heavy metals and sulphates, and very low pH.<br />
1. Einleitung<br />
AMD (Acid Mine Drainage) sind saure kontaminierte<br />
Bergwerkswässer, verursacht durch den Bergbau im<br />
Tagebau oder unterirdischen Bergwerken, in der Regel<br />
mit einem hohen Säuregehalt, reich an Sulfat und mit<br />
einem hohen Gehalt an Schwermetallen, vor allem<br />
Eisen, Zink und Aluminium. Aufgrund der hohen Menge<br />
an Eisenoxid, sind die Bergwerkswässer oft rötlich eingefärbt.<br />
Für die Behandlung von sauren Bergwerkswässern<br />
gibt es zwei Methoden:<br />
1. Die aktive Behandlung, sie besteht in der Anwendung<br />
von Methoden, die eine kontinuierliche<br />
Stromversorgung und die dosierte Zugabe von<br />
Mai 2013<br />
600 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
künstlichen Reagenzien zur Verbesserung der <strong>Wasser</strong>qualität<br />
benötigen. Obwohl wirksam, ist diese<br />
Methode sehr kostspielig wegen der verwendeten<br />
Reagenzien und aufwändiger Ausrüstungen.<br />
2. Die passive (naturnahe) Behandlung beinhaltet AMD-<br />
Behandlung in statischen Systemen (ohne Pumpen)<br />
mit natürlichen Materialien (Organische Materialien,<br />
Kalk, etc.). Passive Systeme funktio nieren, indem sie<br />
die Verbesserung der <strong>Wasser</strong>qua lität durch biogeochemische<br />
Reaktionen, ohne die Verwendung von<br />
synthetischen Reagenzien und ohne Anwendung<br />
externer Energie, erreichen. Dies ist eine wirtschaftliche<br />
Möglichkeit, diese Wässer zu reinigen.<br />
Die herkömmlichen passiven Behandlungs-Systeme wie<br />
offene Karbonatkanäle (OLD), anoxische Karbonatkanäle<br />
(ALD) und Reduktions- und Alkalitätproduktions-<br />
Systeme (RAPS) haben ihre Grenzen und sind anfällig<br />
gegenüber Störungen und passivieren sich (verlieren<br />
ihre Reaktivität), wenn sie zur Behandlung von Bergwerkswässern<br />
mit hoher Säure- und Metallbelastung<br />
der FPI verwendet werden.<br />
Um diese Probleme zu überwinden, wurde die<br />
Methode DAS (Dispersed Alkaline Substrat – verteiltes<br />
alkalischen Substrat) von Rötting et al. entwickelt [1].<br />
Das DAS besteht aus der Mischung eines alkalischen<br />
Reagenz, feinsandigem Kalkstein oder MgO (Magnesiumoxid)<br />
mit einem groben Stützgerüst (inerte Matrix)<br />
aus Hobelspänen.<br />
Das Reaktivmaterial ist feinkörnig und besitzt eine<br />
hohe Reaktionsfähigkeit und reduziert dadurch die Probleme<br />
der Passivierung. Die Hobelspäne haben eine<br />
hohe Durchlässigkeit infolge der großen Poren und führen<br />
zu einer Verringerung des Problems der Verstopfung.<br />
Mit dieser Technologie DAS wird eine Anlage zur<br />
passiven Reinigung von sauren Minenabwässern auf<br />
dem Gelände der aufgelassenen unterirdischen Mine<br />
Monte Romero entworfen. Dieses AMD kontaminiert<br />
den Bach Monte Romero, welcher in das Staubecken<br />
Olivargas fließt und damit dieses kontaminiert.<br />
Das saure zu behandelnde <strong>Wasser</strong> (AMD) ist gekennzeichnet<br />
durch einen niedrigen durchschnittlichen pH-<br />
Wert von 3,3, durchschnittliche Gehalte von 400 mg/L<br />
Fe, 395 mg/L Zn, 105 mg/L Al, 22 mg/L Mn, 3650 mg/L<br />
Sulfat (SO 4<br />
–2 ) und 0,1–1,5 mg/L Cu, Co, Ni, Cd, As und Pb.<br />
Der Gesamtsäuregehalt ist 2020 mg/L als CaCO 3 . Die<br />
durchschnittliche <strong>Wasser</strong>menge des AMD beträgt<br />
2 L/sec. Die Abmessungen der Reinigungsanlage sind<br />
so berechnet, dass die mehrwertigen Metalle Al, Fe, Cu<br />
zu nahezu 100 % entfernt werden. Basierend auf den<br />
Erfahrungen der bestehenden Forschungen, wird eine<br />
passive Reinigungsanlage in mehreren Stufen entworfen.<br />
1.2 Ortsbestimmung<br />
Die Mine Monte Romero befindet sich im Süd-Westen<br />
von Spanien in der Provinz Huelva. Die geographischen<br />
Bild 1. Lage von Cueva de la Mora in der Provinz Huelva und Bild des<br />
Stollenmundloches der Mine Monte Romero.<br />
Koordinaten sind 37° 46' N, 6° 48' O. Sie liegt in der Nähe<br />
des Dorfes Cueva de la Mora, auf einer Höhe von 280 m<br />
üNN und gehört zur Gemeinde Almonaster la Real. Die<br />
Entfernung von Huelva nach Cueva de la Mora beträgt<br />
90 km (Bild 1).<br />
2. Methodik<br />
Kriterien für die Gestaltung der passiven Kläranlage für<br />
die Mine Monte Romero sind:<br />
##<br />
die Topographie der Baustelle,<br />
##<br />
die Belastungswerte des AMD (Tabelle 1, 2. Zeile),<br />
##<br />
die Zuflussmenge von saurem <strong>Wasser</strong>,<br />
##<br />
die DAS-Technologie,<br />
##<br />
Erfahrungswerte der Pilotanlage der Mine<br />
Esperanza (FPI),<br />
##<br />
Auto CAD Land zum Darstellen und Modellieren<br />
des Baugeländes,<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 601
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
##<br />
Auto CAD für die Konstruktion der verschiedenen<br />
Bauteile der Anlage.<br />
Die Reinigung eines AMD in einer passiven Reinigungsanlage<br />
erfolgt in drei Schritten:<br />
1. Oxidation (konvertieren von Fe II in Fe III ),<br />
2. Erhöhung der Alkalinität, insbesondere durch<br />
Verwendung von Kalkstein (CaCO 3 ) oder<br />
Magnesiumoxid (MgO),<br />
3. Sedimentation.<br />
Oxidation ist die Basis, die Zeit und Geld spart in den<br />
meisten Reinigungssystemen. Die Oxidation wird traditionell<br />
in einer Kaskade durch Belüftung durchgeführt.<br />
Erhöhung des pH-Wertes. Der zweite Schritt der<br />
Behandlung erfolgt mittels Neutralisation, d.h. Erhöhung<br />
des pH-Wertes auf Werte zwischen 6,5 und 8,5. Bei<br />
niedrigem pH-Wert ist Eisen löslich und mobil. Die Oxidation<br />
von Fe II zu Fe III ist jedoch schneller bei höheren<br />
pH-Werten.<br />
Andere Metalle fällen auch schneller aus bei höheren<br />
pH-Werten.<br />
In dieser Arbeit verwenden wir Kalk-DAS. Mit dem<br />
Kalk-DAS werden die mehrwertigen Metalle entfernt,<br />
Fe, Al, Cu und andere. Für 2-wertige Metalle kann als<br />
Reagenz MgO verwendet werden, das den pH-Wert auf<br />
9–10 erhöht. In diesem Bereich haben die 2-wertigen<br />
Metalle eine geringe Löslichkeit. Siehe Bild 2, welches<br />
den pH-Wert für die Fällung von Metallionen (Fe, Al, Zn)<br />
anzeigt.<br />
Die Sedimentation erfolgt in Absetzbecken welche<br />
dem Reaktionsbecken mit Kalk-DAS nachgeschaltet<br />
sind.<br />
Zur Berechnung der Abmessungen einer passiven<br />
Reinigungsanlage mit DAS-Kalkstein für saure Minenabwässer<br />
(AMD) können wir die folgenden Methoden<br />
verwenden:<br />
Für die Berechnung der Dimensionen des DAS-Reaktionsbeckens<br />
mit vertikalem Durchfluss verwenden wir<br />
die Werte RA (Removal Rate), die Masse an Metallen, für<br />
jedes Metall, welche je m 2 der Oberfläche Q⋅( Ce<br />
− Cdes s)<br />
Reaktionsbeckens<br />
dem AMD entzogen wird, in g A· (m 2 · Tag)<br />
RA<br />
=<br />
–1<br />
R<br />
A<br />
Q⋅( Ce<br />
− Cs)<br />
=<br />
A<br />
(1.1) <br />
( )<br />
Q⋅ Ce<br />
− C<br />
A =<br />
R<br />
A = Q⋅Behandlungsfläche ( Ce<br />
− Cs)<br />
des Reaktionsbeckens<br />
A<br />
M<br />
QCT f<br />
= ⋅ ⋅ (m 2 )<br />
Q = durchschnittliche R<br />
Durchflussmenge<br />
⋅R<br />
6<br />
A<br />
10 ⋅ z (m 3 /Tag)<br />
R A = Entzugsmenge (g · (m 2 · Tag) –1 )<br />
CM<br />
QCT f<br />
⋅ ⋅ M<br />
e = Metallkonzentration ⋅R<br />
des AMD V<br />
6<br />
A<br />
= am Eingang<br />
10 (mg/L) ⋅ z (für jedes Metall extra)<br />
δ<br />
C s = Metallkonzentration des AMD<br />
M<br />
V<br />
VA<br />
=<br />
TR<br />
= ⋅ beim 24 Verlassen<br />
δdes Reaktionsbeckens Q<br />
Basierend V<br />
TR<br />
= ⋅ 24 auf den Erfahrungen der nachfolgend TR<br />
⋅Q<br />
V = zitierten<br />
Untersuchungen Q werden folgende Werte 24 empfohlen:<br />
In einem Reaktionsbecken mit Kalk-DAS:<br />
TR<br />
⋅Q<br />
##<br />
Zum V = Entfernen von Fe R<br />
24<br />
A = 80–150 g/m 2 · Tag<br />
##<br />
Zum Entfernen des Al R A = 70–100 g/m 2 · Tag<br />
##<br />
Zum Entfernen des Zn R A = 5–8 g/m 2 · Tag<br />
A<br />
s<br />
(1.2)<br />
Ein weiterer Wert, der zu beachten ist, ist die Menge des<br />
reaktiven Materials in einem Reaktionsbecken für die<br />
passive Behandlung Q⋅( C mit Bezug auf seine zu erwartende<br />
e<br />
− Cs)<br />
Funktionszeit, RA<br />
=<br />
A in der kein Wechsel des reaktiven Materials<br />
erfolgen soll.<br />
Für ein Q⋅ Q⋅ (( CKalk-DAS ee<br />
−<br />
C<br />
ss)<br />
)<br />
R<br />
errechnet sich die Masse an Kalk-<br />
A<br />
=<br />
stein (Kalksand) RA<br />
A wie folgt:<br />
( )<br />
Q⋅<br />
M<br />
QCT f<br />
⋅ Ce<br />
⋅ − Cs<br />
A = ⋅R<br />
6<br />
10 R⋅<br />
Az<br />
(2.1)<br />
Masse M an Kalkstein für eine Funktionszeit T<br />
VA<br />
f in<br />
M<br />
QCT f<br />
= ⋅ ⋅ ⋅R<br />
6<br />
Tonnen (t) 10 δ ⋅ z<br />
VM<br />
TR<br />
⋅ 24<br />
VA<br />
=<br />
δQ<br />
(2.2)<br />
Bild 2. Einfluss des pH-Wertes auf die Fällung einiger Metalle. Die<br />
vertikalen rechteckigen Felder zeigen den erwarteten pH-Wert nach der<br />
passiven Behandlung des AMD mit Kalkstein (CaCO 3 ) und Magnesiumoxid<br />
(MgO) (Ball und Nordstrom, 1991).<br />
Volumen TV<br />
R<br />
Q<br />
VT<br />
R<br />
⋅ 24 an Kalkstein (Sand) (m 3 )<br />
Q = 24 Durchflussmenge Q<br />
von AMD (m 3 /Tag)<br />
C = Differenz zwischen Gesamt-Säure vor und<br />
TR<br />
⋅Q<br />
V = nach der Behandlung im zu bemessenden<br />
24<br />
Reaktionsbecken<br />
T f = vorgesehene Betriebszeit in Tagen<br />
R = Faktor für eine Reserve an Kalkstein am Ende<br />
der Funktionszeit, wir wählen 1,3<br />
z = Gehalt von Kalk im Kalkstein (%/100)<br />
δ = Dichte des Kalksteins (t/m 3 )<br />
Zur Berechnung der Größe der Absetzbecken wird die<br />
Verweildauer verwendet, dies ist die Zeit, welche das<br />
AMD im Absetzbecken verweilt, in Stunden.<br />
Mai 2013<br />
602 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
R<br />
A<br />
Q⋅( Ce<br />
− Cs)<br />
=<br />
A<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
( )<br />
Q⋅ Ce<br />
− Cs<br />
Q⋅ Ce<br />
− Cs<br />
Tabelle RA<br />
= 1. Physikalisch-chemische Parameter A = und ausgewählte, wichtige Elemente des AMD am Zulauf in die Anlage und nach der Reinigung<br />
A<br />
RA<br />
im Absetzbecken 3.<br />
( )<br />
( )<br />
Q⋅ Ce<br />
− Cs<br />
Al<br />
A =<br />
M<br />
QCT f<br />
= ⋅ Ca ⋅ Cu Fe Mg Mn SO<br />
⋅R<br />
4 Zn G-Säure pH<br />
R<br />
6<br />
AMD am Zulauf<br />
A<br />
(mg/L) 105 10310 ⋅ z 2 400 320 22 3670 395 2020 3,3<br />
AMD nach<br />
M<br />
QCT f<br />
= ⋅ Behandlung ⋅ (mg/L) 0 M 774 0 0 324 21 3339 342 567 5,5<br />
⋅R<br />
V<br />
6<br />
A<br />
=<br />
Reinigungsleistung 10 ⋅ z % 100 δ –150 100 100 –1,3 6 9,0 13 72<br />
V<br />
A<br />
M<br />
=<br />
δ<br />
T<br />
R<br />
V<br />
= ⋅ 24<br />
Q<br />
T<br />
R<br />
V<br />
= ⋅ 24<br />
Q<br />
(3.1)<br />
TR<br />
⋅Q<br />
V =<br />
24<br />
(3.2)<br />
T R = T Verweildauer<br />
R<br />
⋅Q<br />
(Stunden)<br />
V =<br />
Q = 24 Durchfluss von AMD (m 3 /Tag),<br />
V = Volumen des Absetzbeckens (m 3 )<br />
Für Absetzbecken wird eine Verweildauer empfohlen<br />
von T R = 25–50 h .<br />
Weitere Kriterien für die Bemessung von Absetzbecken<br />
sind:<br />
##<br />
100 m 2 Oberfläche für eine Zulaufmenge von je<br />
1 L/sec.<br />
##<br />
Ein Verhältnis von Länge zu Breite von mindestens<br />
2 : 1, um die Wahrscheinlichkeit von hydraulischen<br />
„Kurzschlüssen“ zu beschränken.<br />
##<br />
Ein Absetzbecken kann 30–50 mg/L Fe beseitigen,<br />
wenn die Gesamtkonzentration höher ist, muss ein<br />
weiteres Absetzbecken und zusätzliche Belüftung<br />
durch Kaskaden hinzugefügt werden, PIRAMID<br />
Consortium (2003) [7].<br />
3. Ziele<br />
Entwurf einer passiven Reinigungsanlage für saure<br />
Bergwerkswässer auf der Grundlage verschiedener<br />
bestehender Ergebnisse anderer Untersuchungen in<br />
experimentellen Pilotanlagen für saure Bergwerkswässer<br />
mit der DAS-Technologie in der Mine Monte<br />
Romero, im Abbaugebiet Cueva de la Mora.<br />
Reinigung der sauren Bergwerkswässer aus der Mine<br />
Monte Romero, welche den Bach Monte Romero kontaminieren.<br />
Die Reinigungsleistung der Anlage beträgt 2 L/sec<br />
(172,8 m 3 /Tag) von AMD mit hohen Konzentrationen<br />
von Schwermetallen und niedrigem pH-Wert.<br />
Durch die Anwendung von kostengünstigen Materialien,<br />
Herstellungsmethoden und Design soll ein bestmögliches<br />
Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht werden.<br />
Weiter soll ohne Unterbrechung und wesentlicher Beeinträchtigung<br />
der Reinigungsleistung das Reaktionsmaterial<br />
der Reinigungsanlage gewechselt werden<br />
können. Die Konstruktion dieser Pilotanlage soll so<br />
erfolgen, dass sie mit geringen Änderungen auch an<br />
anderen Standorten mit anderem zu behandelnden<br />
AMD angewendet werden kann.<br />
Bild 3. Zusammensetzung und physikalisch-chemische Parameter des<br />
AMD der Mine Monte Romero beim Verlassen des Tunnels und am<br />
Zulauf zur Reinigungsanlage.<br />
4. Konstruktion einer Anlage<br />
zur passiven Minenwasserreinigung<br />
Die Merkmale des AMD der Mine Monte Romero und<br />
die Reinigungsmethoden sind aus verschiedenen der<br />
nachfolgend zitierten Publikationen übernommen worden:<br />
1. Rötting, T. et al. (2004) [2].<br />
2. Rötting, T. et al. (2008a) [3].<br />
3. Rötting, T. et al. (2008b) [1].<br />
4. Tesis von Aguasanto Miguel Sarmiento [4].<br />
5. Caraballo et al. (2011) [5].<br />
Die Topographie des Geländes wurde mittels GPS aufgenommen,<br />
um ein digitales Geländemodell in 3D (MDT)<br />
zu erzeugen. Alle Komponenten der passiven Reinigungsanlage,<br />
entsprechend der ausgeführten Dimensionierungen,<br />
wurden mit dem Programm Auto-CAD in<br />
drei Dimensionen entwickelt, um sie dann als gesamte<br />
Anlage in das digitale Gelände einzufügen (Bild 3,<br />
Tabelle 1).<br />
5. Verwirklichung der passiven<br />
Reinigungsanlage<br />
Mit dieser Zusammensetzung des AMD und der<br />
beschriebenen Methodik wurde im Gebiet der Mine von<br />
Monte Romero (Faja Piritica Ibérica – Spanischer Pyrit-<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 603
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Bild 4. Perspektive des Einlaufbauwerkes mit Notüberlauf und<br />
Zulaufbegrenzung auf 2 L/sec.<br />
Bild 5. Plan der Reaktivbecken 1 und 2 mit Kalk-DAS, mittels<br />
AutoCAD entworfen.<br />
Bild 6. Übersichtsplan der gesamten passiven Reinigungsanlage mit<br />
Kalk-DAS-Behandlung, Belüftungskanälen und Absetzbecken.<br />
gürtel im Südwesten Spaniens) eine passive Behandlung<br />
für AMD geplant, bestehend aus den folgenden<br />
Komponenten:<br />
Der Zufluss der AMD ist variabel, besonders nach<br />
starkem Regen und Gewittern. Der Zulauf des AMD in<br />
das Einlaufbauwerk erfolgt deshalb über eine Öffnung,<br />
welche als Thomson-Wehr bekannt ist, sie begrenzt den<br />
Zulauf zur Reinigungsanlage auf eine mittlere <strong>Wasser</strong>menge<br />
von 2 L/sec. Nach Regen oder Gewittern wird die<br />
größere <strong>Wasser</strong>menge des Tunnels direkt dem Bach<br />
Monte Romero zugeleitet damit sie die Prozesse in der<br />
Reinigungsanlage nicht beeinträchtigt (Bild 4).<br />
Nach dem Einlaufbauwerk wurde ein erstes Ab -<br />
setzbecken gebaut, mit einer Fläche von 100 m 2 und<br />
einem Volumen von 110 m 3 , die Verweilzeit beträgt<br />
15 Stunden. In diesem Absetzbecken setzt sich der erste<br />
Teil des Eisens des AMD ab. Von hieraus wird das zu<br />
behandelnde <strong>Wasser</strong> durch einen offenen Kanal einem<br />
Schacht zugeführt, von wo das saure <strong>Wasser</strong> in die Re -<br />
aktionsbecken 1 und 2 fließt, diese sind mit Reaktionsmaterial<br />
vom Typ Kalk-DAS gefüllt (Bild 5).<br />
Die Behandlungsbecken sind in zwei gleiche Teile<br />
von je 20 · 6 m geteilt, wie in Bild 5 dargestellt wird, um<br />
zu ermöglichen, dass der Reinigungsprozess beim Austausch<br />
des Reaktionsmaterials nicht unterbrochen wird.<br />
Die Behandlungsbecken sind aus Stahlbeton im Mittel<br />
4,15 m tief. Der Inhalt ist folgendermaßen aufgebaut<br />
(von unten nach oben): eine 40 cm Drainageschicht<br />
bestehend aus 30 cm grobem Quarz-Kies (Körnung<br />
10–40 mm) und einer zweiten, 10 cm starken Drainageschicht<br />
aus Quarz-Feinkies (5–10 mm). Darüber befindet<br />
sich das eigentliche DAS-Reaktivmaterial in einer Stärke<br />
von 2,25 m. Jedes der beiden Reaktionsbecken hat eine<br />
Fläche von 120 m 2 und ein Volumen (Reaktivmaterial)<br />
von 270 m 3 . Die Wahl des Konstruktionsbetons ist entscheidend,<br />
weil er so lange wie möglich dem chemischen<br />
Angriff des sauren <strong>Wasser</strong>s standhalten muss.<br />
Die Betondeckung über der Armierung der Anlage<br />
muss stark genug sein, damit das saure <strong>Wasser</strong> die<br />
Armierung nicht angreift und diese durch Korrosion<br />
zerstört wird.<br />
Das Reaktivmaterial vom Typ Kalk-DAS der Reaktionsbecken<br />
besteht aus feinkörnigem Kalksandstein mit<br />
20 % (v/v) (d 10 = 0,3 mm, d 50 = 1,4 mm, d max = 5 mm),<br />
gemischt mit einem groben Stützgerüst aus Hobelspänen<br />
von 80 % (mit einer maximalen Länge von 2 cm<br />
und einem Durchmesser von 0,5 cm). Das <strong>Wasser</strong> fließt<br />
dann über einen Belüftungskanal (15 m Länge und<br />
1,5 m Höhenunterschied, die Breite beträgt 0,40 m), wo<br />
es mit Sauerstoff angereichert wird, in das Absetzbecken<br />
2. Dieses hat eine Fläche von 260 m 2 und ein<br />
Volumen von 290 m 3 , die Verweildauer beträgt 40 Stunden.<br />
Die Belüftungskanäle sind aus Betonfertigteilen<br />
hergestellt, wie sie zur Ableitung von Oberflächenwasser<br />
im Straßenbau verwendet werden. Die Absetzbecken<br />
sind aus verdichtetem Boden oder mittels Aus-<br />
Mai 2013<br />
604 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
FACHBERICHTE<br />
hub hergestellt, je nach Höhe des Geländes. Die Abdichtung<br />
besteht aus PE-Folie.<br />
Dieser Prozess wird von einem zweiten Aerationskanal,<br />
gefolgt von dem Absetzbecken 3, wiederholt.<br />
Nach dem Absetzbecken 3 fließt das gereinigte <strong>Wasser</strong> in<br />
Richtung des Baches Monte Romero. Die Gesamtanlage<br />
ist in Bild 6 dargestellt. Die Zusammensetzung und physikalisch-chemischen<br />
Parameter des AMD nach der Reinigung<br />
im Absetzbecken 3 sind in Tabelle 1 dargestellt.<br />
Die Ergebnisse nach der Behandlung mit Kalk-DAS<br />
zeigen niedrige Konzentrationen für Al und Fe, aber die<br />
Konzentrationen von Zn und SO 4 sind weiterhin sehr<br />
hoch und stellen ein Problem dar.<br />
Insbesondere für das Problem mit den hohen Zink-<br />
Konzentrationen muss noch eine Lösung gesucht werden.<br />
6. Schlussfolgerungen<br />
Das Hauptziel dieser Arbeit, eine passive Reinigungsanlage<br />
zu entwerfen für die chemisch-physikalischen<br />
Werte und die Zusammensetzung der Bergwerkswässer<br />
der Mine Monte Romero und deren Reinigung wurde<br />
erreicht.<br />
Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie sich den<br />
begrenzten Verhältnissen der Topografie und Ausdehnung<br />
anpasst.<br />
Die Reinigungsanlage kann 2 L/sec (172,8 m 3 /Tag)<br />
von AMD behandeln.<br />
Durch geringe strukturelle Veränderungen an diesem<br />
Design kann diese Reinigungsanlage auch für die<br />
Behandlung anderer AMD und an anderen Orten eingesetzt<br />
werden.<br />
Der Entwurf der Reaktionsbecken erfolgte so, dass<br />
zu keinem Zeitpunkt während der zukünftigen Unterhaltsarbeiten<br />
die AMD direkt ungereinigt in den natürlichen<br />
Vorfluter fließt. Das Reaktionsbecken ist in zwei<br />
gleiche Teile geteilt, die unabhängig voneinander arbeiten<br />
können, während der Reinigung eines Beckens<br />
arbeitet das andere.<br />
Die Wahl des Konstruktionsbetons ist entscheidend,<br />
weil die Becken so lange wie möglich dem chemischen<br />
Angriff des sauren <strong>Wasser</strong>s standhalten müssen. Die<br />
Betondeckung über der Armierung der Anlage muss<br />
stark genug sein, damit das saure <strong>Wasser</strong> die Armierung<br />
nicht angreift und diese durch Korrosion zerstört wird.<br />
Diese Reinigungsanlage für saure Minenwässer löst<br />
das Problem der hohen Konzentrationen von Schwermetallen,<br />
die in dem AMD der Mine Monte Romero vorhanden<br />
sind.<br />
Es ist erforderlich, weitere Studien durchzuführen,<br />
um das Problem der hohen Konzentration von Zink in<br />
der AMD der Mine Monte Romero zu lösen. Um dieses<br />
zu entfernen, müsste das (AMD) in einem Reaktionsbecken<br />
vom Typ MgO-DAS oder ähnlichen Reaktivmaterialien<br />
behandelt werden.<br />
Vorrang muss immer die Vorbeugung und Minimierung<br />
von sauren Bergwerkswässern haben, um sie in<br />
Ihrer Entstehung zu vermeiden. Dies ist die wirtschaftlichste<br />
Art, Umweltschäden zu verhindern.<br />
7. Künftige Entwicklungen<br />
Es ist vorgesehen noch im Jahr 2013 eine naturnahe<br />
Reinigungsanlage in der aufgelassenen Mine Esperanza<br />
(FPI) zu verwirklichen, welche nach den Berechnungsmethoden<br />
und Entwürfen dieses Artikels projektiert<br />
wird.<br />
Wenn der Bau dieser Anlage für die passive Reinigung<br />
verwirklicht ist, wird es eine wichtige Aufgabe sein, die<br />
Anlage in ihrer Funktionsweise zu überwachen und im<br />
ersten Jahr nach Inbetriebnahme durch wöchentliche<br />
Probenahmen und Messungen aller Reinigungswerte die<br />
aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes gemachten<br />
Prognosen und Bemessungen zu überprüfen. Sicherlich<br />
wird es sich im Ergebnis abzeichnen, dass die eine oder<br />
andere Verbesserung gemacht werden kann, auch im<br />
Sinne einer Kosteneinsparung.<br />
Für künftige passive Reinigungsanlagen werden<br />
dann noch gesichertere Bemessungswerte zur Verfügung<br />
stehen. Insgesamt ist die DAS-Technologie durch<br />
umfangreiche Versuche im Labor und durch Pilotanlagen<br />
überprüft und stellt eine der effektivsten Arten<br />
der passiven Reinigungsmethoden für hochkontaminierte<br />
Bergwerkswässer dar.<br />
Abkürzungen<br />
AMD (Acid Mine Drainage) saure Minenabwässer<br />
DAS (Dispersed Alkaline Substrate), verteiltes, alkalines Substrat<br />
FPI<br />
ALD<br />
OLD<br />
(Faja Pirítica Ibérica) Pyrit-Gürtel in Süd-West-Spanien<br />
(Anoxic Limestone Drain) anoxische Karbonatkanäle<br />
(Oxic Limestone Drain) offene Karbonatkanäle<br />
RAPS (Reducing and Alkalinity Producing Systems) Reduktions- und<br />
Alkalitätproduktionssysteme<br />
MDT (Modelo Digital del Terreno) digitales Geländemodell<br />
Literatur<br />
[1] Rötting, T. S., Caraballo, M. A., Serrano, J. A., Ayora, C. and Carrera,<br />
J.: Field application of calcite Dispersed Alkaline Substrate<br />
(calcite-DAS) for passive treatment of acid mine drainage<br />
with high Al and metal concentrations. Applied Geochemistry<br />
23 (2008b) No. 6, p. 1660–1674.<br />
[2] Rötting, T. S., Ayora, C. and Carrera, J.: Informe sobre los bidones<br />
experimentales de tratamiento de aguas ácidas de mina,<br />
en la mina Cueva de la Mora, 2004.<br />
[3] Rötting, T. S., Thomas, R. C., Ayora, C. and Carrera, J.: Passive<br />
treatment of acid mine drainage with high metal concentrations<br />
using dispersed alkaline substrate. Journal of Environmental<br />
Quality 37 2008a) No. 5., p. 1741–1751.<br />
[4] Sarmiento, A. M.: Tesis von Aguasanto Miguel Sarmiento:<br />
“Estudio de la contaminación por drenajes ácidos de minas<br />
de las aguas superficiales en la cuenca del río Odiel (SO<br />
España)”, 2007.<br />
[5] Caraballo, M. A., Macías, F., Rötting, T. S., Nieto, J. M. and Ayora,<br />
C.: Implementation of a Dispersed Alkaline Substrate (DAS)<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 605
FACHBERICHTE <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
based passive treatment system at Mina Esperanza, SW<br />
Spain: long term remediation of highly polluted acid mine<br />
drainage, Environmental Pollution 159 (2011) No. 12,<br />
p. 3613–3619.<br />
[6] Caraballo, M. A., Macías, F., Rötting, T. S., Nieto, J. M. and Ayora,<br />
C.: Tratamiento pasivo con un sustrato alcalino disperso de<br />
drenajes ácidos de mina con alta carga metálica en la cuenca<br />
del río Odiel (Faja Pirítica Ibérica, SO España), GEOGACETA<br />
48 (2010), p. 111–114.<br />
[7] PIRAMID Consortium: Engineering guidelines for the passive<br />
remediation of acidic and/or metalliferous mine drainage<br />
and similar wastewaters. In: European Commission Fifth<br />
Framework RTD Project No. EVK1-CT-1999-000021‘‘Passive<br />
In-situ Remediation of Acidic Mine/Industrial Drainage”<br />
(PIRAMID), University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle<br />
Upon Tyne, UK, 2003.<br />
Eingereicht: 14.03.2013<br />
Korrektur: 02.04.2013<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Hans Sgier<br />
(Korrespondenzautor) |<br />
E-Mail: Hans.Sgier@alu.uhu.es |<br />
Dr. José Miguel Nieto<br />
Dpto. de Geología,. Universidad de Huelva. Avda |<br />
Fuerzas Armadas s/n. 21071 Huelva, España<br />
Dr. Tobias S. Rötting<br />
Grupo de Hidrología Subterránea |<br />
Universidad Politécnica de Cataluña |<br />
Jordi Girona 1–3 |<br />
08034 Barcelona<br />
Buchbesprechung<br />
Grauwassernutzung<br />
Ökologisch notwendig – Ökonomisch sinnvoll<br />
iWater <strong>Wasser</strong>technik GmbH & Co. KG, Troisdorf,<br />
1. Auflage 2013. 130 S., Preis: € 19,80 zzgl. Porto<br />
u. Verpackung, ISBN 978-3-00-039866-7.<br />
Die Grauwassernutzung ist wie die Regenwassernutzung<br />
und die Verwendung von Brunnenwasser eine<br />
geeignete Technik, um den Trinkwasserverbrauch in<br />
Gebäuden und auf Grundstücken zu reduzieren.<br />
Dies ist ein wirksamer Beitrag zum Umweltschutz<br />
und hilft, die Kosten für den <strong>Wasser</strong>verbrauch zu<br />
senken. Durch die Wiederverwendung von Grauwasser,<br />
im Sinne einer Mehrfachnutzung, wird<br />
weniger <strong>Abwasser</strong> produziert, woraus sich weitere<br />
ökologische und ökonomische Vorteile ergeben.<br />
Künftig wird auch die bereits erprobte Wärmerückgewinnung<br />
aus Grauwasser eine Rolle spielen. In<br />
Hotels und anderen Beherbergungs- Betrieben (Studentenwohnheime,<br />
Jugendherbergen, Gästehäuser<br />
und Pensionen, Campingplätze) ist die Nutzung aufbereiteten<br />
Grauwassers schon heute eine äußerst<br />
effiziente Maßnahme, um die Betriebskosten zu senken.<br />
Vorwort von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus Töpfer,<br />
Bundesumweltminister von 1987 bis 1994, Executive<br />
Director UNEP von 1998 bis 2006, seit 2009<br />
Direktor des Institute for Advanced Sustainability<br />
Studies in Potsdam: im Vorwort zu diesem Buch:<br />
„Der Ressourcen schonende Umgang mit <strong>Wasser</strong><br />
wird weltweit weiter an Bedeutung zunehmen und<br />
Unterstützung brauchen. Ich bin fest davon überzeugt,<br />
dass diese Herausforderung global weit mehr<br />
als nur ein Nischenthema ist. Bereits im Jahr 2050<br />
wird diese Welt rund 9 Milliarden Menschen beheimaten.<br />
Sie alle sind darauf angewiesen, dass in ausreichendem<br />
Maße Nahrungsmittel erzeugt werden.<br />
Allein der dafür erforderliche <strong>Wasser</strong>bedarf wird<br />
die Leistungsfähigkeit schnell übersteigen, wenn es<br />
uns nicht gelingt, mit dem <strong>Wasser</strong> wesentlich effizienter<br />
und fürsorglicher umzugehen. Dazu gehört in<br />
ganz besonderer Weise die Erfassung und Nutzung<br />
des Grauwassers. Deutschland ist eines der Länder,<br />
die dieser einfachen und effektiven Technik zum<br />
Durchbruch verhelfen. Daher wünsche ich dieser<br />
Publikation einen herausragenden Erfolg. Vor allem<br />
wünsche ich aber, dass von dieser Veröffentlichung<br />
multiplikative Effekte auf die Praxis und auf die<br />
wissenschaftliche Arbeit ausgehen.“<br />
Bestellmöglichkeit per E-Mail<br />
info@ewu-gruppe.de<br />
Mai 2013<br />
606 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNGEN<br />
Buchbesprechung<br />
Water Sensitive Urban Design<br />
Von Jaqueline Hoyer, Wolfgang Dickhaut, Lukas<br />
Kronawitter und Björn Weber. 144 Seiten, zahlr.<br />
farbige Abbildungen und Tabellen (ISBN 978-3-<br />
86859-106-4, 1. Auflage 2011 gedruckt/kartoniert<br />
vergriffen) 2. Auflage als e-Book seit März 2013<br />
erhältlich.<br />
Die Kombination der vier Begriffe im Titel stammt<br />
ursprünglich aus Australien. Die Autoren kommen<br />
aus Deutschland. Jaqueline Hoyer, Wolfgang Dickhaut,<br />
Lukas Kronawitter und Björn Weber arbeiten<br />
an der HCU Hafen City University Hamburg. Ihr<br />
Buch ist Teil des internationalen Forschungsprojektes<br />
SWITCH „Managing Water in the City if the<br />
Future“ – und deshalb in Englisch erschienen.<br />
Auf mehr als 140 Seiten wird zusammengestellt,<br />
was Stadtplanung, Freiraumplanung und Siedlungswasserwirtschaft<br />
in der Zukunft gemeinsam<br />
leisten müssen. Anlass sind die Herausforderungen<br />
in Verbindung mit dem Klimawandel, insb. mit<br />
Starkregenereignissen und Überschwemmungen.<br />
Der Fundus, aus dem die Verfasser schöpfen können,<br />
ist groß: 32 Projektpartner beteiligten sich an<br />
SWITCH. Obwohl europäisch aufgestellt durch die<br />
Finanzierung der EU, machen US-amerikanische<br />
und australische Projekte etwa ein Drittel der Beispiele<br />
aus. Im Klimavergleich sind auch Singapore<br />
und Mumbai mit von der Partie. Im Buch werden<br />
die Methoden der Regenwasserbewirtschaftung mit<br />
aktuellem Stand der Technik klar und anschaulich<br />
vorgestellt, ohne die Aspekte Akzeptanz, Funktionalität,<br />
Ästhetik und <strong>Wasser</strong>wirtschaft zu vernachlässigen.<br />
Im Gegenteil – gerade an den neun detailliert<br />
gezeigten Projekten vermittelt die hohe Qualität<br />
der Lösungen, aber auch der Fotos und Grafiken den<br />
Eindruck, dass Erlebnisqualität und Umweltschutz<br />
ohne erkennbare Kompromisse auch in der Großstadt<br />
vereinbar sind, obwohl Interessenkonflikte<br />
dort bekanntermaßen besonders zahlreich sind. Vergleichbar<br />
werden die Fallbeispiele dadurch, dass<br />
die Autoren 3 x 3 Projekte ähnlicher Größe nebeneinander<br />
stellen und bewerten.<br />
Wie bei einem guten Fachbuch üblich, schließt<br />
auch dieses mit einer Zusammenfassung und einem<br />
ausführlichen Quellen- und Literatur-Anhang ab.<br />
Klaus W. König<br />
Bestellmöglichkeit online<br />
www.jovis.de<br />
Zeitschrift KA – <strong>Abwasser</strong> · Abfall<br />
In der Ausgabe 5/2013 lesen Sie u. a. folgende Beiträge:<br />
Althoff / Ketteler / Grün<br />
Moderne Bauverfahren und innovative Inspektionstechnologien<br />
für den <strong>Abwasser</strong>kanal Emscher<br />
Hübner Sanierungslösung für große Nennweiten und extreme Profiltypen –<br />
Das Wickelrohrverfahren<br />
Falk<br />
Werker / Meier<br />
Müller / Baum / Barenthien<br />
Hoppe u. a.<br />
Kanalsanierung im Kontext von Stadtentwicklung<br />
Kostenoptimierung im Kanalbau<br />
Zukunftsperspektive Kanalsanierung – Entwicklung eines<br />
Kanalsubstanzerhaltungskonzeptes für die Landeshauptstadt Düsseldorf<br />
Exakte Lokalisierung von Einleitungen in Entwässerungssysteme<br />
mittels verteilter Temperaturmessungen (DTS) –<br />
Grundlagenermittlung zur effizienten Sanierungsplanung<br />
Hermes Schachtrahmenregulierung – ein ständiges Thema unter neuen Anforderungen –<br />
Auswirkungen der neuen DIN 19573 auf die Qualitäten der Baustoffe<br />
Kaufmann u. a.<br />
Hydraulische Sanierung und Verbesserung des Gewässerschutzes<br />
durch den Einsatz vertikal verfahrbarer Kaskadenwehre – Realisierung,<br />
Betriebserfahrungen und Möglichkeiten der modelltechnischen Abbildung<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 607
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
Ressourcenschutz als<br />
interdisziplinäre Aufgabe<br />
46. ESSENER TAGUNG vom 13. bis 15. März 2013 in Aachen<br />
Anna Abels, Kassandra Klaer und Danièle Mousel<br />
Die diesjährige ESSENER TAGUNG fand vom 13. bis zum<br />
15. März in Aachen statt und stand unter dem Motto<br />
„Ressourcenschutz als interdisziplinäre Aufgabe“. Prof.<br />
Johannes Pinnekamp begrüßte im Namen aller Veranstalter<br />
die über 900 Teilnehmer, die aus ganz Deutschland<br />
und weiteren sieben Ländern angereist waren und<br />
von der breiten Zustimmung der diesjährigen Tagung<br />
zeugten. Das Leitthema Ressourcenschutz zog sich als<br />
roter Faden durch die 18 Sessions. Gastgeber Pinnekamp<br />
versteht den Schutz von Ressourcen als Basis allen<br />
Wirtschaftens und betonte die vielfältigen Verbindungen<br />
zur <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
In der Auftaktsession plädierte Prof. Ernst Ulrich von<br />
Weizsäcker für die nachhaltige Entkopplung von Ressourcenverbrauch<br />
und Wohlstand. Die hohe Importabhängigkeit<br />
Deutschlands bei Metallen und gleichzeitig<br />
niedrige Recyclingraten sollten uns zu denken geben. In<br />
der Ressourcenwirtschaft und Umwelttechnologie sieht<br />
er daher „riesige technische und kommerzielle Chancen“.<br />
Dabei warnte er vor dem Rebound-Effekt: Mit steigender<br />
Effizienz dürfe nicht gleichzeitig auch der Verbrauch<br />
Gastgeber Prof. Johannes Pinnekamp vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
(ISA) der RWTH Aachen bei der Begrüßungsrede.<br />
© www.stephan-rauh.com<br />
wachsen. Prof. Martin Faulstich unterstrich im Anschluss<br />
die Notwendigkeit der zuvor genannten Entkopplung<br />
im Hinblick auf unsere begrenzte Welt. Er zeigte die<br />
Vision einer nachhaltigen Industriegesellschaft mit<br />
einer komplett geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Den<br />
Ausbau entsprechender Branchen schätzte auch er als<br />
„exzellentes Wirtschaftsförderungsprogramm“ ein.<br />
In der von Otto Schaaf, Präsident der DWA, geleiteten<br />
Session zum Thema Ressourcenschutz und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
regte Prof. Helmut Kroiss weiterhin zu Nachdenklichkeit<br />
an. Allgemeine Handlungsempfehlungen<br />
hält er zwar für unrealistisch, betonte jedoch die Bedeutung<br />
von Bildung als Ressource, denn „im Kopf beginnt<br />
jede Veränderung“. Die Ausführungen von Prof. Harro<br />
Bode zeigten, dass mit der Gründung der <strong>Wasser</strong>verbände<br />
in Bezug auf die Bündelung von Wissen und<br />
Ressourcen weltweit beispielhafte Einrichtungen<br />
geschaffen wurden. Reinhard Kaiser (BMU) sieht eine<br />
Vielzahl von Akteuren in der Verpflichtung zu handeln.<br />
Ein erster Schritt sei die von ihm angekündigte Einbeziehung<br />
der Ressourceneffizienz in das öffentliche<br />
Beschaffungswesen innerhalb von zwei Jahren.<br />
Die Notwendigkeit von weiterer Veränderung<br />
zeigte sich auch in den beiden Sessions zum Thema<br />
Ge wässerschutz, geleitet von Prof. Ulrich Irmer und<br />
Dr. Emanuel Grün, in denen die Umsetzung von Maßnahmen<br />
der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie beleuchtet wurde.<br />
Dr. Thomas Grünebaum hält die in Deutschland betonte<br />
Freiwilligkeit von Maßnahmen einerseits und die verbindlichen<br />
europäischen Vorgaben auf der anderen<br />
Seite für einen unauflösbaren Widerspruch. Auf diese<br />
Weise werde nur ein „Flickenteppich“ isolierter Maßnahmen<br />
entstehen. Hinweise für die Priorisierung von Maßgaben<br />
gab Paul Wermter vom Forschungsinstitut für<br />
<strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft (FiW) an der RWTH Aachen.<br />
Statistische Zusammenhänge zwischen Einleitungen<br />
und ihrer Auswirkung auf die Gewässergüte werden<br />
vom schlechten Gesamtzustand der Gewässer überdeckt.<br />
Die naturnahe Entwicklung der Fließgewässer<br />
sehe er daher als prioritär an. In weiteren Vorträgen<br />
wurde der aktuelle Umsetzungsstand von deutscher<br />
Seite dargestellt. Einer zum Teil hohen Anzahl an<br />
Mai 2013<br />
608 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
Maßnahmen steht ein insgesamt noch eher geringer<br />
Gesamtfortschritt bei der Erreichung der vorgegebenen<br />
Ziele gegenüber. Es zeigt sich, dass die Verbesserung<br />
der strukturellen Gewässergüte nicht unbedingt mit<br />
einer Verbesserung des ökologischen Zustands einhergeht.<br />
Zudem stellen die Finanzierung und Beschaffung<br />
von benötigten Flächen teilweise nicht unerhebliche<br />
Hürden dar. Die von Dr. Harry Tolkamp dargestellte<br />
Situa tion in den Niederlanden lässt vergleichbare Probleme<br />
erkennen. Die Umsetzung von Maßnahmen<br />
weist dort gegenwärtig einen heterogenen Fortschritt<br />
auf. Insgesamt versuchen die Niederländer jedoch nicht,<br />
die Anforderungen an die 2015 zu erreichenden Ziele zu<br />
senken, sondern in einem neuen Zeitplan bis 2027 eine<br />
vollständige Umsetzung zu bewerkstelligen.<br />
Eine vollständig geschlossene Kreislaufwirtschaft<br />
beinhaltet die Rückgewinnung und Wiederverwertung<br />
von Ressourcen aus Abfall, weshalb zwei Blöcke dem<br />
Thema Abfall gewidmet wurden. Prof. Wolfgang Firk<br />
führte durch die erste Session „Phosphor als<br />
Ressource“. Aufgrund der Unersetzbarkeit von Phosphor<br />
müsse die Phosphorrückgewinnung mit der nö -<br />
tigen Globalität und einem fachübergreifenden Austausch<br />
von Theorie und Praxis behandelt werden,<br />
erklärte Prof. Roland W. Scholz. Der Bedarf an Phosphor<br />
sei jedoch in den letzten Jahren mit zunehmender<br />
Bevölkerung und wachsendem Wohlstand stark ge -<br />
stiegen. Dr. Claus-Gerhard Bergs stellte in dem Zusammenhang<br />
rechtliche Regelungen vor, die wesentliche<br />
Impulse zu Phosphorversorgungsstrategien geben<br />
sollen. Eine mögliche Verordnung zur Rückgewinnung<br />
von Phosphor werde derzeit BMU-intern diskutiert.<br />
Prof. Johannes Pinnekamp präsentierte Empfehlungen<br />
der DWA Arbeitsgruppe „Wertstoffrückgewinnung aus<br />
<strong>Abwasser</strong> und Klärschlamm“ in Bezug auf den Umgang<br />
mit Phosphor. Die Förderung von Pilotprojekten und<br />
Entwicklungsvorhaben sei notwendig, um eine Technologie<br />
praxisreif zu machen. Dennoch mahnte er, dass die<br />
Idee des Phosphorrecyclings nicht zu negativen Auswirkungen<br />
auf der Kläranlage wie z. B. der Anreicherung<br />
von Schwermetallen führen dürfe. Die Verfahren<br />
der Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammasche<br />
wurden in einem nachfolgenden Vortrag hinsichtlich<br />
des ökologischen und technischen Potenzials gegenüber<br />
den Verfahren aus Schlammwasser und Klärschlamm<br />
favorisiert. In der anschließenden Diskussion<br />
wurde festgehalten, dass eine wichtige Grundlage für<br />
das Recycling von Phosphor ein Markt für das entstehende<br />
Produkt und eine rechtliche Regelung bezüglich<br />
der Möglichkeit zum Einsatz als Düngemittel sei.<br />
Im Block „Ressourcen aus der Abfallwirtschaft“,<br />
moderiert von Prof. Martin Faulstich, wurde auf das<br />
Potenzial von Bioabfällen und Landschaftspflegematerial<br />
zur Energiegewinnung verwiesen, das durch die<br />
Novellierung des EEG an Bedeutung gewinne. Neben<br />
der energetischen Verwertung der Abfälle wurde auch<br />
Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker bei der Eröffnungsrede der<br />
46. ESSENER TAGUNG im März in Aachen. © www.stephan-rauh.com<br />
eine Studie aus Bayern zum Recycling von Metallen vorgestellt.<br />
Für Elemente, die seit vielen Jahren genutzt<br />
werden, bestünden bereits gute Recyclingstrategien<br />
(> 50 %); erläuterte Dr. Matthias Franke. Als weitere Möglichkeit<br />
der Ressourcenschonung stellte Prof. Stefan<br />
Gäth den Einsatz von Ersatzbaustoffen und deren Auswirkung<br />
auf das Grundwasser vor. Er hinterfragte die<br />
Grenzwerte für Substanzen im Grundwasser, was zu<br />
einer kontroversen Diskussion mit dem Plenum führte.<br />
Wie schon im vergangenen Jahr wurde eine Session<br />
dem Thema Fracking gewidmet. Das Kernthema dieses<br />
von Gerhard Odenkirchen moderierten Themenblocks<br />
war die Frage, wie die Auswirkungen dieser Technologie<br />
auf die aquatische Umwelt zu bewerten seien. Dr. Axel<br />
Bergmann und Dr. H. Georg Meiners stellten dazu Ergebnisse<br />
der NRW- und der UBA-Studie vor. Sie merkten an,<br />
dass die vielen Forschungsdefizite und Wissenslücken<br />
in diesem Bereich eine aussagekräftige Risikoanalyse<br />
der Technologie erschwerten. Es sei notwendig, standortspezifische<br />
und nachvollziehbare Vorarbeit zu leisten,<br />
bevor Fracking umgesetzt werden könne. In den<br />
Vereinigten Staaten werde diese Technologie bereits<br />
seit einiger Zeit eingesetzt. Demzufolge wurden dort<br />
bisher mehr Erfahrungen gesammelt, von denen auch<br />
wir profitieren könnten. Allerdings werde in Zeiten der<br />
Energiewende jede Form der Energiegewinnung benötigt,<br />
um den allgemeinen Energiebedarf zu decken,<br />
postulierte Dr. Harald Kassner von Exxon Mobil. Die<br />
Beeinträchtigung des Grundwassers durch die eingesetzten<br />
Fracking-Fluide stelle eine wesentliche Unsicherheit<br />
dieses Verfahrens dar und dürfe nicht vernachlässigt<br />
werden. Vor der Weiterführung dieser Diskussionen<br />
sollte jedoch zunächst überprüft werden, wie<br />
groß das Potenzial für Fracking in Deutschland ist.<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 609
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
Ressourcenschutz als interdisziplinäre Aufgabe<br />
Die 46. ESSENER TAGUNG vom 13. bis 15. März 2013 stand unter<br />
dem Motto „Ressourcenschutz als interdisziplinäre Aufgabe“.<br />
Ver anstalter sind das Institut für Siedlungswasserwirtschaft der<br />
RWTH Aachen (ISA), das Institut zur Förderung der <strong>Wasser</strong>güteund<br />
<strong>Wasser</strong>mengenwirtschaft e.V. (IFWW), das Landesamt für Natur,<br />
Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) und das Forschungsinstitut<br />
für <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft (FiW) in Abstimmung<br />
mit dem Ministerium für Klima, Umwelt, Landwirtschaft,<br />
Natur- und Verbraucherschutz NRW (MKULNV) und dem Bundesministerium<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU).<br />
Die Konferenz findet im jährlichen Wechsel im Eurogress Aachen<br />
und in der Messe Essen statt. Zusätzlich zu den über 70 Wortbeiträgen<br />
in parallelen Sitzungen gibt es eine Ausstellung von Industrie,<br />
Verbänden und Forschung sowie ein Technologieforum, in dem die<br />
Industrie eine Plattform findet, ihre Produkt- und Verfahrensneuerungen<br />
vorzustellen. Auch bei der diesjährigen Tagung fand das<br />
im letzten Jahr initiierte Forum Young Scientists statt, bei dem<br />
junge Wissenschaftler/-innen in Kurzvorträgen die Ergebnisse ihrer<br />
Diplomarbeiten und Dissertationen präsentieren konnten.<br />
Die Tagung schloss wie üblich mit zwei Exkursionen, dieses<br />
Jahr zu den Themen „Schlammbehandlung in drei neuen Faulbehältern<br />
und Einsatz granulierter Aktivkohle in bestehendem Flockungsfilter<br />
auf der Kläranlage Düren“ sowie „Trinkwasseraufbereitungsanlage<br />
Roetgen“.<br />
© www.stephan-rauh.com<br />
Der Tagungsband mit den schriftlichen Langfassungen der<br />
Vorträge kann für 50 Euro erworben werden.<br />
Bestellungen sind möglich bei:<br />
Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen e.V.,<br />
D-52056 Aachen, Fax (0241) 80-222 85, E-Mail: schriftenreihen@isa.rwth-aachen.de,<br />
ISBN 978-3-938996-38-6.<br />
Im kommenden Jahr sind alle Interessierten vom 5. bis 7. März<br />
turnusgemäß nach Essen eingeladen. Anmeldungen zur<br />
47. ESSENER TAGUNG sind ab etwa November 2013 unter<br />
www.essenertagung.de möglich.<br />
„Bedenkenswerte Daten“ so Moderator Dr. Heinrich<br />
Bottermann, wurden im Themenblock <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
& Landwirtschaft vorgestellt. Prof. Bernhard<br />
Schink erläuterte die kontrovers diskutierten Inhalte der<br />
Leopoldina-Stellungnahme zur Bioenergie und stellte in<br />
Frage, ob die Erzeugung von Energie aus Biomasse in<br />
großem Umfang sinnvoll sei. Neben den Seiteneffekten<br />
der klassischen Landwirtschaft sei auch die Biogaserzeugung<br />
ein wachsendes Problem, erläuterte Dr.<br />
Wolfgang Leuchs. Die Landwirtschaft erfolge zurzeit<br />
noch nicht nachhaltig und habe weiterhin durch zu<br />
hohe Nitrat-Emissionen einen belastenden Einfluss auf<br />
die nordrhein-westfälischen Gewässer.<br />
Das in der Fachöffentlichkeit vieldiskutierte Thema<br />
der organischen Spurenstoffe wurde bei der diesjährigen<br />
Essener Tagung in zwei Blöcken behandelt. Unter<br />
der Leitung von Dr. Michael Schärer vom schweizerischen<br />
Bundesamt für Umwelt wurde über das Vorkommen<br />
und die Bewertung von organischen Spuren stoffen<br />
in Gewässern diskutiert. Dr. Christian Götz ging auf<br />
Modellstudien zur Vorhersage von Konzentrationen von<br />
Spurenstoffen in schweizerischen und in deutschen<br />
Gewässern ein. Anhand der Modellüberprüfung mittels<br />
Messdaten konnte bestätigt werden, dass das Stoffflussmodell<br />
ein geeignetes Instrument zur flächendeckenden<br />
Beurteilung des Spurenstoffeintrags sowie zur<br />
Identifikation des Handlungsbedarfs darstelle. Neben<br />
dem Eintrag von Spurenstoffen durch Kläranlagen seien<br />
auch diffuse Einträge von Pflanzenschutzmitteln zu verzeichnen,<br />
bemerkte Prof. Burkhard Teichgräber. Dies<br />
konnte beim Screening ausgewählter Spurenstoffe in<br />
den Flüssen Lippe und Seseke festgestellt werden. Die<br />
von Dr. Friederike Vietoris vorgestellten Ergebnisse einer<br />
Monitoringkampagne von Spurenstoffen in den Ge -<br />
wässern Nordrhein-Westfalens ergaben, dass zurzeit<br />
keine akute gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher<br />
durch Spurenstoffe in der aquatischen Umwelt<br />
vorliege. Dennoch sei eine Minimierung solcher Substanzen<br />
im Sinne des nachhaltigen Ressourcenschutzes<br />
relevant.<br />
Die in den letzten Jahren in zahlreichen Forschungsprojekten<br />
untersuchten Verfahren zur gezielten Spurenstoffelimination<br />
auf Kläranlagen gehen mit zusätzlichen<br />
Kosten und einem höheren Energieverbrauch einher,<br />
wie in der zweiten, von Prof. Heidrun Steinmetz moderierten<br />
Session zum Thema Spurenstoffe ersichtlich<br />
wurde. So stellte Dr. Viktor Mertsch Kostenberechnungen<br />
für die Ertüchtigung kommunaler Kläranlagen mit<br />
einer Ozonung bzw. mit aktivkohlebasierten Verfahren<br />
vor, welche auf zahlreichen Kostenstudien und bekannten<br />
Kosten aus realisierten Projekten basieren. Er kam zu<br />
dem Schluss, dass für eine Kläranlage mit 100 000 Einwohnerwerten<br />
die spezifischen Jahreskosten je nach<br />
Verfahren zwischen 0,10–0,15 €/m³ Frischwasser lägen.<br />
Katrin Krebber referierte über den Energieverbrauch<br />
von Verfahren zur Elimination von Spurenstoffen auf<br />
Mai 2013<br />
610 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
kommunalen Kläranlagen und erläuterte sowohl<br />
Berechnungen als auch großtechnische Erfahrungswerte.<br />
Prof. Thomas Ternes veranschaulichte Methoden<br />
zur Risikocharakterisierung und zum Risikomanagement<br />
von anthropogenen Spurenstoffen und von<br />
Krankheitserregern im <strong>Wasser</strong>kreislauf. Hinsichtlich der<br />
bei der Ozonung von kommunalem <strong>Abwasser</strong> entstehenden<br />
Oxidationsnebenprodukte gab Prof. Torsten C.<br />
Schmidt einen Einblick in die auf den verschiedenen<br />
Pilotanlagen durchgeführten toxikologischen Untersuchungen<br />
und Identifikationsmaßnahmen, die zu<br />
einer Bewertung dieser Thematik beitragen sollen.<br />
Aspekte der Hygiene wurden in der entsprechenden<br />
Session unter der Leitung von Prof. Lothar<br />
Dunemann für die Trink- und <strong>Abwasser</strong>seite diskutiert.<br />
Trotz der im Allgemeinen sehr guten Qualität des<br />
deutschen Trinkwassers wächst unter anderem aufgrund<br />
des sinkenden <strong>Wasser</strong>verbrauches die Anfälligkeit<br />
für eine Verkeimung mit Legionellen in der Hausinstallation.<br />
PD Dr. Joachim Tuschewitzki machte darauf<br />
aufmerksam, dass diese nicht durch die üblicherweise<br />
benutzten fäkalen Indikatoren angezeigt werden. Von<br />
der <strong>Abwasser</strong>seite näherte sich Prof. Regina M. de<br />
Oliveira Barros Nogueira dem Thema. Sie stellte aktuelle<br />
Forschungsergebnisse zur Elimination von Viren auf<br />
Kläranlagen vor. Die wichtigsten Prozesse stellen dabei<br />
die Adsorption am Belebtschlamm sowie die deutlich<br />
langsamer ablaufende Inaktivierung dar.<br />
In drei informativen Blöcken rund um das Thema<br />
Trinkwasser wurde über Trinkwassernetze, das<br />
Management und die Qualität von Trinkwasser referiert.<br />
Die erste Vortragsreihe, geleitet von Dr. Christoph<br />
Donner, behandelte den Betrieb und die Wartung von<br />
Trinkwassernetzen. Vorgestellt wurde eine Methodik zur<br />
Erarbeitung von optimierten Spülplänen, die von den<br />
<strong>Wasser</strong>versorgern selbstständig angewendet werden<br />
kann. Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung von<br />
Trinkwassernetzen stellen intelligente <strong>Wasser</strong>netze,<br />
welche zukünftig durch Sensortechnik frühzeitig Hinweise<br />
auf Störfälle geben können, dar. Auch wenn die<br />
Grundlage für Netzoptimierungen eine gute Datenbasis<br />
des Bestands voraussetze und diese nicht immer<br />
ge geben sei, so sollten fehlende Bestandsdaten nicht<br />
davon abhalten, strategisch mit solch innovativen<br />
Themen umzugehen, bekräftigte Erwin Kober. Für den<br />
Erhalt von <strong>Wasser</strong>versorgungsnetzen wurde eine<br />
systema tische Rehabilitations-Strategie vorgestellt, bei<br />
der die Sanierungsplanung auf durch Ausgrabung<br />
erhaltene Erfahrungen, der Altersstruktur und den<br />
Werkstoffen der Haltungen basiert. Indem bedarfsgerechte<br />
Sanierungen durchgeführt werden, könne die<br />
Qualität des Trink wassernetzes gesichert und Kosten<br />
eingespart werden.<br />
Die Moderation zum zweiten Trinkwasser-Block mit<br />
dem Unterthema „Management“ wurde von Prof. Martin<br />
Jekel übernommen. Vorgestellt wurden Strategien zur<br />
Forum Young Scientists<br />
Auch bei der diesjährigen Tagung fand das im letzten Jahr initiierte<br />
Forum Young Scientists statt, bei dem junge Wissenschaftler/-innen<br />
in Kurzvorträgen die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten und Dissertationen<br />
präsentieren konnten. Unter der Leitung von Dr. Harald<br />
Irmer wurden insgesamt acht Arbeiten vorgestellt. Die Abschlussarbeiten<br />
waren sowohl theoretischer (Fallstudie über die Entwicklung<br />
und Aufwertung von Fließgewässern, <strong>Abwasser</strong>ent sorgungskonzepte<br />
für ländliche Gebiete in Entwicklungs ländern) als auch praktischer<br />
Natur (Optimierung eines <strong>Wasser</strong>werkes, optimierte Membranreinigungen<br />
und Untersuchungen zur Phosphorrücklösung in der Nachklärung).<br />
Bei den Promotionsarbeiten wurde ein mathematisches<br />
Optimierungsmodell zur ressourcenorientierten <strong>Abwasser</strong>bewirtschaftung<br />
präsentiert. Des Weiteren wurden Untersuchungen zum<br />
Nitratabbau in Grundwasserleitern und zur Lachgasbildung bei der<br />
Behandlung von ammoniumbelasteten <strong>Abwasser</strong>strömen erläutert.<br />
Auch wenn das Forum Young Scientists erst zum zweiten Mal stattfand,<br />
war die Resonanz beim Publikum sehr gut, so dass auch bei<br />
der 47. Essener Tagung vom 5. bis 7. März 2014 in Essen Nachwuchswissenschaftlern<br />
die Möglichkeit zur Vorstellung ihrer Forschungsergebnisse<br />
geboten wird.<br />
Sicherung der <strong>Wasser</strong>hygiene, Herausforderungen, die<br />
im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel<br />
und sinkendem <strong>Wasser</strong>bedarf auftreten und das Ressourcenmanagement<br />
der Stadtwerke Düsseldorf bei<br />
der <strong>Wasser</strong>gewinnung. Prof. Martin Exner erläuterte die<br />
Aufgaben der Trinkwasserkommission, welche die<br />
Sicherung einer guten Trinkwasserqualität zum Ziel hat.<br />
Er bemängelte, dass Deutschland als „chemophobes<br />
Land“ chemische Problemstoffe mit der nötigen Sorgfalt<br />
betrachte, während mikrobiologische Parameter<br />
weniger Aufmerksamkeit erhielten. Siegfried Gendries<br />
präsentierte ein neues Tarifmodell, das von der RWW als<br />
Antwort auf den demographischen Wandel umgesetzt<br />
wurde. Die Einführung eines Systempreises, der etwa<br />
50 % der Kosten abdeckt anstelle eines Grundpreises<br />
von 20 % der Kosten, solle eine höhere Umsatzstabilität<br />
gewährleisten. In der nachfolgenden Diskussion wurde<br />
der sinkende <strong>Wasser</strong>verbrauch durch den demografischen<br />
Wandel auch als potenzielles Problem für die<br />
Sicherung der Trinkwasserqualität angesehen. Die Idee,<br />
die Landwirtschaft als Kunde für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
zu gewinnen, um den rückläufigen <strong>Wasser</strong>verbrauch zu<br />
kompensieren, fand breite Zustimmung.<br />
Dr. Wolfgang Leuchs führte durch die dritte Session<br />
zum Thema Qualität des Trinkwassers. In dieser wurde<br />
Bezug auf das Vorkommen und die Elimination von<br />
Spurenstoffen und pathogenen Krankheitserregern in<br />
Oberflächengewässern und Rohwasser zur Trinkwassergewinnung<br />
genommen. Die Eliminationsleistung der<br />
Verfahren zur Spurenstoffelimination sei generell sehr<br />
substanzspezifisch, bemerkte Prof. Martin Jekel. Die Ent-<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 611
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
Preisverleihungen<br />
Auf der 46. ESSENER TAGUNG im Eurogress Aachen zeichnete<br />
Professor Johannes Pinnekamp (1. v. r.), Vorsitzender<br />
der Oswald-Schulze-Stiftung, die Preisträger des diesjährigen<br />
Oswald-Schulze-Preises aus: Claudia Schenk, M.Sc.<br />
(2. v. l.), TU Darmstadt, („Energetische Optimierung der<br />
Klärschlammfaulung durch eine Bilanzierung auf Basis der<br />
organischen Substanz“), Dipl.-Ing. Thomas Franz Hofer<br />
(3. v. l.), TU Graz („Validierung, Charakterisierung und Klassifizierung<br />
von Mischwasserereignissen für das Einzugsgebiet<br />
Graz-West R05“) und Dipl.-Ing. Sarah Mühle (2. v. r.),<br />
RWTH Aachen („Die Auswirkungen des Klimawandels auf<br />
den Betrieb einer <strong>Abwasser</strong>reinigungsanlage“). Links im<br />
Bild ist der Geschäftsführer der Stiftung, Dr. Michael<br />
Krumm, zu sehen. Die Preise waren mit insgesamt 6000<br />
Euro dotiert.<br />
© www.stephan-rauh.com<br />
Die diesjährigen Förderpreise des Instituts zur Förderung<br />
der <strong>Wasser</strong>güte- und <strong>Wasser</strong>mengenwirtschaft e.V. (IFWW)<br />
verlieh Dr. Wulf Lindner (1. v. r.), Vorstandsvorsitzender des<br />
IFWW, an Dr.-Ing. Martin Leson (2. v. l.), der an der Ruhr-<br />
Universität Bochum seine Dissertation mit dem Titel<br />
„Untersuchungen zum Nitratabbau im Grundwasserleiter<br />
der Haltener Sande“ anfertigte, sowie an Ludwika Nieradzik<br />
(3. v. l.) von der Universität Duisburg-Essen („Biofouling<br />
removal from RO-membranes“) für die beste Masterarbeit.<br />
Insgesamt wurde ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro vergeben.<br />
Links im Bild ist Dr. Harald Irmer, Vorsitzender des<br />
Preisgerichtes, zu sehen.<br />
© www.stephan-rauh.com<br />
scheidung für ein Verfahren werde fallen, wenn die einzuhaltenden<br />
Leitparameter festgelegt werden. Prof.<br />
Mathias Ernst rief dazu auf, den Blick auf die relevanten<br />
Substanzen zu schärfen. Unter der Vielzahl der organischen<br />
Verbindungen im <strong>Wasser</strong> müssten die grundwasserrelevanten<br />
Substanzen identifiziert werden, um<br />
eine geeignete Behandlung durchzuführen.<br />
Dem Erhalt der <strong>Abwasser</strong>infrastruktur widmeten<br />
sich am Freitag vier Referenten unter Leitung von Prof.<br />
Theo G. Schmitt. Besonders deutlich wurde dabei, dass<br />
eine frühzeitige ganzheitliche Betrachtung der zu erhaltenden<br />
Infrastruktur zu erheblichen Kosteneinsparungen<br />
führen kann; z. B. bei der gemeinsamen Verlegung<br />
von Gas- und <strong>Wasser</strong>leitungen. Nicht immer können<br />
jedoch die verschiedenen Anforderungen vorteilhaft in<br />
Einklang gebracht werden, erläuterte Prof. Karsten<br />
Müller. Der Erhalt der Infrastruktur durch Prüfung und<br />
gegebenenfalls Sanierung von privaten <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
war in der jüngeren Vergangenheit ein viel<br />
diskutiertes Thema. Dr. Viktor Mertsch zeigte sich optimistisch,<br />
dass die neuen Regelungen, welche die<br />
Prüfung von privaten Anschlüssen entfristen, eine breite<br />
fachliche Zustimmung erhalten.<br />
Durch das weiterhin hochaktuelle Thema der<br />
Niederschlagswasserbewirtschaftung führte Dr. Wulf<br />
Lindner. Prof. Theo G. Schmitt stellte die Frage in den<br />
Raum: „Wie viel von der Beeinträchtigung des lokalen<br />
<strong>Wasser</strong>haushaltes können wir zurücknehmen?“ und<br />
sieht in der Entschleunigung der Regenwasserableitung<br />
eine Schlüsselfunktion. Die hohe hydraulische und stoffliche<br />
Belastung der kleinen Fließgewässer könne durch<br />
den Einsatz von Retentionsbodenfiltern erfolgreich vermindert<br />
werden, verdeutlichte Katrin Lemm in ihrer<br />
Vorstellung von effizienter Regenwasserbehandlung in<br />
Berlin. Ein positiver Nebeneffekt sei auch die hohe<br />
Keimabnahme, welche bei den bereits betriebenen<br />
Retentionsbodenfiltern festgestellt werden konnte.<br />
Die wichtige Rolle der Kosten in der Siedlungswasserwirtschaft<br />
wurde am Freitagvormittag parallel in<br />
dem von Prof. Bernd Wille moderierten Block zum Thema<br />
Management und Ökonomie diskutiert. Als geeignetes<br />
Instrument zur Kostensenkung und -optimierung<br />
Mai 2013<br />
612 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
wurde das Konzept des Benchmarkings thematisiert. So<br />
erläuterte Henning Werker Maßnahmen zur Einsparung<br />
und Optimierung von Kosten im Kanalbau am Beispiel<br />
der Stadt Köln. Durch das Benchmarking im Vergleich zu<br />
anderen Städten konnten Einsparpoten ziale, etwa im<br />
Bereich der Verkehrslenkung und der Erdbauarbeiten,<br />
aufgedeckt und realisiert werden. Dr. Claus Henning<br />
Rolfs berichtete von den Erfahrungen der Stadtentwässerungsbetriebe<br />
Düsseldorf mit Benchmarking im<br />
Bereich der <strong>Abwasser</strong>beseitigung und merkte an, dass<br />
Benchmarking nur mit einem gewissen Aufwand zum<br />
erwünschten Erfolg führen könne.<br />
Ein wichtiger Kostenfaktor in der <strong>Abwasser</strong>beseitigung<br />
und -behandlung ist die Energie, die Thema in<br />
dem von Prof. Harro Bode moderierten Block war. Einen<br />
Blick über den Tellerrand lieferten hier die Erörterungen<br />
von Dr. Katsumi Nomura, der Erfahrungen aus Japan<br />
hinsichtlich der Energieoptimierung auf Kläranlagen<br />
vorstellte. Insbesondere der Einsatz von energieeffizienten<br />
Belüftungssystemen und Aggregaten zur Entwässerung<br />
konnte zu einer Abnahme des Energieverbrauchs<br />
beitragen. Prof. Markus Schröder wies darauf<br />
hin, dass energieintelligente Kläranlagen auch ressourcenintelligent,<br />
in Vernetzung mit den Medien<br />
Boden und Luft, funktionieren müssten. So bestehe<br />
beispielsweise die Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen<br />
von etwaigen Baumaßnahmen mit zu<br />
bewerten. Ekkehard Pfeiffer erklärte, dass Energieeinsparungen<br />
kurzfristig vor allem durch eine Effizienzsteigerung<br />
im normalen Betrieb erreicht werden können,<br />
wohingegen mittelfristig Reinvestitionen als Chancen<br />
zur Minderung des Energieverbrauchs gesehen werden<br />
sollten und langfristig ein ressourcenoptimierter<br />
Zustand für die Zukunft erarbeitet und simuliert werden<br />
sollte. Von der Umsetzung der Theorie in die Praxis<br />
berichtete Dr. Jan Butz, der auf die Herausforderungen<br />
und Probleme eines Ingenieurbüros bei der Umsetzung<br />
von Anlagen zur <strong>Abwasser</strong>wärmenutzung einging.<br />
Abschließend konnte festgehalten werden, dass Wirtschaftlichkeit<br />
und Umweltverträglichkeit eine essentielle<br />
Rolle in der Siedlungswasserwirtschaft spielen,<br />
jedoch die umweltverträglichste Lösung nicht immer<br />
die wirtschaftlichste sei, so dass hier immer ein A bwägen<br />
stattfinden müsse.<br />
In seinem Schlusswort verwies Prof. Harro Bode auf<br />
die „exzellenten Vorträge“ und bekräftigte, dass es sich<br />
bei der Ressourcenschonung nicht nur um einen Appell<br />
handeln dürfe, sondern auch etwas getan werden<br />
müsse. Er lobte die Verbesserungen im Umweltschutz<br />
im Gegensatz zu den 1970er- und 1980er-.Jahren, legte<br />
jedoch nahe, dass dieser auch weiterhin vorangetrieben<br />
werden müsse. Somit bleibt für die <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft<br />
weiterhin viel zu tun. Fortschritte im Umweltund<br />
Ressourcenschutz werden sicherlich auch einen<br />
wichtigen Aspekt bei der 47. ESSENER TAGUNG darstellen,<br />
die vom 5. bis 7. März 2014 in Essen stattfinden<br />
wird.<br />
Autoren<br />
Eingereicht: 12.04.2013<br />
Dipl.-Ing. Anna Abels<br />
E-Mail: Abels@isa.rwth-aachen.de<br />
Kassandra Klaer, M.Sc.<br />
Dipl.-Ing. Danièle Mousel<br />
Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
der RWTH Aachen |<br />
Mies-van-der-Rohe-Straße 1 |<br />
D-52074 Aachen<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 613
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
5. Kolloquium der<br />
Trinkwasserspeicherung der SITW<br />
Praxisseminar am 28. Februar 2013 in Koblenz<br />
Corinna Scholz<br />
Wegen des großen Andrangs musste man in der Fachhochschule Koblenz auf einen größeren Raum ausweichen,<br />
um die 180 Teilnehmer am diesjährigen SITW-Kolloquium unterzubringen. Anstatt wie gewohnt in<br />
der Maschinenhalle der Fachrichtung Bauwesen kamen <strong>Wasser</strong>meister und Leiter von Betreibern sowie Planer<br />
in den Räumen des Fachbereichs Architektur unter.<br />
Die SITW, Fachvereinigung Schutz und Instandsetzung von Trinkwasserbehältern e.V., bot zum 5. Kolloquium<br />
ein besonders vielfältiges Themenangebot. „Diese Bandbreite hatten wir noch nie – und so viele<br />
Teilnehmer auch nicht“, freut sich Eckart Flint, 1. Vorsitzender der SITW.<br />
Neufassung des Regelwerks<br />
Mit Spannung erwarteten die Teilnehmer den Vortrag<br />
von Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach über die DVWG-<br />
Arbeitsblätter W 300 und W 316, die sich seit Jahren in<br />
der Überarbeitung befinden. Gleich vorweg: Noch in<br />
diesem Jahr wird man in die Gelbdruckphase einsteigen.<br />
Die Ausschüsse treffen sich monatlich und die<br />
beiden Werke dürften deutlich umfangreicher werden:<br />
Knapp 300 Seiten werden beide Arbeitsblätter um -<br />
fassen, während das „alte“ Regelwert lediglich 80 Seiten<br />
erreicht.<br />
Das künftige Regelwerk W 300 wird in fünf Teilen<br />
gegliedert sein, die sich mit<br />
1. Planung und Bau,<br />
2. Betrieb und Instandhaltung,<br />
3. Instandsetzung und Verbesserung,<br />
4. Werkstoffen und Qualitätssicherung auf der<br />
Baustelle sowie<br />
5. Werkstoffen, Anforderungen und Prüfung<br />
befassen.<br />
„Das W 316 wird komplett auf den Kopf gestellt“,<br />
berichtete Prof. Breitbach, Gutachter und Dozent an der<br />
FH Koblenz. Denn die neuen Inhalte des W 300 würden<br />
auch ins W 316 einfließen, soweit sie die Anforderungen<br />
an die ausführenden Firmen betreffen. Das neue Regelwerk<br />
führe insgesamt dazu, den Neubau, verschiedene<br />
Werkstoffe sowie die Arbeit der Planer zu regeln. Im<br />
Zusammenhang mit der Zertifizierung der Fachfirmen<br />
werden auch Materialien und Systeme künftig zertifiziert.<br />
Frage aus dem Auditorium war, wie damit umzugehen<br />
sei, wenn Hersteller in der Produktion von ihren<br />
Rund 180 Teilnehmer besuchten das 5. Kolloquium der Trinkwasserspeicherung der SITW in Koblenz. Alle Fotos: © Corinna Scholz<br />
Mai 2013<br />
614 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
Eckart Flint, 1. Vorsitzender der<br />
SITW, eröffnete die Veranstaltung<br />
in der Fachhochschule Koblenz.<br />
Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach<br />
erläuterte die Neufassungen der<br />
DVWG-Arbeitsblätter W 300 und<br />
W 316.<br />
Dipl.-Ing. Karl Dettmar, Geschäftsbereichsleiter<br />
<strong>Wasser</strong> der EVS Energieversorgung Sylt GmbH,<br />
veranschaulichte, wie wichtig gutes Projektmanagement<br />
für die praktische Umsetzung<br />
von Sanierungsaufgaben ist.<br />
Vorgaben abwichen. Antwort von Prof. Breitbach: „Änderungen<br />
im Herstellungsprozess müssen künftig schriftlich<br />
dokumentiert und dem Fremdüberwacher mitgeteilt<br />
werden, der über eine eventuelle Nachprüfung<br />
entscheidet.“ Zudem gebe der Teil 5 des W 300 neue<br />
Überwachungsintervalle vor. Als Beispiel nannte der<br />
Experte die Zwischenprüfungen, denn bislang stehe<br />
eine Überwachung nur alle zehn Jahre an. Nach neuer<br />
Regelung sind es dann nur noch zweieinhalb Jahre.<br />
Zudem muss künftig auch die Qualität der Ausgangsstoffe<br />
für die Herstellung festgehalten werden.<br />
Arbeiten, wo andere Urlaub machen<br />
Aus einem der nördlichsten Versorgungsgebiete berichtete<br />
Dipl.-Ing. Karl Dettmar über die Sanierung aus Sicht<br />
eines Betreibers. Der Geschäftsbereichsleiter <strong>Wasser</strong> der<br />
EVS Energieversorgung Sylt GmbH gab viele praktische<br />
Tipps, was im Zusammenspiel aller Beteiligten während<br />
eines Projektes alles zu beachten ist. „Viele Betreiber<br />
überschätzen die eigene Fachkompetenz“, meinte der<br />
Bauingenieur provozierend und appellierte an Planer<br />
und ausführende Firmen, diesen Umstand zu beachten.<br />
Zudem riet er gerade kleineren <strong>Wasser</strong>versorgern, die<br />
Projektverantwortlichen mit der nötigen Entscheidungskompetenz<br />
auszustatten sowie sich geeignete<br />
externe Hilfe zu holen.<br />
Wenig hilfreich sei es, statt einen Trinkwasser -<br />
behälter von einem Spezialisten planen zu lassen, einen<br />
Architekten, der auf Kirchtürme spezialisiert ist, aber<br />
engen Kontakt zum Bürgermeister pflegt, zu beauftragen.<br />
Bei der Auswahl passender Partner wäre außerdem<br />
ein kritischer Blick auf die Referenzen angebracht:<br />
„Die Erfahrung des Projektverantwortlichen vor Ort<br />
zählt – und nicht die lange Liste von Erfolgen auf der<br />
Homepage des Ingenieurbüros.“<br />
Zudem regte Karl Dettmar an, eine Sanierungsmaßnahme<br />
beim DVGW Cert anzukündigen. Die Prüfinstanz<br />
könnte bei einem nach W 316 zertifizierten Unternehmen<br />
unter Umständen einen Auditor schicken. Das<br />
koste den Versorger keinen Cent und brächte zusätzliche<br />
Sicherheit.<br />
Wichtig sei, bei der Sanierung genügend finanzielle<br />
und zeitliche Reserven einzuplanen. „Denn man weiß<br />
eigentlich erst nach dem Strahlen, was einen genau<br />
erwartet“, so der Geschäftsbereichsleiter. Schließlich<br />
empfahl er, eindeutige Werkverträge mit den Ingenieurbüros<br />
zu schließen, weil die planenden Auftragnehmer<br />
dann den Erfolg schuldeten. Hier könne ein Honorarund<br />
Baujurist wertvolle Tipps geben.<br />
Braune Flecken<br />
Rund 50 % bis 60 % der Trinkwasserbehälter in der<br />
Schweiz seien von sogenannten braunen Flecken<br />
betroffen, berichtete Dipl.-Bauing. (FH) Daniel Oberhänsli,<br />
Geschäftsführer der Schweizer suicorr AG. Der<br />
Schadensverlauf sei nicht zwingend vorhersehbar: Er<br />
könne nach zwei Jahren auftreten oder erst nach drei<br />
Jahrzehnten. Die Trinkwasserqualität wäre nicht beeinträchtigt;<br />
vielmehr stellten die Flecken einen optischen<br />
Schaden dar und träten vornehmlich an bestimmten<br />
Stellen auf – unter anderem an Bereichen der Betonwand,<br />
die von hinten nicht belüftet sind.<br />
Obwohl auch in manchen Trinkwasserbehältern in<br />
Deutschland braune Flecken auftreten, war die Erläu-<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 615
FACHBERICHTE Tagungsbericht<br />
terung der Ursachen für manchen der Teilnehmer neu.<br />
Als Ursache nannte Oberhänsli ungeplante Ionenströme<br />
im Behälter, welche die Oberfläche der Mörtelbeschichtung<br />
angreifen. Diese entstünden beispielsweise, wenn<br />
unterschiedliche Materialien mit abweichenden Potenzialen<br />
eingesetzt würden. Hier könne die Situation<br />
durch galvanische Trennung der Materialien entschärft<br />
werden. Dies mag bei Neubauten und Instandsetzungen<br />
üblich sein; wird bei nachträglichen Installationen<br />
durch andere Gewerke aber nicht immer beachtet<br />
bzw. versehentlich aufgehoben.<br />
Außerdem eigne sich der kathodische Korrosionsschutz<br />
(KKS) zur Verhinderung der Flecken, den die<br />
suicorr AG realisiert. Das Prinzip: Den ungewollten<br />
Stromfluss mit einer Gegenspannung neutralisieren –<br />
ähnlich der Opferanode im Warmwasserbereiter.<br />
Eine andere Gegenmaßnahme stelle die Instandsetzung<br />
der gesamten Oberfläche mit möglichst dicker<br />
Beschichtung niedriger Porosität dar, um Ionenströme<br />
einzudämmen.<br />
Für ein reales Projekt stellte der Schweizer konkrete<br />
Zahlen vor: Eine Potenzial-Feld-Messung in einer<br />
<strong>Wasser</strong>kammer ergab Differenzen von mehreren<br />
100 mV innerhalb weniger Meter. „Da muss ein Strom<br />
fließen. Der Behälter funktionierte quasi wie eine<br />
schwache Batterie“, berichtete Daniel Oberhänsli und<br />
schloss seinen Vortrag damit: „KKS ist ein Exot in der<br />
Trinkwasserspeicherung, vielleicht weil sich Bauingenieure<br />
mit Elektrotechnik nicht so gut auskennen. Die<br />
Erfolgsquote zum Stopp brauner Flecken ist jedoch<br />
vielversprechend.“<br />
Praktische Einblicke<br />
In diesem Jahr gestalteten drei Mitglieder der SITW den<br />
beliebten Praxisblock. Sie präsentierten aus unterschiedlichen<br />
Perspektiven, wie sich Fehler bei Sanierungsprojekten<br />
vermeiden lassen. Andreas Stahl von Aqua Stahl<br />
GmbH beleuchtete den Bereich Planung, Dipl.-Ing. Jan<br />
Rassek von der w+s bau-instandsetzung GmbH widmete<br />
sich der Materialauswahl und über Planungsfehler bei<br />
Stimmen der Teilnehmer<br />
„Der Spannungsbogen hat mir<br />
besonders gut gefallen: Vom Regelwerk<br />
über die Sicht der Betreiber<br />
und Planer bis zur Ausführungsebene<br />
war alles dabei.“<br />
Dipl.-Ing. Roland Desgranges, Ge -<br />
schäftsführer der CP BERATENDE<br />
INGENIEURE GmbH & Co. KG in<br />
Spiesen-Elversberg.<br />
Roland Desgranges war zum ersten<br />
Mal auf einem SITW Kolloquium. Er<br />
wurde durch den Einladungs-Flyer<br />
auf das Seminar aufmerksam und<br />
besuchte es am 28. Februar 2013, um<br />
sich fortzubilden und Anregungen zu<br />
holen. Sein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern<br />
agiert seit Jahrzehnten als<br />
Fach- und Objektplaner für Trinkwasserversorgung.<br />
„Das Kolloquium bietet eine ganze<br />
Menge an Informationen, die uns<br />
bei künftigen Sanierungen helfen<br />
werden.“<br />
Erich Müller ist <strong>Wasser</strong>meister der<br />
Stadt Büren, die ein <strong>Wasser</strong>werk im<br />
Eigenbetrieb führt.<br />
Erich Müller wurde vom DVGW über<br />
das Praxisseminar der SITW informiert<br />
und kam erstmals nach Koblenz,<br />
um sich über die Neuerungen im<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 300 zu informieren.<br />
Sein Aufgabengebiet umfasst<br />
die komplette <strong>Wasser</strong>versorgung: von<br />
der Gewinnung bis hin zur Übergabe<br />
an den Endkunden.<br />
„Qualität ist kein Selbstläufer und<br />
nicht zum Nulltarif zu bekommen.<br />
Da steht permanente Weiterbildung<br />
und Kontaktpflege an wie hier auf<br />
dem SITW Kolloquium.“<br />
Bernd Schulze ist Bauleiter für Betonbau<br />
bei der Umwelttechnik & <strong>Wasser</strong>bau<br />
GmbH in Blankenburg/Harz.<br />
Bernd Schulze ist seit 35 Jahren im<br />
Unternehmen beschäftigt und betreut<br />
Neubau und Sanierung von Trinkwasserbehältern<br />
(TWB). Er ist Sachkundiger<br />
Planungsingenieur für Schutz und<br />
Instandsetzung von Betonbauteilen.<br />
„Die Erfahrungsberichte von Bauherren<br />
und ausfüh renden Firmen<br />
liefern wichtige Details, die ich in<br />
künf tigen Projekten anwenden<br />
kann. Zudem haben sich interessante<br />
Gespräche ergeben.“<br />
Katrin Hahlbeck, Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen<br />
und Vertriebs- und Projektleiterin<br />
für den Bereich Trinkwasserbehälter<br />
bei der Drössler GmbH<br />
Umwelttechnik in Siegen.<br />
Katrin Hahlbeck hat sich gezielt zum<br />
5. Kolloquium angemeldet, weil ihr<br />
die vorherige Veranstaltung sehr gut<br />
ge fallen hatte. Drössler Umwelttechnik<br />
erstellt Betonbehälter in Fertigteilbauweise<br />
unter anderem für die Trinkwasserspeicherung<br />
mit Fassungsvermögen<br />
von 25 bis 15 000 m³.<br />
„Die kritische Betrachtung von Sanierungen<br />
aus Sicht des Bauherrn war<br />
für mich besonders interessant. Und<br />
ich fand es positiv, dass auch mögliche<br />
Fehler angesprochen wurden.“<br />
Holger Rink, <strong>Wasser</strong>werksmeister bei<br />
der <strong>Wasser</strong>verbund Niederrhein GmbH<br />
in Moers.<br />
Holger Rink ist für die Aufbereitungsund<br />
Speicheranlagen zuständig und<br />
begleitet Projekte wie Behältersanierungen<br />
und den Bau von Pumpstationen.<br />
Er war zum zweiten Mal auf<br />
einem SITW Kolloquium und bekam<br />
wertvolle Hinweise zum aktuellen<br />
Stand des Regelwerks sowie Eindrücke<br />
und Hinweise zu anderen Unternehmen.<br />
Mai 2013<br />
616 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
FACHBERICHTE<br />
der Ausführung berichtete Dipl.-Ing. Berthold Bleser von<br />
GFB Ges. für Baukwerksanierung mbH.<br />
Hygienekonzept<br />
Im letzten Vortrag vertiefte Prof. Breitbach die hygienischen<br />
Anforderungen an die Sanierung im Behälter,<br />
dem Bedienungshaus und dem Betriebsgelände nach<br />
dem künftigen W 300, die in einem Hygienekonzept<br />
münden werden. „Das ist quasi als Hausordnung für alle<br />
tätigen Personen auf der Baustelle zu verstehen und<br />
komplett neu in der W 300 enthalten“, erläuterte der<br />
Experte. Als eine Maßnahme würden verschiedene<br />
Hygiene-Schutzzonen eingeführt und aufsteigend mit<br />
Farbtafeln markiert. Für jede Zone sei ein Maßnahmenkatalog<br />
aufzustellen, der vom externen Entsorger bis<br />
zum Bauherren-Chef einzuhalten ist.<br />
„Hygiene hat Vorrang vor Baufortschritt und Wirtschaftlichkeit“,<br />
betonte der Dozent und zeigte dazu ein<br />
Bild aus vergangenen Tagen: Das Bierzelt im Behälter<br />
am „Tag der offenen Tür“ wird es künftig nicht mehr<br />
geben. „Wenn sich keiner mehr über den Hygieneschutz<br />
beschwert, haben wir es geschafft“, beendete Prof. Breitbach<br />
sein Referat.<br />
Ein Teilnehmer erkundigte sich nach dem Aufwand<br />
für ein solches Hygienekonzept und erhielt die Antwort,<br />
dass die meisten Regelungen Selbstverständlichkeiten<br />
seien und bei richtiger Vorplanung keinerlei Kosten entstünden.<br />
Gegebenenfalls beeinträchtige das regelgerechte<br />
Wechseln der persönlichen Hygienekleidung<br />
den Arbeitsablauf mit höchstens 10 % der Tagesleistung.<br />
Das sei bei den Versorgern üblich und die Hygiene wert.<br />
Nächsten Termin vormerken<br />
Das 6. Kolloquium ist geplant, aber noch nicht terminiert.<br />
Interessierte Teilnehmer können sich vormerken<br />
lassen und erhalten beizeiten weitere Informationen<br />
und eine Einladung. Auch Anregungen für Vortragsthemen<br />
und Referenten sind herzlich willkommen.<br />
Weitere Infos und Anmeldung:<br />
E-Mail: verwaltung@sitw.de |<br />
Tel. (052 31) 96 09 18 |<br />
Fax (052 31) 661 02 |<br />
www.sitw.de<br />
Autorin<br />
Dip.-Ing. Corina Scholz<br />
E-Mail: scholz.corinna@t-online.de |<br />
Paul-Sorge-Straße 66a |<br />
D-22459 Hamburg<br />
S1 / 2012<br />
Volume 153<br />
<strong>gwf</strong><br />
INTERNATIONAL<br />
The leading specialist journal<br />
for water and wastewater<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
The leading Knowledge Platform in<br />
Water and Wastewater Business<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
P e r f o r m a n c e 3<br />
Delta Blower, Delta Hybrid and Aerzen Turbo, the perfect combination<br />
of 3 high-performance technologies – for maximum energy efficiency<br />
Reliability expected by a technology leader<br />
Go for the peak of performance!<br />
www.aerzen.com<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH<br />
Phone: + 49 51 54 / 8 10 . info@aerzener.de . www.aerzen.com<br />
Titel GWF.indd 1 18.10.2012 10:19:10 Uhr<br />
MIS Universell.<br />
1/2012<br />
Jahrgang 153<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Established in 1858, »<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>« is regarded<br />
as the leading publication for water and wastewater<br />
technology and science – including water production,<br />
water supply, pollution control, water purification and<br />
sewage engineering.<br />
It‘s more than just content: The journal is a publication<br />
of several federations and trade associations. It comprises<br />
scientific papers and contributions re viewed by experts, offers<br />
industrial news and reports, covers practical infor mation, and<br />
publishes subject laws and rules.<br />
In other words: »<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>« opens a direct way to<br />
your target audience.<br />
Boost your Advertising! Now!<br />
Das Schnellmontagesystem mit eingebauter Injektionsmembran.<br />
MIS ist die innovative Hauseinführung, mit der Sie Bohrungen schnell gas- und wasserdicht machen:<br />
• Expansionsharz-Schnellabdichtsystem für Gas- und <strong>Wasser</strong>hauseinführungen.<br />
• Integrierter Außenflansch. Keine Nachbearbeitung der Außenabdichtung.<br />
• Gleichmäßige Harzverteilung in alle Hohlstellen/Ausbrüche – für alle Mauerwerke geeignet.<br />
• Besonders sicher in der Anwendung – ein Arbeitsgang, eine Kartuschenfüllung.<br />
Damit Wände dichter bleiben. Und Gebäude länger leben.<br />
Informieren Sie sich jetzt: Telefon: 0 73 24 96 00-0 · Internet: www.hauff-technik.de<br />
Mit dem Kopf durch die Wand.<br />
Knowledge for the Future<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH<br />
Arnulfstraße 124<br />
80636 München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Media consultant:<br />
Inge Matos Feliz<br />
matos.feliz@di-verlag.de<br />
Mai Phone: 2013 +49 89 203 53 66-22<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> Fax: +49 617 89 203 53 66-99<br />
HAU-ALL-09-1010 Anz_BP2_210x216.indd 1 26.08.11 13:03
PRAXIS<br />
Weltweiter Einsatz innovativer Filtersysteme für<br />
zentrale und dezentrale Trinkwasseraufbereitung<br />
Meerwasserentsalzungsanlage Hamma/Algier.<br />
Einweihung der EVERS EASY FILTRATION ® in<br />
Magompu/Kerala Indien.<br />
<strong>Wasser</strong>technologie ist die Kernkompetenz<br />
der EVERS e.K.<br />
Das mittelständische Unternehmen<br />
aus Hopsten (bei Münster/Westfalen)<br />
präsentierte dem internationalen<br />
Fachpublikum auf der Messe<br />
„<strong>Wasser</strong> Berlin International“ innovative<br />
Filtersysteme und Filtermaterialien.<br />
Zum Beispiel seine EVERZIT®<br />
Filtermaterialien für die Ein- und<br />
Mehrschichtfiltration, der Enteisenung<br />
und Entmanganung sowie<br />
der Entsäuerung von Grundwasser.<br />
Übrigens: Täglich werden über<br />
22,3 Milliarden Liter Trinkwasser mit<br />
Filtermaterialien von EVERS aufbereitet.<br />
International konzentriert sich<br />
EVERS e. K. derzeit auf den indischen<br />
Markt. In der 5-Millionenstadt Chennai<br />
an der Ostküste Südindiens wurden<br />
für die zentrale Meerwasserentsalzungsanlage<br />
rund 500 m³<br />
EVERZT® N geliefert. Die Vorfiltration<br />
der SWRO Anlage hat eine Aufbereitungskapazität<br />
von etwa 200 000 m³<br />
pro Tag.<br />
Mehr als 6 000 Anlagen weltweit<br />
filtern mit EVERZIT® N<br />
Als Beispiel für dezentrale Trinkwasseraufbereitung<br />
ist das im April<br />
2012 eingeweihte Projekt Magompu<br />
im indischen Bundesstaat Kerala<br />
zu nennen. Im Mittelpunkt steht das<br />
innovative Filtersystem EVERS EASY<br />
FILTRATION®. Es wurde speziell für<br />
die dezentrale Trinkwasseraufbereitung<br />
in Entwicklungs- und Schwellenländern<br />
entwickelt. Diese Anlage<br />
kann bis zu 1000 Einwohner täglich<br />
mit hochwertigem Trinkwasser versorgen.<br />
Neben dem europäischen<br />
Patent wurde dem Filtersystem<br />
auch das indische Patent zuerteilt.<br />
In mehr als 6000 Anlagen auf der<br />
ganzen Welt kommt heutzutage Filtermaterial<br />
des Typs EVERZIT® N zum<br />
Einsatz. Als verfahrenstechnischer<br />
Meilenstein kann die erstmals im<br />
Jahr 2005 großtechnische Umsetzung<br />
der EVERZIT® N Einschichtfiltration<br />
in einem der größten <strong>Wasser</strong>werke<br />
der Welt bezeichnet werden.<br />
„Filtration über EVERZIT® N ist die<br />
wirtschaftlichste Art <strong>Wasser</strong> aufzubereiten“,<br />
so Dr. Hatukai, verantwortlicher<br />
Projektleiter des israelischen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgers Mekorot.<br />
Durch die hohe Materialqualität<br />
kann die Aufbereitungsleistung<br />
maximiert werden und gleichzeitig<br />
die Betriebskosten für die Rückspülung<br />
der Filter minimiert werden.<br />
Aber auch in Deutschland ist das<br />
Unternehmen von Hamburg bis<br />
zum Bodensee aktiv. Das <strong>Wasser</strong>werk<br />
Sipplinger Berg filtert mit<br />
EVERZIT® N pro Jahr mehr als 130<br />
Millionen Kubikmeter Bodenseewasser.<br />
In der Filterhalle entfernen<br />
27 Mehrschichtfilter mit einer<br />
Gesamtfläche von etwa 3 000 m 3<br />
alle Trübstoffe und sorgen für hohe<br />
Sicherheit vor mikrobiologischen<br />
Beeinträchtigungen.<br />
Kleinfiltersysteme für den<br />
Einsatz in Not- und Katastrophengebieten<br />
Hohes Interesse generieren auch<br />
die Kleinfiltersysteme wie das EVERS<br />
WATER WONDER® mobil, das EVERS<br />
WATER WONDER® mini und EVERS<br />
EASY FILTRATION®. Sie sind speziell<br />
für den Einsatz in Not- und Katastrophengebieten<br />
entwickelt. Aber auch<br />
im privaten Gebrauch (z. B. für Segler<br />
und Camper) leisten sie gute<br />
Dienste.<br />
Zu den neuesten Innovationen<br />
zählt der professionelle Filter ever-<br />
Filt®, entwickelt für Kleinpools in<br />
Garten und Freizeit. Das Filtersystem<br />
wird zwischen Beckenauslauf<br />
und Pumpenzulauf gesetzt und<br />
macht das <strong>Wasser</strong> innerhalb von<br />
24 Stunden wieder klar und sauber.<br />
EVERS e. K. beschäftigt 14 Mitarbeiter<br />
und ist seit fast zehn Jahren<br />
nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN<br />
ISO 14001 zertifiziert. Firmengründer<br />
ist der Ingenieur Werner Evers.<br />
Im Zuge der Unternehmensnachfolge<br />
leitet Dipl.-Chem. (Univ.) Stephan<br />
Evers als Generalbevollmächtigter<br />
seit acht Jahren das operative<br />
Geschäft der EVERS e. K.<br />
Sein Bruder, Dipl.-Ing. Thomas<br />
Evers, betreibt die EVERS ENGENEE-<br />
RING. Das Planungsbüro für effiziente<br />
Filtration in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
(für Schwimmbäder,<br />
Indus triewasser und Deponien) er -<br />
stellt Fachgutachten und optimiert<br />
be stehende Anlagen.<br />
Kontakt:<br />
EVERS e.K. WASSERTECHNIK und<br />
ANTHRAZITVEREDELUNG,<br />
Stephan Evers,<br />
Rheiner Straße 14a, D-48496 Hopsten,<br />
Tel. (05458) 9307-0,<br />
E-Mail: info@evers.de, www.evers.de<br />
Mai 2013<br />
618 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRAXIS<br />
Weniger Datenflut, mehr Informationen<br />
in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Auf Druck der Behörden setzt die <strong>Wasser</strong>wirtschaft in Großbritannien verstärkt auf Lebenszyklus-Management<br />
Systeme (Whole Life Asset Management). Sie werden als optimale Lösung angesehen, um die Effizienz<br />
der gesamten Anlage zu steigern, die Kosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen. Für diese Umsetzung<br />
sind verstärkt qualitativ hochwertige Dateninformation notwendig, was jedoch nicht gleichbedeutend mit<br />
einer erhöhten Datenmenge sein sollte. Vor diesem Hintergrund richtete Mitsubishi Electric in Großbritannien<br />
die Fachkonferenz „Innovationen in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft vorantreiben” aus, um anhand von Beispielen vorzustellen,<br />
wie Unternehmen mit diesen neuen Herausforderungen umgehen.<br />
Der Titel von Stephen Hawking<br />
nächstem Buch wird zwar kaum<br />
lauten „Eine kurze Geschichte der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsdaten”, jedoch<br />
könnte eine solche Studie tatsächlich<br />
wichtige Themen verdeutlichen.<br />
Noch vor wenigen Jahrzehnten<br />
war die <strong>Wasser</strong>wirtschaft nicht<br />
automatisiert, das hat sich mit der<br />
technologischen Entwicklung geändert.<br />
Effizienz rückte dabei immer<br />
stärker in den Mittelpunkt: Bereitstellung,<br />
Qualität und Zuverlässigkeit<br />
sollten zunehmend verbessert,<br />
Kosten reduziert und gleichzeitig<br />
Arbeitsplätze gesichert werden.<br />
Während der 1990er-Jahre installierten<br />
viele mittelgroße bis große<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungs- und Pumpenanlagen<br />
SCADA-Systeme (SCADA =<br />
Supervisory Control and Data Ac -<br />
quisition), was bereits zu einer deutlichen<br />
Effizienzsteigerung führte.<br />
Zwischen 2000 und 2009 versuchten<br />
die Planer dann, die verschiedenen<br />
SCADA-Systeme zu<br />
einem Netzwerk zusammenzubringen.<br />
Große Datenmengen wurden<br />
gesammelt und an die zentralen<br />
Computersysteme übertragen,<br />
al lerdings brachte dieses Vorgehen<br />
nicht den erwarteten Effizienzgewinn.<br />
Nach einiger Überlegung wurde<br />
klar, dass die Verwaltung nur einen<br />
geringen Anteil dieser zusätzlichen<br />
Daten nutzte. Weitere Analysen<br />
ergaben zwei Datenarten: Werte,<br />
die für die zentrale Nutzung kaum<br />
relevant waren und solche, die zwar<br />
nützlich, allerdings in einem für<br />
die Zielgruppe nicht verständlichen<br />
Ende 2012 lud Mitsubishi Electric in Großbritannien Branchenexperten<br />
und Fachleute zur Konferenz „Driving Innovations in the Water Industry<br />
Conference” ein, um aufzuzeigen, wie Unternehmen heute mit den<br />
neuen Herausforderungen umgehen.<br />
Format vorlagen. Beispielsweise<br />
konnte anhand der Daten aufgezeigt<br />
werden, dass sich eine Pumpe<br />
in einer entlegenen Anlage bereits<br />
seit sechs Monaten immer wieder<br />
selbst an- und abschaltete. So lagen<br />
der Technik aussagekräftige Hinweise<br />
auf einen Wartungsfall vor.<br />
In einem neuen Konzept entwickeln<br />
die Anwender jetzt ihre eigenen<br />
Subsysteme und erschaffen<br />
dadurch eine leistungsstarke Architektur,<br />
die sie bei der Datenauswertung<br />
unterstützt. Mark Narbrough<br />
vom Systemspezialisten Grontmij<br />
UK erklärt: „Wir fragen die Beschäftigten,<br />
welche Daten ihnen in ihren<br />
Arbeitsabläufen Entscheidungen<br />
erleichtern. Häufig sind diese Daten<br />
tatsächlich bereits auf ihren Systemen<br />
verfügbar, müssen aber in<br />
einem verständlichen Format aufbereitet<br />
werden. Wenn die Mitarbeiter<br />
dann diese Werte nutzen, können<br />
wir versuchen, sie in ihrer Arbeit<br />
weiter zu unterstützen, Funktionen<br />
zu erweitern und die Kommunikation<br />
mit Kollegen zu verbessern.“<br />
Die britischen Behörden nehmen<br />
dieses Thema sehr ernst. Das<br />
wurde besonders deutlich, als<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsunternehmen,<br />
die ihre Investitionspläne im Zuge<br />
der letzten Preisprüfung nicht mit<br />
Daten im vorgegebenen Format<br />
stützen konnten, Strafen in Höhe<br />
von mehreren hundert Millionen<br />
Pfund zahlen mussten. Die Behörden<br />
streben ein Lebenszyklus-<br />
Management-Konzept an, bei dem<br />
die Gesamtausgaben im Mittelpunkt<br />
stehen.<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 619
PRAXIS<br />
Über Mitsubishi Electric<br />
Die Mitsubishi Electric Corporation kann auf 90 Jahre Erfahrung in der Herstellung<br />
zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Produkte für Industrie- und Privatkunden in<br />
allen Teilen der Welt zurückblicken. Das Unternehmen mit weltweit über 117 000 Mitarbeitern<br />
ist Marktführer für Elektro- und Elektroniklösungen und -produkte in Bereichen<br />
wie Unterhaltungselektronik, Informationsverarbeitung, Medizin-, Kommunikations-,<br />
Raumfahrt-, Satelliten- und Industrietechnik sowie in Produkten für die Energiewirtschaft,<br />
<strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong>, das Transportwesen und den Bausektor. Im<br />
Geschäftsjahr zum 31. März 2012 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von<br />
36,3 Mrd. Euro*.<br />
In über 30 Ländern sind Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren<br />
sowie Fertigungsstätten angesiedelt.<br />
Sitz der deutschen Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. Industrial Automation<br />
ist Ratingen bei Düsseldorf. Sie gehört zu der am selben Standort befindlichen<br />
Factory Automation – European Business Group, die wiederum der Mitsubishi Electric<br />
Europe B.V., einer hundertprozentigen Tochter der Mitsubishi Electric Corporation,<br />
Japan zugeordnet ist.<br />
Zu ihren Aufgaben zählt die Koordination von Vertrieb, Service und Support der regionalen<br />
Niederlassungen und Vertriebspartner in Deutschland, Österreich, der Schweiz<br />
und den Beneluxländern.<br />
*Wechselkurs 109,56 Yen = 1 Euro, Stand 31.3.2012 (Quelle: Deutsche Bundesbank)<br />
Vernetztes Denken<br />
„Tatsächlich ist die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
in puncto Vernetzung von Managementfunktionen<br />
vielen anderen<br />
Branchen weit voraus. Sie ebnet<br />
sogar den Weg für andere.“ Narbrough<br />
erklärt weiter, dass bei der<br />
Entwicklung eines Systems jeder<br />
Anwender befragt werden muss,<br />
welche Daten er braucht, wie oft<br />
seiner Meinung nach Updates nötig<br />
sind, wie er die Informationen verarbeitet<br />
und welche Maßnahmen er<br />
von ihnen ableitet. Außerdem sollte<br />
jeder Mitarbeiter erklären, wie seine<br />
Arbeit nach seiner Ansicht in das<br />
unternehmensweite System passt.<br />
„Wir sammeln ausschließlich solche<br />
Werte, die in nutzbare Informationen<br />
umgewandelt werden. Außerdem<br />
arbeiten wir nach dem Prinzip<br />
„Report by Exception“ statt nach<br />
„Report by Event“ – und das macht<br />
häufig den Unterschied aus zwischen<br />
bloßen Daten und tatsächlichen<br />
Informationen.“<br />
Scottish Water setzt diese Herangehensweise<br />
in die Tat um: Das<br />
Unternehmen führt ein neues System<br />
in den Highlands und auf<br />
den schottischen Inseln ein. Einfach<br />
ausgedrückt, erfassen Außendiensttechniker<br />
an mitunter sehr<br />
entlegenen Standorten Daten mittels<br />
Tablet-PCs anstatt auf Papier.<br />
Mit dieser Strategie soll eine digitale<br />
Plattform aufgebaut werden,<br />
die die gesamte Organisation mit<br />
allen Funktionen miteinander verbindet.<br />
„Wir haben an über 100 Standorten<br />
einen Testlauf durchgeführt und<br />
übertragen das Projekt jetzt auf<br />
ganz Scottish Water“, beschreibt<br />
Sheila Campbell-Lloyd, Waste Water<br />
Operations Manager für die Region<br />
Nord und eine treibende Kraft hinter<br />
der Einführung der Technologie.<br />
„Bei dem alten papierbasierten System<br />
bestand die Gefahr, dass zentrale<br />
Datensätze bereits über Monate<br />
veraltet waren. Die Grafiken auf den<br />
Tablet-PCs ähneln den alten Charts<br />
und wurden von den Kollegen sehr<br />
gut angenommen. Sie erfassen die<br />
gleichen Daten, auf deren Grundlage<br />
die Software Berichte erstellt<br />
über Prozessergebnisse, Arbeitspläne,<br />
routinemäßige und außerordentliche<br />
Wartungen sowie Energie-,<br />
Arbeitsschutz- und Umweltparameter.“<br />
Wenn alles in Ordnung scheint,<br />
werden die Berichte archiviert. Bei<br />
potenziellen Problemen werden je<br />
nach Thematik entsprechende präventive<br />
Anweisungen an den Techniker<br />
oder an das zentrale Intelligent<br />
Control Centre (ICC) geschickt.<br />
Die „intelligenten“ Tablet-PCs be -<br />
nachrichtigen automatisch den<br />
Techniker, falls Werte außerhalb<br />
bestimmter Grenzen liegen. Schon<br />
heute werden Daten besser genutzt<br />
als zuvor und im weiteren Projektverlauf<br />
wird die Datensammlung<br />
immer detaillierter werden und so<br />
die Managementeffizienz zunehmend<br />
optimieren.<br />
„Unsere Techniker verstehen sich<br />
bereits jetzt vielmehr als Verwalter<br />
der jeweiligen Standorte und weniger<br />
als bloße Zählerstandleser. Für<br />
Scottish Water ist dieses Projekt<br />
bahnbrechend. Die digitale Plattform<br />
wird letztendlich alle Standorte<br />
und die gesamte Netzwerkinfrastruktur<br />
abdecken und direkt mit<br />
den Geschäftssystemen verknüpft<br />
sein, sodass das gesamte Unternehmen<br />
auf einheitliche und intelligent<br />
verwaltete Informationen zurückgreifen<br />
kann.“<br />
Hardware<br />
Noch vor zehn Jahren hätte man ein<br />
solches Niveau der Systemintegration<br />
als Science Fiction abgetan,<br />
doch mit der modernen Plug-and-<br />
Go-Technologie von heute kann es<br />
schnell Realität werden, wie Jeremy<br />
Shinton von Mitsubishi Electric<br />
auf der <strong>Wasser</strong>wirtschaftskonferenz<br />
erklärte. „Manufacturing Enterprise<br />
Systeme verbinden technische<br />
Echtzeitdaten mit Systemen höherer<br />
Ebenen, wobei deren Implementierung<br />
sich mittels moderner<br />
modularer Steuerungen, wie der<br />
Mitsubishi Electric Q-Serie, sehr<br />
einfach gestaltet. Das System Q ist<br />
eine Automatisierungsplattform mit<br />
fortschrittlichster Multiprozessortechnologie,<br />
wobei in einem einzigen<br />
System unterschiedlichste CPUs<br />
und Sondermodule auf einem Baugruppenträger<br />
miteinander kombiniert<br />
werden können. Dadurch kann<br />
Mai 2013<br />
620 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
PRAXIS<br />
für nahezu jede Anwendung eine maßgeschneiderte<br />
Steuerung ge schaffen werden.<br />
In einer entlegenen Pumpenstation beispielsweise<br />
will man vielleicht die Temperaturen von drei unterschiedlichen<br />
Lagern, die Motorbelastung und -laufzeit,<br />
den Durchfluss und die <strong>Wasser</strong>trübung überwachen.<br />
Mit der passenden Hardware zur Datenerfassung sowie<br />
einer oder mehrerer Datenübertragungsmöglichkeiten<br />
lassen sich diese Werte ganz einfach feststellen.<br />
Herkömmliche Analysesoftware-Tools oder auch<br />
spezielle Mitsubishi Electric Lösungen wandeln die Rohdaten<br />
in Berichte um. Die Formate entsprechen genau<br />
den Anforderungen der jeweiligen Nutzer. Ein Wartungstechniker<br />
beispielsweise interessiert sich für die<br />
aktuellen Temperaturen und Gesamtlaufzeiten, ein Verfahrenstechniker<br />
konzentriert sich auf Durchflussraten<br />
und -mengen, ein Umweltwissenschaftler hingegen<br />
prüft die <strong>Wasser</strong>trübung. Sind die Werte an die Zen trale<br />
weitergeleitet, werden sie mit Daten anderer Pumpenstationen<br />
vernetzt, um Berichte für die Managementebene<br />
zu erstellen.<br />
Für die Zentrale ist es außerdem von Vorteil, wenn<br />
die Daten automatisch die Unternehmenssysteme aktualisieren<br />
– und auch hierfür bietet Mitsubishi Electric<br />
eine integrierte Lösung an. „Unsere Lösung C-Connector<br />
ist speziell dazu ent wickelt, reibungslos Prozess- mit<br />
Unternehmenssystemen zu verbinden”, erklärt Shinton.<br />
C-Connector ist ein SPS-Modul, das Echtzeitdaten direkt<br />
von einem Standort an das zentrale Unternehmenssystem<br />
leitet, beispielsweise an ein SAP-System. Prozessdaten<br />
können dadurch einfach überwacht und analysiert<br />
werden, was zur Steigerung der Anlagentransparenz<br />
und Produktivität beiträgt.<br />
Für Techniker ist C-Connector intuitiv bedienbar, für<br />
kaufmännische Leiter stellt es die gewünschten Informationen<br />
verständlich und sofort verwendbar dar. Die<br />
Lösung erlaubt den direkten, bidirektionalen Datenaustausch<br />
zwischen einer SPS und den Systemen der Unternehmensebene,<br />
wodurch PC-basierte IT-Systeme als<br />
Zwischenschritt wegfallen.<br />
„Zusammen bringen C-Connector und die Q Serie<br />
ein hohes Optimierungspotenzial. Das haben auch<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaftsunternehmen in ganz Europa schnell<br />
begriffen. Mitsubishi Electric hat in diesem Bereich<br />
bereits zahlreiche Installa tionen durchgeführt. Häufig<br />
star teten diese zunächst als kleines System mit etwa<br />
fünf oder sechs Standorten, aber mittlerweile sind sie<br />
um ein Vielfaches der Ursprungsgröße gewachsen“,<br />
erklärt Shinton. „Diese maßgeschneiderte Technologie<br />
kann Unternehmen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft bei der Umsetzung<br />
eines Lebenszyklus-Managements unterstützen.“<br />
Weitere Informationen:<br />
www.mitsubishi-automation.de<br />
http://global.mitsubishielectric.com<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> erscheint in der DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Die führende technischwissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für das<br />
<strong>Wasser</strong>fach<br />
Informieren Sie sich regelmäßig über alle technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der <strong>Wasser</strong>versorgung und<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S - Recht und Steuern<br />
im Gas und <strong>Wasser</strong>fach.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 621<br />
Jetzt bestellen!
PRAXIS<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage in Arnsberg<br />
Für eine gesicherte Aufbereitung<br />
und hohe Qualität des Trinkwassers<br />
mit Verzicht auf Chlorierung<br />
wurden die <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
Möhnebogen und Langel<br />
Ultrafiltrationsanlage. © TIG Group GmbH<br />
© Stadtwerke Arnsberg<br />
TIG Group GmbH<br />
modernisiert und erweitert. Die<br />
Stadtwerke und der <strong>Wasser</strong>beschaffungsverband<br />
Arnsberg beauftragten<br />
im Rahmen einer öffentlichen<br />
Ausschreibung die TIG Group GmbH<br />
aus Husum, welche vom Anlagenbau,<br />
über die Automation bis zum<br />
Service die Gesamtverantwortung<br />
des Projektes übernahm. Hand in<br />
Hand arbeitete der Spezialist für<br />
Total Site Solutions mit dem Ingenieurbüro<br />
Wetzel und Partner. Im Rahmen<br />
der Arbeitsgemeinschaft mit<br />
der Baufirma Verfuß aus Hemer,<br />
wurde der Bau und die Inbetriebnahme<br />
federführend von der TIG<br />
Group geleitet.<br />
Kernstück der neuen Technik ist<br />
eine Ultrafiltrationsanlage, mit der<br />
im Aufbereitungsprozess auch Viren<br />
und Bakterien entfernt werden.<br />
Gründe für die Modernisierung<br />
waren durch kriminelle Energie eingeleitetes<br />
PFT (perfluorierte Tenside)<br />
in das Arnsberger Trinkwasser<br />
im Jahre 2006 sowie Starkregen im<br />
darauffolgenden Jahr.<br />
Ultrafiltration<br />
Aktivkohlefilter und Ultrafiltrationen<br />
wurden in die Bestandsanlage<br />
integriert und auf einem neuen<br />
Steuer- und Leitsystem automatisiert<br />
und visualisiert. Bei der <strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
ist der Großteil der<br />
Das Unternehmen ist Spezialist für Total Site Solutions und bietet in den Kernbereichen<br />
Energie- und Kraftwerktechnik, Industrieautomation, <strong>Wasser</strong>- und Reinstwasseraufbereitung,<br />
Abluftreinigung, Abfallbehandlung, Engineering und Apparatebau maßgeschneiderte,<br />
schlüsselfertige Anlagen, angefangen bei der Planung, Konstruktion und<br />
Fertigung bis zur Montage und Inbetriebnahme. Ein umfangreicher Service sowie<br />
Lösungen für die Optimierung von bestehenden Anlagen runden das Portfolio ab.<br />
Bis zum Ende letzten Jahres bestand die TIG Group aus neun rechtlich eigenständigen<br />
Gesellschaften, seit Januar 2012 sind diese Unternehmen nun durch Verschmelzung zu<br />
einer einzigen Gesellschaft zusammengefasst, der TIG Group GmbH mit Hauptsitz in<br />
Husum.<br />
Anlage auch nach der Sanierung<br />
bestehen geblieben. Neu im <strong>Wasser</strong>werk<br />
ist die <strong>Wasser</strong>aufbereitung.<br />
Pro Stunde können in Arnsberg nun<br />
je 600 Kubikmeter <strong>Wasser</strong> gereinigt<br />
werden, das ergibt pro Tag einen<br />
Durchlauf von etwa 12 000 Kubikmetern.<br />
Dem Fluss Möhne, beziehungsweise<br />
der Ruhr, wird Uferfiltrat<br />
zur <strong>Wasser</strong>gewinnung entnommen.<br />
Diesem werden Flockungsmittel<br />
zugesetzt, sodass sich in der Ultrafiltrationsanlage<br />
Bakterien, Keime<br />
und Vieren vom Trinkwasser trennen.<br />
Anschließend erfolgt eine Reinigung<br />
durch vier Aktivkohle-Filter,<br />
bei der organische Substanzen und<br />
die oben genannten Schadstoffe<br />
(PFT) entfernt werden. Die Bestrahlung<br />
mit ultraviolettem Licht löst<br />
den Einsatz von Chlorgas ab, Zu -<br />
sätze von Chemikalien entfallen.<br />
Eine Anlage zur Notdesinfektion<br />
bleibt vorhanden.<br />
Schnelle Sicherheit<br />
Die Bauzeit für das <strong>Wasser</strong>werk<br />
Möhnebogen betrug nur ein Jahr.<br />
Das modernisierte <strong>Wasser</strong>werk Langel<br />
ist am 28. September 2012 nach<br />
einer zweijährigen Bauzeit mit der<br />
gleichen Technologie in Betrieb<br />
genommen worden. „Wir haben in<br />
Arnsberg eine der modernsten <strong>Wasser</strong>gewinnungsanlagen<br />
in kürzester<br />
Zeit realisiert. Möglich war dieses<br />
durch die sehr gute Zusammenarbeit<br />
mit dem Kunden und Ingenieurbüro<br />
Wetzel und Partner.<br />
Die Bürger profitieren nun von<br />
einer ge sicherten Aufbereitung und<br />
hoher Qualität ihres Trinkwassers“,<br />
erklärt Projektleiter Alexander Kapitän<br />
von der TIG-Group GmbH ab -<br />
schließend.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.tig-group.com<br />
Mai 2013<br />
622 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Mehrstufige Hochdruckpumpe<br />
Maximal effizient und mit außergewöhnlichen Funktionalitäten ausgestattet<br />
Bei der CR-Baureihe von Grundfos<br />
(mehrstufige Hochdruckpumpen<br />
für die Industrie, Kommunen<br />
und OEM-Kunden) kann der Anwender<br />
unter einer Vielzahl von Varianten<br />
und Zusatzausrüstungen wählen.<br />
Für diverse Medien (korrosiv,<br />
abrasiv, hochviskos), hohe Drücke<br />
sowie einen breiten Temperaturbereich<br />
stehen unterschiedliche Werkstoffe,<br />
spezielle Gleitringdichtungen<br />
und auch eine leckagefreie Ausführung<br />
mit Magnetkupplung zur Verfügung.<br />
Trotz der Standardisierung<br />
wichtiger Bauteile ist so eine Pumpenauslegung<br />
nach Maß möglich –<br />
wer alle Kombinationsmöglichkeiten<br />
zusammenzählt, kommt auf<br />
nahezu eine Million Varianten.<br />
Bei den Motoren für die E-Pumpen-Ausführungen<br />
CRE bietet das<br />
Unternehmen dem Anlagenbauer/<br />
Betreiber bis zu einer Leistung von<br />
2,2 kW aktuell eine Top-Innovation:<br />
Einen Hochdrehzahlmotor (3600<br />
statt der üblichen 2900 min -1 ), der<br />
die höchste Energieeffizienzklasse<br />
IE4 (IEC TS 60034-31 Ed.1) übertrifft<br />
und ein kompaktes Design ermöglicht.<br />
Der neue Motor glänzt zudem<br />
mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen.<br />
Super Premium Efficiency IE4<br />
Der MGE-Motor von Grundfos – eine<br />
selbst entwickelte und produzierte<br />
Antriebseinheit für Pumpen mit<br />
integriertem Frequenzumformer –<br />
erfüllt im Leistungsbereich bis<br />
22 kW schon bislang die Wirkungsgradanforderungen<br />
gemäß IE3. Seit<br />
April 2013 wird dieser Motor bis zu<br />
einer Leistung einschließlich 2,2 kW<br />
durch eine besonders effiziente Permanentmagnetmotoren-Baureihe<br />
ersetzt. Diese Motoren übertreffen<br />
sogar zusammen mit dem integrierten<br />
Frequenzumformer deutlich<br />
die Anforderungen der Energieeffizienzklasse<br />
Super Premium Efficiency<br />
IE4.<br />
Als weitere Besonderheit ist herauszuheben,<br />
dass PM-Motoren<br />
gerade im meist beanspruchten<br />
Teillastbereich kaum an Wirkungsgrad<br />
einbüßen – anders als ältere<br />
Asynchronmotoren, die hier ‚einbrechen‘.<br />
Der Clou: Grundfos-Kunden<br />
erhalten diesen neuen Hocheffizienzmotor<br />
preisneutral zum bisherigen<br />
MGE. Schon beim ersten<br />
Einschalten ist die Amortisation<br />
erreicht und der Betreiber spart<br />
sofort Kosten.<br />
Ein zwingendes Datum für die<br />
Einführung von IE4-Motoren gibt<br />
die aktuelle Ökodesign-Richtlinie<br />
zwar nicht vor (derzeit sind nur Termine<br />
für die Einführung von IE3-<br />
Motoren fixiert – 2015 bzw.<br />
2017), doch gibt es natürlich<br />
heute schon sehr gute Gründe,<br />
den neuen MGE-Motor von<br />
Grundfos zu verwenden. Wie<br />
beschrieben sind das zum einen<br />
Kostengründe: Ein 1,1 kW MGE-<br />
Motor erreicht z.B. einen Wirkungsgrad<br />
von über 90 % und<br />
liegt damit deutlich über den<br />
IE4-Wirkungsgradanforderungen<br />
von 85 % nach IEC<br />
TS 60034-31 Ed.1. Legt man<br />
die aktuelle IE2-Wirkungsgradanforderung<br />
zugrunde, weist<br />
der 1,1 kW MGE Motor einen 12 Prozentpunkte<br />
besseren Wirkungsgrad<br />
auf.<br />
Die Entwickler kennen eine<br />
ganze Reihe weiterer Argumente,<br />
warum der MGE-Motor der 3. Generation<br />
jedem anderen Motor vorzuziehen<br />
ist: Nämlich wegen den<br />
neuen cleveren Funktionalitäten,<br />
die dem Betreiber das Anpassen der<br />
Pumpen in den Prozess erheblich<br />
erleichtern.<br />
Super Premium auch in den<br />
Funktionalitäten<br />
Wie bisher sind MGE-Motoren mit<br />
vorprogrammierten Regelungsarten<br />
ausgestattet – beispielsweise ist<br />
ein Betrieb unter Konstantdruck<br />
möglich, ebenso unter Proportionaldruck.<br />
Oder die Pumpe hält ein<br />
konstantes Niveau oder die Temperatur.<br />
Neben den acht unterschiedlichen<br />
Regelungsarten kann der Sollwert<br />
von anderen Sensorwerten<br />
(z. B. Temperatur, Volumenstrom<br />
u. a.) beeinflusst werden (Funktion<br />
Sollwertverschiebung), was die<br />
Regelungsflexibilität zusätzlich er -<br />
höht.<br />
Diese vordefinierten Regelungsarten<br />
ermöglichen es dem Betreiber,<br />
die Pumpe sehr einfach den<br />
üblichen Anwendungen anzupassen.<br />
Diese bekannten Funktionen<br />
CRE mit<br />
neuem MGE-<br />
Motor.<br />
▶▶<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 623
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
wurden nochmals verbessert und<br />
erweitert.<br />
Neu sind Zusatzfunktionen, wie<br />
das Befüllen einer Rohrleitung unter<br />
verringerter Förderleistung ohne<br />
Gefahr eines schädlichen Druckstoßes,<br />
das Abschätzen des Volumenstroms<br />
auf der Basis der Drehzahl<br />
und des Energieverbrauchs sowie<br />
das Abschätzen der spezifisch benötigten<br />
Energie in kWh/m 3 auf Basis<br />
des Förderstroms. Alle diese Funktionen<br />
ermöglichen es dem Motor,<br />
die CRE-Pumpe perfekt an die An -<br />
lagenverhältnisse anzupassen.<br />
Höhere Drehzahl,<br />
kompakteres Design<br />
Welche Bedeutung hat die Ausführung<br />
als Hochdrehzahlmotor?<br />
Durch die höhere Ausgangsdrehzahl<br />
liefert die Pumpe eine größere<br />
Fördermenge bzw. mehr Förderhöhe<br />
als die bisher angebotene<br />
2900-min –1 -Variante (zur Erinnerung:<br />
gemäß Affinitätsgesetz bringt<br />
eine doppelt so hohe Drehzahl den<br />
vierfachen Förderdruck). Das<br />
bedeutet in der Praxis, dass der<br />
Anlagenbauer/Betreiber für die<br />
gleiche Leistung eine kleinere<br />
Pumpe einplanen kann, er also Platz<br />
spart. Für die 2900 min -1 /3600 min -<br />
1<br />
-Umstellung stehen fertige Austauschlisten<br />
zur Verfügung. International<br />
tätige Anlagenbauer werden<br />
es begrüßen, nunmehr mit einem<br />
50/60-Hz-Motor zu arbeiten.<br />
Für Leistungen über 2,2 kW bis<br />
22 kW steht wie bisher der MGE-<br />
Motor mit integriertem Frequenzumformer<br />
der Premium-Wirkungsgrad-Klasse<br />
IE3 zur Verfügung. Bis<br />
45 kW bietet Grundfos einen IE4-<br />
Motor mit externem Frequenzumformer<br />
CUE an; über 45 kW stehen<br />
IE3-Motoren zur Verfügung.<br />
Der neue MGE-Motor ist zudem<br />
als Renewable-Version verfügbar: In<br />
dieser Ausführung kann der Motor<br />
direkt an Solarzellen oder Batterien<br />
mit Gleichstrom angeschlossen<br />
werden. Der Motor optimiert seine<br />
Drehzahl permanent in Abhängigkeit<br />
der zur Verfügung stehenden<br />
Leistung, in der Fachsprache ‚Maximum<br />
Power Point Tracking MPPT‘<br />
genannt. Das bedeutet: Der Motor<br />
arbeitet stets an einem Betriebspunkt,<br />
wo das Produkt aus Strom<br />
und Spannung ein Maximum<br />
erreicht. Dieser optimale Betriebspunkt<br />
hängt von der Bestrahlungsstärke,<br />
der Temperatur und dem Typ<br />
der Solarzellen ab.<br />
Fazit: Während andere Anbieter<br />
solche Motoren als Option zum<br />
Standard-Programm anbieten, wird<br />
Grundfos sie gegenüber den bisherigen<br />
Aggregaten preisneutral er -<br />
setzen. Somit macht das Unternehmen<br />
beim Thema Energieeffizienz<br />
wieder Nägel mit Köpfen: Bis zur<br />
Leistung von 2,2 kW bieten die<br />
Pumpen Wirkungsgrade besser als<br />
Super Premium Efficiency IE4 – zu<br />
vergleichbaren Kosten wie die bisherigen<br />
MGE-Motoren. Der Betreiber<br />
spart somit sofort Geld, muss<br />
keine langen Amortisationszeiten<br />
abwarten.<br />
Kontakt:<br />
GRUNDFOS GMBH,<br />
Schlüterstraße 33,<br />
D-40699 Erkrath,<br />
Tel. (0211) 92969-0,<br />
Fax (0211) 92969-3699<br />
http://de.grundfos.com<br />
BEULCO-Produkte sind trinkwasserkonform<br />
Logo Trinkwasserkonform<br />
2013.<br />
© BEULCO<br />
Die Überarbeitung der Trinkwasserverordnung<br />
stellt Hersteller<br />
und Verarbeiter bei der Materialauswahl<br />
vor eine große Herausforderung.<br />
Die zulässige Bleikonzentration<br />
im Trinkwasser wird ab Dezember<br />
2013 auf 10 Mikrogramm/L<br />
herabgesetzt. Das bedeutet, dass<br />
Messinglegierungen, die seit Jahrzehnten<br />
in der Trinkwasserinstallation<br />
eingesetzt werden, zum Teil<br />
nicht mehr eingebaut werden dürfen.<br />
Das Umweltbundesamt (UBA)<br />
wird künftig sämtliche Materialien<br />
und Werkstoffe prüfen, die mit<br />
Trinkwasser in Berührung kommen,<br />
und hierzu eine Positivliste erstellen.<br />
Im Praxisalltag kann diese<br />
Umstellung für Irritationen bei Planern<br />
und Installateuren führen.<br />
Denn es ist nicht immer auf den<br />
ersten Blick ersichtlich, welcher<br />
Werkstoff vorliegt.<br />
BEULCO fühlt sich als Hersteller<br />
an dieser Stelle gefordert und hat<br />
das sogenannte Green-Label<br />
geschaffen. Zukünftig erfüllt jedes<br />
BEULCO-Produkt mit diesem Label<br />
die strengen Anforderungen der<br />
Trinkwasserverordnung. Darüber<br />
hinaus garantiert BEULCO, dass für<br />
alle Komponenten der jeweils beste<br />
Werkstoff eingesetzt wird. Die verschiedensten<br />
Anforderungen an die<br />
Werkstoffe resultieren nicht zuletzt<br />
aus der Verwendung der Produkte.<br />
Eine ausreichend hohe Korrosionsbeständigkeit<br />
der eingesetzten<br />
Werkstoffe ist eine wesentliche<br />
Grundlage für ein qualitativ hochwertiges<br />
Produkt. BEULCO ist durch<br />
langjährige Erfahrung im Umgang<br />
mit unterschiedlichsten Messingund<br />
Rotgusslegierungen auf die<br />
Auswahl der optimalen Werkstoffe<br />
spezialisiert und ist in der Lage, für<br />
jedes Produkt den jeweils besten<br />
Werkstoff zu ermitteln.<br />
Kontakt:<br />
BEULCO® GmbH & Co. KG,<br />
Postfach 120,<br />
D-57425 Attendorn,<br />
Tel. (02722) 695-0,<br />
Fax (02722) 695-5240,<br />
E-Mail: info@beulco.de,<br />
www.beulco.de<br />
Mai 2013<br />
624 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
SMARTSENS: die erste Familie von Analysesensoren,<br />
die Transmitter überflüssig macht<br />
Das Jahr 2013 stellt einen Wendepunkt<br />
in der Analysenmesstechnik<br />
dar: KROHNE stellt SMART-<br />
SENS vor, die erste Serie von stromschleifengespeisten<br />
2-Leiter-Analysesensoren<br />
mit integrierter Transmittertechnologie.<br />
Die SMARTSENS<br />
Sensoren mindern das Risiko von<br />
Ausfällen entlang der Kette vom<br />
Sensor bis zum Prozessleitsystem<br />
und vereinfachen die Handhabung<br />
von Analysesensoren auf revolutionäre<br />
Weise. Im ersten Schritt werden<br />
die Sensoren für pH, Redox und<br />
Leitfähigkeit vorgestellt, weitere<br />
Parameter folgen.<br />
Bis heute war für Analysesensoren<br />
ein externer (proprietärer)<br />
Transmitter vor Ort notwendig, der<br />
die Sensorsignale für das Prozessleitsystem<br />
auswertet. Betrachtet<br />
man die Messkette vom Sensor zum<br />
Prozessleitsystem in einer Fehlerberechnung<br />
nach IEC 61508/IEC<br />
61511, so gehen prozentual die<br />
meisten der möglichen Fehler zu<br />
Lasten des Transmitters. Die häufigsten<br />
Fehlerquellen sind falsche<br />
Installation, Verkabelung oder Konfiguration<br />
des Transmitters. Um<br />
diese Art von Problemen zu vermeiden,<br />
hat KROHNE den Transmitter<br />
miniaturisiert und im Sensorkopf<br />
integriert: Jeder SMARTSENS Sensor<br />
kann nun über das 4...20 mA/HART-<br />
Signal direkt mit dem Prozessleitsystem<br />
verbunden werden. KROHNE<br />
ist damit der erste Anbieter, der<br />
eine direkte Verbindung per standardisiertem<br />
Feldbus vom Sensor zum<br />
Prozessleitsystem bietet.<br />
Aufgrund von Einflüssen wie<br />
Medium, Temperatur, Feuchtigkeit,<br />
Umgebungsbedingungen oder Verschmutzungen<br />
verlieren Analysesensoren<br />
im Laufe der Zeit ihre<br />
Genauigkeit und müssen erneut<br />
kalibriert, gereinigt, regeneriert und<br />
letztlich ausgetauscht werden.<br />
Heute funktionieren die meisten<br />
Analysesensoren im Feld mit Analogtechnologie<br />
und müssen ge -<br />
meinsam mit dem Transmitter vor<br />
Ort kalibriert werden, auch wenn sie<br />
an entfernten oder schwer zugänglichen<br />
Messstellen ohne Schutz vor<br />
Witterung installiert sind. Dies sind<br />
alles andere als ideale Bedingungen<br />
für die Kalibrierung, die auch zu falschen<br />
Werten im Prozessleitsystem<br />
führen können. SMARTSENS bietet<br />
hier eine sichere Alternative: Alle<br />
SMARTSENS Sensoren sind digitale<br />
Sensoren und können offline in<br />
einem Labor unter kontrollierten<br />
Bedingungen (re-)kalibriert werden.<br />
Die Sensoren speichern die Kalibrierdaten<br />
und können anschließend<br />
einfach wieder an der Messstelle<br />
eingesetzt werden. Für die Offline-<br />
Kalibrierung können die Sensoren<br />
per USB-Schnittstellenkabel für die<br />
bidirektionale HART 7 Kommunikation<br />
und Stromversorgung an<br />
einem PC angeschlossen werden,<br />
der dieselbe PACTware (FDT/DTM)<br />
Bedienoberfläche wie das Assetmanagement-System<br />
verwendet.<br />
Zu den Zielbranchen für die<br />
SMARTSENS Sensoren gehören<br />
Chemie-, Pharma-, Lebensmittelund<br />
Getränkehersteller sowie Energie-<br />
und <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>anwendungen.<br />
Jeder SMARTSENS Sensor<br />
ist speziell für seinen Einsatzbereich<br />
ausgelegt: Die Zulassungen und<br />
Zertifikate reichen von explosionsgefährdeten<br />
(Zone 0) bis zu hygienischen<br />
Bereichen. Gemeinsam mit<br />
der Sensorfamilie stellt KROHNE<br />
auch eine große Auswahl an Zubehör<br />
vor, wie z.B. stromschleifengespeiste<br />
Displays, USB-Schnittstellenkabel<br />
und Armaturen.<br />
SMARTSENS stromschleifengespeiste 2-Leiter-Analysesensoren<br />
mit integrierter Transmittertechnologie<br />
(von links nach rechts: SMARTSENS ORP 8510,<br />
SMARTSENS PH 8150, SMARTSENS PH 8570,<br />
SMARTSENS COND 7200).<br />
Über KROHNE<br />
KROHNE ist ein Anbieter von Komplettlösungen<br />
für Prozessmesstechnik zur Messung von Durchfluss,<br />
Massedurchfluss, Füllstand, Druck und<br />
Temperatur sowie für Analyseaufgaben. Das 1921<br />
gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg,<br />
Deutschland, beschäftigt weltweit über<br />
3000 Mitarbeiter und ist auf allen Kontinenten<br />
vertreten. KROHNE steht für Innovation und<br />
höchste Produktqualität und gehört zu den<br />
Marktführern für industrielle Prozessmesstechnik.<br />
Kontakt:<br />
KROHNE Messtechnik GmbH,<br />
Ludwig-Krohne-Straße 5,<br />
D-47058 Duisburg,<br />
Tel. (0203) 301 0,<br />
Fax (0203) 301 10 389,<br />
E-Mail: info@krohne.de,<br />
www.krohne.com<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 625
PRODUKTE UND VERFAHREN<br />
Hohe Performance im Infrastrukturbau mit<br />
modernster IT-Technologie<br />
RIB Software AG lanciert STRATIS in neuer Version<br />
Über die RIB-Gruppe<br />
Mit STRATIS 14.4 führt das Stuttgarter<br />
Technologieunternehmen<br />
RIB eine neue Version des In -<br />
frastruktur-Softwaresystems in den<br />
Markt ein. Die aktuelle Softwareversion,<br />
die seit Mai erhältlich ist, soll<br />
laut Hersteller speziell die Arbeit an<br />
großen Projekten für Planer und<br />
Mit über 15 000 Kunden zählt die RIB-Gruppe<br />
mit Hauptsitz in Stuttgart zu den größten Softwareanbietern<br />
im Bereich technische ERP-<br />
Lösungen für das Bauwesen. Gegründet im Jahre<br />
1961 hat RIB in Deutschland eine marktführende<br />
Position erzielt. Die weltweit größten Bauunternehmen,<br />
öffentliche Verwaltungen, Architekturund<br />
Ingenieurgesellschaften sowie Großunternehmen<br />
im Bereich des Industrie- und Anlagenbaus<br />
rund um den Globus optimieren ihre<br />
Planungs- und Bauprozesse durch den Einsatz<br />
von RIB-Softwaresystemen. RIB ist in den Regionen<br />
EMEA, Nordamerika und APAC mit eigenen<br />
Niederlassungen vertreten.<br />
bauausführende Unternehmen im<br />
Straßen- und Tiefbausektor intuitiver<br />
und gleichzeitig komfortabler<br />
gestalten. Hierfür haben die RIB-<br />
Softwareingenieure neueste IT-<br />
Technologien in die Entwicklung<br />
des Systems einfließen lassen.<br />
Produktmanager Andreas Dieterle<br />
betont: „Bei STRATIS 14.4<br />
haben wir uns verstärkt auf die Performance<br />
fokussiert. Es ist uns<br />
gelungen, den Bildschirmaufbau<br />
um das 20-fache zu beschleunigen,<br />
was die Bearbeitung von Großprojekten<br />
mit umfangreichen Geländemodellen<br />
und besonders hohen<br />
Punktvolumina signifikant verbessert.<br />
Bei Nutzung der Zoom-Funktion<br />
baut sich der Bildschirm enorm<br />
schnell auf, sodass der Anwender in<br />
der Lage ist, besonders flexibel und<br />
effizient zu arbeiten. An der Oberfläche<br />
werden entsprechend dem<br />
aktuellen Zoom-Maßstab störende<br />
Elemente intelligent ausgeblendet.<br />
Es sind stets alle Details optimal zu<br />
erkennen.“<br />
Eine Basis für die optimierte Performance<br />
bildet unter anderem die<br />
Mehrprozessortechnologie, die in<br />
STRATIS 14.4 erstmals zur Anwendung<br />
kommt. Angepasst an den<br />
Trend zu Smartphones und Tablets<br />
auf den Baustellen ist die neue<br />
STRATIS-Version auf Windows-8-Geräten<br />
voll lauffähig. Ob am Rechner<br />
im Büro oder mit mobilem Endgerät<br />
draußen: Projektmanager, Bauplaner<br />
und Bauleiter haben fortan<br />
überall Zugriff auf ihre STRATIS-<br />
Pläne und können Projektänderungen<br />
schnell und sicher an das System<br />
weitergeben – für eine durchgängige<br />
Dokumentation.<br />
Kontakt:<br />
RIB Deutschland GmbH,<br />
Andreas Dieterle,<br />
Vaihinger Straße 151,<br />
D-70567 Stuttgart,<br />
E-Mail: andreas.dieterle@rib-software.com,<br />
www.rib-software.com<br />
Mai 2013<br />
626 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Impressum<br />
INFORMATION<br />
Das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Die technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>versorgung, Gewässerschutz,<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung und <strong>Abwasser</strong>technik.<br />
Organschaften:<br />
Zeitschrift des DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
des Bundesverbandes der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e. V. (BDEW),<br />
der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.<br />
(figawa),<br />
der DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
(ÖVGW),<br />
des Fachverbandes der Gas- und Wärme versorgungsunternehmen,<br />
Österreich,<br />
der Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein (AWBR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke e. V. (ARW),<br />
der Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr (AWWR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)<br />
Herausgeber:<br />
Dr.-Ing. Rolf Albus, Gaswärme Institut e.V., Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Ruhrverband, Essen<br />
Dipl.-Ing. Heiko Fastje, EWE Netz GmbH, Oldenburg<br />
Prof. Dr. Fritz Frimmel, Engler-Bunte-Institut, Universität (TH) Karlsruhe<br />
Dipl.-Wirtschafts-Ing. Gotthard Graß, figawa, Köln<br />
Prof. Dr. -Ing. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart (federführend <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>)<br />
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Klaus Homann (federführend Gas|Erdgas),<br />
Thyssengas GmbH, Dortmund<br />
Prof. Dr. Matthias Krause, Stadtwerke Halle, Halle<br />
Dipl.-Ing. Klaus Küsel, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau<br />
GmbH, Erkrath<br />
Prof. Dr. Joachim Müller-Kirchenbauer, TU Clausthal,<br />
Clausthal-Zellerfeld<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert, EBI, Karlsruhe<br />
Dr. Karl Roth, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR<br />
BauAss. Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Aggerverband, Gummersbach<br />
Harald Schmid, WÄGA Wärme-Gastechnik GmbH, Kassel<br />
Dr.-Ing. Walter Thielen, DVGW e. V., Bonn<br />
Dr. Anke Tuschek, BDEW e. V., Berlin<br />
Heinz Watka, Open Grid Europa GmbH, Essen<br />
Martin Weyand, BDEW e. V., Berlin<br />
Redaktion:<br />
Hauptschriftleitung (verantwortlich):<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Arnulfstraße 124, 80636 München,<br />
Tel. +49 89 203 53 66-33, Fax +49 89 203 53 66-99,<br />
E-Mail: ziegler@di-verlag.de<br />
Redaktionsbüro im Verlag:<br />
Sieglinde Balzereit, Tel. +49 89 203 53 66-25,<br />
Fax +49 89 203 53 66-99, E-Mail: balzereit@di-verlag.de<br />
Katja Ewers, E-Mail: ewers@di-verlag.de<br />
Stephanie Fiedler, M.A., E-Mail: fiedler@di-verlag.de<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Jan-Ulrich Arnold, Technische Unternehmens -<br />
beratungs GmbH, Bergisch Gladbach<br />
Prof. Dr.-Ing. Mathias Ernst, TU Hamburg-Harburg, Hamburg<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Wolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr<br />
München, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Abfall technik, Neubiberg<br />
Dr. rer. nat. Klaus Hagen, Krüger WABAG GmbH, Bayreuth<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW GmbH, Mülheim/Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, TU Berlin, Berlin<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Reinhold Krumnack, DVGW, Bonn<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. Karl Morschhäuser, figawa, Köln<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Dipl.-Geol. Ulrich Peterwitz, AWWR e.V. (Arbeitsgemeinschaft der<br />
<strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr), Schwerte<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Universität Hannover<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doering, Hannover<br />
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Institut für Siedlungswasserbau,<br />
<strong>Wasser</strong>güte- und Abfallwirtschaft, Universität Stuttgart, Stuttgart<br />
Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis, Bieske und Partner<br />
Beratende Ingenieure GmbH, Lohmar<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl, Techn. Universität Dresden, Dresden<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, Institut für Rohrleitungsbau an der<br />
Fachhochschule Oldenburg e.V., Oldenburg<br />
Verlag:<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstraße 124,<br />
80636 München, Tel. +49 89 203 53 66-0, Fax +49 89 203 53 66-99,<br />
Internet: http://www.di-verlag.de<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Verlagsleitung: Kirstin Sommer<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Mediaberatung:<br />
Inge Matos Feliz, im Verlag,<br />
Tel. +49 89 203 53 66-22 Fax +49 89 203 53 66-99,<br />
E-Mail: matos.feliz@di-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung:<br />
Brigitte Krawzcyk, im Verlag,<br />
Tel. +49 89 203 53 66-12, Fax +49 89 203 53 66-99,<br />
E-Mail: krawczyk@di-verlag.de<br />
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 63.<br />
Bezugsbedingungen:<br />
„<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>“ erscheint monatlich<br />
(Doppelausgabe Juli/August). Mit regelmäßiger Verlegerbeilage<br />
„R+S – Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach“ (jeden 2. Monat).<br />
Jahres-Inhaltsverzeichnis im Dezemberheft.<br />
Jahresabonnementpreis:<br />
Print: 350,– €<br />
Porto Deutschland 30,– / Porto Ausland 35,– €<br />
ePaper: 350,– €<br />
Einzelheft Print: 39,– €<br />
Porto Deutschland 3,– € / Porto Ausland 3,50 €<br />
Einzelheft ePaper: 39,– €<br />
Abo plus (Print und ePaper): 455,– €<br />
Porto Deutschland 30,– / Porto Ausland 35,– €<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Studentenpreis: Ermäßigung gegen Nachweis.<br />
ePaper für € 70,–, Heft für € 175,– zzgl. Versand<br />
Bestellungen über jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag.<br />
Abonnements-Kündigung 8 Wochen zum Ende des Kalenderjahres.<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen:<br />
Leserservice <strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Tel. +49 931 4170-1615, Fax +49 931 4170-494<br />
E-Mail: leserservice@di-verlag.de<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen<br />
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages<br />
strafbar. Mit Namen gezeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt<br />
der Meinung der Redaktion.<br />
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH<br />
Ostring 13, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, München<br />
Printed in Germany<br />
Mai 2013<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 627
INFORMATION Termine<br />
##<br />
Klärschlamm – Wertstoff der Zukunft? – Achte DWA-Klärschlammtage<br />
04.–06.06.2013, Fulda<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Barbara Sundermeyer-Kirstein,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef, Tel. (02242) 872-181, E-Mail: sundermeyer-kirstein@dwa.de,<br />
http://de.dwa.de/klaerschlammtage.html<br />
##<br />
Dresdner Grundwassertage 2013 – Entwicklung und Applikation innovativer Grundwasserschutz- und<br />
Grundwasserbehandlungsmaßnahmen<br />
11.–12.06.2013, Dresden<br />
Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V., Frau Raimann, Meraner Straße 10, 01217 Dresden,<br />
Tel. (0351) 4050-642, Fax (0351) 4050-679, E-Mail: sraimann@dgfz.de, www.gwz-dresden.de<br />
##<br />
Moderner Kanalbau im Überblick – Zehnte DWA-Kanalbautage<br />
18.–19.06.2013, Bad Soden<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Renate Teichmann,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef, Tel. (02242) 872-118, E-Mail: teichmann@dwa.de,<br />
http://de.dwa.de/kanalbautage-2013.html<br />
##<br />
Gewässerschutz – Deutschland und Europa<br />
26.06.2013, Hennef<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Belinda Höcherl, Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
53773 Hennef, Tel. (02242) 872-206, E-Mail: hoecherl@dwa.de, http://213.216.6.175/eva/Flyer/2524.pdf<br />
##<br />
Siedlungswasserwirtschaft 20..40..60 – Herausforderungen und Perspektiven „insight outsite K’town“<br />
05.07.2013, Kaiserslautern<br />
Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der TU Kaiserslautern mit tectraa, Zentrum für Innovative<br />
Ab<strong>Wasser</strong>technologien, Dipl.-Biol. Birgit Valerius, Tel. (0631) 205-2905, E-Mail: birgit.valerius@bauing.uni-kl.de,<br />
http://siwawi.bauing.uni-kl.de/<br />
##<br />
Gewässerschutz hat Priorität<br />
18.–19.09.2013, Kassel<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Doris Herweg, Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
53773 Hennef, Tel. (02242) 872-236, E-Mail: herweg@dwa.de, http://de.dwa.de/trws-2013.html<br />
##<br />
wat – <strong>Wasser</strong>fachliche Aussprachetagung<br />
30.09.–01.10.2013, Nürnberg<br />
DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e.V., Ludmilla Asarow, Josef-Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9188-601, Fax (0228) 9188-997, www.wat-dvgw.de<br />
##<br />
KOMMUNALE<br />
23.–24.10.2013, Nürnberg<br />
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg, Tel. (0911) 86 06-0, Fax (0911) 86 06-82 28,<br />
www.kommunale.de<br />
##<br />
Geothermie-Industriemesse Geo-T EXPO<br />
12.–14.11.2013, Essen<br />
www.messe-essen.de, www.geotexpo.com<br />
##<br />
acqua alta<br />
12.–14.11.2013, Hamburg<br />
www.acqua-alta.de<br />
##<br />
sps/ips/dricves<br />
26.–28.11.2013, Nürnberg<br />
www.mesago.de<br />
Mai 2013<br />
628 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Einkaufsberater<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser.de/einkaufsberater<br />
Ansprechpartnerin für den<br />
Eintrag Ihres Unternehmens<br />
Inge Matos Feliz<br />
Telefon: 0 89/203 53 66-22<br />
Telefax: 0 89/203 53 66-99<br />
E-Mail: matos.feliz@di-verlag.de<br />
matos.feliz@oiv.de<br />
Die technisch-wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung
2013<br />
Einkaufsberater<br />
Armaturen<br />
Be- und Entlüftungsrohre<br />
Biogaslösung
2013<br />
Bohrtechnik, <strong>Wasser</strong>gewinnung, Geothermie<br />
Einkaufsberater<br />
Brunnenservice<br />
Informations- und Kommunikationstechnik<br />
Fernwirktechnik
2013<br />
Einkaufsberater<br />
Drehkolbengebläse<br />
Kompressoren<br />
Drehkolbenverdichter<br />
Schraubenverdichter<br />
Korrosionsschutz<br />
Aktiver Korrosionsschutz<br />
Passiver Korrosionsschutz<br />
Regenwasser-Behandlung, -Versickerung, -Rückhaltung
2013<br />
Kunststoffschweißtechnik<br />
Rohrleitungen<br />
Einkaufsberater<br />
Schachtabdeckungen<br />
Smart Metering
2013<br />
Einkaufsberater<br />
Turbogebläse<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Biologische <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Chemische <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung
2013<br />
Rohrdurchführungen<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung und <strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
Sonderbauwerke<br />
Einkaufsberater<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Inge Matos Feliz<br />
Tel. 089 2035366-22<br />
Fax 089 2035366-99<br />
matos.feliz@di-verlag.de<br />
<strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong>
Beratende Ingenieure (für das <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>fach)<br />
Darmstadt l Freiburg l Homberg l Mainz<br />
Offenburg l Waldesch b. Koblenz<br />
• Beratung<br />
• Planung<br />
• Bauüberwachung<br />
• Betreuung<br />
• Projektmanagement<br />
Ing. Büro CJD Ihr Partner für <strong>Wasser</strong>wirtschaft und<br />
Denecken Heide 9 Prozesstechnik<br />
30900 Wedemark Beratung / Planung / Bauüberwachung /<br />
www.ibcjd.de Projektleitung<br />
+49 5130 6078 0 Prozessleitsysteme<br />
<strong>Wasser</strong> Abfall Energie Infrastruktur<br />
UNGER ingenieure l Julius-Reiber-Str. 19 l 64293 Darmstadt<br />
www.unger-ingenieure.de<br />
Beratende Ingenieure für:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
Telefon 0511/284690<br />
Telefax 0511/813786<br />
30159 Hannover<br />
Kurt-Schumacher-Str. 32<br />
• Beratung<br />
• Gutachten<br />
• Planung<br />
• Bauleitung<br />
info@scheffel-planung.de<br />
www.scheffel-planung.de<br />
DVGW-zertifizierte Unternehmen<br />
Die Zertifizierungen der STREICHER Gruppe umfassen:<br />
ISO 9001<br />
ISO 14001<br />
SCC p<br />
BS OHSAS 18001<br />
GW 11<br />
GW 301<br />
• G1: st, ge, pe<br />
• W1: st, ge, gfk, pe, az, ku<br />
GW 302<br />
• GN2: B<br />
FW 601<br />
• FW 1: st, ku<br />
G 468-1<br />
G 493-1<br />
G 493-2<br />
W 120<br />
WHG<br />
AD 2000 HP 0<br />
ISO 3834-2<br />
DIN 18800-7 Klasse E<br />
DIN 4099-2<br />
Ö Norm M 7812-1<br />
TRG 765<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA, Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Schwaigerbreite 17 · 94469 Deggendorf · T +49 (0) 991 330 - 231 · E rlb@streicher.de · www streicher.de<br />
Das derzeit gültige Verzeichnis der Rohrleitungs-Bauunternehmen<br />
mit DVGW-Zertifikat kann im Internet unter<br />
www.dvgw.de in der Rubrik „Zertifizierung/Verzeichnisse“<br />
heruntergeladen werden.<br />
Zertifizierungsanzeige_<strong>gwf</strong>_<strong>Wasser</strong>-<strong>Abwasser</strong>_20121112.indd 1 12.11.2012 08:47:01
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
Seite<br />
ABB Automation GmbH, Frankfurt 509<br />
Ahoy Rotterdam nv, Rotterdam<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau b. Döbeln<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau b. Döbeln 555<br />
Aquadosil <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Essen 515<br />
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar 521<br />
Endress+Hauser GmbH & Co. KG, Weil am Rhein<br />
4. Umschlagseite<br />
Titelseite<br />
Einhefter<br />
e.qua Netzwerk, Berlin 563–570<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 561<br />
HOBAS Rohre GmbH, Neubrandenburg 525<br />
Huber SE, Berching 551<br />
Klinger GmbH, Idstein 517<br />
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 557<br />
KRYSCHI <strong>Wasser</strong>hygiene, Kaarst 571<br />
MEORGA GmbH, Nalbach 573<br />
RWW Rheinisch-Westfälische <strong>Wasser</strong>werksgesellschaft mbH,<br />
Mülheim a.d. Ruhr 541<br />
Einkaufsberater / Fachmarkt 629–676<br />
3-Monats-<strong>Vorschau</strong> 2013<br />
Ausgabe Juni 2013 Juli/August 2013 September 2013<br />
Erscheinungstermin:<br />
Anzeigenschluss:<br />
24.06.2013<br />
07.06.2013<br />
14.08.2013<br />
26.07.2013<br />
16.08.2013<br />
22.08.2013<br />
Themenschwerpunkt<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Produkte und Verfahren<br />
• Regenwassernutzung<br />
• Entwässerungssysteme<br />
• Misch- und Trennkanalisation<br />
• Dezentrale Regenwasserbehandlung<br />
• Regenwasserspeicherung und<br />
-versickerung<br />
• Reinigungssysteme für Straßenabläufe,<br />
Metalldachfilter, Filtersysteme<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Produkte und Verfahren<br />
• Hochbelastete Abwässer<br />
• Mechanische Reinigung<br />
• Biologische Stufe,<br />
Belebtschlammverfahren, Nitrifikation,<br />
Denitrifikation<br />
• Chemische Verfahren<br />
• Membrantechnik<br />
• Klärschlammbehandlung<br />
Trinkwasseraufbereitung und Hygiene<br />
Aufgaben und Verfahren<br />
• Partikelentfernung, Entfernung organischer<br />
Stoffe<br />
• Entsäuerung, Enthärtung<br />
• Flockung und Flockungsmittel<br />
• Adsorptions-Verfahren<br />
• Membrantechnik, Ultrafiltration<br />
• Desinfektion: Chlorung, Ozonung,<br />
UV-Bestrahlung<br />
Fachmessen/<br />
Fachtagungen/<br />
Veranstaltung<br />
(mit erhöhter Auflage<br />
und zusätzlicher<br />
Verbreitung)<br />
DWA-Landesverbandstagung<br />
Sachsen/Thüringen –<br />
Weimar, 12.06.2013<br />
11. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung –<br />
Würzburg, 26.06.–27.06.2013<br />
DWA-Bundestagung –<br />
Berlin, 23.09.–24.09.2013<br />
wat –<br />
Nürnberg, 30.09.–02.10.2013<br />
Kommunale –<br />
Nürnberg, 09.10.–10.10.2013<br />
Änderungen vorbehalten
Tiefbaumesse InfraTech<br />
15. - 17. Januar 2014<br />
Messe Essen, Nordrhein-Westfalen