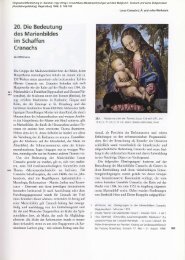im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einführung und Übersicht<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2<br />
Lebensphase prinzipiell modifizierbare Einstellungen zu Sterben und Tod aus. Die bisl<strong>an</strong>g<br />
untersuchten Korrelate dieser Einstellungen zu Sterben und Tod bezogen sich jedoch meist<br />
auf Kin<strong>der</strong> und Jugendliche und insbeson<strong>der</strong>e Menschen <strong>im</strong> mittleren Erwachsenenalter,<br />
also Personen <strong>im</strong> Altersbereich zwischen 35 und 65 Jahren (Lindenberger & Schaefer,<br />
2008). Auch die todbezogenen Einstellungen terminal Erkr<strong>an</strong>kter sowie <strong>der</strong>en Betreuer<br />
erfahren <strong>im</strong> Kontext <strong>der</strong> Hospizbewegung, Palliativmedizin und Euth<strong>an</strong>asie-Diskussion<br />
<strong>an</strong>haltendes Forschungsinteresse. Doch wie sieht es mit <strong>der</strong> gesellschaftlich <strong>im</strong>mer bedeutsamer<br />
werdenden Gruppe <strong>der</strong> Hochbetagten aus?<br />
Obwohl theoretische Aussagen über Einstellungen von Sterben und Tod <strong>im</strong> hohen<br />
Alter, also ab ca. dem 80. Lebensjahr (ebd., s. auch Punkt 1.3), aus bereits bek<strong>an</strong>nten Theorien<br />
und Befunden zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Altersgruppen ableitbar sind, fehlt es weitgehend <strong>an</strong> empirischer<br />
Bestätigung <strong>für</strong> dieses am stärksten wachsende demographische, jedoch th<strong>an</strong>atospsychologisch<br />
unterrepräsentierte Segment (z.B. Tomer, 2000b; Wittkowski, 2005). Dies<br />
k<strong>an</strong>n zumindest teilweise <strong>an</strong> <strong>der</strong> gegenwärtigen Tabuisierung des Todes in den westlichen<br />
Industrienationen liegen (vgl. Ariès, 1981, 2009; T. Walter, 1991, 1995). Augenscheinliche<br />
Gründe mögen in einer natürlichen Scheu und ethischen Bedenken liegen, sehr alten<br />
Menschen eine <strong>der</strong>artig direkte Konfrontation mit ihrem baldigen Lebensende zuzumuten.<br />
Auch ein m<strong>an</strong>gelndes Interesse am (hohen) Alter und den damit verbundenen Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
bis hin zu Abwehr und Negation <strong>der</strong> Gesellschaft sowie <strong>der</strong> forschenden Disziplinen<br />
können bestehende Hemmschwellen erklären.<br />
Um die bisherige Forschungslücke zu schließen, wird in <strong>der</strong> vorliegenden Studie<br />
entsprechend <strong>der</strong> Fokus auf sehr alte Menschen – hier Menschen am Ende ihres achten und<br />
neunten Lebensjahrzehnts – gelegt, die dem Tod aus chronologischer und mortalitätsstatistischer<br />
Sicht, auch unabhängig vom Vorliegen von Kr<strong>an</strong>kheiten, am Nächsten sind<br />
(Fortner & Ne<strong>im</strong>eyer, 1999; Fortner, Ne<strong>im</strong>eyer, Rybarczyk, & Tomer, 2000) bzw. die geringste<br />
noch verbleibende Restlebenszeit aufweisen. Die Tatsache, dass diese Personengruppe<br />
in bisherigen Studien zur Untersuchung <strong>der</strong> Einstellungen zu Sterben und Tod<br />
weitgehend vernachlässigt wurde, bezeichnen führende Th<strong>an</strong>atosforscher wie Robert A.<br />
Ne<strong>im</strong>eyer und Victor G. Cicirelli in Anbetracht <strong>der</strong> Offensichtlichkeit des Themas als<br />
„ironic <strong>im</strong>bal<strong>an</strong>ce“ (Tomer, 2000b, S. vii) o<strong>der</strong> „paradoxical, given the fact that ol<strong>der</strong><br />
adults are the group with the greatest vulnerability to death“ (Cicirelli, 2002b, S. 1). Die<br />
hier vorgestellte Arbeit soll dazu beitragen, die bisherigen theoretischen und empirischen<br />
Erkenntnisse <strong>der</strong> Th<strong>an</strong>atospsychologie, <strong>der</strong> ´<strong>Psychologie</strong> des Todes`, bezüglich <strong>der</strong> Einstellungen<br />
zu Sterben und Tod und insbeson<strong>der</strong>e einer akzeptierenden versus einer ängstlichen<br />
Sicht auf Hochbetagte sowohl theoretisch-integrativ als auch querschnittlichempirisch<br />
zu erweitern und mögliche Beson<strong>der</strong>heiten des Lebens <strong>im</strong> Angesicht des Todes<br />
darstellen.<br />
Aus Sicht <strong>der</strong> Autorin ist es nötig, dies zu untersuchen, da das Thema <strong>im</strong> Hinblick<br />
auf den viel zitierten demographischen W<strong>an</strong>del ein äußerst bris<strong>an</strong>tes Tabu darstellt. War<br />
<strong>der</strong> Tod vor nicht allzu l<strong>an</strong>ger Zeit vor allem ein Phänomen des jungen und mittleren Alters,<br />
ist er heute durch den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt „weitgehend<br />
Altersschicksal“ (Bölsker-Schlicht, 1992, S. 11). Da viele <strong>der</strong> heute geborenen Menschen<br />
also auf das Erreichen eines sehr hohen Alters hoffen dürfen, wird die Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung<br />
mit dem Sterben und dem Tod <strong>im</strong> hohen Alter eine zunehmend größere Personengruppe