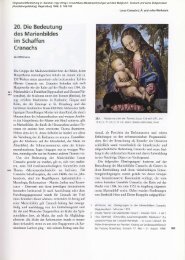im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einführung und Übersicht<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
12<br />
Der Soziologe Laslett (1995) prägte <strong>für</strong> die Lebensphase des jungen Alters zwischen 65<br />
und 80 Jahren den Begriff des Dritten Lebensalters und <strong>für</strong> das alte Alter ab ca. 80 Jahren<br />
den Terminus des Vierten Lebensalters, wobei ersteres als Zeit <strong>der</strong> „persönlichen Erfüllung“<br />
und „höchsten Punkt in <strong>der</strong> Bahn des individuellen Lebens“, das Vierte Alter dagegen<br />
als Zeit <strong>der</strong> „unabän<strong>der</strong>lichen Abhängigkeit, <strong>der</strong> Altersschwäche und des Todes“ charakterisiert<br />
wird (S. 35). Dabei ist <strong>der</strong> Beginn <strong>der</strong> jeweiligen Altersphase nicht einheitlich<br />
definiert, da kontinuierlich; so beginnt das Dritte Lebensalter m<strong>an</strong>chmal erst ab 70 sowie<br />
das Vierte Lebensalter erst ab 85 Jahren (vgl. z.B. Kruse, 2007, S. 50; Lindenberger &<br />
Schaefer, 2008; Settersten Jr. & Trauten, 2009)<br />
Das Konzept des Vierten Lebensalters wurde von Paul und Margret Baltes theoretisch<br />
weiter ausdifferenziert, in <strong>der</strong> Berliner Altersstudie empirisch überprüft und um die<br />
Phase des extremen Alters ab 100 Jahren erweitert (P. B. Baltes & Smith, 1999; Mayer &<br />
Baltes, 1996). Die sogen<strong>an</strong>nten best agers ab 65 können nach <strong>der</strong> aktiven Familien- und<br />
Berufsphase ihr Zeit recht frei gestalten: Meist ist die Rente ausreichend, geistige und körperliche<br />
Gesundheit und soziales Netzwerk mit Verw<strong>an</strong>dten und Freunden sind noch intakt,<br />
so dass eine aktive und ausgefüllte Lebensgestaltung möglich ist und zum Teil aufgrund<br />
<strong>der</strong> neugewonnen Freizeit sogar erst in ihrer vollen Ausprägung möglich wird, etwa<br />
in Form von ausgedehnten Reisen o<strong>der</strong> ehrenamtlichem Engagement. Eine Bewältigung<br />
„<strong>der</strong> altersspezifischen und alterstypischen Anfor<strong>der</strong>ungen dieser Lebensphase“ (Rott,<br />
2011, S.59) gelingt in den meisten Fällen, so dass die <strong>an</strong>f<strong>an</strong>gs vorgestellte Werbekampagne<br />
durchaus realistisch ist und durch zahlreiche empirische Befunde bestätigt werden k<strong>an</strong>n<br />
(z.B. P. B. Baltes & Smith, 2003; P. B. Baltes & Staudinger, 2000; Perlmutter, 1990).<br />
Die Phase <strong>der</strong> Hochaltrigkeit ist jedoch durch eine hohe Vulnerabilität mit starken<br />
Verän<strong>der</strong>ungen und altersassoziierten Verlusten geprägt (<strong>für</strong> eine zusammenfassende<br />
Darstellung vgl. Lindenberger & Schaefer, 2008; H.-W. Wahl & Heyl, 2004; H.-W. Wahl<br />
& Rott, 2002). Baltes sieht <strong>im</strong> Erreichen eines so hohen Alters eine sich zunehmend äußernde<br />
unvollständige hum<strong>an</strong>ontogenetische Architektur zutage treten, da <strong>der</strong> evolutionäre<br />
Selektionsdruck <strong>der</strong> jüngeren Jahre, gekoppelt <strong>an</strong> Fruchtbarkeit, Fortpfl<strong>an</strong>zung, Überleben<br />
und Aufzucht <strong>der</strong> Nachkommen, mit zunehmendem Alter <strong>im</strong>mer stärkere Schwachstellen<br />
aufzeige (P. B. Baltes, 1997, 1999; P. B. Baltes & Smith, 1999). Es scheint, als ob <strong>der</strong><br />
Mensch auf die Hochaltrigkeit genetisch nicht vorbereitet ist und die Grenzen eines erfolgreichen<br />
Alterns erreicht – eine Erkenntnis des 21. Jahrhun<strong>der</strong>ts, da aufgrund <strong>der</strong> weitaus<br />
geringeren Lebenserwartung in früheren Zeiten nur selten jem<strong>an</strong>d über das Dritte Lebensalter<br />
hinausgekommen ist. Das sinkende biologische Potential bedingt auch, dass verstärkt<br />
gesellschaftliche und kulturelle Interventionen zur Kompensation notwendig werden –<br />
etwa durch institutionalisierte Unterbringungsmöglichkeiten – <strong>der</strong>en Wirkungsgrad <strong>im</strong><br />
Alter jedoch schwächer werden: Das Zusammenspiel von biologischen und kulturellen<br />
Faktoren lässt nach. Der stetige Verlust von Ressourcen <strong>im</strong> hohen Alter kumuliert sich<br />
nach und nach und die sich offenbarende, vor allem körperlich-gesundheitliche „systemische<br />
Schwäche des Individuums“ (Rott, 2011, S. 59) führt zu Funktionsverlusten und<br />
schließlich zum Exitus <strong>der</strong> Person (J. Smith & Baltes, 1997). Ein typisches Beispiel <strong>für</strong> das<br />
´Einstürzen` <strong>der</strong> menschlichen Architektur ist die neurodegenerative Alzhe<strong>im</strong>er-Demenz,<br />
<strong>der</strong>en Prävalenz mit dem Alter exponentiell zun<strong>im</strong>mt und ca. die Hälfte <strong>der</strong> über<br />
90jährigen betrifft (Rott, 2011).