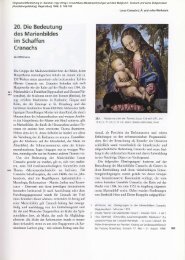im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einführung und Übersicht<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16<br />
– hier mit Fokus auf die kulturgeschichtliche Entwicklung, sozusagen als Blick über den<br />
eigenen disziplinären Tellerr<strong>an</strong>d, dargestellt werden.<br />
Die Sterblichkeit ist eines <strong>der</strong> großen Menschheitsthemen, <strong>der</strong> Tod ist Teil <strong>der</strong> conditio<br />
hum<strong>an</strong>a, ein universelles Ereignis und unumstößliches Naturgesetz. Es verwun<strong>der</strong>t<br />
daher kaum, dass nahezu jede wissenschaftliche Disziplin inklusive <strong>der</strong> ´schönen Künste`<br />
sich mit <strong>der</strong> Endlichkeit ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>gesetzt hat. Die Thematik liefert eine schier unendliche<br />
Fülle unterschiedlicher Betrachtungsweisen, etwa aus Philosophie (Connelly, 2003;<br />
Laager, 1996; Nassehi & Weber, 1989; Tomer, 1994; Wils, 2007), Theologie und Religionswissenschaft<br />
(Hölscher, 2007; Schwikart, 1999; Tomer, Eliason, & Wong, 2008;<br />
Wilkening, 2007), Literatur-, Musik- und Theaterwissenschaft (Bruggisser-L<strong>an</strong>ker, 2010;<br />
Dickenson, 1995; Duhr, 2010; Gasch, 2007; Gilbert, 2011; Hammerstein, 1980; J<strong>an</strong>sen,<br />
1989; Laager, 1996; Macho, 2007; Perdigao, 2010; Stefenelli, 1998), Soziologie<br />
(Gronemeyer, 2007; Robertson-von Trotha, 2008; Seale, 1998), Kunst- (Ariès, 1984;<br />
Lü<strong>der</strong>s, 2009; Richard, 1995; Warda, 2011) und Kulturgeschichte (Ariès, 2009; Friedm<strong>an</strong>,<br />
1997; Mischke, 1996; Neum<strong>an</strong>n, 2007), Ethnologie und kulturvergleichen<strong>der</strong> Anthropologie<br />
(Elsas, 2010; Honekamp-Yamamoto, 2008; Irish, Lundquist, & Nelsen, 1993;<br />
Pennington, 2001), Medizin, Medizinethik (Groß, Esser, Knoblauch, & Tag, 2007; Jox,<br />
2011; Stefenelli, 1998) und Pflegewissenschaften (Morg<strong>an</strong>, 1996; Wilkening & Kunz,<br />
2003) – hier insbeson<strong>der</strong>e auch zu den viel beforschten Themen Sterbehilfe, end-of-life,<br />
palliative care und Hospizbewegung (An<strong>der</strong>heiden, Bardenheuer, & Eckart, 2008; Corless,<br />
2006; Em<strong>an</strong>uel & Em<strong>an</strong>uel, 1998; Saun<strong>der</strong>s & Baines, 1991; Schmitz-Scherzer, 1992;<br />
Singer, Martin, & Kelner, 1999; Wittkowski, 2008), Gerontologie (Cicirelli, 2002b;<br />
Kastenbaum & Tomer, 2000; Kruse, 2007; Moss, 2003; Tomer, 2000b) sowie <strong>Psychologie</strong><br />
mit Psychotherapieforschung (Akhtar, 2010a; Feifel, 1990; Howze, 2002; Niemiec &<br />
Schulenberg, 2011; Richm<strong>an</strong>, 2006; Tausch-Flammer, 1987; Vogel, 2007; Wong, 2010a).<br />
Da in <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit die heutigen Einstellungen zu Sterben und Tod (<strong>für</strong> eine<br />
genaue Definition s. Punkt 2.1) bei Hochaltrigen untersucht werden, möchte die Autorin<br />
die kulturhistorische Entwicklung dieser Einstellungen darstellen – wenn auch aus Platzgründen<br />
nur oberflächlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – um eine Einbettung<br />
des Umg<strong>an</strong>gs mit Sterben und Tod in einen illustrativen Rahmen zu ermöglichen.<br />
Die Definition sowie empirisch-wissenschaftliche Untersuchung <strong>der</strong> Einstellungen<br />
zu Sterben und Tod erfolgte erst in den letzten Jahrzehnten (vgl. Punkt 1.5, 2 und 2.2).<br />
Natürlich existierten diese jedoch bereits, seit <strong>der</strong> Mensch evolutionär die Stufe erreicht<br />
hat, bei <strong>der</strong> er sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wurde. Sie unterliegen dem W<strong>an</strong>del<br />
<strong>der</strong> Zeit und werden unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em durch Gesellschaft, Epoche, Kultur und Religion<br />
als auch durch die individuelle Entwicklung beeinflusst und können einen wichtigen Beitrag<br />
zur Klärung <strong>der</strong> mittlerweile vorherrschenden Tabuisierung des Todes leisten. Kastenbaum<br />
spricht diesbezüglich von einer konstruktivistischen Annäherung <strong>an</strong> das Thema,<br />
wobei <strong>der</strong> Tod nicht nur über verschiedene Zeiten hinweg konstruiert und rekonstruiert<br />
wird, etwa auf gesellschaftlicher Ebene, son<strong>der</strong>n dieser Prozess <strong>im</strong>mer auch auf individueller,<br />
ontogenetischer Ebene stattfindet (2006, S. 5ff). Allerdings lässt sich aus historischer<br />
Sicht nur retrospektiv-spekulierend und verallgemeinernd etwas über die Entstehung und<br />
Ausprägung <strong>der</strong> Einstellungen zu Sterben und Tod sagen.