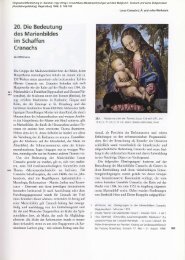im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhalt - Ruprecht-Karls ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einführung und Übersicht<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
20<br />
Gemäß Ariès waren die Einstellungen zu Sterben und Tod bei aller Individualität und Heterogenität<br />
durch eine pragmatisch-resignative, neutral-akzeptierende Grundhaltung geprägt.<br />
M<strong>an</strong> fügte sich in das Unvermeidliche und <strong>für</strong>chtete weniger um sein eigenes Ableben,<br />
son<strong>der</strong>n war als Angehöriger nach einem Trauerfall vielmehr auf die soziale Anteilnahme<br />
in einer Gesellschaft ohne jegliche soziale Absicherung <strong>an</strong>gewiesen und musste<br />
sich um das Überleben <strong>der</strong> eigenen Familie kümmern. Ariès konstatiert das „jahrtausendel<strong>an</strong>ge<br />
Überdauern einer nahezu unverän<strong>der</strong>lichen Einstellung zum Tode […], die eine naive<br />
und spont<strong>an</strong>e Fügung ins Schicksal und in den Willen <strong>der</strong> Natur zum Ausdruck brachte“<br />
(2009, S. 43). Der Umg<strong>an</strong>g mit dem Tod sei ferner durch eine „indifferente Vertrautheit“<br />
(ebd.) geprägt gewesen, wodurch er „<strong>im</strong> schroffen Gegensatz“ (ebd., S. 42) zu unserem<br />
heutigen Gewahren wenig <strong>an</strong>gsteinflößend gewesen sei. Fällt es dem mo<strong>der</strong>nen Menschen<br />
oft schwer, sich (sein) Sterben und (seinen) Tod überhaupt vorzustellen, war dies zu<br />
alten Zeit ein völlig natürliches Faktum, mit dem m<strong>an</strong> tagtäglich konfrontiert wurde.<br />
1.4.3 Einstellungen zu Sterben und Tod <strong>im</strong> Mittelalter und <strong>der</strong> frühen Neuzeit:<br />
Der eigene Tod<br />
Die sich in <strong>der</strong> Überg<strong>an</strong>gszeit von <strong>der</strong> Antike zum Mittelalter nach und nach vollziehende<br />
Verkirchlichung <strong>der</strong> Trauerkultur erfuhr <strong>im</strong> Mittelalter (hier ca. ab dem 12. bis zum 15.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t) ihren Höhepunkt; bei <strong>der</strong> nun „institutionalisierten und ritualisierten Jenseitsvorsorge“<br />
(Bölsker-Schlicht, 1992, S. 19) hatte die Kirche die Monopolstellung inne und<br />
prägte die Einstellungen zu Sterben und Tod nachhaltig, so etwa durch oft drastisch und<br />
gewollt beängstigend ausgeschmückte bildlich-plastische Darstellungen des Jüngsten Gerichts<br />
und <strong>der</strong> drohenden postmortalen Vergeltung in Wort, Schrift und Bild. Die vielleicht<br />
f<strong>an</strong>tastischsten Interpretationen aus dieser Zeit sind auf Hieronymus Boschs Triptychen<br />
´Das Jüngste Gericht` und ´Der Garten <strong>der</strong> Lüste` aus dem 15. Jahrhun<strong>der</strong>t dargestellt.<br />
Doch auch nicht-sakrale Kunst befasste sich eingehend mit <strong>der</strong> Sterblichkeit, <strong>der</strong>en Betrachtung<br />
das Realisieren <strong>der</strong> eigenen Vergänglichkeit durch Darstellung des physischen<br />
Augenblicks o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Symbolik des Todes zum Ziel hatte; als Beispiel sei hier das über<br />
viele Jahrhun<strong>der</strong>te wie<strong>der</strong>kehrende Motiv des Totent<strong>an</strong>zes o<strong>der</strong> d<strong>an</strong>se macabre gen<strong>an</strong>nt.<br />
Vertiefende Abh<strong>an</strong>dlungen sowie Beispiele zu den Kunstformen Ars moriendi, V<strong>an</strong>itas<br />
und mittelalterliche Totentänze finden sich z.B. bei Hammerstein (1980), Laager (1996),<br />
Pennington (2001), Warda (2011) und Ariès (2009). Die Sterblichkeit wurde also durchaus<br />
offen als mahnendes memento mori – abgeleitet vom Lateinischen memento moriendum<br />
esse als Ermahnung, unserer Sterblichkeit zu gedenken – und Hinweis auf ein tugendhaftes,<br />
christliches Leben <strong>im</strong> Diesseits thematisiert, so dass diese in vielen Bereichen wie Alltag,<br />
Glaube und Kunst präsent war. Das Barock-Sonett ´Abend` von Andreas Gryphius aus<br />
dem Jahr 1650 sei hier beispielhaft <strong>für</strong> den damaligen künstlerischen Ausdruck des Sterblichkeitsbewusstseins,<br />
<strong>der</strong> Vergänglichkeit o<strong>der</strong> V<strong>an</strong>itas des menschlichen Daseins dargestellt<br />
(Mauser, 1976):