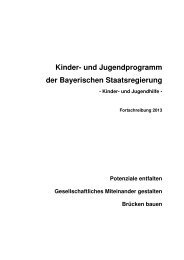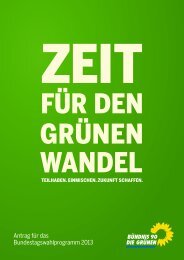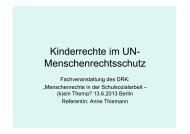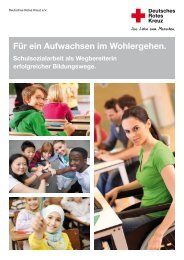Bildungsmonitor 3 - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
Bildungsmonitor 3 - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
Bildungsmonitor 3 - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Bildungsmonitor</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> Nr. 3<br />
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen<br />
zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache<br />
oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern<br />
und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung<br />
des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer<br />
Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien<br />
zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.<br />
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung<br />
und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung<br />
und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten<br />
sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.<br />
Quelle:<br />
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezember 2008<br />
Herunterzuladen unter:<br />
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf<br />
2.2 Elternrecht auf Inklusion?<br />
In Österreich wurde bereits 1993 das Wahlrecht für Eltern von Kindern mit Behinderungen<br />
eingeführt. Nicht die Fachleute, sondern die Eltern sollten für ihr Kind entscheiden,<br />
ob es eine allgemeine oder eine Förderschule besuchen solle. Im Nationalen Bildungsbericht<br />
(2009) ist die Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Österreich insgesamt<br />
und in den einzelnen Bundesländern untersucht worden. Nach Auffassung der Bildungsjournalistin<br />
Brigitte Schumann, die sich in ihrer Dissertation „Ich schäme mich ja<br />
so!“ - Die Sonderschule für Lernbehinderte als „Schonraumfalle“ (Bad Heilbrunn 2007)<br />
intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat, sollte dieses Modell, das nun<br />
auch von deutschen Bildungspolitikern offeriert wird, skeptisch stimmen. Sie hält es für<br />
die Steuerung einer inklusiven Entwicklung völlig ungeeignet.<br />
Der Nationale Bildungsbericht für Österreich stellt fest, dass sich die Integrationsquote<br />
seit dem Jahr 2000/2001 bundesweit bei ca. 50% eingependelt hat und seitdem stagniert.<br />
Gleichzeitig legt er offen, dass es erstaunliche regionale Disparitäten in der Entwicklung<br />
der gemeinsamen und getrennten Förderung von Kindern mit Behinderungen<br />
gibt. Während in der Steiermark die Integrationsquote von Kindern mit Behinderungen<br />
bei 83% liegt, beträgt sie in Niederösterreich nur 32%. Auch Vorarlberg und Tirol sind<br />
Bundesländer mit hohen Segregationsquoten und einer deutlichen Sonderschulorientierung,<br />
demgegenüber fallen die entsprechenden Quoten in der Steiermark, dem Burgenland<br />
und in Oberösterreich eher gering aus.<br />
Sehr deutlich tritt der Bildungsbericht der Auffassung entgegen, dass sich in den unterschiedlichen<br />
Entwicklungen ein unterschiedlicher Elternwunsch ausdrückt. Er führt die<br />
Unterschiede zurück „auf lokale und regionale Traditionen sowie den diesen zugrunde<br />
liegenden Einstellungen, Haltungen, Kompetenzen und Verhaltensweisen der Professionellen,<br />
insbesondere von den Schulbehördenvertreter/innen". Der Bericht hält als Ergebnis<br />
fest: „Das Ausmaß getrennter bzw. gemeinsamer Erziehung und Bildung scheint beliebig<br />
zu sein und weniger vom Elternwunsch als den Einstellungen und Haltungen der<br />
Professionellen und dem vorhandenen Angebot abzuhängen.“ Für Prof. Feyerer, Leiter<br />
des Instituts für Inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Linz, steht<br />
fest: Die Verankerung des Elternwahlrechts anstelle eines Rechtsanspruchs, wie es die<br />
UN-Konvention heute unmissverständlich vorsieht, hat zu einer „Alles ist möglich, aber<br />
nichts ist fix“-Politik geführt. In manchen Regionen kam es zu vorbildlichen Entwicklungen,<br />
in manchen Regionen zu einem heute höheren Segregationsquotienten als 1993.<br />
Insgesamt kam es zu einer Doppelgleisigkeit und damit zur sicherlich teuersten Variante,<br />
der Aufrechterhaltung beider Systeme. Will man flächendeckende und leistbare Inklusion<br />
erreichen, ist das Elternwahlrecht kein Weg.<br />
Jahrzehntelang haben Eltern von Kindern mit Behinderungen in Deutschland vergeblich<br />
von der Politik das Recht eingefordert, zwischen Förderschule und Regelschule wählen zu<br />
können. Just zu dem Zeitpunkt, wo die UN-Konvention dem einzelnen Kind mit Behinderung<br />
einen individuellen Rechtsanspruch auf inklusive Bildung garantiert und die progressive<br />
Realisierung eines inklusiven Schulsystems fordert, hat die Kultusministerkonferenz<br />
(KMK) die Vorzüge des Elternwahlrechts entdeckt. Zum Zwecke des Elterwahlrechts muss<br />
10