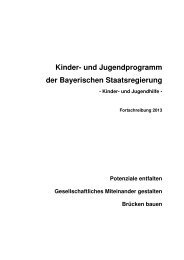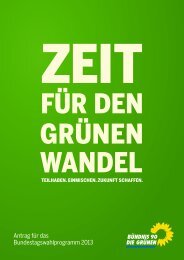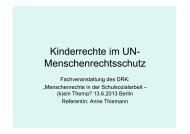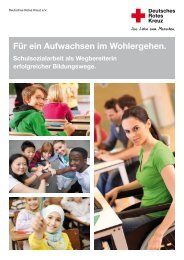Bildungsmonitor 3 - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
Bildungsmonitor 3 - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
Bildungsmonitor 3 - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bildungsmonitor</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> Nr. 3<br />
se Veränderungen markieren jedoch aufgrund gleichbleibender Schlussfolgerungen lediglich<br />
einen „rhetorischen Wandel“. Eine eindeutige inhaltliche Definition von „Lernbehinderung“<br />
lag und liegt dabei nicht vor, aufgrund einer letztlich fehlenden klinischwissenschaftlichen<br />
Begründbarkeit einer solchen sozialen Kategorie. „Lernbehinderung“<br />
wird ausschließlich relational als negative Abweichung von den Durchschnittsleistungen<br />
der Kinder der betreffenden Klasse, Schule oder im betreffenden Altersjahrgang bestimmt.<br />
Sie wird immer mit individuellen Defiziten begründet.<br />
Mit der Individualisierung der Schulprobleme von „Lernbehinderten“ werden sowohl die<br />
Probleme des Systems Schule als auch die gesellschaftlich bedingten Armutsprobleme<br />
der Betroffenen unsichtbar gemacht, kritisiert die Wissenschaftlerin. „Lernbehinderte“<br />
können sich im „Schonraum“ der Sonderschule nicht als arm und sozial benachteiligt erfahren<br />
und reflektieren. Sie sind Objekte reduzierter Erwartungen, die in einem geschützten<br />
Territorium außerhalb der Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft mit eingeschränkten<br />
Bildungsangeboten gefördert werden. Bis heute werden sie wegen ihrer „Leistungsschwäche“<br />
auf ihre „Hilfsbedürftigkeit“ festgelegt und reduziert.<br />
„Lernbehinderung“ im bildungsbiografischen Vollzug<br />
In der Biografienanalyse stellt Pfahl fest, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen<br />
sich die sonderpädagogische Zuschreibung auf unterschiedliche Weise zu Eigen gemacht<br />
haben. Die Fallbeschreibungen verdeutlichen, dass die Befragten ihre Schulerfahrungen<br />
als individuelle Schwierigkeiten begreifen. Pfahl kann zeigen, dass die Verinnerlichung<br />
der sonderpädagogischen Ideologie zu „Selbsttechniken der Behinderung“ führt. Diese<br />
gehen sowohl mit reduzierten Selbstansprüchen als auch mit einer Einschränkung der<br />
(beruflichen) Handlungsfähigkeit einher. Selbst wenn die Betroffenen in beruflichen Zusammenhängen<br />
erfolgreich sind, haben sie Selbstzweifel, die sie wiederum in inferiore<br />
Rollen zwingt. Sie schreiben sich selbst die „Lernbehinderung“ lebenslang zu und fordern<br />
eine darauf abgestellte Sonderbehandlung ein. Ihrer psychologischen Konditionierung als<br />
„lern- und leistungsschwach“ im „Schonraum“ der Sonderschule wird im Rahmen des<br />
beruflichen Übergangssystems heute mit der Folge entsprochen, dass sich ihre abhängigen<br />
und hilfebedürftigen Subjektrollen auch nach der Schulzeit weiter verfestigen.<br />
In der Zusammenführung der diskursanalytischen und biografienanalytischen Ergebnisse<br />
verdeutlicht Pfahl, wie im Prozess der sonderpädagogisch vermittelten Fremd- und<br />
Selbstzuschreibung soziale Ungleichheit reproduziert wird. Zusammenfassend lautet ihr<br />
Ergebnis: „Techniken der Behinderung fungieren als Mechanismen der Reproduktion sozialer<br />
Ungleichheit, die den eigentlichen Schulbesuch weit überdauern und die biografische<br />
Arbeit am eigenen Selbst und seine gesellschaftlichen Chancen maßgeblich strukturieren.<br />
Die Kategorie Lernbehinderung wird am sozialen Ort Schule konstruiert, an dem<br />
sie festgestellt, aufgeschrieben und im wechselseitigen Handeln inszeniert wird.“<br />
Forderungen an die Bildungspolitik<br />
Lisa Pfahl begründet mit ihrer Studie die Notwendigkeit, die Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt<br />
„Lernen“ aufzulösen und die behinderungsspezifische Etikettierung und<br />
Klassifizierung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der individuellen Feststellungsdiagnostik<br />
zu beenden, als unausweichlich für eine verantwortungsvolle Bildungspolitik.<br />
Diese Position wird auch in den Gutachten von Klemm/Preuss-Lausitz für die Bundesländer<br />
Bremen und NRW argumentativ untermauert und zur Grundlage für die strategische<br />
Umsetzung der UN-BRK erhoben. Die Bildungsforscher verbinden die Auflösung der Sonderschule<br />
mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ und der ihr verwandten Sonderschularten<br />
mit den Förderschwerpunkten „emotionale und soziale Entwicklung“ sowie „Sprache“<br />
mit der Einführung der systemischen sonderpädagogischen Ressourcenzuweisung und<br />
plädieren dezidiert für den Verzicht der herkömmlichen individuellen Feststellungsdiagnostik.<br />
Diagnostische Verfahren sollen aus ihrer Sicht ausschließlich der Lernprozessförderung<br />
dienen. Die Gutachter lehnen nachdrücklich das Elternwahlrecht für diese Förderschwerpunkte<br />
ab.<br />
Pfahls Untersuchung legt ebenso eindringlich nahe, dass die Sonderpädagogik mit dieser<br />
ideologischen Ausrichtung als wissenschaftliche Disziplin keine Zukunft haben darf. Für<br />
die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern muss aus Sicht der Wissenschaftlerin generell<br />
gelten, dass sie sich an dem Recht auf Inklusion orientiert und damit an einer gemeinsamen<br />
und gleichberechtigten Bildung für alle.<br />
40