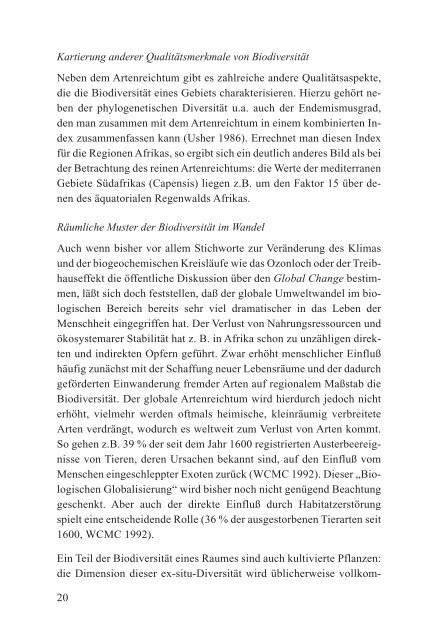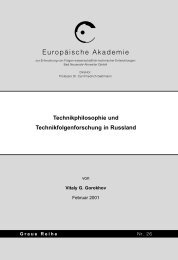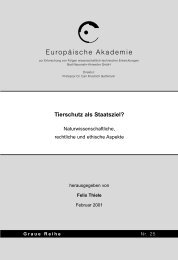Download PDF - Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler
Download PDF - Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler
Download PDF - Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kartierung anderer Qualitätsmerkmale von Biodiversität<br />
Neben dem Artenreichtum gibt es zahlreiche andere Qualitätsaspekte,<br />
die die Biodiversität eines Gebiets charakterisieren. Hierzu gehört neben<br />
der phylogenetischen Diversität u.a. auch der Endemismusgrad,<br />
den man zusammen mit dem Artenreichtum in einem kombinierten Index<br />
zusammenfassen kann (Usher 1986). Errechnet man diesen Index<br />
für die Regionen Afrikas, so ergibt sich ein deutlich anderes Bild als bei<br />
der Betrachtung des reinen Artenreichtums: die Werte der mediterranen<br />
Gebiete Südafrikas (Capensis) liegen z.B. um den Faktor 15 über denen<br />
des äquatorialen Regenwalds Afrikas.<br />
Räumliche Muster der Biodiversität im Wandel<br />
Auch wenn bisher vor allem Stichworte zur Veränderung des Klimas<br />
und der biogeochemischen Kreisläufe wie das Ozonloch oder der Treibhauseffekt<br />
die öffentliche Diskussion über den Global Change bestimmen,<br />
läßt sich doch feststellen, daß der globale Umweltwandel im biologischen<br />
Bereich bereits sehr viel dramatischer in das Leben der<br />
Menschheit eingegriffen hat. Der Verlust von Nahrungsressourcen und<br />
ökosystemarer Stabilität hat z. B. in Afrika schon zu unzähligen direkten<br />
und indirekten Opfern geführt. Zwar erhöht menschlicher Einfluß<br />
häufig zunächst mit der Schaffung neuer Lebensräume und der dadurch<br />
geförderten Einwanderung fremder Arten auf regionalem Maßstab die<br />
Biodiversität. Der globale Artenreichtum wird hierdurch jedoch nicht<br />
erhöht, vielmehr werden oftmals heimische, kleinräumig verbreitete<br />
Arten verdrängt, wodurch es weltweit zum Verlust von Arten kommt.<br />
So gehen z.B. 39 % der seit dem Jahr 1600 registrierten Austerbeereignisse<br />
von Tieren, deren Ursachen bekannt sind, auf den Einfluß vom<br />
Menschen eingeschleppter Exoten zurück (WCMC 1992). Dieser „Biologischen<br />
Globalisierung“ wird bisher noch nicht genügend Beachtung<br />
geschenkt. Aber auch der direkte Einfluß durch Habitatzerstörung<br />
spielt eine entscheidende Rolle (36 % der ausgestorbenen Tierarten seit<br />
1600, WCMC 1992).<br />
Ein Teil der Biodiversität eines Raumes sind auch kultivierte Pflanzen:<br />
die Dimension dieser ex-situ-Diversität wird üblicherweise vollkom-<br />
20