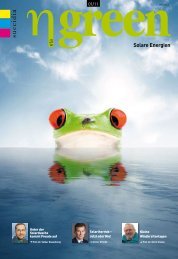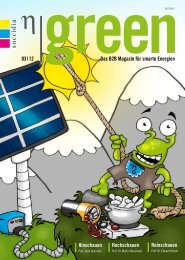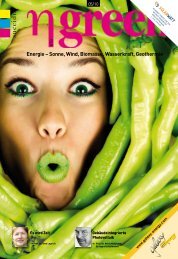Energie – Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie - η green
Energie – Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie - η green
Energie – Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie - η green
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sorptive Langzeitwärmespeicherung<br />
Am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) der<br />
Universität Stuttgart wurde im Projekt „MonoSorp“ ein neues<br />
Verfahren, basierend auf einer sorptiven Langzeitwärmespeicherung,<br />
zur solarthermischen Gebäudebeheizung entwickelt. Das<br />
Verfahren beruht auf der Adsorption von Wasserdampf an zeolithischen<br />
Wabenkörpern. Dabei werden in einem offenen Prozess<br />
aus Zeolithpulver extrudierte Wabenkörper von feuchter Raumabluft<br />
durchströmt. Die austretende erwärmte Luft wird in Verbindung<br />
mit einer kontrollierten Gebäudebelüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
zur Erwärmung der Zuluft genutzt. Die Regeneration<br />
des Speichers erfolgt solarthermisch in den Sommermonaten.<br />
Abb. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer solchen Heizungsanlage<br />
für ein Gebäude. Dabei ist die Lüftungsanlage mit<br />
Wärmerückgewinnung ausgeführt und die „klassische“ solare<br />
Kombianlage um einen Sorptionsspeicher erweitert. Während der<br />
Heizperiode wird die verbrauchte, feuchte (Raum) Abluft durch<br />
den Sorptionsspeicher geleitet, in dem die Luftfeuchte adsorbiert<br />
wird. Die dabei frei werdende Wärme führt zu einer Temperaturerhöhung<br />
des Luftstroms. Die dem Gebäude zugeführte Umgebungsluft<br />
wird dadurch auf Temperaturen deutlich oberhalb der<br />
Raumtemperatur aufgewärmt und trägt so zur Raumheizung bei.<br />
In Abb. 2 ist die jährliche <strong>Energie</strong>einsparung für ein Einfamilienhaus<br />
mit einer Wohnfläche von etwa 140 m², das mit einer kontrollierten<br />
Lüftung mit Wärmerückgewinnung ausgerüstet ist, im<br />
Vergleich zu einer StandardKombianlage dargestellt. Die Kollektorfläche<br />
wurde dazu so gewählt, dass sie gerade ausreicht, um den<br />
Sorptionsspeicher im Sommer vollständig zu regenerieren. Bereits<br />
mit hoch effizienten Vakuumröhrenkollektoren mit Flächen von<br />
20<strong>–</strong>30 m² und vergleichsweise geringen Speichervolumina von<br />
10<strong>–</strong>15 m³ sowie relativ einfacher Systemtechnik lassen sich sehr<br />
hohe solare Deckungsanteile realisieren. Mit einer Speicherdichte<br />
von 130 kWh/m³ wird bei dem hier eingesetzten monolithischen<br />
Sorptionswärmespeicher etwa die zweieinhalbfache <strong>Energie</strong>speicherdichte<br />
im Vergleich zu einem Warmwasserspeicher erreicht. Die<br />
experimentellen Untersuchungen belegen die technische Machbarkeit.<br />
Einige Punkte bedürfen jedoch noch weiterer Forschung.<br />
Abb. 1 Schematische Darstellung eines Gebäudes mit kontrollierter<br />
Lüftung, Wärmerückgewinnung und Sorptionsspeicher Quelle: ITW<br />
0410<br />
17<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
Messe EUPVsec in Valencia!<br />
Halle 3, Stand B22