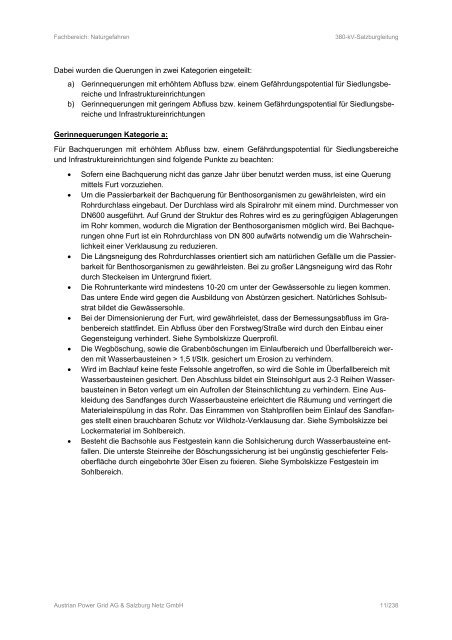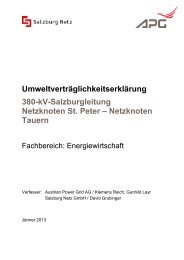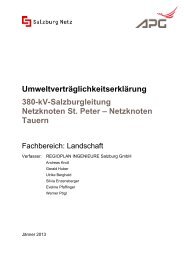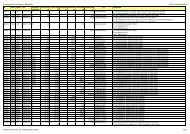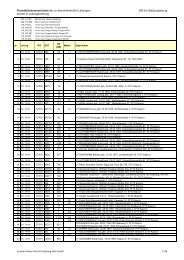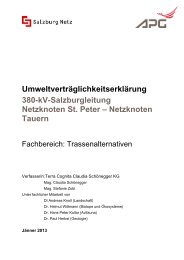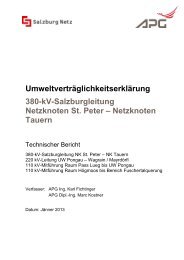380kv - eb - naturgefahren - jan. 2013 - final.pdf - Land Salzburg
380kv - eb - naturgefahren - jan. 2013 - final.pdf - Land Salzburg
380kv - eb - naturgefahren - jan. 2013 - final.pdf - Land Salzburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fachbereich: Naturgefahren<br />
380-kV-<strong>Salzburg</strong>leitung<br />
Dabei wurden die Querungen in zwei Kategorien eingeteilt:<br />
a) Gerinnequerungen mit erhöhtem Abfluss bzw. einem Gefährdungspotential für Siedlungsbereiche<br />
und Infrastruktureinrichtungen<br />
b) Gerinnequerungen mit geringem Abfluss bzw. keinem Gefährdungspotential für Siedlungsbereiche<br />
und Infrastruktureinrichtungen<br />
Gerinnequerungen Kategorie a:<br />
Für Bachquerungen mit erhöhtem Abfluss bzw. einem Gefährdungspotential für Siedlungsbereiche<br />
und Infrastruktureinrichtungen sind folgende Punkte zu beachten:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Sofern eine Bachquerung nicht das ganze Jahr über benutzt werden muss, ist eine Querung<br />
mittels Furt vorzuziehen.<br />
Um die Passierbarkeit der Bachquerung für Benthosorganismen zu gewährleisten, wird ein<br />
Rohrdurchlass eing<strong>eb</strong>aut. Der Durchlass wird als Spiralrohr mit einem mind. Durchmesser von<br />
DN600 ausgeführt. Auf Grund der Struktur des Rohres wird es zu geringfügigen Ablagerungen<br />
im Rohr kommen, wodurch die Migration der Benthosorganismen möglich wird. Bei Bachquerungen<br />
ohne Furt ist ein Rohrdurchlass von DN 800 aufwärts notwendig um die Wahrscheinlichkeit<br />
einer Verklausung zu reduzieren.<br />
Die Längsneigung des Rohrdurchlasses orientiert sich am natürlichen Gefälle um die Passierbarkeit<br />
für Benthosorganismen zu gewährleisten. Bei zu großer Längsneigung wird das Rohr<br />
durch Steckeisen im Untergrund fixiert.<br />
Die Rohrunterkante wird mindestens 10-20 cm unter der Gewässersohle zu liegen kommen.<br />
Das untere Ende wird gegen die Ausbildung von Abstürzen gesichert. Natürliches Sohlsubstrat<br />
bildet die Gewässersohle.<br />
Bei der Dimensionierung der Furt, wird gewährleistet, dass der Bemessungsabfluss im Grabenbereich<br />
stattfindet. Ein Abfluss über den Forstweg/Straße wird durch den Einbau einer<br />
Gegensteigung verhindert. Siehe Symbolskizze Querprofil.<br />
Die Wegböschung, sowie die Grabenböschungen im Einlaufbereich und Überfallbereich werden<br />
mit Wasserbausteinen > 1,5 t/Stk. gesichert um Erosion zu verhindern.<br />
Wird im Bachlauf keine feste Felssohle angetroffen, so wird die Sohle im Überfallbereich mit<br />
Wasserbausteinen gesichert. Den Abschluss bildet ein Steinsohlgurt aus 2-3 Reihen Wasserbausteinen<br />
in Beton verlegt um ein Aufrollen der Steinschlichtung zu verhindern. Eine Auskleidung<br />
des Sandfanges durch Wasserbausteine erleichtert die Räumung und verringert die<br />
Materialeinspülung in das Rohr. Das Einrammen von Stahlprofilen beim Einlauf des Sandfanges<br />
stellt einen brauchbaren Schutz vor Wildholz-Verklausung dar. Siehe Symbolskizze bei<br />
Lockermaterial im Sohlbereich.<br />
Besteht die Bachsohle aus Festgestein kann die Sohlsicherung durch Wasserbausteine entfallen.<br />
Die unterste Steinreihe der Böschungssicherung ist bei ungünstig geschieferter Felsoberfläche<br />
durch eing<strong>eb</strong>ohrte 30er Eisen zu fixieren. Siehe Symbolskizze Festgestein im<br />
Sohlbereich.<br />
Austrian Power Grid AG & <strong>Salzburg</strong> Netz GmbH 11/238