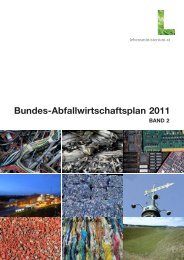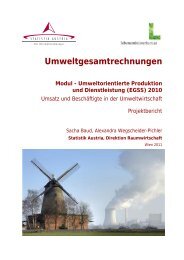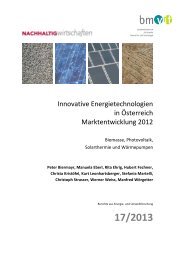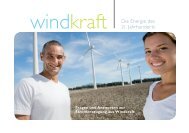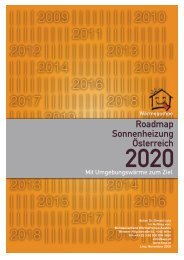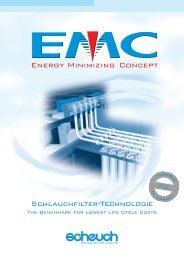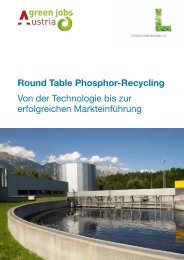green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
kleiner dimensionierte, Kessel sind darauf ausgelegt,<br />
Temper<strong>at</strong>uren knapp unter dem Dampfniveau<br />
zu erzeugen (bis 95°C). Dadurch ergibt sich, dass<br />
vor allem jene Betriebe diese Technologie anwenden,<br />
die ein geringeres Temper<strong>at</strong>urniveau<br />
benötigen. Dazu zählen beispielsweise Lackierereien,<br />
die ein Temper<strong>at</strong>urbedarfsniveau von rund 70<br />
°C aufweisen [2].<br />
Für einen langfristigen, <strong>tech</strong>nisch und wirtschaftlich<br />
optimierten Betrieb muss jedem Projekt in der Planungsphase<br />
ein detailliertes Wärmekonzept hinterlegt<br />
sein, in dem die Anlagendimensionierung, die<br />
Betriebsstunden, das Wärmeverteilnetz und weitere<br />
wichtige Parameter aufgeführt sind [1].<br />
Neben dem Temper<strong>at</strong>urniveau und einem Wärmekonzept<br />
sind die örtlichen Voraussetzungen für<br />
eine Anwendung von Biomasse entscheidend. So<br />
muss beispielsweise ein Raum für die Lagerung des<br />
Brennstoffes (z. B.: Pelletslager) vorhanden sein. Bei<br />
Neu- oder Zubauten ist es sinnvoll, bereits frühzeitig<br />
die notwendige Infrastruktur mit zu berücksichtigen<br />
[2]. Ein entscheidender Faktor für ein nachhaltiges<br />
Funktionieren der Anlage ist die Qualität der Errichtung<br />
vor Ort. Die Anlageninstall<strong>at</strong>ion bietet viele<br />
potenzielle Fehlerquellen und kann selbst bei <strong>tech</strong>nisch<br />
ausgereiften Komponenten zu geringerer Effizienz<br />
der Gesamtanlage führen. Entsprechendes<br />
Augenmerk muss auf eine fachlich kompetente Anlagenerrichtung<br />
gelegt werden [1].<br />
Biomasse stellt eine von vielen Möglichkeiten zur<br />
Energiegewinnung dar. Auch wenn das Angebot<br />
an Biomasse in Europa groß ist, sollen bei jeder<br />
Anlagenplanung sämtliche erneuerbaren Energieträger<br />
auf deren Eins<strong>at</strong>zmöglichkeit geprüft<br />
werden um die am besten geeignete Variante zu<br />
wählen. Auch Kombin<strong>at</strong>ionen mehrerer erneuerbarer<br />
Energieträger, beispielsweise Bioenergie uns Solarthermie<br />
sind in vielen Fällen sinnvoll.<br />
Wirtschaftliche Aspekte<br />
Ein Vorteil von Biomasseheizanlagen ist die kontinuierliche<br />
Kostenersparnis im Betrieb aufgrund der<br />
geringeren Brennstoffkosten. Vor allem im kleinen<br />
Leistungsbereich (Eins<strong>at</strong>zgebiete von Bürogebäuden<br />
bis zu kleinen Produktionshallen) befindet sich<br />
die Anlageneffizienz aufgrund der umfassenden Erfahrungen<br />
im Ein- und Mehrfamilienwohnbau auf<br />
sehr hohem Niveau. Bezogen auf den Preis für eine<br />
kWh, liegen die Kosten für Energie aus Biomasse<br />
zwischen 40 und 60 % verglichen mit der Energiebereitstellung<br />
aus Öl. Wie schnell sich eine Anlage<br />
rentiert ist nicht in jedem Fall gleich, die Größe<br />
der Anlage sowie die Qualität in der Planung,<br />
bei der Install<strong>at</strong>ion und während des Betriebs<br />
der Anlage sind dafür mitentscheidend. Auch die<br />
Größe und Dichte eines Wärmenetzes haben Auswirkungen<br />
auf die Effizienz und somit auf die Wirtschaftlichkeit<br />
einer Anlage [1].<br />
Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Amortis<strong>at</strong>ionszeit<br />
der Investition) ist zudem entscheidend<br />
zu betrachten, mittels welches Energieträgers sich<br />
der Betrieb bisher mit Energie versorgt h<strong>at</strong> (sofern<br />
es sich nicht um eine Neuerrichtung eines Betriebsgebäudes<br />
handelt). Da Biomassefeuerungen in der<br />
Regel komplexer als Gasfeuerungen sind, wirkt sich<br />
das neg<strong>at</strong>iv auf den Preis für die Install<strong>at</strong>ion aus, geringere<br />
Brennstoffkosten gleichen diesen Nachteil<br />
aber im laufenden Betrieb wieder aus [2].<br />
Mit den wirtschaftlichen Vorteilen für das Unternehmen<br />
selbst gehen durch die Verwendung von heimischer<br />
Biomasse (Biomasse wird in der Regel regional<br />
bereitgestellt) aufgrund des Verzichts auf den<br />
Import von fossilen Energieträgern aus dem Ausland<br />
auch positive volkswirtschaftliche Effekte einher.<br />
Wertschöpfung und Beschäftigung wird im Inland<br />
generiert, Technologiehersteller können ihre Expertise<br />
weiter ausbauen [1].<br />
Neben einer Finanzierung aus Eigenmitteln oder<br />
durch Kredite können beispielsweise auch Contractingmodelle<br />
zur erfolgreichen Realisierung einer<br />
Biomasseanlage herangezogen werden. Durch<br />
das Auslagern der Biomasseanlage kann sich das<br />
Unternehmen auf sein Kerngeschäft konzentrieren.<br />
Dabei plant, errichtet, finanziert und betreibt ein<br />
spezialisiertes Unternehmen (Contractor) die Biomasseanlage.<br />
Refinanziert werden die Investitionskosten<br />
über die Lieferung von Wärme an den Betrieb<br />
[10].<br />
Wirtschaftliche Vorteile in Form von Energiekosteneinsparungen<br />
ergeben sich beispielsweise<br />
auch bei der Nutzung von Biogas mittels Blockheizkraftwerken<br />
mit denen sowohl Wärme aus<br />
auch Strom produziert werden kann. Neben einer<br />
innerbetrieblichen Nutzung der gewonnenen<br />
Energie kann diese auch in ein Nahwärme-Verteilnetz<br />
sowie in das Stromnetz eingespeist<br />
werden. Bei innerbetrieblicher Nutzung kann je<br />
nach Auslegung nahezu Netzautarkie erreicht<br />
werden, darüber hinaus kann sich das Unternehmen<br />
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber<br />
der Konkurrenz sichern. Biogas h<strong>at</strong> weiters den<br />
Vorteil, dass es einerseits vor Ort in Strom und/<br />
oder Wärme umgewandelt aber auch über weite<br />
Strecken verlustfrei transportiert werden kann.<br />
Gegebenenfalls kann auch in das bestehende<br />
Erdgasnetz eingespeist werden [4].<br />
Mikro-KWK<br />
© iStockPhoto/Wittelsbach Bernd<br />
Eine weitere Möglichkeit zur Energiebereitstellung in<br />
Betrieben ist die Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung (Mikro-KWK).<br />
Der Begriff „Kraft-Wärme-Kopplung“ beschreibt<br />
die gleichzeitige Energieumwandlung von chemischer<br />
Brennstoffenergie (beispielsweise im<br />
Brennstoff Biomasse enthalten) in thermische<br />
und mechanische und/oder elektrische Energie.<br />
Es kann somit mittels einer Anlage sowohl Wärme<br />
als auch Strom bereitgestellt werden. Von<br />
Mikro-KWK spricht man gemäß KWKRichtlinie<br />
(2004/8/EG) dann, wenn die elektrische Leistungsgröße<br />
der Anlage kleiner 50 KW el ist [7].<br />
Ein wesentlicher Vorteil einer KWK-Anlage ist, dass<br />
nur eine Anlage zur Erzeugung von sowohl Wärme<br />
als auch Strom notwendig ist. Weiters ergibt<br />
sich durch die Kraft-Wärme-Kopplung ein geringerer<br />
Brennstoffbedarf verbunden mit niedrigeren<br />
Emissionen. Da eine Heizung in der Regel dann benötigt<br />
wird, wenn im Gebäude bzw. im Betrieb auch<br />
Strombedarf gegeben ist, ergibt sich eine hohe Eigenverbrauchsabdeckung,<br />
die sich positiv auf die<br />
Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems auswirkt [8].<br />
Biomassefeuerungen benötigen im laufenden Betrieb<br />
eine gewisse Strommenge, beispielsweise für<br />
das Zündelement, für die Brennstoff-Förderschnecke<br />
oder für das Saugzuggebläse. Diese Energie<br />
kann bei KWK-Systemen durch die Anlage selbst<br />
bereitgestellt werden, ein netzunabhängiger Betrieb<br />
ist möglich [9].<br />
Derzeit besteht bei innov<strong>at</strong>iven Mikro-KWK<br />
Technologien in vielen Bereichen noch Forschungs-<br />
und Entwicklungsbedarf. Zu den innov<strong>at</strong>iven<br />
Technologien zählen vor allem jene, die<br />
neben gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen<br />
auch feste Biomasse als Brennstoff ermöglichen.<br />
Die Energieumwandlung kann dabei beispielsweise<br />
mittels Stirlingmotor, Mikro-Dampfmotor, ORC-Prozess<br />
oder Mikro-Gasturbinen erfolgen. Da bei der<br />
Stirlingmotor-Technologie die Verbrennung extern<br />
st<strong>at</strong>tfindet, ist er prinzipiell auch für feste Brennstoffe<br />
geeignet und kann sich gut für den Eins<strong>at</strong>z<br />
im Kleingewerbebereich sowie im Haushaltssektor<br />
eignen [7].<br />
Derzeit wird von der Firma ÖkoFEN eine Strom<br />
produzierende Pelletsheizung entwickelt und<br />
getestet, die zukünftig unter anderem im Gewerbebereich<br />
zum Eins<strong>at</strong>z kommen soll. Bei diesem<br />
Projekt wird ein praxiserprobter Stirlingmotor aus<br />
Serienproduktion mit einem speziell entwickelten<br />
Pelletskessel kombiniert. Durch die Kombin<strong>at</strong>ion<br />
aus Strom- und Wärmeproduktion sowie der Nutzung<br />
direkt vor Ort können Systemverluste deutlich<br />
reduziert werden. Die derzeit im Praxistest befindlichen<br />
Anlagen weisen eine Brennerleistung von rund<br />
15 kW auf und können rund 14 kW thermische und<br />
1 kW elektrische Energie bereitstellen. Je nach Laufzeiten<br />
des Kessels können somit bis zu 7.000 kWh<br />
Strom pro Jahr produziert werden. Die Abmessungen<br />
der Pelletsheizung mit integriertem Stirlingmodul<br />
werden sich nur unwesentlich von jenen einer<br />
normalen Pelletsheizung unterscheiden, da das Stirlingmodul<br />
aufgrund der kompakten Bauweise gut<br />
in den Heizkessel integriert werden kann. Ein Pufferspeicher,<br />
der als Wärmeenergiespeicher dient,<br />
entkoppelt die Wärmeproduktion zeitlich vom t<strong>at</strong>sächlichen<br />
Verbrauch, sodass auch dann Ökostrom<br />
produziert werden kann, wenn gerade kein Wärmebedarf<br />
gegeben ist [8].<br />
In einer Biogärtnerei wurde kürzlich die erste Anlage<br />
dieser Art in Betrieb genommen. Weitere Feldtestanlagen<br />
sind geplant. Mit der 14 kW-Anlage wird eine<br />
rund 400 m² große Lagerhalle mittels Fußbodenheizung<br />
beheizt. Zusätzlich wird mit rund einem Kilow<strong>at</strong>t<br />
Leistung Strom erzeugt, der den Strombedarf<br />
der Lagerhalle abdeckt und den Überschussstrom<br />
ins Netz einspeist [13].<br />
© ÖkoFEN<br />
22 <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> 23