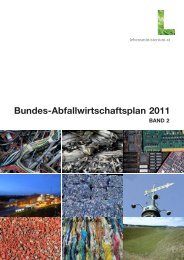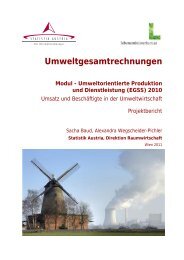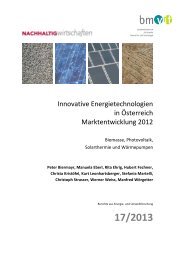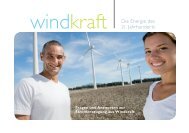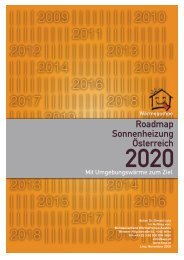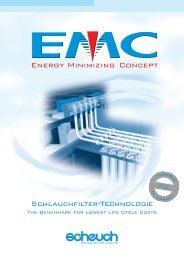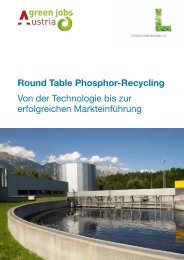green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erhöhen des nutzbaren<br />
Temper<strong>at</strong>urniveaus mittels<br />
Wärmepumpe<br />
Das Potenzial zur direkten Nutzung der oberflächennahen<br />
Erdwärme (ohne Wärmepumpe) als<br />
Raumwärme ist wegen des niedrigen Temper<strong>at</strong>urniveaus<br />
nur eingeschränkt vorhanden. Daher<br />
ist bei Anlagen zur Nutzung von oberflächennaher<br />
Erdwärme meist die Zwischenschaltung einer<br />
Wärmepumpe zwischen Gewinnungs- und Nutzungskreislauf<br />
erforderlich. Wärmepumpen werden<br />
nach verschiedenen Kriterien, wie Eins<strong>at</strong>zzweck,<br />
Art der Wärmequelle, Bauart, Antriebsart, verwendeter<br />
Kältemittel und Medien für Wärmetransport<br />
etc. eingeteilt und unterschieden. Verschiedene<br />
Kennzahlen beschreiben die Leistungsfähigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe. Für<br />
Elektrowärmepumpen seien die beiden wichtigsten<br />
genannt:<br />
• die Leistungszahl (engl. COP… Coefficient<br />
of Performance), die für einen bestimmten<br />
Arbeitspunkt das momentane Verhältnis von<br />
abgegebener Wärmeleistung zu aufgenommener<br />
elektrischer Antriebsleistung, bezogen<br />
auf einen bestimmten Anlagenumfang, beschreibt;<br />
• die Jahresarbeitszahl (engl. SPF… Seasonal<br />
Performance Factor), mit deren Hilfe die gesamte<br />
Anlage energetisch bewertet werden<br />
kann, da sie im t<strong>at</strong>sächlichen Betrieb ermittelt<br />
wird.<br />
Neben den elektrisch betriebenen Wärmepumpen<br />
sind am Markt auch thermisch oder mit Erdgas betriebene<br />
Wärmepumpen verfügbar. Üblicherweise<br />
lassen sich mit Wärmepumpen Temper<strong>at</strong>uren von<br />
50 – 65 °C erreichen. Hochtemper<strong>at</strong>ur-Wärmepumpen<br />
mit Zieltemper<strong>at</strong>uren von 80 °C und akzeptablem<br />
Wirkungsgrad (COP von 3) sind ebenfalls<br />
am Markt erhältlich, spezielle Anlagen können<br />
Temper<strong>at</strong>uren von bis zu 150 °C bereitstellen [6].<br />
Anlagenformen mit Wärmepumpe<br />
Für die Nutzung oberflächennaher Erdwärme mittels<br />
Wärmepumpe sind grundsätzlich drei Anlagenformen<br />
möglich, bei denen die Wärmequelle<br />
selbst bzw. die Anzahl der Wärmequellen das<br />
Unterscheidungsmerkmal darstellen. Während<br />
beim monovalenten Betrieb der gesamte Wärmebedarf<br />
mit einer Energiequelle bzw. beim monoenergetischen<br />
Betrieb mit einem Energieträger<br />
(im Fall der Wärmepumpe i.d.R. der elektrischer<br />
Strom) abgedeckt wird, wird beim bivalenten Betrieb<br />
für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage<br />
ein zweites Heizsystem parallel oder altern<strong>at</strong>iv zur<br />
Wärmepumpe verwendet. Bei Geothermieanlagen<br />
liefert der Boden bzw. das Grundwasser in der Regel<br />
ausreichend Energie, um den Heizwärmebedarf<br />
eines Gebäudes zu decken, unter der Voraussetzung,<br />
dass dieses nach Niedrigenergiestandards<br />
errichtet worden ist. Die geringe erforderliche Heizungs-Vorlauftemper<strong>at</strong>ur<br />
und der geringe Heizwärmebedarf<br />
in energieeffizienten Gebäuden<br />
begünstigen den effizienten Eins<strong>at</strong>z von Wärmepumpen.<br />
Bei besonders großen Gebäuden und im<br />
Altbaubereich, wo nach erfolgter thermischer Sanierung<br />
eine vorhandene Heizung als Zus<strong>at</strong>zheizung<br />
weiterverwendet werden soll, bietet sich aus<br />
wirtschaftlichen Gründen ein bivalenter Anlagenbetrieb<br />
an. Im Bereich der Altbausanierung spielt<br />
dabei auch die Wärmequelle Luft eine zunehmende<br />
Rolle [5]. Kriterien für die Wahl der optimalen<br />
Wärmepumpentype und Anlagenform sind primär<br />
die energie<strong>tech</strong>nischen bzw. thermodynamischen<br />
Randbedingungen für den betrachteten Anwendungsfall.<br />
Zukünftige rechtliche Anforderungen<br />
Über ein gemeinsames Energielabel für alle Heizungen<br />
gemäß der Energielabel-Richtlinie (Energieverbrauchskennzeichnung<br />
RL 2010/30/EG) soll<br />
ein besserer Effizienzvergleich für alle energiebetriebenen<br />
Produkte erreicht werden, womit für den<br />
Verbraucher der zu erwartende Energieverbrauch<br />
einer Heizungsanlage auch im Bereich der Wärmepumpe<br />
transparenter dargestellt wird. Über die<br />
Kennzeichnung, ähnlich der bei Kühlschränken und<br />
Waschmaschinen, und das CE-Kennzeichen soll<br />
der Verbraucher die verschiedenen Wärmeerzeuger<br />
hinsichtlich ihres Umweltnutzens direkt vergleichen<br />
können. Bei der Einstufung wird die Effizienz<br />
der Anlage auf Basis des Primärenergieeins<strong>at</strong>zes<br />
berücksichtigt. Der Umrechnungsfaktor von Strom<br />
in Primärenergie, von Eurost<strong>at</strong> als Durchschnittswert<br />
eines Mitgliedsta<strong>at</strong>es festgelegt, liegt momentan<br />
bei 2,6 für Strom und bei 1,0 für fossile<br />
Energieträger. Der endgültige Entwurf der entsprechenden<br />
Verordnung, ein delegierter Rechtsakt auf<br />
der Grundlage von Art. 10 der Richtlinie 2010/30/<br />
EU, liegt seit dem Frühjahr <strong>2013</strong> vor. Er schreibt ab<br />
2015 das Energielabel und D<strong>at</strong>enblätter für Heizkessel,<br />
Kombi-Heizkessel und Wärmepumpen mit<br />
einer Nennleistung bis 70 kW vor und regelt auch<br />
die Details der Energiekennzeichnung. Die Wärmepumpe<br />
schneidet im Vergleich zum Energielabel<br />
anderer Wärmeerzeuger besonders positiv ab, wovon<br />
auch direkte Marktimpulse für Heizungs- und<br />
Kühlsysteme mit Wärmepumpe erwartet werden.<br />
Zudem können Verbraucher von europäischen<br />
Förderprogrammen profitieren, wenn sie Anlagen<br />
mit der besten Energieeffizienzklasse wählen.<br />
Parallel dazu liegt dem Europäischen Parlament<br />
und dem R<strong>at</strong> derzeit eine Verordnung zu den<br />
Ökodesign-Anforderungen an Heizungen gemäß<br />
Ökodesignrichtlinie (ErP-Rahmenrichtlinie<br />
2009/125/EC) zur Prüfung vor. Die Richtlinie setzt<br />
anders als die Energieverbrauchskennzeichnung<br />
nicht beim Verbraucher an, sondern zielt vielmehr<br />
darauf ab, den umweltschädlichsten Produkten<br />
bereits den Marktzugang zu verwehren, indem sie<br />
verbindliche Mindestanforderungen für die Energieeffizienz,<br />
NO X -und Lärmemissionen festlegt.<br />
Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf betrifft<br />
das sowohl Heizkessel und Kombi-Heizkessel als<br />
auch Wärmepumpen mit einer Nennleistung bis<br />
400 kW. Halten diese Produktgruppen die Mindestanforderungen<br />
nicht ein, dürfen sie in Zukunft<br />
nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Die<br />
Durchführungsverordnung wird voraussichtlich<br />
im Sommer <strong>2013</strong> in Kraft treten. Die darin festgeschriebenen<br />
Ökodesign-Anforderungen sollen<br />
dann ab 2015 gelten.<br />
Vorteile der Nutzung oberflächennaher<br />
Geothermie<br />
Die Geothermie nimmt unter den erneuerbaren<br />
Energien wegen ihrer Eigenschaften eine besondere<br />
Stellung ein: Sie steht als Grundlastenergie unabhängig<br />
von Witterung, Tag- und Nachtzeiten immer<br />
bedarfsgerecht zur Verfügung. So kann oberflächennahe<br />
Erdwärme beispielsweise direkt oder über<br />
eine Wärmepumpe zum Heizen oder Kühlen genutzt<br />
werden. Der Untergrund dient dabei als Energiequelle<br />
und -speicher und wird je nach Bedarf entweder<br />
zum Entzug oder zur Einlagerung von Wärme<br />
oder Kälte eingesetzt. Der Bodenkörper wird so zum<br />
Langzeitspeicher für thermische Energie [1].<br />
In neuen Bürogebäuden zählt heute ein<br />
ganzheitliches Klimakonzept, das über das reine<br />
Beheizen der Räumlichkeiten weit hinausgeht, zum<br />
Standard. Die Geothermie ist unter den erneuerbaren<br />
Energien prädestiniert, um komplexe Raumklimakonzepte<br />
mit einer nachhaltigen Technologie<br />
umzusetzen, da mit ihr kostengünstig und ohne<br />
zusätzliche Investitionen auch die Kühlung des Gebäudes<br />
erfolgen kann. Dabei ist der Eins<strong>at</strong>z von ef-<br />
34 <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> 35