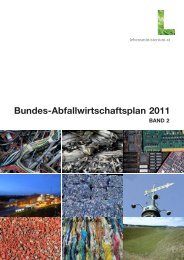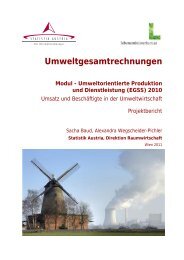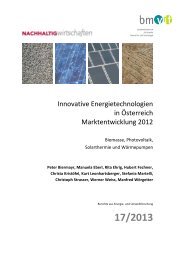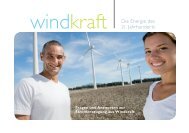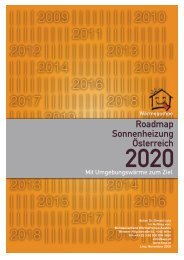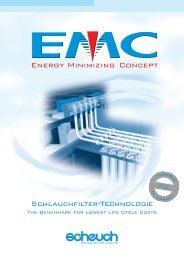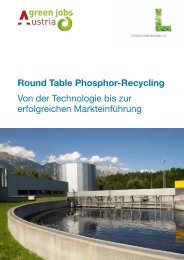green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einleitung<br />
Das Klima- und Energiepaket der EU sieht für das<br />
Jahr 2020 vor, mindestens 20 Prozent der Treibhausgase<br />
gegenüber 1990 zu reduzieren, den Anteil erneuerbarer<br />
Energien am Bruttoendenergieverbrauch<br />
auf 20 Prozent zu steigern und die Energieeffizienz<br />
um 20 Prozent zu verbessern (20-20-20 Ziele). Des<br />
Weiteren wurde auf europäischer Ebene ein Fahrplan<br />
(Roadmap) für Maßnahmen bis 2050 entwickelt,<br />
durch den eine THG-Emissionsreduktion um<br />
80 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden soll [1].<br />
Mit dem im März <strong>2013</strong> verabschiedeten Grünbuch<br />
„Ein Rahmen für die Klima- und die Energiepolitik<br />
bis 2030“ h<strong>at</strong> die Europäische Kommission eine Diskussion<br />
über die Klima- und Energiepolitik der EU<br />
bis 2030 initiiert [2]. Nach einer öffentlichen Konsult<strong>at</strong>ion<br />
sollen konkrete Vorschläge, u. a. zu Art und<br />
Höhe potenzieller Klima- und Energieziele für 2030<br />
und wichtigen Aspekten der europäischen Energiepolitik,<br />
ausgearbeitet werden.<br />
Die EU-Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der<br />
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist<br />
eine von vier EU-Regelungen zur Erreichung der<br />
20-20-20 Ziele und tr<strong>at</strong> am 25. Juni 2009 in Kraft.<br />
Diese Richtlinie legt einen gemeinsamen Rahmen<br />
für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren<br />
Quellen fest, der insbesondere die Erzeugung von<br />
Strom und den Verkehrssektor betrifft und bei den<br />
Berichtspflichten auch den Wärmesektor umfasst.<br />
Die Neufassung der Gebäuderichtlinie der Europäischen<br />
Union (RL 2010/31/EG „Gesamtenergieeffizienz<br />
von Gebäuden“, EPBD recast) verpflichtet unter<br />
anderem zur Erstellung eines n<strong>at</strong>ionalen Plans, wie<br />
dieser Standard bis 2020 im Baurecht umgesetzt<br />
werden kann. Demnach muss die Umsetzung von<br />
Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich<br />
jedenfalls jene Entwicklungen berücksichtigen,<br />
die in der Erneuerbaren-Richtlinie sowie in der<br />
neuen Gebäuderichtlinie enthalten sind. Letztere<br />
sieht beispielsweise vor, dass bis 2020 im Neubau<br />
„Fast-Nullenergiegebäude“ (nearly zero energy<br />
buildings) umgesetzt werden sollen, die in erster<br />
Linie durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch<br />
und durch den Eins<strong>at</strong>z erneuerbarer Energieträger<br />
erreicht werden sollen.<br />
Die neue Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen<br />
Union (RL 2012/27/EG) tr<strong>at</strong> am 4. Dezember<br />
2012 in Kraft. Damit soll sichergestellt werden, dass<br />
das übergeordnete Energieeffizienzziel der Union<br />
bis 2020 erreicht wird. Jeder Mitgliedsta<strong>at</strong> h<strong>at</strong> einen<br />
Richtwert für ein n<strong>at</strong>ionales Energieeffizienzziel festzulegen,<br />
der auf den Primärenergieverbrauch, den<br />
Endenergieverbrauch oder auf Endenergieeinsparungen<br />
oder auf die Energieintensität bezogen sein<br />
kann. Die Richtlinie enthält darüber hinaus die Verpflichtung,<br />
zwischen 2014 und 2020 jährlich 1,5 %<br />
der an EndkundInnen verkauften Energie einzusparen.<br />
Die Energieeffizienzrichtlinie ist bis 5. Juni 2014<br />
von den Mitgliedsta<strong>at</strong>en in n<strong>at</strong>ionales Recht umzusetzen.<br />
Die drei Hauptsäulen der österreichischen Energiepolitik<br />
sind die Senkung der Nachfrage nach<br />
Energie durch ihre sinnvolle Nutzung und durch<br />
die Verbesserung der Effizienz ihres Eins<strong>at</strong>zes, die<br />
Forcierung erneuerbarer Energieträger und die Verbesserung<br />
der Energieversorgungssicherheit [3]. Im<br />
Rahmen des Klima- und Energiepakets h<strong>at</strong> sich Österreich<br />
verpflichtet, bis 2020 den Anteil erneuerbarer<br />
Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch auf<br />
34 Prozent zu erhöhen und seine Treibhausgasemissionen<br />
in Sektoren, die nicht dem Emissionshandel<br />
unterliegen (non-ETS), um mindestens 16 Prozent<br />
bezogen auf die Emissionen des Jahres 2005 zu<br />
reduzieren. Für die dem EU-Emissionshandel unterliegenden<br />
Sektoren ist eine EU-weite Reduktion<br />
der Treibhausgase um 21 Prozent gegenüber 2005<br />
beschlossen worden. Für den non-ETS-Bereich ist<br />
der lineare Reduktionspfad für die österreichischen<br />
Treibhausgasemissionen ab <strong>2013</strong> verbindlich vorgegeben<br />
(Effort-Sharing-Entscheidung Nr. 406/2009/<br />
EG).<br />
Instrumente und Maßnahmen zur Erreichung der<br />
österreichischen Klimaschutzziele sind der Klimaund<br />
Energiefonds, das Konjunkturpaket II zur<br />
thermischen Sanierung sowie im Sektor Verkehr<br />
die Kraftstoffverordnung 2012. Die seit vielen Jahren<br />
etablierte betriebliche Umweltförderung im<br />
Inland fördert umweltrelevante Mehrinvestitionen<br />
von Unternehmen v.a. in den Bereichen Eins<strong>at</strong>z<br />
erneuerbarer Energieträger, effizienter Energieeins<strong>at</strong>z<br />
und betriebliche Mobilitätsmaßnahmen. Das<br />
Ökostromgesetz zielt auf die Förderung der Erzeugung<br />
von elektrischer Energie aus erneuerbaren<br />
Energieträgern ab, wobei sich die Vergabe der Mittel<br />
nach den Schwerpunkten der Kosteneffizienz, der<br />
Technologieentwicklung (Hinführung zur Marktreife)<br />
und Investitionssicherheit orientieren soll [4]. Das<br />
Ökostromgesetz 2012 enthält u. a. folgende Neuerungen:<br />
das jährliche Förderbudget wurde erhöht,<br />
für das Jahr 2020 wurden auf Grundlage von Kapazitäts-<br />
(MW) und Produktionszuwächsen (TWh)<br />
für Ökostrom aus Wasserkraft, Windenergie, Biomasse/Biogas<br />
und Photovoltaik neue, verbindliche<br />
Ökostromziele festgelegt und es gibt wieder eigene<br />
Förderbudgets für die einzelnen Technologien.<br />
Außerdem wurde der Finanzierungsmechanismus<br />
hinsichtlich mehr Transparenz in Verbindung mit<br />
deutlichen Erleichterungen für einkommensschwache<br />
Haushalte und energieintensive Unternehmen<br />
neu gestaltet. Seit 2004 deckt die Initi<strong>at</strong>ive des<br />
Lebensministeriums klima:aktiv [6] mit den Themenschwerpunkten<br />
„Bauen und Sanieren“, „Energiesparen“,<br />
„Erneuerbare Energie“ und „Mobilität“<br />
alle zentralen Technologiebereiche einer zukunftsfähigen<br />
Energienutzung ab. klima:aktiv leistet mit<br />
der Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich<br />
Energieeffizienz, der aktiven Ber<strong>at</strong>ung und Schulung,<br />
sowie breit gestreuter Inform<strong>at</strong>ionsarbeit einen<br />
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Bundes-Energieeffizienzgesetz,<br />
das Anfang April <strong>2013</strong><br />
den Ministerr<strong>at</strong> passiert h<strong>at</strong>, jedoch noch nicht im<br />
Parlament beschlossen werden konnte, soll in Österreich<br />
die Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt werden.<br />
Einer regionalen und überregionalen Energieplanung<br />
kommt im Rahmen einer gesamtsystemischen<br />
Betrachtung des Energiesystems zentrale Bedeutung<br />
zu (Energieraumplanung). Sie unterstützt die<br />
Abwärmenutzung aus der Industrie, aus Biomasse,<br />
Erdwärme, Abfällen und Solarenergie und aus<br />
öffentlicher Stromerzeugung. Die Energieplanung<br />
sollte dabei eine integrierte Perspektive verfolgen,<br />
und nicht ausschließlich auf Nah- und Fernwärme<br />
fokussiert sein. Sie könnte auch Standorte<br />
für größere Energiesysteme wie Windparks oder<br />
Kurzumtriebswälder beinhalten. Die ökonomischen<br />
Auswirkungen regionaler Energieplanung hängen<br />
wesentlich von der konkreten Ausgestaltung ab. Es<br />
ist jedoch allgemein zu erwarten, dass eine gesamtsystemische<br />
Energieplanung wesentliche regionale<br />
Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte generieren<br />
kann [5].<br />
Der Energiebedarf in Betrieben ergibt sich im Wesentlichen<br />
durch die Nachfrage an Energiedienstleistungen,<br />
welche die Nachfrage von Strom, Wärme<br />
(Raum- und Prozesswärme) und Transport bestimmt.<br />
Erneuerbare Energien ermöglichen eine Diversifizierung<br />
der Energieversorgung, was der Energieversorgungssicherheit<br />
und der Wettbewerbsfähigkeit<br />
dient. Zudem können die Unternehmen einen<br />
oft nicht unwesentlichen Anteil ihrer Energiekosten<br />
einsparen, wenn sie die betriebsintern benötigte<br />
Energie mittels erneuerbarer Energieträger selbst<br />
bereitstellen und damit den Eins<strong>at</strong>z fossiler Energieträger<br />
zumindest teilweise substituieren.<br />
Der vorliegende <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> legt im Hinblick<br />
auf die Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele<br />
seinen Schwerpunkt auf folgende Bereiche und<br />
stellt dazu die angewandten Technologien vor:<br />
• Eins<strong>at</strong>z erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung<br />
vorrangig zur Deckung des Eigenbedarfs<br />
in Betrieben (Prozesse und Gebäude),<br />
Dienstleistungsgebäuden und mehrgeschoßigen<br />
Wohnbauten durch Nutzung und Ausbau<br />
der Potenziale beispielsweise im Bereich der<br />
Windkraft und der Photovoltaik,<br />
• Senkung des Wärme- und Kühlbedarfs in<br />
Betrieben (Prozesse und Gebäude), Dienstleistungsgebäuden<br />
und mehrgeschoßigen<br />
Wohnbauten durch Systemoptimierung, Abwärmenutzung<br />
und thermische Sanierung,<br />
• optimierte Bereitstellung von Wärme in Betrieben<br />
(Prozesse und Gebäude), Dienstleistungsgebäuden<br />
und mehrgeschoßigen<br />
Wohnbauten aus Fernwärme (Abwärme,<br />
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Biomasse)<br />
oder durch erneuerbare Energien wie Solarthermie,<br />
Biomasse und Umgebungswärme<br />
unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler<br />
Konzepte der Energieraumplanung.<br />
Good-Practise-Beispiele der Umsetzung untermauern<br />
die ökologischen und ökonomischen Vorteile der<br />
dargestellten Technologien. Der Betrieb eigener Anlagen<br />
zur Erzeugung erneuerbaren Stroms, wie Photovoltaik-Anlagen<br />
und Windturbinen, der Bezug von<br />
Fernwärme, der Umstieg auf Ökostrom, die Nutzung<br />
von Erdwärme und Sonnenkraft für die Aufbringung<br />
der benötigten Raum- und Prozesswärme sowie die<br />
Umstellung von Öl- auf Biomasseheizungen gehören<br />
zu den wichtigsten Beispielen.<br />
6 <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> 7