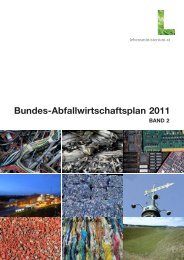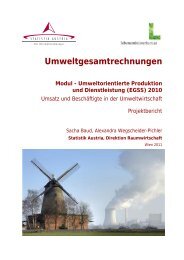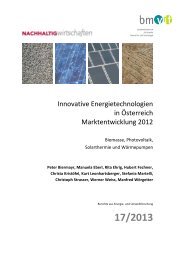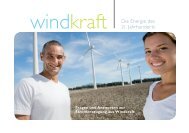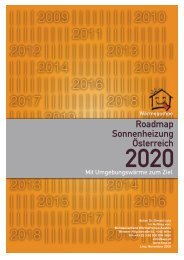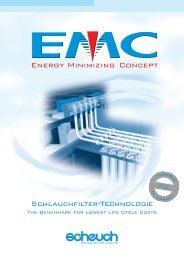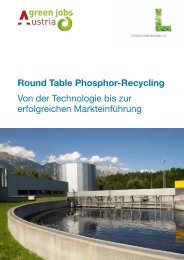green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
über Einzellösungen immer vorrangig zur Deckung<br />
des betrieblichen Wärmebedarfs eingesetzt werden<br />
[8]. Dabei wird in der Energiestr<strong>at</strong>egie Österreich vor<br />
allem die verstärkte Nutzung industrieller Abwärme<br />
als wesentlicher Hebel für den Ers<strong>at</strong>z fossiler<br />
Energieträger im Wärmebereich genannt. Im Bereich<br />
Produktion ist eine verstärkte Nutzung von Abwärme<br />
sowohl innerbetrieblich (Wärmeintegr<strong>at</strong>ion und<br />
Prozessintensivierung) als auch nach außen (Verkauf<br />
von Abwärme als Nahwärme bzw. Einspeisung<br />
in Wärmenetze) und die Nutzung des Potentials von<br />
hocheffizienter Co- und Polygener<strong>at</strong>ion im Interesse<br />
des gesamten Energiesystems anzustreben. Die<br />
<strong>tech</strong>nischen Möglichkeiten, Potenziale und Vorteile<br />
der Nutzung betrieblicher Abwärme für Unternehmen<br />
wurde bereits in einem eigenen Kapitel des<br />
<strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> 2012 ausführlich behandelt [9].<br />
Im Rahmen der Erstellung eines österreichweiten<br />
Überblicks zu den vorhandenen und ungenutzten<br />
Abwärmequellen in Industriebetrieben sowie der Erarbeitung<br />
von Maßnahmenvorschlägen zur Weiterentwicklung<br />
der Voraussetzungen für eine Nutzung<br />
dieser Potenziale (Abwärmepotenzialerhebung<br />
2012) wurde festgestellt, dass der größte Anteil an<br />
Abwärme – ca. 5.300 GWh/a bzw. rund drei Viertel<br />
des Gesamtpotenzials – bei Temper<strong>at</strong>uren zwischen<br />
20 und 35 °C anfällt [10]. Das wichtigste Abwärmemedium<br />
ist Wasser. In der Regel muss diese<br />
Abwärme für eine sinnvolle und wirtschaftliche Verwertbarkeit<br />
durch Wärmepumpen auf ein höheres<br />
Temper<strong>at</strong>urniveau angehoben werden. Aus energiepolitischer<br />
Sicht ist es jedenfalls entscheidend,<br />
diesen quantit<strong>at</strong>iv wichtigen Niedertemper<strong>at</strong>ursektor<br />
zu erschließen. Rel<strong>at</strong>ivierend ist anzumerken,<br />
dass Abwärmemengen, die über Kühlwasser<br />
an die Umgebung abgegeben werden oftmals aufgrund<br />
von Einleitgrenzwerten auf sehr niedrigem<br />
Temper<strong>at</strong>urniveau vorliegen, wiewohl innerbetrieblich<br />
durchaus höhere Temper<strong>at</strong>urniveaus vorliegen.<br />
Die Abwärmepotenzialerhebung 2012 zeigte außerdem,<br />
dass 44 % der teilnehmenden Unternehmen<br />
ihre Abwärmemengen noch nicht im Detail quantifiziert<br />
haben. Zusätzliche Anstrengungen, den Unternehmen<br />
ihre eigenen Abwärmepotenziale besser<br />
bewusst zu machen, könnten bewirken, dass neue<br />
Chancen für Abwärmeprojekte identifiziert und mehr<br />
Projekte als bisher umgesetzt werden.<br />
Wärmenetze<br />
(Nah- und Fernwärme)<br />
Leitungsgebundene Wärmenetze bieten die Möglichkeit,<br />
Überschuss- und Abwärme aus Industriebetrieben<br />
und Energieanlagen beispielsweise zur<br />
Beheizung von Büros und Wohnungen zu nutzen.<br />
Durch die zunehmende Etablierung des Fast-Nullenergiegebäude-Standards<br />
im Neubau bzw. höher<br />
werdenden Anteils thermisch sanierter Gebäude<br />
ist allerdings ein deutlicher Rückgang des Bedarfs<br />
an Niedertemper<strong>at</strong>ur-Energie im Gebäudesektor zu<br />
erwarten. Dadurch können Kapazitäten von Nahund<br />
Fernwärmesystemen für zusätzliche Kunden,<br />
beispielsweise im Produktionssektor mittels<br />
Wärmepumpen, bereitgestellt werden.<br />
Andererseits entstehen in Zukunft für Industriebetriebe<br />
neue Möglichkeiten, ihre Niedertemper<strong>at</strong>ur-Abwärmepotenziale<br />
auf eine sinnvolle Art und Weise zu<br />
verwerten, da die benötigten Vorlauftemper<strong>at</strong>uren<br />
für die Beheizung neuer Gebäude in der Tendenz<br />
sinken. Niedertemper<strong>at</strong>urnetze mit Vorlauftemper<strong>at</strong>uren<br />
von 5 bis 20 °C, sogenannte Anergienetze,<br />
könnten hier zukünftig interessante Perspektiven<br />
eröffnen. Typische Abnehmer für diese Abwärme<br />
durch Wärmepumpen könnten z.B. Wohngebäude,<br />
Hotelanlagen oder Thermen sein.<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Die Erdwärmequelle kann als saisonaler oder temporärer<br />
energetischer Zwischenspeicher genutzt<br />
werden und sich so ein vorübergehendes Missverhältnis<br />
von Energieangebot und -nachfrage ausgleichen.<br />
Dies gilt nicht nur für die einzelne Anlage,<br />
sondern im Prinzip auch für Wärmenetze, in denen<br />
eine Vielzahl von Produzenten und Nachfragern mit<br />
zu großen Anteilen vol<strong>at</strong>ilem Verhalten aktiv ist. So<br />
kann die Geothermie als kostengünstiger saisonaler<br />
Wärmespeicher die Möglichkeit einer vollsolaren<br />
Wärmeversorgung von Wohn- und Servicegebäuden<br />
eröffnen, womit sie als Schlüssel<strong>tech</strong>nologie für eine<br />
Systeminnov<strong>at</strong>ion im Bereich der Raumwärmebereitstellung<br />
und Brauchwassererwärmung zu sehen<br />
ist. In Hinblick auf das große Potenzial im Bereich<br />
der Gebäudesanierung wurden im österreichischen<br />
Forschungsprojekt GEOSOL ausschließlich multiplizierbare<br />
Systemlösungen für den Gebäudebestand<br />
untersucht. Hierbei standen die Untersuchung der<br />
<strong>tech</strong>nischen Machbarkeit und die Charakterisierung<br />
der Erfolgsfaktoren für die Errichtung und den<br />
Betrieb von solaren Mikrowärmenetzen mit saisonaler<br />
geothermischer Wärmespeicherung im<br />
Vordergrund. Das GEOSOL-System eignet sich für<br />
räumlich dichte Aggreg<strong>at</strong>e von wärme<strong>tech</strong>nisch sanierten<br />
Bestandsgebäuden, welche mit Niedertemper<strong>at</strong>ur-Wärmeverteilsystemen<br />
ausgest<strong>at</strong>tet sind<br />
[11].<br />
Wenn Wärmeangebot und Wärmebedarf örtlich<br />
nicht zusammenfallen und kein entsprechendes<br />
Wärmenetz verfügbar ist, ist es grundsätzlich auch<br />
möglich Speichersysteme einzusetzen, die die Wärme<br />
als l<strong>at</strong>ente Wärme oder als chemische Energie in<br />
mobilen LKW- oder Bahn-gestützten Speichersystemen<br />
bzw. Wärmecontainern zwischenspeichern.<br />
Als Wärmespeichermedien stehen Metallhydride<br />
oder Silicagel (für chemische Energie) oder aber Paraffine<br />
für l<strong>at</strong>ente Energie zur Verfügung. In letzterem<br />
Fall führt Wärmezufuhr zu einem Wechsel des<br />
Aggreg<strong>at</strong>zustands von fest auf flüssig. Die mit den<br />
bestehenden Technologien erzielbaren Wärmespeicherdichten<br />
und Wärmeleistungen sind, verglichen<br />
mit den theoretischen Potenzialen, bisher für eine<br />
Wirtschaftlichkeit in industriellen Systemen zu gering.<br />
Damit diese Speicher<strong>tech</strong>nologien in der Praxis<br />
eine Chance auf Durchsetzung haben ist daher noch<br />
weitere Forschung und Entwicklung notwendig [10].<br />
Wärmenetze auf Basis von Niedertemper<strong>at</strong>urwärme<br />
und Wärmepumpen werden häufig auch<br />
als Anergienetze bezeichnet. Der Begriff Anergie<br />
verweist auf jenen Anteil der Energie, mit<br />
dem man keine Turbine mehr antreiben oder andere<br />
Arten von mechanischer Arbeit verrichten<br />
kann. In Holland und der Schweiz gibt es Gemeinden,<br />
die „Anergienetze“ mit Vorlauftemper<strong>at</strong>uren<br />
von 5 bis 20 °C (und Rücklauf von 5 bis<br />
10 °C) zur Verfügung stellen, an die die Nutzer<br />
lokal ihre Wärmepumpen oder Kältemaschinen<br />
anschließen können. In Österreich sind noch<br />
keine derartigen Anwendungsbeispiele bekannt.<br />
Angesichts der großen Abwärmemengen im<br />
Niedertemper<strong>at</strong>urbereich sind jedoch die Entstehung<br />
solcher Beispiele sowie die begleitende<br />
Erforschung der Wirtschaftlichkeit, Anwendbarkeit<br />
und Praxistauglichkeit von Anergienetzen<br />
wünschenswert [10].<br />
Weitere prioritäre Themen der Forschung und Entwicklung<br />
im Bereich der Geothermie wurden vom<br />
Geothermal Technology Panel der Europäischen<br />
Technologiepl<strong>at</strong>tform Renewable He<strong>at</strong>ing & Cooling<br />
entwickelt [12].<br />
38 <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> 39