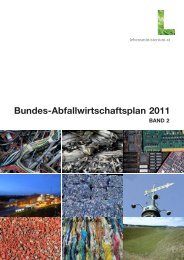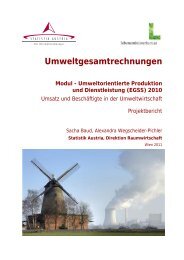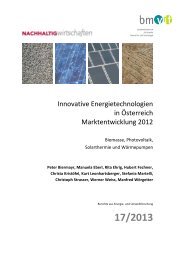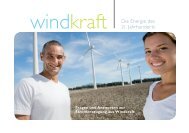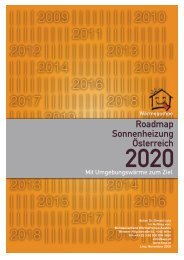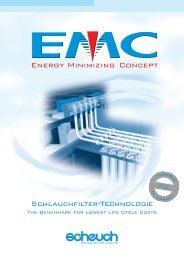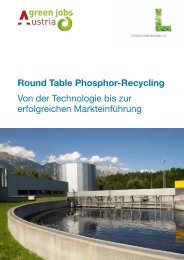green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
green tech report 2013 - umwelttechnik.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Good Practice XI<br />
EnergieAG Powertower Linz<br />
Der 19-geschossige Büroturm ist das weltweit erste<br />
Bürohochhaus, das mit Passivhauscharakter errichtet<br />
wurde. Herzstück des energie<strong>tech</strong>nisch weltweit<br />
einmaligen Vorzeigeprojektes ist das integrierte Gesamtenergiekonzept,<br />
das aus den drei Eckpfeilern<br />
Gebäudehülle und Fassade, Haus<strong>tech</strong>nik sowie<br />
Energieaufbringung besteht. Weltweit erstmals in<br />
einem Bürohochhaus dieser Größe kommt fast der<br />
gesamte Energiebedarf aus erneuerbaren Energieträgern.<br />
Dank eines ausgeklügelten Energiekonzeptes<br />
kann auch auf den Eins<strong>at</strong>z von fossilen Energieträgern<br />
für Heizung und Kühlung verzichtet werden.<br />
Grundstein für dieses Konzept ist die multifunktionale<br />
Fassadenkonstruktion, die zu zwei Dritteln<br />
aus Glas und zu einem Drittel aus hochisolierenden<br />
M<strong>at</strong>erialien besteht. Dadurch können ein niedriger<br />
Heizwärmebedarf (Wärmedämmwert U ges < 0,8 W/<br />
m²), niedriger Kühlbedarf durch eine Reduktion des<br />
solaren Wärmeeintrages um 90 % und die optimale<br />
Durchlässigkeit für Tageslicht und damit reduzierter<br />
Kunstlichteins<strong>at</strong>z gewährleistet werden. Der<br />
Energieaufwand für Heizung und Kühlung kann auf<br />
ein Minimum reduziert werden. Die gesamte Haus<strong>tech</strong>nik<br />
verbraucht nur halb so viel Energie wie herkömmliche<br />
Technik in einem Gebäude vergleichbarer<br />
Größe. Die Klim<strong>at</strong>isierung der Räume mittels abgehängter<br />
Kühldecken mit Strahlungswirkung ohne<br />
Bruttogeschoßfläche<br />
Wärmedämmwert<br />
Anzahl Energiepfähle und Abteuftiefe<br />
Anzahl Erdwärmesonden und Bohrtiefe<br />
32.872 m² (inkl. Tiefgarage)<br />
U ges < 0,8 W/m²<br />
90 à 10 m<br />
46 à 150 m<br />
Fassadenfläche 11.620 m²<br />
davon Photovoltaikfläche 637 m²<br />
Heizlast (Winter)<br />
Kühllast (Sommer)<br />
Einsparung CO 2<br />
800 kW<br />
800 kW<br />
ca. 300 Tonnen pro Jahr<br />
Quelle:<br />
http://www.zement.<strong>at</strong>/Service/liter<strong>at</strong>ur/fileupl/klima07_vbg_wilk_kaltenhauser.pdf<br />
Konvektion, Heizkörper mit hohem Strahlungsanteil<br />
und individueller Regelbarkeit und einer Frischluftversorgung<br />
durch kontrollierte Be- und Entlüftung<br />
mit nicht spürbarem 1,5 fachen Luftwechsel wurden<br />
realisiert.<br />
Für die Energieversorgung des Gebäudes wurden<br />
in das Fundament 90 Gründungspfähle als<br />
Energiepfähle integriert und 46 Tiefsonden à 150<br />
m gebohrt. Über diese wird aus dem Erdreich mittels<br />
Wärmepumpen die Energie für das Beheizen<br />
und Kühlen des PowerTowers gewonnen. Weitere<br />
Energie wird aus dem Grundwasser über zwei<br />
Förderbrunnen bezogen. Das Kühlwasser wird vor<br />
allem für das Rechenzentrum und für den Betrieb<br />
© M. Burger<br />
der Frischluftversorgung herangezogen. Die mittels<br />
Photovoltaik erzeugte elektrische Energie wird für<br />
den Betrieb der Wärmepumpen und Brunnenpumpen<br />
verwendet (Wärmepumpenvorlauftemper<strong>at</strong>ur:<br />
35/30°C, Heizleistung 337,4 kW). Das neue Kraftwerk<br />
ist mit 637 Quadr<strong>at</strong>meter das größte fassadengebundene<br />
Solarkraftwerk Österreichs und liefert<br />
jährlich 42.000 Kilow<strong>at</strong>tstunden Strom.<br />
Good Practice XII<br />
Mehrfamilienhaus Neubau<br />
(Haus der Zukunft 2020)<br />
Der Versuch, das Leben in einem Fünf-Familien<br />
Wohnhaus so zu organisieren, dass keine CO 2 -Emissionen<br />
verursacht werden, wurde mit dem Projekt<br />
„Haus der Zukunft 2020“ in Kammer bei Schörfling<br />
am Attersee realisiert. Eine hocheffektive Dämmung<br />
der Gebäudehülle, eine Betonkernaktivierung zur<br />
Speicherung von Energie, der Eins<strong>at</strong>z von Wärmepumpen<br />
zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie,<br />
kontrollierter Wohnraumlüftung und einer<br />
Photovoltaikanlage sowie eine Ladest<strong>at</strong>ion für das<br />
Elektroauto wurden in diesem Projekt eingesetzt.<br />
Der Energiebedarf für Heizung und Warmwasser<br />
wird über ein spezielles Solardach und einer Erdwärmepumpe<br />
mit einer Arbeitszahl von ca. 5 abge-<br />
Wohnnutzfläche<br />
Nutzfläche Stiegen, Lager, Carport<br />
Heizlast<br />
Heizwärmebedarf<br />
Gesamtenergiebedarf<br />
Anzahl Erdwärmesonden und Bohrtiefe<br />
420 m²<br />
145 m²<br />
13,2 kW<br />
24,9 kWh/m 2 a<br />
18.200 kWh/a<br />
3 à 80 m<br />
Photovoltaikfläche 140 m²<br />
Einsparung CO 2<br />
ca. 8,3 Tonnen pro Jahr (ohne Mobilität)<br />
jährliche Heiz-/Kühlkostenersparnis gegenüber Gas ca. € 2.000<br />
Investment (Mehrkosten im Vergleich zu konventioneller<br />
Heizung/Kühlanlage ohne Erdwärmenutzung)<br />
Förderquote (gegebenenfalls und Bezeichnung des Förderprogramms)<br />
ca. € 20.000<br />
© Josef Köttl<br />
deckt, wobei die Antriebsenergie des Kompressors<br />
und der Umwälzpumpen zur Gänze mit Öko- und<br />
Solarstrom aus dem eigenem Solarkraftwerk abgedeckt<br />
wird. Ein Zu- und Abluftsystem mit Energierückgewinnung<br />
und Erdwärmevorwärmung sorgt<br />
für ein gesundes Raumklima. Jeder Autoabstellpl<strong>at</strong>z<br />
verfügt über eine eigene Solartankstelle. Der Solarstrom<br />
für die Elektroautos wird direkt von der Photovoltaikanlage,<br />
die auf dem Carport montiert ist,<br />
geliefert.<br />
Das Energiekonzept erfüllt das Anforderungsprofil<br />
des Landes Oberösterreich. Die geforderte Energiekennzahl<br />
für ein Niedrigstenergiehaus von 27 kWh/<br />
m 2 a wird mit ca. 20-24 kWh/m 2 a klar unterschritten.<br />
Für das „Haus der Zukunft“ wurde die ÖMAG Förderung,<br />
Einspeisevergütung 0,18 Cent/kWh beansprucht. Weitere<br />
Unterstützungen von den jeweiligen Projektpartnern.<br />
Keine Förderung aus öffentlicher Hand.<br />
Amortis<strong>at</strong>ionszeit (bzw. auf die Mehrkosten gegenüber<br />
einer „konventionellen“ Lösung)<br />
ca. 10 Jahre<br />
Quelle: Haus der Zukunft 2020<br />
42 <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> <strong>green</strong> <strong>tech</strong> <strong>report</strong> <strong>2013</strong> 43