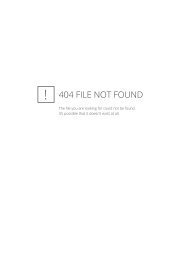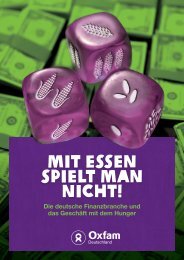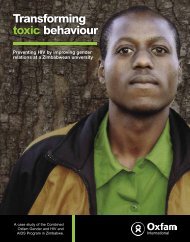Ein Kaffee-Rettungsplan - Oxfam
Ein Kaffee-Rettungsplan - Oxfam
Ein Kaffee-Rettungsplan - Oxfam
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Scheitern des Abkommens und dem Ende des Preis-<br />
Korsetts 1989 setzte hingegen ein dramatischer Preisverfall<br />
ein, der seither, abgesehen von zwei kurzen<br />
Preissteigerungen wegen frostbedingter Ernteausfälle<br />
in Brasilien 1995 und 1997, anhält und den Preis sogar<br />
unter das Niveau der durchschnittlichen Produktionskosten<br />
sinken ließ.<br />
Kritiker nennen viele Gründe für das Scheitern des<br />
Abkommens. So gab es große politische Feilscherei<br />
um höhere Exportquoten, und für neue Produzenten<br />
war der Markteintritt sehr schwierig. Außerdem hielten<br />
sich einige Mitglieder nicht an die vereinbarten<br />
Quoten und verkauften außerhalb des Abkommens an<br />
Länder, die nicht dem Abkommen angehörten. Dies<br />
untergrub die Bemühungen, das angestrebte Preisniveau<br />
zu halten und führte zum Vertrauensschwund<br />
unter den Mitgliedern. Manche Kritiker halten das<br />
Preis-Korsett für die Ursache der anhaltenden Überproduktion,<br />
weil das Preisband zu hoch angesetzt war.<br />
Andere sind der Ansicht, das Überangebot sei eher auf<br />
die beiden kurzfristigen starken Preisanstiege von<br />
1994/95 und 1997 als auf die Hochpreisphase der<br />
80er Jahre zurückzuführen.<br />
Die vorliegenden Vorschläge zur Wiederbelebung des<br />
Abkommens scheitern am mangelnden politischen<br />
Willen der Beteiligten. Die Konsumländer zeigen<br />
gegenwärtig keine Bereitschaft mitzuarbeiten, und die<br />
Produktionsländer scheinen zur <strong>Ein</strong>haltung der von<br />
ihnen selbst aufgestellten Regeln entweder nicht<br />
willens oder nicht in der Lage. Angesichts fehlender<br />
Unterstützung der Konsumländer hatten die Produktionsländer<br />
zwar den Versuch unternommen, im<br />
Alleingang ihre Exportmengen zu beschränken, jedoch<br />
scheiterte diese Initiative 2001. Der Mangel an politischem<br />
Willen, die Märkte mittels Quoten zu regulieren,<br />
bedeutet allerdings keinesfalls, dass nicht andere<br />
Ansätze zur Marktregulierung, insbesondere solche,<br />
die sich auf die Wirkung von Marktmechanismen stützen,<br />
durchaus funktionieren könnten. Von der ICO<br />
wurde ein solcher Ansatz entwickelt, nämlich ein<br />
Modell, das die gehandelte <strong>Kaffee</strong>menge auf der<br />
Grundlage der Qualität verringert. Diese Initiative wird<br />
aber nur mit der Unterstützung der reichen Länder<br />
und der <strong>Kaffee</strong>röster funktionieren können.<br />
18<br />
<strong>Ein</strong>zug der Riesen auf dem <strong>Kaffee</strong>markt: Brasilien und<br />
Vietnam<br />
Brasilien und Vietnam haben das weltweite <strong>Kaffee</strong>angebot<br />
völlig umgestaltet. Vor zehn Jahren noch fiel<br />
Vietnam mit seiner <strong>Kaffee</strong>produktion von gerade einmal<br />
1,5 Mio. Sack in den Statistiken kaum auf. In den<br />
90er Jahren öffnete das Land seine Agrarwirtschaft<br />
dem Weltmarkt, und die Regierung förderte den<br />
<strong>Kaffee</strong>anbau mit Land, Bewässerungssystemen und<br />
Subventionen. Seit 2000 ist Vietnam der zweitgrößte<br />
<strong>Kaffee</strong>produzent der Welt, mit 15 Mio. Sack <strong>Kaffee</strong>,<br />
größtenteils aus kleinbäuerlicher Produktion.<br />
Brasilien, der zweite Riese, ist eigentlich kein Neuling,<br />
sondern schon seit langem weltgrößter <strong>Kaffee</strong>produzent.<br />
Aber erst in jüngster Zeit wurde die Produktion<br />
durch Änderungen bei den Anbaumethoden und Verlagerung<br />
der <strong>Kaffee</strong>anbaugebiete erneut gesteigert. Die<br />
Erhöhung der Erntemengen basiert auf verstärkter<br />
Mechanisierung, intensiveren Produktionsverfahren<br />
und der Verlagerung des Anbaus aus den traditionellen,<br />
frostgefährdeten Regionen in neue Gebiete. Die<br />
allseits erwartete Riesenernte in Brasilien wird Exportrückgänge<br />
in anderen Ländern wettmachen und damit<br />
das Überangebot an <strong>Kaffee</strong> weiter aufrechterhalten. 39<br />
Zusätzlich zu dem dramatisch gestiegenen Angebot<br />
hat dies gravierende Auswirkungen auf die traditionellen<br />
<strong>Kaffee</strong>produktionsländer: Sie müssen nun mit<br />
einem beispiellos hohen Produktivitätsniveau konkurrieren.<br />
„Damit Sie einen <strong>Ein</strong>druck von den Unterschieden<br />
bekommen: In einigen Gebieten Guatemalas sind etwa<br />
1.000 Leute nötig, die jeweils einen ganzen Tag arbeiten,<br />
um einen Container mit 275 Säcken à 60 kg zu füllen. Im<br />
brasilianischen Cerrado braucht man dafür fünf Leute und<br />
eine Erntemaschine für zwei bis drei Tage. <strong>Ein</strong>er fährt und<br />
die anderen pflücken den <strong>Kaffee</strong>. Wie sollen Familienbetriebe<br />
in Mittelamerika damit konkurrieren?“, fragt Patrick<br />
Installe, Geschäftsführer von Efico, einem Rohkaffee-<br />
Handelsbetrieb. 40<br />
Was löste diesen Sprung in der Weltkaffeeproduktion<br />
und das daraus resultierende Überangebot aus? Für<br />
den Markteinstieg einiger Länder und ihrer Bäuerinnen<br />
sind sicherlich die extremen Preisspitzen der<br />
Jahre 1994/95 und 1997 – ausgelöst durch frostbedingte<br />
Ernteausfälle in Brasilien – verantwortlich.<br />
Aber in den Produktionsländern trugen auch andere



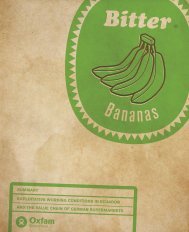

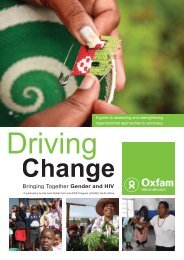

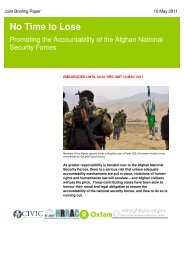
![Download: Faltposter EU-Handelspolitik [PDF 2,17MB] - Germanwatch](https://img.yumpu.com/25095854/1/190x161/download-faltposter-eu-handelspolitik-pdf-217mb-germanwatch.jpg?quality=85)